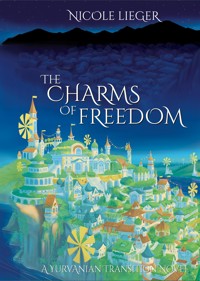8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Eine poetische Reise, eine packende Vision.“
Amalai lebt ganz im Zauber dieser sinnlichen Erde, und eines Tages führt das Rascheln der Gräser sie bis zu einem geheimnisvollen Fremden, zu einem Lied der Anderwelt...
Aber dann liegt ein Junge tot im Wald. Bedroht ein Dämon die Stadt? Schon marschieren Soldaten auf, ein Omen der Rückkehr von Krieg und Herrschaft. Doch Amalais Freunde werden das Leben als freie Gemeinschaft verteidigen! Durch Kampf? Oder eben nicht durch Kampf, sondern bezaubernd andere Wege?
Eine junge Rebellin und ein verhinderter Prinz, eine nüchterne Magierin und ein schillernder Träumer verbünden sich, um die Stadt zu retten. Und stellen sich einer unsicheren Wahrheit, die Liebe, Angst und die Schönheit des Sternenlichts in sich birgt...
„Ein hoffnungsfrohes Bild einer anderen möglichen Welt, ein Lied des Wandels.“
„Perfekt für Fans von Becky Chambers, Ursula K. LeGuin und Studio Ghibli.”
Zieht es dich hin zu
-) dem Flüstern des Windes in den Weiden
-) achtsamem Aktivismus
-) errungenem Frieden und real lebbarer Toleranz
-) genussvollem Baden
-) fragwürdigen Begegnungen mit der Anderwelt
-) queer-freundlichen, sex-positiven und diversen Settings
-) magischen Spiegeln, die neue Bilder einer alten Welt zeigen?
Dann bist du hier richtig... :-)
Willlkommen bei einem zauberhaften Märchenroman!
Titel der englischsprachigen Ausgabe: The Starlight of Shadows - The Yurvanian Transition Novels.
Weitere Bücher aus der Reihe Yurvanische Wandelromane:Der Zauber der Freiheit / The Charms of Freedom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SCHATTEN AUS STERNENLICHT
Ein Yurvanischer Wandelroman
N i c o l e L i e g e r
Für David Abram,
Autor des wunderbaren Buches ‘Becoming Animal’
und ein Magier unserer Welt.
Ein Hintergrund-Glossar-Geplauder
der yurvanischen Welt
findet sich auf meiner Webseite:
nicolelieger.eu/yurvania
Inhaltsverzeichnis
SCHATTEN AUS STERNENLICHT
Für David Abram
Ein Hintergrund-Glossar-Geplauder
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Vielen Dank für die gemeinsame Reise! :-)
DER ZAUBER DER FREIHEIT
Impressum
Lust auf mehr?
1
Letzte Streifen aus Gold und Purpur zogen sich über den Himmel, aber die Kronen mächtiger Baumriesen tauchten Amalai schon in Dunkelheit. Um sie rauschte ein Meer voller Düfte und Spuren.
Amalai ließ eine bleiche Blüte in ihre Hand fallen. Farne wogten um ihren Kopf während sie auf dem Waldboden kniete und den beißend süßen Geruch einatmete. Dies war die Stunde, da die samtigen Kelche sich der Nacht öffneten. Genau der Moment, wo ihr Aroma am wildesten, ihre Kraft am unbändigsten war. Genau der richtige Augenblick, um sie zu sammeln.
Spuren eines zweideutigen Parfüms stiegen in Amalais Nase, ein unverschämter Lockruf zwischen Wollust und Verwesung, verheißungsvoll bis an die Grenze der Übelkeit. Aber Amalai wusste die gespenstischen Blumen zu gewinnen, ihnen ihre verwirrende Essenz zu entlocken. Die zur gegebenen Zeit in ein heißes Bad fließen konnte, um Menschen mit sanftem Wohlgefallen zu umschmeicheln und ihre Schmerzen zu lösen.
Amalai seufzte zufrieden, als sie eine weitere blasse Nachtblüte in ihre Hand fallen ließ. Nur noch ein oder zwei, dachte sie. Den Rest würde sie wachsen lassen.
Doch dann sprangen die Affen auf und jagten aufgeregt durchs Geäst. Vögel schrien Alarm. Ein großes Tier brach laut und ungestüm durch das Unterholz.
Amalai duckte sich tief zwischen die Farne und hielt den Atem an. Angestrengt lauschte sie auf die Quelle des Tumults. Dann schlich sie vorsichtig zwischen den schwarzen Stämmen voran, bis sie etwas sehen konnte.
Es waren drei Kadetten, aus der Klingenburg. Dicht gedrängt stolperten sie auf den Waldrand zu, seltsam unbeholfen, als wären sie aneinander gefesselt. Nein, sie trugen etwas, ein großes, sperriges Ding.
Amalai ging ihnen nach.
Schon bald liefen die Kadetten das letzte Stück offene Wiese bis zur Kaserne hinunter. Aber noch bevor sie das Tor hinten in der Hofmauer erreicht hatten, kam ihnen eine Wache über die kleine Brücke entgegen. Dann noch eine Kriga aus dem Hof, und noch eine. Schon bald hatte sich eine kleine aufgebrachte Menge aus Kadetten und älteren Krigas versammelt.
Amalai trat unauffällig näher und spähte zwischen den uniformierten Rücken hindurch. Auf einer Bahre lag ein junger Mann, oder eher ein Bursche. Er war kaum älter als sechzehn und auffallend schön, sein Gesicht so ebenmäßig und vollkommen wie das einer Marmorstatue. Und auch so weiß, so kalt. Er war tot.
Sein Körper war mit einem Tuch bedeckt. Amalai wusste nicht, ob es nur eine albtraumhafte Einbildung war, oder ob sie wirklich die Konturen zerschmetterter Glieder darunter erkennen konnte.
Sie wandte sich ab. Und wandte sich dann doch wieder zu.
Die Krigas rund um die Bahre murmelten. Einige waren stumm vor Schock, andere fluchten leise und wütend vor sich hin. Die Kadetten aus dem Wald gaben Erklärungen ab, wieder und wieder.
Bis einem von ihnen die Galle überging. »Ich schwör’s! Ich hab’s gesehen, mit eigenen Augen!« Er war ein stämmiger Bursche, voller Kraft und Muskeln. Doch sein Körper zitterte.
Ein Kamerad legte ihm den Arm um die Schultern und versuchte, ihn zu beruhigen. »Na komm, Kortid.«
Aber Kortid wollte nicht beruhigt werden. »Ich sag’s euch! Ich war es, der Hun gefunden hat. Und ich hab’s gesehen! Da hockte ein Schatten auf seiner Brust. Ein Geist, ein Monster, schwarz wie die Nacht! Ein Dämon! Der hat Hun gefangen und sein Blut getrunken!«
Kortid war unnatürlich blass, selbst für jemanden mit so weißer Haut. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Einige der Krigas schienen ihm zu glauben, und waren steif und unbeholfen vor Angst. Andere versuchten immer noch, Kortid zuzureden wie einem kranken Kind.
»Schaut doch selbst! Schaut seinen Hals an!«, schrie Kortid, außer sich.
Die Krigas warfen einander unsichere Blicke zu. Dann trat ein hagerer Mann vor und zog mit knapper Geste am Tuch. Im Schein der Laterne leuchtete Huns Hals fahl wie der Mond, so blass und makellos wie sein Gesicht. Keine Wunden verunstalteten seine Haut. Bis auf zwei winzige rote Punkte an der Seite. Genau über der Schlagader.
Der Kriga fuhr zurück. Andere beugten sich weiter vor.
Ein Flüstern ging durch die Gruppe, die zuvor erwartungsvoll verstummt war. Das Raunen schwoll an wie eine Welle, brach und kehrte zu seinem Ursprung zurück als ein Verdacht, eine Frage, ein Gerücht. Tiefe Gespräche voller Nicken und Kopfschütteln entspannen sich. Und brachen ruckartig ab, als Befehle vom Kasernentor her gebrüllt wurden. Alle Krigas schlugen sofort die Hacken zusammen.
Wortlos trugen sie die Bahre hinein.
Das Tor fiel zu.
Langsam, wie in einer unwirklichen Trance gefangen, ging Amalai davon.
* * *
»Aber es gibt keine Dämonen! Das wissen doch alle!«, polterte Rebonya, und ihre Mandelaugen funkelten die anderen Kadetten an.
Tumult erfüllte den Gemeinschaftsraum, Unglaube, Fassungslosigkeit.
Hun war tot.
Eine Gruppe Kadetten umringte Kortid und lauschte mit gerunzelten Brauen seiner Geschichte von dem Monster, das er im Wald gesehen hatte. Andere schlugen mit der Faust gegen die Wand oder sanken in sich zusammen, den Kopf in den Händen.
In mehreren Ecken entspannen sich hitzige Debatten.
»Dämonen sind doch nur ein Märchen!« Rebonya schüttelte den Kopf so heftig, dass ihr die kurzen schwarzen Haare um die Ohren flogen. »Schauergeschichten aus der Feudalzeit, als alte Magjas Illusionen herbei zauberten, um die Untertanen gefügig zu halten.« Sie schnaubte. »Auf so was fallen wir doch nicht mehr rein!«
Der Kadette neben ihr wiegte bedächtig den Kopf. »Aber Hun ist tot im–«
»Ja, Hun ist tot!« Rebonyas Wut unterbrach ihn. »Und ich kann dir sagen, welcher böse Geist ihn auf dem Gewissen hat!« Sie zeigte mit anklagendem Finger in Richtung Burghalle. »Dieser Geist! Ein Geist, der Menschen in sinnlose Gefahren schickt und das ›Korrektur‹ nennt. Obwohl es in Wirklichkeit nur ein fadenscheiniger Vorwand für die Mächtigen ist, ihre Untergebenen leiden zu lassen.«
Rebonyas Hand ballte sich zu einer Faust. »Diese ›Korrekturen‹ haben noch nie dazu beigetragen, den Charakter oder das Verhalten eines Menschen zu verbessern.« Sie verzog den Mund. »Alles, was sie bringen ist Angst, Schmerz und Demütigung. Selbstzweifel, die Leute glauben lassen, sie hätten so etwas verdient. Und die sie bereit machen, andere genauso zu behandeln. Alltägliche Quälereien, die zukünftige Krigas darauf drillen, mindestens so viele Grausamkeiten auszuteilen, wie sie selbst einstecken mussten.«
Das ging ein bisschen weit. Durfte man so etwas sagen? Einer der Kadetten wich einen Schritt zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und sah Rebonya mit zusammengekniffenen Augen an.
Aber Rebonya polterte weiter. »Du kannst sagen, Hun hatte einen Unfall beim Holzfällen. Aber warum ist denn dieser Unfall überhaupt passiert, bitte schön?! Warum war er denn allein diesen Baum fällen?«
»Es war kein Unfall.« Genau in diesem Moment ging Kortid hinter Rebonya vorbei. Sein Gesicht war blass, seine Stimme müde. Nur noch ein Flüstern.
»Es war ein Dämon.«
* * *
›Ein Dämon.‹
Berqar machte ein paar Schritte zum Fenster und schaute zwischen den Gitterstäben hinaus. Kalt und abweisend ragte die Burg in den Himmel.
»Ein Dämon ist im Wald erschienen. Und hat Hun getötet.«
So war die Mär zu ihr gekommen, zur Kommandantin der Klinge, der ältesten Kaserne Yurvanias. Es erschien ihr wie ein Omen, ein Orakel. Wie ein Zeichen voll versteckter Bedeutungen, voller Warnung vielleicht, oder voll verborgener Verheißung.
Es war ein Ruf. Wenn es Berqar nur gelänge, den verschleierten Pfad zu sehen, die geheime Botschaft zu entschlüsseln. Schicksal und Mysterium riefen nach Berqar. Sie konnte es fühlen. Aber noch nicht verstehen.
Berqar blickte hinaus in die Dämmerung, in blutrote Wolken über den schwarzen Zinnen.
Und langsam nahm die Vision Gestalt an.
Ein Schatten stieg über Behrlem auf, über einer schwachen, hilflosen Stadt. Eine Macht der Finsternis bedrohte das Leben unschuldiger Menschen, würde morden, gnadenlos! Ein Dämon war da, ein Teufel, eine Ausgeburt der Hölle!
Berqar fühlte eine Energie in sich aufsteigen wie glühend rote Lava. Ein gleißendes Feuer lief durch ihre Adern, eine Gewissheit. Das war es! Das war der Ruf, der Befehl. Das war, was sie tun musste.
Berqar drehte sich um, mit einem Funken in den Augen, den sie längst erloschen geglaubt hatte. Aber da war er wieder. Und würde brennen, lichterloh!
* * *
Amalai lehnte sich an die Wand ihrer Dachterrasse und zog den warmen Körper ihres Geliebten tiefer in ihre Arme. Lahoon schmiegte sich an sie. Sein Rücken war nackt, und seine samtige Schmetterlingshaut schimmerte blau und türkis im schwachen Abendlicht. Er sah aus wie ein Fay, der sich ins Terrenreich verirrt hatte. Aber er war ein Kind dieser Erde, soweit sie wussten, ein Menschentier wie alle anderen auch. Auch wenn die Sehnsucht nach der Anderwelt tief in seiner Seele saß und ihn bereit machte, sich an jeden Strohhalm zu klammern, oder nach den Sternen zu greifen. Und genau so hatte er Amalais Geschichte aufgenommen.
Seine Stimme war rau, durchdrungen von Hoffnung und Verlangen. »Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Vielleicht, nur vielleicht, ist das meine Chance, die Fay zu finden.«
Lahoon strich sich eine Strähne pechschwarzen Haares aus der Stirn. »Ich werde in den Wald gehen. Zu den Schatten, dem Dämon, den Fay. Wer auch immer dort gewesen sein mag heute Nacht. Ich werde nach ihnen suchen.«
Lahoons Blick war auf den Horizont gerichtet, wo der schwarze Wald schwer und dunkel unter einem sternenklaren Himmel lag. »Ich habe schon so oft gerufen. Habe gebeten und gewartet, gesungen und gelockt. Habe die Fay immer gespürt, im Schlag meines Herzen, im Duft der Erde. Sie sind da. Aber ich weiß nicht, wo. Oder wer. Was sind sie? Dämonen, Feen, Einhörner? Engel und Geister? Wesen jenseits von Namen und Vorstellung?«
Lahoons Worte wurden zu einem Flüstern, das der Wind davontrug. »Sie haben sich mir nie offenbart. Aber vielleicht jetzt. Heute Nacht.«
Lahoon ließ seine Stirn gegen Amalais dunkle Locken sinken. »Ich muss alleine gehen. Du wirst keine Angst um mich haben?«
»Nein.«
In der Ferne rief eine Eule.
»Doch.« Amalai schloss ihre Finger um Lahoons Hand. »Du begibst dich in Gefahr. Aber was sonst solltest du tun?«
Die Pflanzen der Terrasse raschelten leise neben ihr, in der Sprache der Blätter. Amalai nahm ihren Trost an. Sie neigte sich Lahoon zu, bis ihre Wangen sich berührten. »Du wirst die rechte Art finden, den Schatten im Wald zu rufen. Ich vertraue auf deine Träume und die Sehnsucht deiner Seele. Deine Liebe zu den Fay wird dich leiten.«
*
Lahoon versank im nächtlichen Wald wie in einem Ozean, der ihn mit sanften Wellen in die Tiefe zog. Der mondlose Himmel stand weit und dunkel über der Welt, und Lahoon wandelte zwischen den schwarzen Stämmen und den schwankenden Gestalten der Farne.
Der ganze Wald war voller Leben, voll glänzender Augen und schnuppernder Nasen. Voller Rascheln, von Blättern und Schuppen und winzigen Krallen.
Die magische Laterne in Lahoons Hand warf einen schwachen goldenen Schein auf den Boden, einen Kreis aus Licht, der ihn gerade mal einen Schritt weit sehen ließ. Und ihn umgekehrt meilenweit sichtbar machte. Ein einzelner leuchtender Punkt in einem endlosen Meer aus Dunkelheit. Alle Wesen des Waldes würden wissen, wo er war. Es gab kein Versteck für ihn.
Und vielleicht war das gut so.
Denn Lahoon war ein Suchender, aber einer, der vor allem darauf vertraute, gefunden zu werden. Sein ganzes Wesen war ein Angebot, eine Verlockung, ein Willkommen. Lahoon jagte nicht nach, sondern lud ein. Er war offen und willig. Bereit, zu hören und zu spüren, zu empfangen. Und von sich selbst zu geben.
Lahoon sandte sein geborgtes Licht aus, ohne zu zögern.
Er wollte sogar noch mehr tun.
Rund um Lahoon sangen die Stimmen der Nacht, sie rauschten und zirpten, knackten und quakten. Affen tanzten über ihm durchs Geäst. Zweige brachen unter seinen Füßen.
Lahoon fühlte sich ein in diese Symphonie des Waldes. Und ließ seine eigenen Töne mitklingen. Summend und schnalzend, eine leise, zögernde Frage pfeifend ging Lahoon weiter, vertraute auf seine Intuition und das Geleit des dichten Lebens um ihn herum.
Sie brachten ihn direkt zu dem gefällten Baum.
Der mächtige Stamm lag am Rande einer Lichtung inmitten der Spuren von Verhängnis, von Aufruhr und Zerstörung. Das Gras war zertrampelt, Äste abgerissen. Furchen im Boden zeugten von schweren Lasten, die über den Boden geschleift worden waren.
Nun lagen sie still im Dunkel der Nacht.
Nur der matte Schein der Laterne erhellte eine Krone voll welkender Blätter. Ein Baumriese war hier gestorben, und hatte im Fallen einen Jungen mit in den Tod gerissen.
Lahoon sank auf die Knie und legte seine Stirn an die raue Borke.
Lange Zeit blieb er bewegungslos, fühlte, wie der Atem seinen Körper verließ und eins wurde mit dem Geruch von Wald und Harz und fruchtbarer Erde.
Eine Brise ließ die Blätter rund um ihn rascheln und flüstern. Langsam und vorsichtig begann Lahoon zu antworten, mit seinem eigenen rauen Atem, mit den Lauten, die sein innerer Wind machte, wenn er über die Blätter und Bänder in seiner Kehle strich.
Ein Summen vibrierte in seiner Lunge, floss hinaus in die Welt als ein Klagelied, ein Requiem. Als Trauer, als ein Hinspüren zum Mysterium des Todes und dem Schatten der Fay, der über ihm lag.
Lahoons Stimme brach nun ohne sein Wollen oder Zutun aus ihm heraus, wurde ein Ruf, eine Suche in ätherischen Welten.
Der Schmerz über den Tod verschmolz mit der endlosen Sehnsucht nach einem Leben, das Lahoon fühlen konnte, aber nicht berühren, nicht erreichen.
Er wusste nicht, ob er in Worten sprach oder nur in der Form seiner Melodien, dem Ton seiner Stimme, den Bewegungen seines Körpers. Aber er sprach, soviel wusste er. Und er fühlte die Gegenwart der Fay, die seine Augen nicht sahen. »Wer seid ihr? Was ist geschehen?«
Ranken des Todes schwebten noch immer über der Szenerie. Lahoon konnte sie spüren. Er lehnte sich in ihre Spuren während er sang, immer weiter, in sanften, fragenden Melodien.
»Ihr seid gekommen, im Moment des Todes.« Die Blätter bebten. »Wer seid ihr? Warum seid ihr hier?«
Lahoons Stimme war heiser. »Habt ihr getötet?«
Seine Finger strichen über die furchige Rinde. Auf der Suche nach einer Antwort, oder nach einer besseren Frage.
»Begleitet ihr die Sterbenden? Mildert die Schmerzen, geleitet die Seelen?«
Lahoons Finger verfing sich in der Kerbe, die die Axt geschlagen hatte.
»Oder ist der Tod der einzige Moment, in dem ihr von einer Welt in die andere treten könnt? Ist dieser Spalt, dieser Bruch im Gefüge des Seins, euer Portal?«
Lahoons Wahrnehmung veränderte sich.
Er spürte, wie die Welt um ihn dichter wurde, voller, so als hätten sich bislang ungeahnte Ebenen für ihn sichtbar gemacht.
Der Wald war voller Tod. Lahoon konnte es nun sehen.
Im matten Schein der Laterne, am Rande der Nacht, saß ein Käfer und aß ein Blatt. Lahoon erlebte mit, wie das Blatt starb und zu Käfer wurde. Die winzigen grünen Zellen zerbrachen, ihre unglaublich komplexe Struktur löste sich auf. Aber all die Lebenskraft war noch da, verwandelte sich, wurde zu Zellen eines Käfers, eines dunklen Auges, eines durchsichtigen Flügels unter dem Schutz des dicken Panzers. Der Käfer schnupperte mit zarten Fühlern in den Wald hinaus und flog davon. Lebenskraft eines Blattes floss durch seine Muskeln und trug ihn durch die Lüfte. Ein goldener Punkt schwebte aus dem Lichtkreis der Laterne davon.
Und wurde zu Fledermaus.
Der Käfer knackte zwischen kleinen scharfen Zähnen. Der Tod riss eine weitere Wunde in das Geflecht des Lebens, wie ein Schrei, ein sengender Blitz.
Und dann löste der Käfer sich auf. Winzige Zellen hörten auf, Käfer zu sein, und wurden Fledermaus. Sie wurden zum Schlag ledriger Flügel, zur Feinheit in den Ohren eines geheimnisvollen Wesens, das sich selbst durch ein Labyrinth an Ästen rief. Die Lebenskraft floss durch seine Adern, stark und ungebremst, eine Quelle der Bewegung, der Entfaltung, der Wünsche.
Lahoon fühlte die Fledermaus davonfliegen, mit ihren eckigen, erratischen Bewegungen. Und hatte plötzlich eine Vision ihres Todes.
Ihr pelziger Körper lag auf dem Boden, still und verkrümmt. Er wurde Heimat für die Ursprünge von Käfern, und einen Mikrokosmos von Wesen so unbegreiflich, dass Lahoon die Worte fehlten um sie zu benennen. Der Körper der Fledermaus war ein eigenes Universum, eine ganze Welt voll unvorstellbar fremdartiger Geschöpfe. Er sprühte und wimmelte vor Leben, bis diese Welt sich schließlich selbst aufgebraucht hatte und in sich zusammenfiel. Dann wurde sie zu Erde, zur Wiege der Bäume.
Lahoon fuhr mit der Zunge über seine Lippen.
Er konnte all die Übergänge fühlen, die sich durch den Wald zogen. Den Tod, und die Transformation. Es gab Millionen Risse im Gewebe des Seins. Momente der Instabilität, Orte, wo das Unfassbare geschah. Wo Gestalten sich wandelten und Lebenskraft von einem zum anderen floss.
Wenn der Tod das Portal war, mit dem die Fay von einer Welt in die andere kamen, dann musste es unendlich viele Wege geben.
»Oder ist es der Tod eines Menschen, den ihr braucht? Diejenigen von euch, die nicht durch den Spalt eines Käfers kriechen können?«
Lahoon zitterte.
War er bereit zu sterben? Gegessen zu werden, seinen Körper und seine Lebenskraft in einen anderen fließen zu lassen? Einen Fay?
»Nein,« flüsterte er. »Nein. Noch nicht. Ich bin nicht bereit mich aufzulösen, selbst wenn es ein Weg wäre, zu dir zu werden. Ich möchte dir zuerst begegnen, als der, der ich jetzt bin. Ich möchte diesen Körper haben, um deine Berührung zu spüren. Diese Seele, um dich zu erkennen.«
Lahoon konnte den Tod im Wald um sich sehen, wie gespenstische Glühwürmchen, wie Spinnweben aus Mondlicht. Die Risse im Geflecht der Welt waren überall.
Mit der sanften Bewegung eines Druiden griff Lahoon in dieses Licht, in diese Finsternis. Sie lag in seinen Händen wie ein feiner Schleier, ein ätherisches Gewebe.
Als Lahoon vorsichtig die Arme hob, formten sich dicke Falten aus Sternenlicht über seinen Händen, volle, runde Schichten aus unsichtbarem Samt. Silbrige Schimmer bogen sich, bildeten einen Türbogen, wie der Rand einer angehobenen Decke. Darunter gähnte ein schwarzes Loch. Eine Höhle, ein Tunnel. Gerade groß genug für einen Menschen.
»Komm«, flüsterte Lahoon in die Passage unter seinen Händen. »Komm.«
Nichts regte sich.
Da war kein Laut, keine Bewegung, kein lebendes Wesen, das Lahoon spüren konnte.
Er sang sanft in die Dunkelheit, Balladen der Hoffnung, des Willkommens und der Liebe.
Die Töne verklangen. Es gab kein Echo. Dumpfe Stille blieb zurück.
Lahoons Seele verging vor Sehnsucht. Sein Körper bebte.
Mit der Sicherheit eines Schlafwandlers hob Lahoon die schimmernden Falten an und duckte sich darunter hindurch.
Er fiel in die Dunkelheit.
2
Rebonya trug die vergoldete Rüstung der Ehrengarde. Sie stand vollkommen still in Reih und Glied, als Huns Totenwache.
Durch das Fenster fiel die Schwärze einer bitteren Nacht herein, aus der die letzten blutroten Strahlen längst geschwunden waren. Hun lag aufgebahrt wie ein Held. Der Kasten um seinen Leichnam war groß und flach, mehr ein Bett als ein Sarg, bedeckt von einer riesigen Fahne. Nur sein Kopf war zu sehen.
Rebonya blickte aus dem Augenwinkel hinunter auf Huns Gesicht. Ihre Hand ballte sich zur Faust.
Doch da kam das Zeichen.
In perfektem Gleichklang hob die Ehrengarde die Bahre an und trug sie hinein. Das Gewölbe über ihnen, hoch wie das einer Kathedrale, warf das hohle Echo ihrer Schritte zurück.
Die große Halle der Burg war voller Krigas, alle in Formation. Die, die auf dem weiten Steinboden keinen Platz mehr gefunden hatten, standen auf der breiten Treppe oder den balkonartigen Korridoren im ersten und zweiten Stock.
Alle salutierten. Hunderte von Augen verfolgten, wie der Sarg auf einem mächtigen Tisch in der Mitte des Saals aufgebahrt wurde. Hun, immer noch schön wie eine Marmorstatue, sah aus wie der Inbegriff eines Prinzen, eines Helden auf seinem Grabmal.
Berqar hatte eine dramatische Pause eingelegt.
Nun nahm sie ihre Rede wieder auf. Ihre Stimme war leise, doch selbst ihr Flüstern war in der vollkommenen Stille des Saales zu hören. »Eine unfassbare Bedrohung hängt über uns, über der sanften, hilflosen Stadt Behrlem. Eine Macht der Finsternis.« Berqar ließ ihren Blick über die Menge der versammelten Krigas schweifen. »Ein Monster, ein grausamer Dämon sucht uns heim.«
Schwerter glänzten im Fackelschein.
»Hun war das erste Opfer. Abgeschlachtet von einem Ungeheuer.« Berqar gewann an Fahrt. »Hun hat sein Leben gegeben, um uns zu warnen! Lasst uns sein Andenken ehren!« Ihre Worte erschallten nun laut und klar. »Lasst Huns Tod nicht umsonst gewesen sein! Macht ihn zu unserem Weckruf, unserem Kampfschrei!« Sie riss die Fahne vom Sarg.
Hun war blutig, nackt, entstellt.
In hundert Kehlen verfing sich der Atem; in hundert Herzen fehlte ein Schlag.
»Das ist das Werk des Dämons!«, donnerte Berqars Stimme durch den Saal. »So werdet ihr aussehen, wenn ihr nicht kämpft! Doch ich sage: Nein!!! So werden wir nicht enden! Wir sind stark! Und wir sind im Krieg!«
Der Puls schlug wieder in den Adern der Krigas. Und wurde schneller.
»Krieg! Krieg!«, bellte Berqar durch die Burg.
Die Krigas stimmten in ihren Ruf ein, erst zögerlich und leise. Doch dann wiederholten sie den Kampfschrei, gaben ihm Kraft und Stärke, bis die Halle vibrierte mit der Inbrunst ihres Gebrülls, und tief unten im Gemäuer schlafende Geister weckte.
»Krieg!!! Krieg!!! Krieg!!!«
* * *
Lahoons Kopf schmerzte. Träume und Schatten tanzten hinter seinen Augen, zupften an seinen Lidern. Er stöhnte.
Und bekam Antwort. Unzählige Stimmen zirpten, sangen und raschelten um ihn herum.
Lahoon öffnete mit Mühe ein Auge. Ein Affe hüpfte vor ihm auf den Boden und verschwand himmelwärts auf den nächsten Baum. Das warme Licht des Morgens schimmerte durch die Blätter.
Vorsichtig stemmte sich Lahoon auf einen Ellbogen. Sein Körper war steif und wund.
Aber trotz all der Bilder in seinem Kopf, all der Spuren von Reise an seinem müden Körper hatte Lahoon keinen Zweifel: Er war in genau demselben Wald aufgewacht. Er war nicht in der Anderwelt, nicht in Fay. Und alles, woran er sich erinnerte, war sein eigenes Suchen in den Tiefen der Nacht, seine eigene endlose Sehnsucht.
*
Erschöpft sank Lahoon gegen die Wand der Dachterrasse. Er zog Amalai an sich und blickte hinaus über den Kräutergarten zu ihrem Nachbarn, dem Badepalast, der gerade eben von den ersten Sonnenstrahlen geküsst wurde. Ein warmes Leuchten kam in alle Farben. Lahoon sah das tiefe Goldgelb der Wände, das sanfte Rot der Ziegeldächer, die sich an den Ecken stolz nach oben reckten. Das frische Grün der Wiesen.
Er seufzte. »Es war überwältigend. Magisch. Aber es war nicht fay.«
Lahoon lehnte den Kopf an die Wand und schloss die Augen. »Es sei denn, ich habe es vergessen. Das Bewusstsein verloren.« Lahoons Stimme driftete über die Terrasse, suchte ihren Weg in der Ungewissheit von Wind und Raum. »Oder vielleicht ist die Bedeutung von fay genau das. All die Wunder, an die ich mich sehr wohl erinnere. Möglicherweise ist fay nichts anderes als das Zauberhafte des Terrenreichs, wie du immer sagst.«
Amalai schüttelte sachte den Kopf. »Ich sage das in Bezug auf mich selbst. Für mich ist jedes Kraut ein Wunder, und auch ein eigenes Lebewesen, eine Person. Ich muss keine kleine Fee in der Blüte sitzen sehen, um in Beziehung zu treten. Oder um bezaubert zu sein. Ich bin auch so schon voller Staunen. Darüber, wer die Pflanzen sind, in ihrer eigene Wesenheit. Ich werde der Mysterien dieser Erde nie müde werden.«
Sie wandte sich Lahoon zu. »Aber ich glaube genauso fest an deinen Weg. Wenn du die Fay so stark spürst, bin ich sicher, dass es sie gibt. Und dass du ihnen eines Tages begegnen wirst.« Sie küsste seine Schulter.
Lahoon seufzte tief. »Eines Tages.«
Ein Vogelschwarm erhob sich und zog aufwärts, immer höher und höher, in das grenzenlose Reich der Wolken, der endlosen Wälder, der fernen Berge.
Lahoon fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ich war so nah dran, letzte Nacht. So nah... Aber nein. Wieder nicht.«
Bedächtig wiegte Amalai den Kopf. »Nun ja. Vielleicht gab es in dieser Geschichte nie eine Fay. Und auch keinen Dämon. Ja, der Kadette trug Spuren am Hals wie von einem Biss. Aber er trug auch noch andere Spuren. Viel gröbere. Der Bursche wurde von einem Baum erschlagen. Das klingt sehr nach einem Unfall beim Holzfällen. Und kaum nach der Jagdmethode eines Wesens aus der Anderwelt.«
»Hm.«
Lahoon strich über einen runden Blumentopf und ließ die Blätter der Pflanze mit seinen Fingern spielen. Der tote, vertrocknete Körper einer Blüte fiel zu Boden.
Lahoons Hand ballte sich zu einer Faust. »Der Junge ist gestorben. Er ist wirklich gestorben. Weil er einen Baum gefällt hat, unter lebensgefährlichen Bedingungen. Weil das sein Befehl war. Seine ›Korrektur‹.« Lahoon schluckte. »Sie haben sein Leben riskiert, in der Kaserne. So machen die das. Disziplinieren Leute. Bringen sie in Gefahr.« Seine Lippen waren blass. »Was soll denn das?«
Lahoon stemmte sich ruckartig hoch und zog Amalai mit sich auf den schmalen Balkon, der auf Höhe der Dachterrasse rund um ihr Haus lief. Lahoon blieb auf der gegenüberliegenden Seite stehen und schaute über die Mauer zu ihrem anderen Nachbarn, der Kaserne.
Der Hof war voller Krigas. Sie standen alle brav in geraden Linien und ordentlichen Quadraten und hoben und senkten ihre Schwerter auf Befehl.
Lahoon biss die Zähne zusammen. »Hier. Da liegt die wahre Gefahr. Bei einer Institution, die tagtäglich übt, Gewalt anzuwenden. Gegen Menschen!« Lahoon zeigte anklagend auf den Kasernenhof. »Was ist das hier? Oder: Wann ist das? In der Zeit vor dem Wandel?«
Er zischte giftig.
Dann seufzte er. »So kommt es mir manchmal vor. Als wäre die Kaserne, voller Angst und Aggression, eine kleine Eiskugel, wo die Zeit eingefroren ist, wo die Welt vergangener Jahrhunderte konserviert ist. Wo das gleiche Stück wieder und wieder aufgeführt wird. Jedes Mal, wenn man die Kristallkugel schüttelt, beginnt der Schnee wieder zu fallen und die kleinen Soldaten bewegen sich, alle in derselben Art, alle zur selben Zeit, gefangen in einer hoffnungslosen und endlosen Schleife aus Brutalität und Unterwerfung.«
Lahoon verstummte. Er ließ die Brüstung los und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand des Hauses. Seine Augen schweiften in die Ferne, an einen Ort weit jenseits der Burgmauern.
Er hob die Flöte, die er um den Hals trug, an die Lippen und ließ eine wehmütige Melodie erklingen. Ein Klagelied, das aus einer rauen, grauen Welt kam, einem Ort endlosen Leides, einem Kreislauf der Gewalt, ohne Hoffnung und ohne Ausweg. Lahoon ließ die Töne durch die Luft gleiten, mit dem Winde verwehen.
Dann hörte er auf. Er trat mit dem Fuß gegen den Pfosten des Geländers. »Es stimmt nicht! Diese Welt war nicht ohne Ausweg. Es gab ein Tor, und wir sind hindurch gegangen. Wir sind draußen! Oder etwa nicht? Der Wandel hat stattgefunden! Warum gibt es noch immer diese Überbleibsel des alten Geistes? Und dieser alten Praxis.« Er warf die Hände in die Luft. »Was ist das? Warum haben wir das noch nicht abgeschafft?«
Amalai zuckte kummervoll mit den Schultern. »Weil der Wandel nicht an einem Tag erledigt war? Auch wenn es in der Mitte ein paar sehr dramatische Tage gab, an denen alles sehr schnell zu gehen schien. Aber in Wahrheit hatte sich die Bewegung über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, aufgebaut und langsam Fahrt aufgenommen. Zumindest glaube ich, dass sie auf diese Weise gewonnen hat und auch immer noch gewinnt. Durch Beharrlichkeit, nicht durch Dramatik. Und man kann diesen langsamen, stetigen, unaufhaltsamen Wandel genau hier sehen.«
Amalai zeigte auf den Westflügel der Burg. Er stand leer. Ebenso wie viele der Ställe und Nebengebäude. Sie alle lagen still und leblos da, mit verriegelten Türen und trüben Fenstern. Nutzlos und vergessen gähnten sie herüber, Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit, als die Zahl der Krigas noch ein Vielfaches betrug und der Hof ständig von Uniformen und schallenden Befehlen erfüllt war. Als die Klinge, die größte Kaserne in ganz Yurvania, den gesamten Süden beherrschte.
Lahoon grummelte unwirsch. »Ich weiß. Die Kaserne wird geschlossen, wie so viele andere auch. Und die letzten Kadetten, die sie haben, füllen kaum noch die Räume der Schule. Es schwindet alles dahin.« Er knirschte mit den Zähnen. »Langsam.«
Amalai seufzte. »Ja. Langsam.« Ihr Finger zeichnete eine klare Linie entlang des Geländers. »Aber solange es die Krigas noch gibt, haben sie zumindest keine Macht, keine Präsenz in der Stadt. Du und ich und alle Menschen in Behrlem leben im Geiste unserer neuen Gesellschaft, in Freiheit und Gleichheit. Wo es Entscheidungen der Gemeinschaft gibt, nicht Befehle von Obrigkeiten. Wo niemand mehr in Armut lebt. Behrlem ist frei. Die Überbleibsel des alten Regimes, auch wenn es sie noch gibt, sind in das Innere der Kaserne verbannt.«
Lahoon betrachtete die kahle, kriegerische Burg und wurde plötzlich von Schwindel ergriffen. Er spürte, wie die Übel der Vergangenheit als eine dicke schwarze Soße aus der Kaserne herausrannen, unter den Türen hervorquollen und an Fenstern herunterliefen. Wie eine Rußwolke über dem Burgturm aufstieg und zu ihm herüber trieb, ihn einhüllte, ihn und die ganze Stadt in ihrer giftigen Umarmung erstickte. Lahoons Hand krampfte sich Halt suchend um das Geländer, in einem Wirbel böser Vorahnung.
»Geht es dir gut?« Amalais besorgte Stimme durchdrang den Nebel. Langsam lösten sich die dunklen Wolken auf. Die Welt lag wieder klar und ruhig da.
Lahoon keuchte. Er richtete sich auf. »Ja«, sagte er mit rauer Stimme. »Ja. Geht schon.«
Er holte tief Luft und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Hauswand. »Es ist nur... dieser Ort macht mich krank.« Er drehte sich müde um. »Lass uns gehen.« Lahoon legte einen Arm um Amalai. Er schlenderte bewusst gemächlich zur Dachterrasse zurück und warf dabei lange, heilsame Blicke hinunter in das satte Grün von Amalais Kräutergarten, dann hinüber auf die weiten Wiesen und funkelnden Teiche des Badepalastes.
3
Rebonya ließ sich mit einem Seufzer auf ihre Matte plumpsen. Sie hatten frühmorgens mit dem Exerzieren begonnen. Alle. Und würden gleich wieder weitermachen.
›Jetzt wo wir im Krieg sind‹, dachte Rebonya giftig, ›kann man es wohl gar nicht übertreiben. Immer schön auf und ab marschieren. Gönn den Leuten ein bisschen Schlaf, und schon könnten sie vergessen, verbissen mit den Zähnen zu knirschen.‹
In diesem Moment kam ihr einziger Zimmergenosse herein. Das Morgenlicht spielte auf seiner schwarzen Haut als Gureev leise und sorgsam die Tür hinter sich schloss.
Rebonya betrachtete ihn lakonisch.
Niemand, dem sie je begegnet war, hatte auch nur annähernd eine so perfekte Haltung, bewegte sich mit so unbändiger Anmut, war so unaufhörlich würdevoll. Es war richtig nervig. Und es war einfach seine Art. Gureev brauchte sich nicht zu konzentrieren, um sich so zu bewegen. Was auch völlig unmöglich gewesen wäre. Jeder normale Mensch müsste sich schon in eine Dauermigräne hineinkonzentrieren um das hinzukriegen, dachte Rebonya. Nein, Gureev war es gewohnt. Wahrscheinlich müsste er sich richtig anstrengen, um ab und zu eine unelegante Bewegung zu machen. Nun, er hatte ja noch Zeit zu üben, schlug Rebonyas innere Stimme mit einem spöttischen Unterton vor.
Mit sanfter Achtsamkeit platzierte Gureev einen Schmöker auf dem Tisch.
Rebonya rappelte sich hoch, um einen neugierigen Blick darauf zu werfen. »Was ist das?«
»Strategie und Taktik. Ich soll jede Woche ein Kapitel lesen und einen Essay mit meinen Gedanken dazu abgeben.«
Rebonya sah ihn überrascht an. »Abgeben? Wem?«
»Berqar. Sie wird die Essays mit mir durchbesprechen.«
Rebonya pfiff leise durch die Zähne. »Berqar gibt dir Privatunterricht. Zu Strategie.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Na, warum sollte mich das überraschen? War ja eigentlich zu erwarten.« Rebonyas Stimme war schneidend. »Sie weiß von deinen Eltern. Seit du vor ein paar Monden hierher gekommen bist, denkt sie, du bist ein Prinz. Ihr Prinz. Der ihr Herrscher sein sollte. Unser aller Herrscher. Aber ich kann dir gleich sagen, dass das nichts wird! Niemals!!!«
Gureev hob eine Augenbraue. »Hältst du es für nötig, in regelmäßigen Abständen darauf hinzuweisen? Für den Fall, dass ich es vergesse?«
»Ja! Sollte ich wohl. Sicherheitshalber«, brummelte Rebonya.
Sie runzelte die Stirn. »Es ist vielleicht nicht deine Schuld, wenn Berqar dich bevorzugt. Aber es ist deine Schuld, wenn du es nicht einmal merkst.«
Gureev schien unsicher. Er legte die Fingerspitzen auf den Einband des dicken Buches. »Ich bekomme Zusatzlektionen zu Strategie weil ich sie brauche. Ich bin noch nicht gut genug. Und gerade jetzt, wo – « Er unterbrach sich. »Gerade jetzt.«
»Ha«, stieß Rebonya verächtlich hervor. »Gerade jetzt, wo Hun an Berqars ruchlosen Korrekturen gestorben ist, jetzt musst du etwas lernen über Strategien von Armeen. Sehr logisch!«
Sie spitze ihre Lippen. »Und du glaubst, dass Berqar mir deshalb keine Zusatzlektionen gibt, weil ich schon brillant bin? Und alle anderen in der Klinge auch?«
Gureev sagte nichts.
»Mach dir keine Hoffnungen«, zischte Rebonya. »Sie wird dich bloß für ihre Zwecke einspannen, wie alle anderen auch. Wie Hun.«
Ihre Augen verengten sich zu wütenden Schlitzen. »Sogar nach seinem Tod hat sie ihn missbraucht. Aber wer, bitte schön, wird denn darauf hereinfallen? Krigas sind doch keine Idioten! Sondern bloß Menschen. Die unter Druck stehen, inmitten eines brutalen Systems. Aber trotzdem. Viele von uns werden doch ihren Verstand nicht wegwerfen, oder ihn zumindest ehebaldigst wiederfinden.«
Rebonya hob ihren Blick. »Hast du dich mal gefragt, warum Hun blutig und verrenkt unter der Fahne lag? Warum war er nicht gewaschen, gekleidet und zurecht gerichtet, wie es üblich ist, wenn man Tote aufbahrt?« Rebonya stemmte die Hände in die Hüfte. »Im Wald war Hun nicht nackt. Und wo kam das ganze Blut eigentlich her? Womöglich musste Berqar für den dramatischen Effekt einen Hasen opfern?«
»Genug!«
Gureevs Stimme war hart und bestimmt. Er schaute Rebonya streng an. Dann drehte er sich um und nahm sorgsam das Buch hoch. Er öffnete es jedoch nicht, sondern hielt es bloß in den Händen, während er Rebonya den Rücken zukehrte.
»Du glaubst an gar nichts«, sagte er schließlich, kalten Vorwurf in der Stimme.
Rebonyas Muskeln spannten sich an.
Gureev drehte sich mit gemessenen Bewegungen zu ihr um. »Warum bist du hier?« Sein Ton war kühl. »Was machst du bei der Klinge? Wenn du zu wissen glaubst, dass hier alles so furchtbar falsch läuft?«
Rebonya schnaubte. »Ich bin hier raus, sobald ich kann, keine Sorge. Ich brauche nur das Abschlusssiegel der Klinge, damit ich an der Akademie der Magischen Künste in Varoonya zugelassen werde. Nur noch ein paar Monde, dann bin ich weg.«
Gureevs Augenbraue hob sich wieder. »Aber warum bist du je gekommen? Warum bist du nicht gleich bei deiner Familie geblieben?«
Rebonya explodierte. »Nicht jeder hat Eltern, die einen verwöhnen und verhätscheln. Manche Leute müssen einfach weg, egal wie.« Sie warf Gureev einen giftigen Blick zu. »Meine Eltern waren furchtbar. Auch ihre ganzen Freunde waren schräg. Die ganze Atmosphäre war einfach grauenhaft. Ich musste da raus. Und als ich elf war, habe ich einen Weg gefunden. ›Die Kadettenschule der Klinge Yurvanias‹ klang großartig.« Rebonya verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich war ein Kind. Ich hatte keine Ahnung. Und als ich verstand, wo ich da gelandet war, war es schon zu spät. Ich musste mich hier einfach durchschlagen. Und in der Zwischenzeit herausfinden, was ich als Nächstes tun will. Und wie ich das anstelle.«
Das war etwas mehr, als sie hatte sagen wollen. Unter ihrem schwarzen Pony warf Rebonya Gureev einen verstohlenen Blick zu. »Na, wie auch immer. Jetzt bin ich hier, und du auch. Und deine Familie ist genauso weit weg wie meine. Und von genauso viel taktvollem Schweigen umgeben.«
»Es gibt Gründe für das Schweigen, im Falle meiner Familie.« Gureev hielt seinen Kopf noch eine Spur höher.
»Ja, und im Falle meiner Familie auch.«
»Das ist nicht das Gleiche.« Das Urteil eines Königs hätte nicht mit mehr Autorität gesprochen werden können.
»Oh nein, ganz und gar nicht.« Rebonya machte eine ausladende Geste mit dem Arm. Aber ihre Augen glänzten gefährlich. »Deine Familie waren Feudale und meine nur einfach so fies. Also keine Überschneidungen, abgesehen von der Fiesheit. Aber vielleicht waren deine Leute ja auch nie fies zu dir, sondern nur zu allen anderen,« fügte sie in beißendem Ton hinzu. »Ihre Liebsten haben sie ja vielleicht nach wie vor verwöhnt, selbst nachdem sie Varoonya verlassen mussten, die Taschen voller Juwelen.«
»Die einzigen Juwelen, die die feudalen Familien mitnehmen konnten, als sie ins Exil getrieben wurden,« verkündete Gureev würdevoll, »waren die Juwelen in ihren Herzen.« Er machte eine bedeutungsschwangere Pause. »Die reinsten Diamanten«, fügte er hinzu, genau im gleichen Moment als Rebonya sagte: »Herzen aus Stein.«
Gureev würdigte sie keiner weiteren Antwort. Mit erhobenem Haupt und einem Ausdruck noblen Gleichmuts wandte er sich seiner Matte zu. Sie war bereits ordentlich aufgerollt. Aber Gureev zupfte die obenauf gefalteten Laken zu noch mehr makelloser Glätte.
Rebonya sah ihm zu. Das war wieder typisch. Sogar um sein Bett zu machen ging Gureev lieber auf ein Knie nieder als sich zu bücken. Nur damit er den Rücken gerade halten konnte und edel und anmutig aussah. Rebonya schüttelte den Kopf und schmiss sich mit einem lauten und uneleganten Plumps wieder auf ihre eigene Matte.
* * *
Der Ort war still, eingehüllt in eine seltsame Lautlosigkeit, in der nicht einmal die Vögel sangen. Berqar ritt in die gähnende Leere des alten Gehöfts, in einen Innenhof voller Disteln und Unkraut. Geschwärzte Wände ragten ringsum auf, eine schweigende Anklage, ein stummes Mahnmal. Die Überreste eines eingestürzten Daches vermoderten in einer Ecke, zwischen Asche und verkohlten Balken.
Was einmal ein lebendiges Zuhause gewesen war, voller Ziegen und Enten und herumlaufender Kinder, lag nun tot und verlassen da, gespenstisch.
Berqar stieg ab.
Sie stellte sich vor dem alten Wohntrakt in Position, mit Blick auf den einzigen Teil der Gemäuer, der noch nicht eingestürzt war, und klatsche einen kurzen, präzisen Rhythmus mit den Händen. Dann wartete sie regungslos. Ihr starrer, ausdrucksloser Blick war auf die Mauern vor ihr gerichtet.
Plötzlich hob ein scharfer Wind an, ein unheimliches Geheul, das aus der leeren Tür des Hauses zu kommen schien. Der ganze Hof verschwamm wie eine Fata Morgana, als würde die Wirklichkeit an Substanz verlieren und zu einem Trugbild aus flimmernder Luft werden.
Berqar rührte sich nicht.
Rund um sie dehnte und krümmte sich das Universum in wabernden Verrenkungen, voll durchscheinender Bilder, wimmernde Spiegel einer Realität, die einst fest und sicher schien. Ein dünner, jammernder Klagelaut zog sich durch den Wind, durch diesen Traum oder Albtraum von einer Welt.
Doch dann teilten sich die Wogen. Das Geheul wurde zu einem feinen Flötenklang, und ein Pfad reinster Klarheit zeigte sich vor dem verkohlten Bauernhaus.
Mit einer Aura aus Macht und Würde trat der Magja heraus, in dunklen, mit Runen bestickten Roben, die bis zu seinen Füßen fielen.
Berqar verneigte sich tief, in der höfischen Geste treuer Gefolgsleute.
*
Die Stube des Gehöfts war groß gewesen, fast wie eine Taverne. In den kargen, verbrannten Überresten stolzierte nun Pramus auf und ab wie in der Empfangshalle eines belagerten Königs.
»Wahrlich, dies ist unser Ruf! Nie hat eine Zeit stärker zu uns gesprochen als diese. Das Dämonenreich selbst streckt seine Arme nach uns aus!« Unterschwellige Erregung schwang in seiner Stimme mit.
Berqar ließ die Finger über die verkohlten Überreste einer Heugabel gleiten. Der Stiel war schwarz. Aber die eisernen Spitzen waren noch lang und hart.
»Werdet Ihr in den Wald gehen?«
»Nein. Dort ist der Dämon nicht. Er wird an anderer Stelle wieder erscheinen. Und dann werde ich sein Meister! Ich werde ihn bändigen, versklaven, zu meinem Diener machen! Ihn rufen und verbannen, wie es mir gefällt. Und die Welt wird in Angst und Ehrfurcht kauern vor der schrecklichen Macht, so wie sie es die Jahrhunderte hindurch getan hat!«
Pramus strich mit der Hand über seinen langen, grauen Bart. »Wir haben so lange gewartet, all die Jahre. Wie viele Tage meines Lebens habe ich damit verbracht, diejenigen zu suchen, die treu zur Restitution stehen! Verbindungen zu weben, Knoten zu knüpfen, und die Bünde zu nähren. Damit wir bereit sind, wenn der Tag gekommen ist! Wenn Magjas wieder an der Seite von Königen schreiten, und obersten Krigas in all ihrer Glorie! Das Volk wird sich verneigen vor den Großen, wie es sich gehört. Wenn die Macht von Schwert und Stab sich vereinigt, wird die Herrschaft wieder in den rechten Händen liegen!«
Pramus drehte sich so schwungvoll zu Berqar um, dass Drachen aus Silberfäden in seiner wogender Robe bebten. »Ein Glück, dass ich gerade in Behrlem war. Wir müssen schnell sein. Das Feuer schüren. Die Flamme nähren. Zuschlagen wie der Blitz.«
Seine dunklen Augen glänzten unter dem breiten Hut. »Meine Dienerin wird bereit sein, heute Nacht. Wenn Ihr nur die Gelegenheit schafft.«
»Aber wird er überhaupt da sein?«
Pramus machte eine wegwerfende Geste. »Wo sonst? Das Risiko müssen wir eingehen.«
* * *
»Ich kann es mit dir gemeinsam tun.« Voll Würde und Anmut hob Gureev seine Hand zu einer einladenden Geste.
Kortid sah ihn erleichtert an. »Danke.« Er tat einen Schritt in Richtung Korridor. »Es ist nicht so arg viel. Es ist bloß...«
Gureev nickte. »Ich verstehe.«
Kortid drehte sich um und ging voraus zu seiner Kammer. Er zögerte, die Hand auf der Klinke. Dann riss er die Tür mit einem Ruck auf.
Gureev trat ein.
Huns Sachen lagen unordentlich verstreut zwischen denen von Kortid. Als wäre es mitten am Tag, mitten im Leben, ein kleiner Moment, in dem Hun zur Tür rausgestürmt war, ohne sein Bett zu machen oder seine Bücher zu schließen. Mit nur einem kurzen Wort für seinen Freund und Zimmergenossen, über die Schulter zurückgerufen. Das zerknüllte Laken zeigte noch an, wo Hun gelegen hatte. Der Kamm lag daneben, bereit, durch Huns Haar zu gleiten.
Kortid stand an der Schwelle, die Arme eng um die Brust geschlungen.
Gureev ließ sich auf ein Knie nieder und nahm sanft den Kamm hoch.
Er strich mit dem Finger darüber.
Dann legte er ihn sorgsam in die Packtasche, die Kortid für ihn aufhielt.
* * *
»Ihr seid zu früh.« Der Wirt kratzte sich hinter dem Ohr und sah die fünf jungen Krigas unsicher an. »Von der Burg sagten sie, sie brauchen extra Braten, haben einen Engpass bei sich in der Küche. Aber er war erst für später beordert.« Er wiegte nachdenklich den Kopf. »Jetzt gleich kann ich den nicht vom Feuer nehmen. Wär ein Jammer.«
Er machte eine einladende Geste in Richtung der Tische. »Aber egal. Setzt euch doch hin, und eh ihr’s euch verseht, ist er schon fertig.«
Die Krigas standen bei der Theke, mit grimmigen Posen und finsteren Gesichtern. Eine dunkle Wolke ging von ihnen aus, driftete langsam hinüber zu den Tischen, an denen Bäuerinnen und Handwerker lachten und redeten, Karten spielten oder ein ruhiges Abendessen genossen.
Die Atmosphäre spannte sich an. Der Bäcker warf einen verstohlenen Blick auf die Uniformen. Ein Bauernbursche räusperte sich und rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Nichtsdestotrotz. Wahrscheinlich hätte sich die Stimmung schnell wieder auf die übliche Gemütlichkeit eingependelt, hätte nicht Tenatetlan, eine fahrende Krämerin, die Krigas in ein Gespräch gezogen. Ihnen Fragen gestellt. Gab es da nicht einen Toten im Wald?
Kortid war unter den Krigas. Er hatte sich nicht wieder gefangen, seitdem er Hun gefunden hatte. Wann immer das Thema aufkam, ging Kortid entweder weg oder redete sich in Rage. So wie jetzt.
»Ich sag’s euch! Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen! Es war ein Dämon!«
Die Zweifel der Krämerin heizten ihn nur weiter an. Tenatetlan begann, andere Gäste in das Gespräch hineinzuziehen, nach ihrer Meinung zu fragen, um ihr Urteil zu bitten. Kortid glühte vor Inbrunst. Seine Geschichte donnerte vorwärts wie eine Horde Büffel und riss seine Kameraden mit.
Tenatetlan begann zu schwanken. Nach ihrer anfänglichen Skepsis ließ sie sich nun von Kortids Angst und Intensität überwältigen und wurde zu Öl auf dem Feuer der Krigas. Nun überboten sich alle an Schreckensbildern. Von dem Dämon, seiner teuflischen Natur, seinem Blutrausch. Der Gefahr, in der sie alle schwebten, jede einzelne, jederzeit. Niemand war sicher. Hinter jeder Ecke konnte der Tod lauern, ein Monster dein Blut aussaugen. Ein Horror! Es musste etwas getan werden! Schnell!
Die Luft vibrierte.
Ojorsven, der Stadtbüre, der sich auf einen gemütlichen Abend an seinem Stammtisch in der Taverne gefreut hatte, blickte zu Boden und zupfte fahrig an seinem Ärmel.
* * *
Als die Sonne hinter dem Horizont versank, blieb die Abendluft lau und weich, voller Erinnerungen und Verheißungen. Amalai lehnte sich an die Wand ihrer Dachterrasse, ein Glas herb-süßen Saftes in der Hand.
In den Gärten des Badepalastes leuchteten magische Lichter in allen Farben, schwankten sachte zwischen Strandschaukeln und blühenden Büschen, spiegelten sich auf den Wellen. Badegäste schwammen gemächlich durch die Teiche oder flanierten auf verschlungenen Pfaden durch die Wiesen. Die Stimmen der Menschen und das Lachen, das sich ab und zu darunter mischte, verschmolz zu einem Gemurmel der Zufriedenheit, einer Melodie des Abends, die zusammenfloss mit dem Rauschen der Blätter und dem hingebungsvollen Gesang der Vögel.
Und dann wob sich noch ein Lied in die Sommerluft. Das Lächeln in Amalais Augen vertiefte sich. Das war Lahoon. Es war sein Konzert im Pavillon, heute Nacht.
Die Süße von Lahoons Klängen fiel tief in Amalais Herz. Sie hatte dies schon so oft gehört. In endlosen Übungsstunden, immer und immer wieder die gleichen Passagen. Und dennoch war sie wieder einmal bezaubert, umgarnt von den Strängen der Sehnsucht, von der Aura des Wunderbaren, die Lahoon in seine Musik zu weben verstand.
Amalai legte ihren Kopf zurück und ließ sich davontragen von den Harmonien, die zwischen magischen Lichtern und duftenden Blüten zu ihr herüber wehten.
Doch dann erstarrte sie. Überrascht schaute sie in die Dunkelheit ihres eigenen Gartens hinunter. Da war etwas. Oder jemand? Sie trat an die Balustrade und lehnte sich hinaus. Da, kein Zweifel. Eine schwarze Gestalt duckte sich hinter einen Busch, schoss vorwärts bis zum nächsten Versteck, versuchte das Licht zu meiden. Von Dunkel zu Dunkel huschte der Schatten, von Deckung zu Deckung. Und verschwand in der Nacht.
Amalai kniff suchend die Augen zusammen. Aber sie sah nichts mehr.
* * *
Der Kasernenhof lag still und verlassen da. Gureev durchquerte ihn bis hinüber zum leeren Westflügel und setzte sich auf einen Eckstein. Lange Schatten fielen von den Wänden, die streng und unerbittlich im sterbenden Licht des Abends standen. Eine Fackel brannte irgendwo in der Ferne, unter dem Fallgitter des großen Tores. Die Burgmauern umringten sie massig und übermächtig wie eine Festung der Finsternis.
Gureev konnte immer noch Kortids zitternde Schultern fühlen, die sich bei der Brücke in seinen Arm gepresst hatten, sah noch immer den wilden, panischen Blick seiner Augen.
Gureev biss sich auf die Lippen.
Bilder seiner Kindheit tauchten ungerufen vor seinem inneren Auge auf.
Eine schummrige, geheimnisvolle Bibliothek voll staubiger Bücher und polierter Regale. Ein Sonnenstrahl, der durch eine Dachluke fiel wie ein goldener Finger, der genau auf den größten aller Schätze zeigte: dick und schwer, mit vergoldeten Kanten und reich verzierten Anfangsbuchstaben zu Beginn jeder Mär.
Gureevs kleine Kinderhand blätterte andächtig um. Um zu sehen, wie der strahlende Ritter aus einer handkolorierten Zeichnung auf ihn zu ritt, mit erhobenem Haupte und reinem Herzen. Ein Drachentöter, Beschützer der Schwachen. Das Sinnbild des guten Helden, des wahren Prinzen.
Gureev hatte die Geschichte auswendig gelernt, so wie sie im Buch stand, und so, wie sein Großvater sie am Kamin erzählte. Sie war in seine Träume gesunken, in den Kern seines Seins.
Und doch. Irgendwie...
Vor der dunklen Silhouette der Burg hatte Gureev die deutliche Vision des Reiters, der auf ihn zukam, des weißen Rosses in stolzem Trab – als die Stute plötzlich scheute, sich mit schreckgeweiteten Augen aufbäumte. Zwischen ihren Hufen, im Staub des Hofes, lag Huns verrenkter Leichnam.
4
Im fahlen Licht des Morgens trafen zwei Silhouetten aufeinander. Sie griffen an und fuhren zurück, attackierten erneut, voller Kraft und Entschlossenheit. Ihre Schwerter glänzten und klirrten. In unermüdlicher Verfolgung umkreisten die Gegner einander, tanzten und fochten, stießen und parierten, in einer Mischung aus Konzentration und Getriebenheit, die keinen anderen Gedanken zuließ. Schweiß lief über ihre Rücken, als sie lauerten, mit wachen Augen und gespannten Muskeln, zum Angriff bereit.
Da fiel eines der Schwerter zu Boden. Eine flache Staubwolke hüllte die Klinge ein, als sie im Sand zu liegen kam. Der Kriga hob den Arm, in einer Geste der Beschwichtigung, der Überredung, der Kapitulation.
»Lass gut sein!«, keuchte Gureev. Er lehnte sich gegen die Kasernenmauer. Eine Brise strich über seine nasse Haut und brachte die dunklen Gerüche des Waldes mit sich. Gureev betrachtete Kortid mit einem leichten Kopfschütteln. »Gönn uns eine Pause. Wir haben ohnehin noch einen ganzen Tag Exerzieren vor uns.«
Kortid war genauso außer Atem. Aber weit davon entfernt, aufzugeben. »Wir müssen uns vorbereiten«, zischte er mit dem bisschen Luft, das ihm noch blieb. »Wir müssen jetzt die besten Krigas werden, die wir nur sein können. Mit all unserer Kraft, all unserem Geschick. Und wenn der Dämon auf uns niederfährt, geben wir alles, was wir haben.« Kortid biss sich auf die Lippe. »Und hoffen, dass es reicht«, stieß er hervor.
Er umfasste sein Schwert mit entschlossenem Griff. In seinen Augen war ein Leuchten, das keinen Raum ließ für Schwäche oder Zweifel.
* * *
Goldene Morgensonne strich mit langen, trägen Fingern über das Schreibehaus von Behrlem. Es war ein breites, freundliches Gebäude, wie so viele im Kern der Provinzhauptstadt. Rot lackierte Balken glänzten stolz in den weißen Wänden, und die Fenster wurden von filigranen Holzgittern geziert, auch wenn das Papier darin längst durch Glas ersetzt worden war. Das Dach hing weit über die breite Veranda hinaus und gab damit nicht nur Schutz vor Regen, sondern auch ein heimeliges Gefühl von Geborgenheit.
Und normalerweise funktionierte das auch.
In all den Jahrzehnten, die Ojorsven nun schon gemeinsam mit Nenimoria als Büre von Behrlem tätig war, hatte er sich immer sehr wohl gefühlt, sowohl im Haus als auch in seiner Position. Trotz all der rapiden Veränderungen, die das Land als Ganzes durchmachte, war Ojorsvens eigenes Leben doch ein sanftes, beschauliches geblieben. Voll von alten Bekannten, von Bauern und Handwerkerinnen, die mit Anfragen zu ihm kamen, und nach einem kleinen Plausch und einem erwiesenen Dienst zufrieden wieder gingen.
Aber jetzt...
Ojorsven wünschte, Nenimoria wäre da, sodass sie gemeinsam beraten könnten. Aber seine getreue Kameradin half für ein paar Tage ihrer Familie auf dem Land.
Ojorsven seufzte. Er nahm seine Filzkappe ab und betrachtete ihre kunstvolle Stickerei, während er sie sorgsam auf dem Beistelltisch platzierte. Sein Morgentee winkte ihm mit dünnen, dampfenden Fahnen und beruhigend vertrauten Düften zu, und Ojorsven lehnte sich in seinem Stuhl zurück, um die Tasse an seine Lippen zu führen.
Dennoch tippte er geistesabwesend mit den Fingern auf die Tischplatte, während sich in seinem Kopf die Bilder der letzten Nacht wiederholten. Die Leute waren besorgt. Verängstigt und aufgewühlt. War da ein Dämon? Gab es Dämonen? Ojorsven hatte eigentlich immer gedacht dass nein. So lernte man das schließlich als Kind: dass die Dämonen immer bloß Schimären gewesen seien, Illusionen der alten Magjas. In den Schreibstuben der Hauptstadt würden sie sicher auch nichts davon hören wollen. Und dennoch. Die Leute waren aufgebracht. Und schienen zu denken, dass Ojorsven als Büre der Stadt etwas tun sollte. Aber was denn?
Ojorsven hatte keine Ahnung. Er seufzte tief. Wie auch immer. Er musste ja nicht wissen, was zu tun war. Er war schließlich nur der Büre, hier, um die Wünsche der Bevölkerung umzusetzen. Nicht, um zu bestimmen oder zu erraten, was diese Wünsche waren. Sobald irgendein besorgter Mensch eine konkrete Idee für eine Maßnahme hatte, konnte der sie ja am Brett draußen anschlagen und eine Abstimmung anberaumen. Oder direkt zu Ojorsven kommen, falls es nur eine Kleinigkeit war. Und solange niemand kam, würde Ojorsven die Sache einfach auf sich beruhen lassen.
Er nickte sich bestätigend zu und ignorierte das ungute Gefühl, das in seiner Magengrube verblieb. Mit einer finalen Geste strich er über seinen Schreibtisch und wandte sich einem Stapel Papiere zu, in dem er Anfragen vermutete, die er auch beantworten konnte.
In diesem Moment flog die Tür des Schreibehauses auf und zwei Krigas stürmten herein, um mit einem lauten Aufstampfen direkt vor Ojorsvens Tisch zum Stillstand zu kommen.
»Büre Ojorsven!«, brüllte Berqar, als ob sie erwartete, dass er vor ihr salutieren würde. Ojorsven stand tatsächlich auf und sah mit fahrigen Blicken zwischen Berqar und ihrem Adjutanten hin und her. Er strich mit der Hand über seinen Seitenscheitel.
Berqar schrie weiter wie ein General vor der Endschlacht. »Behrlem ist in Gefahr! Ein furchtbares Monster zieht durch die Stadt, sengend und mordend! Ein Dämon! Behrlem muss sich verteidigen! Es geht um unser Leben!«
Ihre Augen waren schmal. »Ich weiß, dass das Schreibehaus niemand beschützen kann. Aber keine Angst! Die Klinge ist bereit. Wir helfen euch in eurer Not! Noch heute werden Krigas in ganz Behrlem Position beziehen. Die Stadt braucht Sicherheit!«
Berqar knallte ein Blatt Papier auf den Tisch. »Dies ist ein Notstand. Wir haben keine Zeit für Abstimmungen. Es braucht ein Ad-hoc-Mandat für sofortige Aktion. Hier unterschreiben.« Berqar hielt ihren Finger auf die entsprechende Stelle.
Ojorsven blickte auf das Dokument. Er begann zu lesen, doch die Zeilen tanzten vor seinen Augen. Sein Kopf summte.
»Vorwärts!«, bellte Berqar ihn an. »Wir haben nicht den ganzen Tag. Der Schutz der Stadt steht auf dem Spiel! Also beeil dich, es sei denn, du hast einen besseren Plan.«
Ojorsven hatte keinen Plan und wusste auch nicht, wo er einen hätte hernehmen sollen. Unter dem Eindruck von Berqars entschiedenem Zeigefinger tunkte er den Pinsel in die Tinte und ließ die Hand zögernd über dem Papier schweben. Dann unterschrieb er.
* * *
Schwer drückten die Kasernenmauern auf das Land. Das graue Gestein der Burg war alt wie die Berge, aber nicht mehr wild und frei, sondern behauen, dem Willen eines anderen unterworfen. Um selbst der Unterwerfung zu dienen. Streng blickten die Türme der Burg auf Lahoon herab, mit der Macht eines drückenden Albtraums.
Zu ihren Füßen marschierten Krigas über den Kasernenhof. Uniformierte Figuren mit gleichgeschalteten Schritten, die alle auf den nächsten Schrei warteten, der ihnen sagen würde, was sie tun sollten. Schrei, Marsch. Schrei, Halt. Wie Marionetten, bereit, jedem Zug an den Schnüren Folge zu leisten.
Lahoon schüttelte sich. »Diese Krigas. Was haben die nicht alles im Dienste der Feudalen getan! ›Bauernaufstand niederschlagen‹, ›unruhige Provinzen befrieden‹. Was immer nur hieß: Blut vergießen. Und diejenigen umbringen, die zu sagen wagten, dass vielleicht alle Menschen gleich an Rechten und Würde sind, und niemand zur Herrschaft über andere geboren.« In Lahoons Augen brannte ein wütendes Feuer.
Amalai verschränkte die Arme über der Brust und blickte starr in die Schatten der Burg. »Ja«, sagte sie zu Lahoon und zu der über ihr aufragenden Finsternis. »Stimmt. Und trotz alledem haben wir gewonnen. Der Wandel hat Wurzeln geschlagen. Er ist gewachsen, langsam, aber beständig. Unumkehrbar. Und zu Ehren der Krigas muss gesagt werden, dass zu guter Letzt doch die meisten von ihnen desertiert sind.«
Lahoon brummelte unwillig. »Zu guter Letzt. Zu guter Letzt. Da beschlossen die Krigas, nun doch keine Menschen mehr abzuschlachten, selbst wenn jemand das einen Befehl nannte.«
Amalai lächelte den drohenden Bollwerken triumphierend zu. »Ja. Sie sind einfach gegangen, haben der Gewalt den Rücken gekehrt. Sind Bäuerinnen und Händler geworden, Väter und Mütter, Söhne und Liebhaber. Ganz normale Leute, die andere Dinge zu tun haben, als jemanden zu töten.«
Die Burg blickte karg und kalt auf Amalai herab und schwieg. Aber Amalai war noch nicht fertig. Sie wandte sich Lahoon zu. »Und dass die Krigas desertiert sind, hat doch den Höhepunkt des Wandels erst ermöglicht. Schließlich war es in dem Moment, als große Teile der Armee sich auflösten, dass die Palastwache an der Seite der Volksdelegierten erschien und der Königin mitteilte, dass die Monarchie abgeschafft ist und alle Feudalen ins Exil gehen würden.«
»Wunderbar«, gab Lahoon zurück. »Jahrhundertelang haben die Krigas Menschen brutal unterdrückt, und irgendwann waren sie so nett, damit aufzuhören. Wie schön von ihnen.«
Amalai hielt seinem Blick stand. »Ja. Genau.« Sie lehnte sich an die Balustrade und ließ ihre Blicke hinaus wandern in die Landschaft vor ihnen. Es gab einen Himmel über der Kaserne, und er war genauso blau und endlos wie anderswo. Und da war der kleine silbrige Bach, der am Ende der Burggründe verlief und ihre Grenze markierte. Dahinter wogte das tiefe, saftige Grün der Wälder.
Amalai legte den Kopf schief, und der Wind ließ dunkle Locken über ihre Wange tanzen. »Eigentlich stimmt es nicht ganz. Man kann nicht sagen, dass ›die Krigas‹ über so lange Zeit brutal unterdrückt haben. Es waren nicht dieselben Krigas. Nur die Institution ist über Jahrhunderte die Gleiche geblieben. Aber die Menschen darin sind gekommen und gegangen.«
Sie richtete ihren Blick wieder auf den Kasernenhof, wo sich eine kleine Gruppe von Krigas aus der Formation löste und auf das Burgtor zuschritt. »Die meisten Leute, die heute in der Kaserne sind, sind zu jung, um noch unter den Feudalen gedient zu haben. Sie haben nie jemanden getötet.«
Lahoon folgte ihrem Blick und sah zu, wie die vereinzelten Krigas unter dem Fallgitter des Tores verschwanden. »Ja. Viele sind sogar nach dem Wandel geboren. Trotzdem. Oder, gerade deshalb: Warum sind sie eingetreten? Warum werden sie Teil so einer Institution? Denn die Institution war tatsächlich jahrhundertelang grausam und brutal. Sie kann zu Recht beschuldigt werden. Beschuldigt, und aufgelöst!« Lahoon schlug unwirsch mit der Hand auf das Geländer.
Dann erstarrte er, den Blick auf die Kaserne gerichtet.
Das Tor hatte sich geöffnet.
Die Krigas marschierten hinaus.
* * *
Als Amalai und Lahoon ins Schreibehaus stürmten, stellten sie fest, dass eine Freundin von ihnen bereits da war. Mit dem gleichen Ziel, und schon auf halbem Weg. Sie war mitten im Gespräch.
»Ihr könnt unmöglich die Krigas autorisieren, derart in der Stadt aufzumarschieren!«, schnaubte Unleha Ojorsven an. »Um einen erfundenen Dämon zu jagen! Also wirklich!« Der Geist der Rebellion stieg von Unleha auf wie Rauch von einem gereizten Drachen.
Ojorsven räusperte sich. »Die Leute waren sehr besorgt,« verteidigte er sich. »Aufgebracht. Das war ein richtiger Aufruhr in der Taverne letzte Nacht, das sag ich dir. Es musste etwas getan werden. Und zwar schnell.«
Unleha schüttelte verärgert den Kopf, dass ihre zahlreichen kurzen Zöpfe nur so flogen. »Keine Ahnung, was letzte Nacht in der Taverne war. Oder warum es einen Aufruhr gab. Aber ich kann dir sagen, dass die Stadt als solche nicht gerade vor Angst zittert. Oder an Geister und Dämonen glaubt. Ist doch lächerlich!«
Unleha zeigte mit dem Finger auf Ojorsven. »Ein Bursche ist in der Kaserne zu Tode gekommen! Als er zu einer lebensgefährlichen Aufgabe beordert wurde, zur ›Korrektur‹! Das ist eine Untersuchung wert! Selbst in ihrem Inneren muss die Kaserne sich an grundlegende Werte unserer Gesellschaft halten. Sie können Leute nicht solchen Gefahren aussetzen. Das ist, was das Schreibehaus tun sollte: eine Untersuchung veranlassen! Die Kontrolle über die Kaserne verbessern! Aber nicht: die Krigas in die Stadt holen. Das ist genau verkehrt herum!«
Unlehas dunkle Augen funkelten.
Ojorsven richtete sich auf, und sah mit seinen langen Kaftan und dem silbrigen Dhoti tatsächlich gediegen und würdevoll aus. »Es wird selbstverständlich eine Abstimmung geben«, verkündete Ojorsven förmlich. »Innerhalb eines Mondes, so wie die Bestimmungen es vorsehen. Wir haben die Ankündigung schon ausgehängt. Was ich unterschrieben habe, sind nur interimistische Maßnahmen. Für die Zeit bis zu Abstimmung.«
Er zwirbelte seinen beeindruckenden Schnurrbart. »Also kein Grund zur Aufregung. Es wird eine Abstimmung geben, und wenn die Stimmung in der Stadt so ist, wie du sagst, dann werden die Maßnahmen bald wieder Geschichte sein. Schon beim nächsten Neumond.«
*
»Das ist doch unglaublich!«
Sie gingen eine friedliche, stille Gasse hinunter, und milder Sonnenschein spielte golden auf Unlehas dunkler Haut. Aber nichts von alledem beruhigte sie im Mindesten. Mit einem dumpfen Wutschrei trat Unleha gegen einen Stein und schickte ihn in hohem Bogen ins Gebüsch.