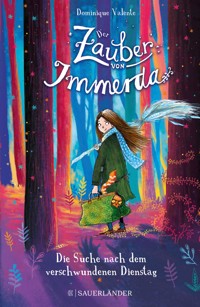
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Der Zauber von Immerda
- Sprache: Deutsch
In Anemonas Hexenfamilie hat jede eine besondere magische Fähigkeit. Sie selbst kann leider nur verschwundene Dinge wiederfinden. Eine ziemlich unmagische Fähigkeit, vor allem, wenn es sich um verlegte Gebisse handelt (Igitt!). Bis eines Tages Moreg Vaine, die mächtigste aller Hexen, Anemona um Hilfe bittet: Der letzte Dienstag ist verloren gegangen – und einzig Anemona kann ihn wiederfinden. Zusammen mit Oswald, dem miesgelaunten Monster von unter dem Bett, begibt Anemona sich auf die Suche nach dem verlorenen Tag und einem uralten Zauber, der ganz Immerda zu bedrohen vermag … Originell, bestechend humorvoll, voller Phantasie und überraschender Wendungen: Band 1 der phantastischen Serie um die Hexe Anemona und das magische Land Immerda. Mit Bildern von Sarah Warburton
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dominique Valente
Der Zauber von Immerda
Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag
Über dieses Buch
Magie stirbt nie!
In Anemonas Hexenfamilie hat jede eine besondere magische Fähigkeit. Nur Anemona nicht. Das Einzige, was sie kann, ist verschwundene Dinge wiederfinden, nichts besonderes also. Bis eines Tages Moreg Vaine, die mächtigsten Hexe aus ganz Immerda auftaucht, und Anemona um Hilfe bittet. Denn der letzte Dienstag ist verloren gegangen und dringend wiedergefunden werden. Zusammen mit Oswald, dem Monster von unter dem Bett begibt sich Anemona auf die Suche, bei der sie nicht nur einen orientierungslosen Drachen ohne Ei und eine edelmütige Trollin trifft, sondern auch herausfindet, was hinter der Legende von Immerda steckt …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Dominique Valente wurde in Südafrika geboren und lebt heute in Sussex, England. Bevor sie mit dem Schreiben von Büchern begann, hat sie als Journalistin für Magazine gearbeitet. Da sie aber – wie sie vermutet – an dem Phänomen leidet, mit zunehmendem Alter immer jünger zu werden, zieht sie es heute vor, tagsüber die meiste Zeit im Pyjama zu bleiben und von mürrischen Monstern, schrulligen Drachen und Magie zu träumen. »Der Zauber von Immerda. Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag« ist ihr Kinderbuchdebüt.
Sarah Warburton ist Illustratorin, Mutter und Besitzerin eines Border Terriers, und ihr Zuhause befindet sich in einem überwucherten Garten und einem hübschen Atelier mit vielen Keksen und großen Tassen heißem Tee. Sie lebt in Bristol, England.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Eigenlizenz
Erschienen bei FISCHER E-Books
STARFELL: WILLOW MOSS AND THE LOST DAY
Text © Dominique Valente 2019
Translation © S. FISCHER VERLAG GMBH translated under licence from HarperCollins
Publishers Ltd
Originally published in English by HarperCollins Children’s Books
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2020 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Sabine Reddig, Karben unter Verwendung einer Illustration von Sarah Warburton
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5212-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Karte
1 Das Mädchen, das verlorene Sachen fand
2 Eine Frage der Zeit
3 Das Monster von unter dem Bett
4 Das Speisekammerportal
5 Die Besenbauer
6 Die (Neuerdings) Verbotene Stadt
7 Amoria Spell
8 Die Villa Dazumal
9 Die Geschichte des Drachen
10 Der Dunkelseher
11 Die Verlorenen Zaubersprüche von Immerda
12 Der Mondgarten
13 Der Mitternachtsmarkt
14 Der Hexenstein
15 Warten und Vergessen
16 Krawalltraud
17 Eine Horde Trolle
18 Das Haus der Hexe
19 Magie in Wolkana
20 Wie man einen Kobold zum Explodieren bringt
21 Wieder gestern
Danksagung
Ankündigung Band 2
Für Catherine, die es als Erste toll fand, für Helen, die geholfen hat, meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen, und für Rui, der von Anfang an daran geglaubt hat.
1Das Mädchen, das verlorene Sachen fand
Die meisten Leute glauben, mit Zauberkräften auf die Welt zu kommen ist das Beste, was einem passieren kann. Vermutlich, weil sich unter Zauberkraft alle immer nur die spektakulären Fähigkeiten vorstellen, wie fliegen, sich unsichtbar machen oder nervige Verwandte in Schweine verwandeln. Als wäre zaubern zu können wie ein riesiges Partybüfet, an dem man sich nach Lust und Laune bedienen kann.
In Immerda jedoch bekommt nicht jeder, der das Glück hat, ein bisschen was an Zauberkraft abgestaubt zu haben, die allergrößten Leckerbissen – sagen wir, die karamellgefüllte Schokotorte – unter den magischen Fähigkeiten ab. Viele müssen sich mit den labbrigen Karottenschnitzen zufriedengeben, die sowieso keinen interessieren. Und zu diesen Leuten gehörte leider auch Anemona, das jüngste und am wenigsten mit Magie gesegnete Mitglied der Familie Moss.
Anemonas Begabung schien eher von einem Zauberschrottplatz zu stammen: Hin und wieder erwies sie sich als ganz nützlich, aber im Großen und Ganzen war sie nichts, worüber man in Ohs und Ahs und Begeisterungsstürme ausbrechen würde. Nicht das kleinste Oh, nicht das leiseste Ah, sondern allerhöchstens mal ein laues Lüftchen der Zufriedenheit.
Anemona hatte die Gabe, verlorene Sachen zu finden.
Wie Schlüssel. Oder Socken. Oder, wie kürzlich erst, Jeremiah Crotchets Holzgebiss.
Darauf hätte sie echt verzichten können. Das Gebiss war nämlich direkt aus der Schnauze von Knacki, Crotchets uralter Bulldogge, in Anemonas ausgestreckter Hand gelandet, komplett mit schleimigem Sabber verschmiert.
Nachdem die Crotchets Anemona wie üblich mit einem Spurgel bezahlt hatten, den sie für ihre Dienste berechnete, hatte sie beschlossen, dass dringend eine Preiserhöhung fällig war. Außerdem hatte sie sich vorgenommen, in Zukunft immer einen kleinen Kescher bei sich zu tragen – für die unappetitlicheren Dinge, die sie so fand.
Wie gesagt, ihre Gabe war nicht die eindrucksvollste, aber wenigstens brachte sie Essen auf den Tisch, meistens einen halben Laib Brot. Was immerhin besser war als nichts, wenn sie sich nicht gerade mit ihrer mittleren Schwester Camilla verglich. Camilla hatte vor kurzem einen Pflug samt davorgespanntem Esel von Farmer Jensen heruntergehoben. Allein mit der Kraft ihrer Gedanken.
Tja, man könnte sagen, Camillas Gabe war einen Hauch … prickelnder.
Als Anemona sechs Jahre alt war, kurz nachdem zum ersten Mal ihre Zauberkräfte in Erscheinung getreten waren, hatte ihr Vater ihr erklärt, die Welt sei voller unterschiedlicher Menschen: »Alle sind wichtig und werden gebraucht. Aber manche ziehen einfach ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf sich als andere. Zum Beispiel gibt es Menschen wie deine Mutter – die flößt allen einen Heidenrespekt ein, sobald sie auch nur den Raum betritt. (Was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass sie Tote sprechen hören kann.) Und dasselbe gilt für deine Schwestern. Tja, und dann gibt es eben Leute wie dich und mich.«
Das tat weh. Ein winziges bisschen.
Anemona war klein, mit langen, schnittlauchglatten braunen Haaren und dazu passenden braunen Augen. Sie kam eher nach ihrem Vater, ihre Schwestern dagegen hatten das umwerfende Aussehen ihrer Mutter geerbt: groß, schwarze Haare und grüne »Smaragdaugen«, wie immer alle schwärmten. Dabei war Anemona sich ziemlich sicher, dass keiner aus ihrer Familie je einen echten Smaragd zu Gesicht bekommen hatte.
Als Anemona sich bei Granny Flora darüber beklagte, dass sie ihrer wunderschönen Mutter und ihren Schwestern so wenig ähnlich sah, hatte ihre Großmutter nur geschnaubt. Eitelkeit hatte sie schon immer albern gefunden. Die konnte sie sich bei ihren grünen Haaren nämlich sowieso nicht leisten. Granny Flora war einmal die beste Zaubertrankbrauerin von ganz Immerda gewesen. Heute dagegen nannten die Leute sie Flora Flause, nachdem es beim Brauen im Gebirge des Nax zu einer Explosion mit äußerst interessanten Folgen gekommen war. Ihre Haarfarbe war nur eine davon.
»Also wirklich, Kind. Dann hast du eben keine Smaragdaugen, na und? Deine braunen sind genauso gut, besonders wenn’s darum geht, Sachen zu sehen, die andere nicht bemerken«, sagte sie mit verschlagenem Lächeln, bevor sie ein paar ihrer fragwürdigeren Zaubertränke unter einer losen Bodendiele auf dem Dachboden verstaute. Anemona war die Einzige, die von diesem Geheimversteck wusste.
Granny Flora hatte recht, Anemona sah tatsächlich oft Dinge, die andere Leute gar nicht wahrzunehmen schienen. In den vergangenen Jahren hatte sie sich regelrecht darauf spezialisiert. Und so stand sie auch heute wieder im Garten ihres Elternhauses und blickte auf die Schlange wartender Menschen, die sich entlang der niedrigen Steinmauer aufgestellt hatten. Alle diese Leute hatten irgendwas verlegt und erhofften sich nun Anemonas Hilfe bei der Suche danach.
»Ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll, ich habe überall gesucht …«, jammerte Prudenzia Foghorn auf der anderen Seite des offenstehenden Tors.
»Haben Sie mal auf Ihrem Kopf nachgesehen?«, fragte Anemona.
»Na so was!«, rief Prudenzia, die sich über den Kopf tastete, wo tatsächlich die vermisste, mit Strasssteinchen besetzte Brille glitzerte. »Ich Dummerchen«, fügte sie mit einem verlegenen Kichern hinzu, bevor sie sich zum Gehen wandte.
»Das macht dann einen Spurgel«, rief Oleandra, Anemonas älteste Schwester, die gerade aus dem Haus kam und das Gespräch mitangehört hatte.
»Wieso, sie hat doch gar nicht gezaubert«, protestierte Prudenzia und riss empört die Augen auf.
»Aber Ihre Brille hat sie trotzdem gefunden, oder etwa nicht? Sie haben genau das bekommen, weswegen Sie hergekommen sind. Ist doch nicht Anemonas Schuld, wenn Sie nicht richtig in den Spiegel gucken.« Oleandra ließ nicht locker und bedachte Prudenzia mit einem so strengen Blick, dass diese irgendwann klein beigab und Anemona den Spurgel in die Hand drückte.
»Ich hab gehört, Hexen dürfen für ihre Dienste gar kein Geld verlangen«, nörgelte die klapprige Ethel Mustard von weiter hinten in der Schlange. »Sie dürfen keinen Profit aus ihrer Veranlagung schlagen«, verkündete sie wichtigtuerisch, und ihre Äuglein, denen nichts in der Nachbarschaft entging, leuchteten.
Ethel Mustard, muss man wissen, gehörte zu jenen Leuten, die sich insgeheim wünschten, der König hätte Grinfog zum »Verbotenen Dorf« erklärt. Das hätte nämlich dazu geführt, dass Anemona und ihre Familie – also magisch begabte Leute im Allgemeinen – sich irgendwo anders hinscheren mussten.
»Wer hat Ihnen das denn erzählt?« Oleandra fuhr zu Ethel herum und starrte sie so finster an, dass die alte Frau regelrecht zusammenzuschrumpfen schien. »Wenn ein Tischler Ihnen was schreinert, bezahlen Sie ihn schließlich auch. Und meine Schwester hat eine Dienstleistung erbracht, warum sollte es bei ihr anders sein?«
»Tja, weil sie eben anders ist«, flüsterte Ethel, auf deren Wangen zwei rote Flecken erschienen waren.
Oleandras Augenbrauen zogen sich zusammen. »Tja«, grollte sie nun förmlich, »vielleicht sollten Sie ihr dann eher noch mehr zahlen.«
In der Schlange erhob sich aufgebrachtes Gebrummel.
Doch Oleandras Gabe – neben der, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen – bestand darin, Dinge in die Luft zu jagen, und so brummelte niemand allzu laut. Mit so jemandem wollte man es sich lieber nicht verscherzen.
Anemona seufzte. Sie hatte zwar beschlossen, ihren Preis auf einen Florint und einen Leighton-Apfel zu erhöhen, aber sie war sich nicht ganz sicher, ob die Strategie, den Leuten ihre furchteinflößende Schwester auf den Hals zu hetzen, die allerklügste war. Sie selbst mochte Leighton-Äpfel nicht mal besonders gern, aber Schnaufer, der ausrangierte Zuchthengst der Jensens, umso mehr. Anemona kam jeden Donnerstag auf dem Weg zum Markt an seiner Koppel vorbei. Die Kinder aus dem Dorf hatten ihm seinen Namen verpasst, weil er jedes Mal, wenn er angetrottet kam, schnaufte wie eine Dampflok mit Asthma. Zum Dank für die offensichtliche Mühe, die er auf sich nahm, um sie zu begrüßen, versorgte Anemona ihn gern mit seiner Lieblingsleckerei.
»Dein Problem ist«, sagte Oleandra, die es, wie Anemona nun auffiel, nicht für nötig zu halten schien, ihr den Spurgel auszuhändigen, »dass du deine Fähigkeiten nicht genug wertschätzt, so bescheiden sie auch sein mögen.«
»Fähigkeiten? Das nennst du Fähigkeiten?«, spöttelte Camilla, die gerade in einem bodenlangen, schwarz schimmernden Umhang aus dem Haus kam. »Na ja, ein einigermaßen brauchbarer Spürhund ist sie, aber mehr auch nicht.« Sie grinste hämisch. Dann drehte sie sich, ohne auf Anemonas Protest zu achten, zu Oleandra um und fragte: »Fertig?« Die beiden waren auf dem Weg zu ihrer Mutter, die sich gerade auf Wahrsagereise befand.
Anemona schloss die Augen und atmete tief durch. Als sie sie wieder aufmachte, sah sie, dass ihre zwei Schwestern, mit ihren wehenden schwarzen Haaren und Mänteln, schon halb die Straße hinunter waren.
Schicksalsergeben drehte sie sich wieder zu ihren wartenden Kunden um und zuckte zusammen.
Wo kurz zuvor noch die Warteschlange gewesen war, stand nur noch eine einzige Frau. Sie war groß und dürr wie eine Bohnenstange, das blasse, schmale Gesicht gerahmt von schwarzem Haar. Ihr dunkles Gewand reichte bis zum Boden, und sie trug spitze, violette Stiefel. Beim Anblick ihrer Miene straffte sich Anemonas Rücken, bevor ihr Gehirn dazwischenfunken konnte.
Die Frau hob eine zackig nach oben weisende Augenbraue und sagte: »Guten Morgen?«
»G-Guten Morgen …?«, stammelte Anemona, die sich fragte, wer die Frau sein mochte.
Ein Teil von Anemonas Verstand hielt die Luft an. Es war der Teil, der von ihren Knien gesteuert zu werden schien, denn die hatten furchtbar zu zittern angefangen, als wüssten sie mehr als der Rest von Anemona.
»Moreg Vaine«, sagte die Frau schlicht, als wäre es etwas vollkommen Alltägliches, sich als die am meisten gefürchtete Hexe von ganz Immerda zu erkennen zu geben. Wobei es das für Moreg Vaine wohl tatsächlich war.
»Ach herrje«, entfuhr es Anemona. Ihre schlotternden Knie hatten sich also nicht geirrt.
Moreg Vaines Lippen kräuselten sich.
Anemona sollte sich noch Jahre später darüber wundern, dass in diesem Moment nicht ihre Beine unter ihr nachgegeben hatten, so sicher war sie, dass das leiseste Flüstern sie hätte umpusten können.
Aber niemals, nicht mal in ihren wildesten Träumen über eine Begegnung mit der berüchtigten Hexe, hätte sie sich ausmalen können, was als Nächstes geschah.
»Tässchen Tee?«, schlug Moreg vor.
2Eine Frage der Zeit
Anemona folgte Moreg Vaine ins Haus und sah verblüfft zu, wie die Hexe die Glut in dem rußgeschwärzten Kamin schürte und den alten, verbeulten Teekessel füllte. Dann klopfte Moreg sich die Manteltaschen ab, zog ein kleines Säckchen daraus hervor und nickte versonnen, während sie etwas daraus in den Kessel schüttete.
»Hethal sollte genau das Richtige sein«, murmelte sie und rieb sich nachdenklich das Kinn. Dann schien sie sich wieder ihrer Umgebung bewusstzuwerden. »Setz dich doch«, sagte sie und bot Anemona einen Stuhl in deren eigenem Zuhause an.
Anemona gehorchte zögerlich. Irgendwo tief in ihrem Inneren klammerte sie sich an die vage Hoffnung, dass das alles bloß ein Traum war – oder vielleicht hatte die Hexe sich ja auch in der Haustür geirrt? Dann jedoch fielen ihr ihre guten Manieren wieder ein, und sie sagte: »Äh, Miss Vaine … Ich – ich kann das auch machen, wenn Sie möchten …?«
Moreg winkte ab. »Nicht nötig, ich weiß noch, wo alles ist.«
Anemonas Mund klappte auf. »Woher das denn?«, fragte sie erstaunt.
Moreg nahm zwei Tassen von der vollgestellten hölzernen Anrichte und zuckte mit den Schultern. »Regena und ich kennen uns schon ewig, auch wenn wir uns seit Jahren nicht gesehen haben.«
»Sie kennen meine Mutter?«
Moreg stellte einen angestoßenen blauen Becher mit weißen Blümchen vor Anemona auf den Tisch und setzte sich ihr mit einer eigenen zierlichen Teetasse gegenüber.
»Wir kannten uns, als wir noch junge Mädchen waren. Hat sie das nie erwähnt?«
Anemona verneinte ein wenig zu energisch.
Natürlich wusste Anemona, dass ihre Mutter – und vermutlich sogar Moreg Vaine – irgendwann mal ein junges Mädchen gewesen sein musste, aber so ganz wollte ihr diese Tatsache trotzdem nicht in den Kopf. Es war ein bisschen, wie wenn sie dahinterzukommen versuchte, warum jemand seine Zeit mit Briefmarkensammeln verbringen sollte. Dazu fiel ihr nichts ein, als höflich die Augenbrauen zu heben.
»Ist alles schon sehr lange her«, plauderte Moreg weiter. »Da warst du noch gar nicht auf der Welt. Damals haben wir wie viele Leute unserer Art – also magischerArt – mit unseren Familien in Brackwasser gewohnt. Deine Mutter war gut mit meiner Schwester Molsa befreundet. Als Kinder waren die beiden unzertrennlich, haben Bärenfallen aufgestellt, um den örtlichen Einsiedler zu fangen, Teepartys für die Toten veranstaltet, nackt im Mondlicht getanzt … Aber dann hat sich alles verändert, wie es das nun mal immer tut, und viele von uns sind weggezogen. Es war sicherer so, und Molsa ist schon lange fort.« Moreg räusperte sich. »Aber das tut jetzt nichts zur Sache, trink deinen Tee.«
»Hm«, war alles, was Anemona herausbrachte, während sie verzweifelt versuchte, sich NICHT ihre nackt im Mondlicht tanzende Mutter vorzustellen.
Sie sah die Hexe an und dann schnell wieder weg. Moregs Blick war rasiermesserscharf. Anemonas Kehle wurde ganz trocken, als ihr eins der unheimlichsten Gerüchte – wobei, als ununheimlich konnte man wohl keins davon bezeichnen – einfiel, die sie über Moreg gehört hatte. Es hieß, Moreg Vaine könne jemanden durch einen einzigen Blick zu Stein erstarren lassen. Anemona guckte in ihre Teetasse und dachte: Was will sie hier? Doch wohl nicht bloß mit mir Tee trinken. Sie probierte einen Schluck. Der Tee war köstlich. Süß und stark, so wie sie ihn am liebsten mochte. Und Moreg hatte sogar genau die richtige Tasse erwischt (es gab nicht viel in diesem Haus, was tatsächlich Anemona gehörte), dabei hatte sie mitten in dem Sammelsurium aus Geschirr auf der Anrichte gestanden.
Gut, vermutlich wussten erfahrene Hexen einfach, wem welche Tasse gehörte. Irgendwann werde ich sie fragen müssen, warum sie hier ist, dachte Anemona mit einem Schauder. Wieder nippte sie an ihrem Tee, um das Unvermeidliche noch ein wenig hinauszuzögern.
Vielleicht, grübelte sie weiter, ist Moreg ja gekommen, um Mum zu besuchen. Das war wohl die logischste Erklärung.
Keine zwei Schlucke Tee später riss Moreg Anemona aus ihren hoffnungsvollen Überlegungen, indem sie sie mit ihren tintenschwarzen unergründlichen Augen musterte und etwas sehr Beunruhigendes sagte: »Ich brauche deine Hilfe.«
Anemona blinzelte. »M-meine Hilfe?«
Moreg nickte. »Es geht um den Dienstag. Tja, ich weiß nicht recht, wie und warum, aber … ich bin mir einigermaßen sicher, dass er verschwunden ist.«
»Verschwunden?«
»Ja.«
Bestürztes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus.
Anemona starrte Moreg an.
Die Hexe starrte zurück.
Es gab nur eine Erklärung für das alles. Die Hexe musste verrückt geworden sein. Granny Flora sagte immer, so was könne jedem passieren. Und die musste es wohl wissen, schließlich war sie selber verrückt.
Es gab Gerüchte darüber, dass Moreg Vaine ganz allein in den Zwischennebeln lebte, dem Durchgang zum Reich der Untoten. Kein Wunder, wenn man da einen kleinen Sprung in der Schüssel bekam. Verrückt und mächtig zugleich schien Anemona eine eher bedenkliche Kombination zu sein, und so schenkte sie der Hexe ein nervöses Lächeln in der Hoffnung, dass sie sich bloß verhört hatte. »Verschwunden? Der – der Tag?«
Moreg nickte, dann stand sie auf, nahm den Grinfog-Kalender von seinem Haken an der Wand neben der Haustür und reichte ihn Anemona.
Anemona warf einen Blick darauf.
Sie war nicht sicher, was sie sehen sollte, und rechnete fast damit, dass auf Montag direkt Mittwoch folgen würde. Ein bisschen enttäuscht stellte sie fest, dass das nicht der Fall war. Der Dienstag war noch da. Komplett mit einer Werbeanzeige für Leighton-Apfelwein, der jedes Leiden heilt.
»Aber er ist doch noch …«
Moreg nickte ungeduldig. »Jaja, er ist noch da, aber guck mal genauer hin.«
Anemona guckte genauer hin. In jedes Tageskästchen auf dem Kalender waren Termine für Volksfeste und Dorfversammlungen, Erntepläne, Mondphasen und andere wichtige Sachen gedruckt. Jeder Tag hatte mindestens einen Eintrag – außer der Dienstag.
Sie runzelte die Stirn. »Aber das könnte doch alle möglichen –«
»– Gründe haben, ich weiß. Das habe ich auch zuerst gedacht. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da mehr dahintersteckt. Und zwar nichts Gutes.« Moreg hielt kurz inne. »Kannst du dich erinnern, was du am Dienstag gemacht hast?«
Anemona überlegte. Sie schloss die Augen, und für den Bruchteil einer Sekunde erschien in ihrem Kopf das Bild eines mottenzerfressenen lila Huts mit einer langen, keck zur Seite abstehenden grünen Feder daran, dann Granny Floras abgewandtes Gesicht, und einen Moment lang krampfte sich ihr Magen vor Angst zusammen. Doch das Bild verschwand genauso schnell, wie es gekommen war, und mit ihm das mulmige Gefühl.
Es war, wie sich an einen Traum zu erinnern, der einem kurz nach dem Aufwachen noch so ganz und gar echt vorkommt, aber dann mit jeder Sekunde stärker verblasst, so dass am Ende kaum noch etwas übrig bleibt. Am Montag hatte sie Farmer Lonnis geholfen, seinen Pachtvertrag zu finden. Ohne den hätte er seine Erlaubnis zum Orangenanbauen verloren, aber zum Glück hatte er Anemona um Hilfe gebeten, und sein Hof war gerettet. Als Dank dafür hatte er ihr einen ganzen Sack Orangen geschenkt. Anschließend war sie nach Hause gegangen und hatte zusammen mit Granny Flora die Grummelnden Gertruden umgetopft. Deren süße rote Früchte benutzte ihre Großmutter, um den unangenehmen Geschmack mancher ihrer Tränke zu übertünchen (was nicht besonders gut funktionierte, so wie die meisten von Grannys Tränken seit ihrem Unfall nicht mehr besonders gut funktionierten). Am Mittwoch war sie zum Markt gegangen und hatte ein paar Frauen in Herm bei der Suche von verlorenen Haushaltsutensilien geholfen. Am Donnerstag war ihre Mutter zu ihrer Wahrsagereise aufgebrochen, und dann war auch schon heute gewesen …
»Nicht so richtig. Irgendwie will mir nicht einfallen, was an dem Tag war.«
Moreg nickte und stieß einen Seufzer aus. »Das hatte ich befürchtet. Genauso war es bisher bei jedem, den ich gefragt habe. Alle scheinen sich an das meiste zu erinnern, was sie diese Woche gemacht haben, nur der Dienstag ist wie ausgelöscht.«
Anemona biss sich auf die Lippe. »Aber ist das nicht ganz …«
»Normal?«, beendete Moreg ihre Frage und winkte ab. »Natürlich. Die meisten Menschen können sich ja nicht mal erinnern, was es am Tag zuvor zum Abendessen gab. Aber normalerweise gelingt es ihnen, zumindest irgendwas auszugraben, wenn sie sich ein bisschen konzentrieren. Nur an den Dienstag hat niemand die geringste Erinnerung. Nicht mal ich selbst.«
Anemona zog die Augenbrauen zusammen. Das war wirklich seltsam. »Wie viele Leute haben Sie denn gefragt?«
Moreg hielt kurz inne. »Alle Einwohner von Hoyp.«
Anemona staunte. Ein ganzes Dorf! Okay, Hoyp war klein, im Grunde nicht viel mehr als eine langgezogene Straße mit Häusern rechts und links, aber trotzdem. Dort wohnten mindestens fünfzehn Familien.
Ihr kam ein weiterer Gedanke. Zuerst zögerte sie, aber dann sprach sie ihn doch aus. »Warum haben Sie gesagt, nicht mal Sie selbst?«
Ein Lächeln huschte über Moregs Gesicht. »Du bist aufgeweckt – das ist gut. Ich meinte damit, dass es umso seltsamer ist, weil mir so was noch nie passiert ist.«
Anemona schnappte nach Luft. »Sie haben noch nie irgendwas vergessen, was Sie mal gemacht haben?«
»Ganz recht.«
Anemonas Augen wurden kugelrund. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte – allein die Vorstellung erfüllte sie mit Ehrfurcht und Entsetzen gleichermaßen.
Moreg wechselte das Thema. »Ich habe gehört, du bist eine Finderin.«
Anemona blinzelte. So hatte sie noch nie jemand bezeichnet. Sie schüttelte sich innerlich, als sie an ihre Schwester Camilla dachte, die sie den Großteil ihrer Kindheit lang Bello den Spürhund genannt hatte. Zum Glück hatte sie irgendwann damit aufgehört. Mehr oder weniger.
»Ja. Oder nein. Nicht direkt. Ich meine … ich finde manchmal Sachen … verschwundene Sachen.«
Moreg sagte nichts.
Anemona füllte hastig das Schweigen. »Also … wenn Sie mal Ihren Schlüssel verlieren, dann könnte ich Ihnen wahrscheinlich helfen, aber ich glaube nicht, dass das mit einem ganzen Tag funktioniert … selbst wenn der verlorengegangen sein sollte.«
Moreg hob eine Augenbraue. »Aber probieren könntest du es doch mal?«
Anemona dachte kurz nach. Das stimmte. Probieren konnte sie es. Sie nahm einen tiefen Atemzug, schloss die Augen, hob den Arm Richtung Himmel und konzentrierte sich auf den Dienstag, doch –
»HÖR SOFORT AUF DAMIT!«, donnerte Moreg, die so abrupt aufgesprungen war, dass ihr Stuhl umkippte und mit lautem Klappern auf dem Steinboden landete. Sie starrte auf Anemonas Arm, als hätte dieser sich in eine Giftschlange verwandelt, und Anemona ließ ihn sinken. Moreg presste sich die Hände auf die Brust und schnappte ein paarmal abgehackt und zittrig nach Luft.
Anemona bemühte sich, auf gar keinen Fall vorwurfsvoll zu klingen, als sie mit bebender Stimme fragte: »Was haben Sie denn? Ich dachte, ich soll es probieren …«
Moreg rieb sich den Hals, und einen Moment später klang ihre Stimme beinahe wieder normal, bis auf ein ganz leichtes Quietschen, wenn man genau hinhörte.
»R-richtig, richtig«, sagte sie. »Ja. Du sollst es probieren, aber doch nicht jetzt sofort. Um Wols willen, nicht, bevor wir uns einen Plan zurechtgelegt haben. Wir können nicht einfach so mir nichts, dir nichts loslegen. Nicht auszudenken, was das für Folgen haben könnte.« Sie erschauderte heftig unter ihren eigenen Worten. »Herrje!«
Als Anemona sie fragend ansah, erklärte sie, ihre schwarzen Murmelaugen weit aufgerissen: »Wenn es dir gelungen wäre, den fehlenden Dienstag zu finden und zurück in unsere Wirklichkeit zu holen, hätte es möglicherweise eine Katastrophe gegeben – so etwas kann glatt die Struktur des Universums zerreißen und zum Weltuntergang führen.«
»Äh, Verzeihung, wie war das?«, fragte Anemona.
»Ich glaube, dann wäre die Welt untergangen.«
Mit presslufthämmerndem Herzen lehnte Anemona sich zurück. Die Eröffnung, dass sie gerade beinahe den Weltuntergang eingeleitet hätte, war, gelinde gesagt, ein wenig beunruhigend.
Moreg dagegen schien sich wieder einigermaßen gefasst zu haben.
»Also, es ist so: Solange wir nicht rausgefunden haben, was eigentlich passiert ist, machen wir wahrscheinlich alles nur schlimmer. Noch schlimmer, als es schon ist, und das ist bereits so schlimm, wie man es sich überhaupt vorstellen kann.«
Anemona blickte sie verwirrt an. »Warum das denn? Ich meine, klar ist es nicht … äh, supertoll, dass der Dienstag verlorengegangen ist, aber davon geht doch nicht gleich die Welt unter, oder? Es ist doch nur ein einziger Tag …«
Und noch dazu ein Tag, den keiner zu vermissen scheint, dachte Anemona. Wozu der ganze Wirbel?
Moreg blinzelte. »Wenn wir den Tag nicht finden, geht die Welt unter, glaub mir. Das, was mit dem letzten Dienstag passiert ist, könnte den Stoff, aus dem Immerda gemacht ist, beschädigen und ihn Faden für Faden aufribbeln.«
Anemona stieß ein Keuchen aus. Ihr war nicht klar gewesen, dass die Situation so ernst war.
Moreg nickte. »Und darum müssen wir ganz am Anfang beginnen. Wir können keine Maßnahmen ergreifen, bevor wir nicht genau wissen, was geschehen ist. Und vor allem, warum.«
Die Stirn nachdenklich in Falten gelegt, drehte sie sich zum Fenster, als befände sich die Lösung dort draußen. »Es gibt jemanden, den wir um Rat fragen sollten, jemanden, der uns helfen kann … Was allerdings ein bisschen kompliziert werden dürfte, weil wir ihn dafür erst mal finden müssen.«
»Wieso kompliziert?«, entgegnete Anemona.
Moreg drehte sich zu ihr um, den Hauch eines Lächelns auf den Lippen. »Tja, weißt du, er ist ein Oublier, und zwar einer der besten in ganz Immerda. Er stammt aus einer uralten Familie von Oubliers. Das Problem ist nur, dass diese Leute beinahe unmöglich zu finden sind, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss.«
Anemona blickte sie verständnislos an. »Ein Ubli – was?«
»Oublier. Das ist Altschellisch.« Letzteres war ein Ausdruck, von dem Anemona immer angenommen hatte, er würde ein Wort bezeichnen, das mehr Buchstaben hatte, als sinnvoll erschien. Heute war Neuschellisch die am weitesten verbreitete Sprache in Immerda. Na gut, vielleicht abgesehen von Hochzwergisch, aber das war hauptsächlich deswegen beliebt, weil man darin so wunderbar herzhaft fluchen konnte. »Man spricht es Uu-blie-ee aus, das ist das Geschlecht der Dunkelseher, weißt du? Leute, die in die Vergangenheit blicken können.«
»Also das Gegenteil von Hellsehern?«
Moreg kratzte sich am Kopf. »So in etwa –«
»Meine Mutter ist eine!«, unterbrach Anemona sie, deren Mutter tatsächlich eine namhafte Hellseherin war, die durch das ganze Königreich Schellagh reiste, um den Menschen ihre Zukunft vorauszusagen.
Irgendetwas musste Moreg im Hals stecken geblieben sein, denn ihre Stimme klang plötzlich ein wenig erstickt, als sie antwortete: »Äh ja, genau, wie deine Mutter. Die meisten Leute, die sich als Hellseher bezeichnen und behaupten, sie könnten in die Zukunft blicken, haben allerdings keinen Schimmer von dem Handwerk. Viele rühmen sich sogar damit, Verbindungen zur ›anderen Seite‹ zu haben, also zu den Toten, die ihnen angeblich verraten, wann was passieren wird.« Sie schnaubte missbilligend. »Wahre Hellseher sind äußerst selten. Solche Leute erkennen Muster in vermeintlich unbedeutenden Ereignissen und lesen daraus den Lauf der Zukunft. Wenn sie zum Beispiel eine Blume entdecken, die im Winter blüht, obwohl sie das normalerweise erst im Frühling tut, können sie daraus schlussfolgern, dass es im Sommer einen Taifun geben wird.«
Anemona starrte sie ausdruckslos an.
Moreg fuhr fort: »Es sei denn, es gelingt ihnen, den nächstbesten Feldsperling dazu zu überreden, sein Nest zu bauen, bevor es an der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche Mitternacht schlägt, oder so was. Verstehst du?«
Anemona rang sich eine Art Nicken ab, hauptsächlich, weil sie das Gefühl hatte, als würde Moreg eins erwarten. In Wirklichkeit verstand sie nämlich gar nichts.
Doch Moreg, die offenbar nichts merkte, redete einfach weiter. »Die Dunkelseher dagegen können die Erinnerungen der Menschen in ihrer Nähe lesen. Die erscheinen ihnen in Form von Visionen. Im Gegensatz zu Hellsehern sind sie allerdings ziemlich unbeliebt und haben auch nicht viele Freunde, wie du dir vorstellen kannst …«
Anemona schüttelte den Kopf. »Wieso denn das?«
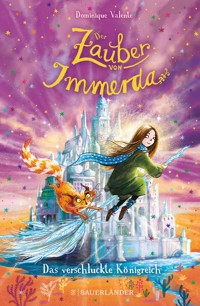
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











