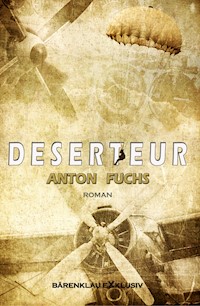
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer noch keinen Krieg erlebt hat, kann nur erahnen wie groß das Leid ist, das er mit sich führt.
Nach einer Kriegsverletzung genesen, mit neuem Marschbefehl ins Ungewisse versehen, begibt sich ein junger Wiener Soldat über verschiedene Etappen, auf eine unumgängliche Reise zurück an die Front.
Zusammengepfercht wie Vieh, wird er zusammen mit anderen Soldaten, ob alt, ob jung, mit dem Zug quer durchs Land, an die Front verfrachtet. Ihn plagen Zweifel über den Sinn dieses Krieges, der sinnlosen Zerstörung und des sinnlosen Tötens. Leittragende oft, auch wenn meist nicht gewollt, sind die Schwächsten – die Kinder.
Die noch immer anhaltende Kriegseuphorie vieler Soldaten und Zivilisten kann und will er nicht verstehen. Schon auf seiner Fahrt zurück an die Front macht er sich, wenn auch unbewusst, Gedanken über eine mögliche Flucht, über Fluchtwege und wie diese zu bewältigen sind. Er versucht seine Ankunft am Ziel seines Marschbefehles, wenn auch nur für Stunden oder Tage hinauszuzögern, ist immer seltener bereit sich für eine Sache vereinnahmen oder gar töten zu lassen, von der er immer weniger überzeugt ist.
Eines Tages macht er, gerade in Holland stationiert, den ersten, entscheidenden Schritt und nutzt seine womöglich einzige Chance zur Flucht. Damit beginnt seine Odyssee und die damit verbundene ständige Furcht vor Entdeckung. Er schlägt sich bis nach Wien, seiner Heimat, zu seinen Eltern durch. Dort kann er jedoch nicht bleiben und zieht, mit falschen Papieren versehen weiter nach Mannheim und von Freunden immer wieder versteckt quer durchs Land. Doch gerade gegen Ende des Krieges wird vermehrt Jagd nach Deserteuren und Spionen gemacht. Wird er es schaffen, seinen Jägern zu entkommen? Oder schnappen sie ihn doch noch so kurz vor dem Ende …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anton Fuchs
Deserteur
Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Streve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Mit einem Nachwort »Wenn Freiheit nicht nur Illusion ist« von Ines Schweighöfer
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Deserteur
1.
5. September 1944
2.
Dienstag, 26. September 1944
3.
2. Oktober 1944
23. Oktober 1944
4.
Laak, Roggel, 28. Oktober 1944
4. November 1944
5.
17. November 1944
8. Dezember 1944
15. Dezember 1944
6.
19. Januar 1945
24. Januar, 4 Uhr nachts
7.
2. Februar 1945 – Mein Geburtstag
27. Februar, abends
8.
19. März 1945
26. März 1945
27. März 1945
29. März 1945
Nachwort
Das Buch
Wer noch keinen Krieg erlebt hat, kann nur erahnen wie groß das Leid ist, das er mit sich führt.
Nach einer Kriegsverletzung genesen, mit neuem Marschbefehl ins Ungewisse versehen, begibt sich ein junger Wiener Soldat über verschiedene Etappen, auf eine unumgängliche Reise zurück an die Front.
Zusammengepfercht wie Vieh, wird er zusammen mit anderen Soldaten, ob alt, ob jung, mit dem Zug quer durchs Land, an die Front verfrachtet. Ihn plagen Zweifel über den Sinn dieses Krieges, der sinnlosen Zerstörung und des sinnlosen Tötens. Leittragende oft, auch wenn meist nicht gewollt, sind die Schwächsten – die Kinder.
Die noch immer anhaltende Kriegseuphorie vieler Soldaten und Zivilisten kann und will er nicht verstehen. Schon auf seiner Fahrt zurück an die Front macht er sich, wenn auch unbewusst, Gedanken über eine mögliche Flucht, über Fluchtwege und wie diese zu bewältigen sind. Er versucht seine Ankunft am Ziel seines Marschbefehles, wenn auch nur für Stunden oder Tage hinauszuzögern, ist immer seltener bereit sich für eine Sache vereinnahmen oder gar töten zu lassen, von der er immer weniger überzeugt ist.
Eines Tages macht er, gerade in Holland stationiert, den ersten, entscheidenden Schritt und nutzt seine womöglich einzige Chance zur Flucht. Damit beginnt seine Odyssee und die damit verbundene ständige Furcht vor Entdeckung. Er schlägt sich bis nach Wien, seiner Heimat, zu seinen Eltern durch. Dort kann er jedoch nicht bleiben und zieht, mit falschen Papieren versehen weiter nach Mannheim und von Freunden immer wieder versteckt quer durchs Land. Doch gerade gegen Ende des Krieges wird vermehrt Jagd nach Deserteuren und Spionen gemacht. Wird er es schaffen, seinen Jägern zu entkommen? Oder schnappen sie ihn doch noch so kurz vor dem Ende …
***
Deserteur
Außer diesen, in vorliegender Meldung angeführten, von mir als Diensthabendem am 30. März 1945 eigenhändig in das Dienstbuch eingetragenen Gegenständen, hatte der Obergefreite Erich Kauff in seiner Aktentasche noch zwei Gasplanenbeutel gehabt. Sie waren damals, wie ich erst Tage später zu meinem Schrecken feststellte, bei der Abgabe seines Gepäcks versehentlich auf unserer Station liegengeblieben.
In dem einen dieser beiden grünen Leinensäckchen fand ich zerlesene Bücher und Zeitungsausschnitte mit angestrichenen Sätzen, eine Straßenkarte von Deutschland im Taschenformat und einen sorgfältig handgezeichneten Plan vom deutsch-holländischen Grenzgebiet; etliche Bleistifte, einen Kerzenstummel, einen kleinen Kunstführer durch das Stift Rot an der Rot, einen abgegriffenen Brief seiner Mutter (geschrieben im Winter 1941), und schließlich eine Familienfotografie, aus der er mich – mit seinen Geschwistern hinter seinen aufrecht sitzenden Eltern stehend – starr anblickte.
Die zweite Tasche enthielt Aufzeichnungen.
In flüchtiger, kaum lesbarer Schrift, manchmal auch nur schlampig gekürzt, waren sie in vier kleine Hefte, auf viele einzelne, nummerierte Zettel und Briefumschläge, ja sogar auf Ränder von Zeitungsausschnitten, Buchseiten und auf Rückseiten von Fotografien niedergeschrieben. Hie und da war eine Stelle sorgfältiger ausgearbeitet, die meisten aber waren ohne Datum und anscheinend in großer Hast hingeworfen.
Aus der Befürchtung, wegen einer verspäteten Abgabe dieser beiden Gasplanenbeutel, belangt oder gar in ein Disziplinarverfahren verwickelt zu werden, nahm ich sie damals mit nach Hause und verschloss sie ungelesen in einem Fach meines Kleiderschranks.
Etliche Monate nach Beendigung des Krieges zeigte ich sie einem Bekannten, Herrn Dr. phil. Jakob Grabher, der mir schon nach flüchtiger Durchsicht den Rat gab, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Einen Rat, den ich freilich erst nach meiner Pensionierung – vor zweieinhalb Jahren also – und da erst nach längerem Schwanken zu befolgen geneigt war.
Für die mühsame, wie ich mich wiederholt überzeugen konnte, gewissenhafte Entzifferung dieser Aufzeichnungen, sowie deren sinngetreue Anordnung, Kapiteleinteilung und Zusammenfassung zu einem verlagsreifen Manuskript, bin ich obengenanntem Herrn Dr. Grabher zu besonderem Dank verpflichtet.
Einige mit Tinte geschriebene Stellen waren allerdings bei dem Versuch Kauffs, den Rhein zu überschwimmen, nass geworden und so sehr verwischt, dass man sie nicht mehr entziffern konnte. Einige andere, die uns zu krass oder zu abseits liegend erschienen, haben wir nach gemeinsamer Übereinkunft weggelassen.
Tengler, Albert
Grenzschutzbeamter i.R.
Das alte Gesicht eines Vaters,
der immer auf- und abgeht und vor sich hinmurmelt:
Ich kann’s nicht glauben!
Ich kann es einfach nicht glauben!
Doch zwischen Schneesturm
und glühendem Steppenwind
wachsen die Soldatenfriedhöfe in die Unendlichkeit.
In Afrika sahst du einmal
die Schulterklappe eines Generals im Sande liegend.
Und zur gleichen Zeit
verbrannten mit dem abgeschossenen Postflugzeug
zehntausend Worte der Sehnsucht
im riesigen Wald westlich von Kalinin.
Staub und Stahl- und Dreckfontänen
auf der rauchenden Rollbahn
von Ichweißnichtmehrwo nach dem Herzen der Erde.
Einen endlosen Panzergraben
habt ihr quer durchs Land geschnitten.
Quer durch Land und Schulterklappe
und Feldpostbrief und dein altes Gesicht.
1.
Der Abschied von zu Hause fiel dann doch noch übereilt aus, obwohl wir uns schon früh am Abend zusammengesetzt hatten. Wir hatten Wein getrunken und in jener bang vorgetäuschten Zuversicht über die kommende Zeit gesprochen: An welche Front es wohl diesmal gehen, wie lange dieser Krieg noch dauern und ob der Rest unserer Familie sein Ende gut überstehen werde?
Aber dann war’s plötzlich höchste Zeit. Im Vorzimmer rollte ich noch rasch meinen Mantel und nahm das Gepäck auf, wobei mir mein Vater mit unbeholfenem Eifer in den einen Tragriemen helfen wollte. »Danke, es geht schon allein«, sagte ich. »Und … auf Wiedersehen also!«
»Auf Wiedersehen!« Schulternschwer, mit frisch benagelten Stiefeln tastete ich mich neben meiner Mutter das dunkle, steinerne Stiegenhaus hinunter.
Ein kühler Wind blies durch die leere, mondhelle Alserstraße. Weit und breit keine Straßenbahn. Zwei Scheinwerfer suchten den hellen Himmel ab, rückten einander näher, überkreuzten einander, gingen wieder auseinander. Der eine erlosch, während der andere unbeweglich in den Himmel zeigte.
Da bog ein offener Polizeistreifenwagen in unsere Straße, fuhr langsam, dicht an uns vorbei. Ich leistete meine Ehrenbezeigung und erschrak unwillkürlich, als ich die dunklen Augenhöhlen im ernsten, mondfahlen Gesicht des Beifahrers eine Weile auf mich gerichtet sah.
Doch da kam auch schon eine Straßenbahn. Und auf der Plattform stehend ging es durch die verdunkelte Stadt. Vertraute Straßen mit ihren geschlossenen Geschäften. Vereinzelte Ruinen. Litfaßsäulen. Hell schimmerte der Donaukanal im Mondlicht.
Als wir am Praterstern ausstiegen, kam mir der Abschied erst zu Bewusstsein. Bisher hatte ich noch im Stillen gehofft, dass sich irgendwas ereignen würde. Man hätte ja noch ausgleiten und sich einen Arm oder ein Bein brechen können. Aber es war nichts geschehen. Wie eine riesige Kulisse lag der Nordbahnhof mit seinen Türmen und Zinnen vor uns, öde, wie alle Bahnhöfe, in denen Urlaube zu Ende gehen.
Im lärmenden Durcheinander der Vorhalle erwartete mich Kettner, mit seiner jungen, hochschwangeren Frau. Wieso ich denn so spät käme, warf er mir vor. Er sei schon über eine Stunde hier und habe bereits einen Platz besetzt. Wir hatten uns vor einem halben Jahr bei der Genesendenkompanie kennengelernt und waren nun gemeinsam in Marsch gesetzt worden.
Wenn ich schon früher seine anhänglich geschwätzige Gesellschaft gemieden hatte, flößte mir nun die Aussicht, vielleicht für längere Zeit, mit ihm beisammen sein zu müssen, einen schwermütigen Widerwillen ein. Um wie viel lieber wäre ich allein gefahren! Ein Mensch, der mit einem reist, wird unterwegs gern zu einer Fessel, wenn es auch natürlich sein mag, sich bei der Abfahrt unüberlegt, jedem nur irgendwie bekannten Reisegefährten anzuschließen.
In acht Minuten geht der Zug. Bahnsteigsperre. Also wird der Abschied von meiner Mutter kurz. Sie weint. Doch wir müssen uns beeilen, laufen die Treppe hinauf. Hastig die Papiere hervorgekramt, dem Sperrposten vorgezeigt. Und endlich hinaus auf den Bahnsteig. Lärm. Schwefliger Geruch. Der Zug steht auf dem zweiten Gleis, übervoll. Rotkreuz-Schwestern verteilen Kaffee. Leere Gepäckwagen rattern metallen auf dem steinernen Bahnsteig zurück. Vorn am Rande der Halle, das große unerbittliche Ziffernblatt der Uhr, und draußen pafft die Lokomotive weiße Wolken.
Wir laufen den Zug entlang. Nirgends Platz. Vielleicht komme ich gar nicht mehr mit. Dann könnte ich mir ja vom Bahnhofsoffizier eine Bestätigung schreiben lassen … »Macht mir bloß, dass ihr reinkommt!«, brüllt eine scharfe Stimme. Da sind wir auch schon vor Kettners Waggon. Er zwängt sich die Stufen hinauf. Nein, hier geht’s beim besten Willen nicht. Die bekommen ja nicht einmal die Türe zu. Also zum nächsten Waggon. Wieder nichts. Weiter, von Tür zu Tür. Bis es mir endlich gelingt, auf eine Plattform hinaufzuklettern und stolpernd, vorbei an fluchenden Soldaten, an Tornistern, klappernden Kochgeschirren – »Verdammt noch mal, so pass doch auf!« – quetschte ich mich so tief wie möglich in den dunklen, vollgestopften Gang hinein.
»Mensch, der hat’s aber eilig! Hätte auch früher kommen können!« Ein Feuerzeug flammt auf. Erleichtert lege ich mein Gepäck auf einen Haufen zusammen. Ja, ich hätte wirklich früher kommen sollen! Aber zu Hause war’s mir noch gleichgültig, ob ich einen Platz bekomme oder nicht. Ich drücke mich näher ans Fenster heran und grabe in meiner Manteltasche nach den Papieren, um sie wieder in die Brusttasche zu stecken.
Da setzt sich der Zug in Bewegung. Langsam, schwer, übervoll beladen mit Soldatenfracht, schiebt er sich aus der großen Halle in die Mondnacht hinaus. Die hohe Signalbrücke über uns. Rote, blaue Lichter. Erloschene Bogenlampen pendeln blechern im Wind.
Dann schnauft die Lokomotive etliche Male kurz hintereinander. Ein ungeduldiger Ruck geht klappernd bis zum letzten Waggon. Und nun beginnt der lange Zug über Weichen, an Stellwerken und Verladerampen vorbei, allmählich schneller, durch den langgestreckten Fracht- und Rangierbahnhof zu rollen. Vorbei an ausgestreckten Armen von Wasserkränen, an Drehscheiben, an einem großen, halbrunden Lokomotivschuppen, in den sich gerade eine Maschine, langsam wie eine Schnecke, in ihr Gehäuse zurückzieht. Vereinzelte abgedunkelte Laternen, Unterführungen, leere Straßenkreuzungen im Mondlicht. Und drüben die lang aneinandergereihten Zinskasernen mit unzähligen, verhängten Fenstern, wie eine Reihe hoher Schiffe vor Anker.
Im rascheren Vorübergleiten nehme ich jedes Bild, jeden Laut mit bestürzend deutlicher Einmaligkeit wahr. Sehe scharf jedes einzelne rußig verschlafene Eisenbahnergesicht unter mir vorüberfahren, sehe Lastwagen an einer Bahnschranke warten, spüre den Dampf, den beißenden Rauch am Fenster vorüberstreichen und schmecke seinen schwefligen Geschmack am Gaumen.
Endlich wieder in einem Zug fahren. In Zügen fahren und den harten Räderschlag auf den Schienen spüren. Wieder reisen und am Fenster stehend, in die vorbeiströmende Landschaft schauen. Alles riecht so gut nach Eisenbahn. Der dicke Ledergurt am Fensterrahmen, die kleinen Emailschilder in den drei Sprachen, die geheimnisvoll verbotene Notbremse der Kindheit.
Und im Abteil sitzt man mit fremden Menschen zusammen, die schweigsam beobachtend auf Gespräche warten, Zeitschriften lesen, hinausstarren oder hin- und herpendelnd zu schlafen versuchen. Und wenn man zum Waschraum will, muss man sich durch den langen Gang hindurchquetschen und über Koffer und die Beine Schlafender steigen.
Und rascher geht’s durch die schlafende Vorstadt, rascher vorbei an Villen und Gärten, an Hütten, an Brücken, Fabriken und ausgedehnten Schutthalden. Die alte vertraute Strecke, die wir als Kinder jedes Jahr in die Ferien fuhren und die noch immer nach Ferne, Sonne, See und Abenteuer schmeckt.
Wie gut, dass ich noch in diesen Zug hereingekommen bin! Wenn ich mir vorstelle, jetzt wieder in der Straßenbahn nach Hause zufahren … Es ist immer etwas Befremdendes, bei der Rückkehr an einen Ort, von dem man sich am selben Tag, für lange Zeit verabschiedet hat.
Doch da haben wir die Stadt mit ihren letzten Ausläufern schon hinter uns. Weit dehnt sich der Wienerwald im Mondlicht. Mulden. Jähe Hänge dazwischen und unter uns die geschäftig nebenherlaufende Straße mit ihren Kurven und Brücken.
Immer schneller stößt der Zug in die Nacht. Bis endlich die Lokomotive, frei, erlöst einen langgezogenen Pfiff zu den Sternen schickt, den sie hastig abbricht, um nur ja nichts zu versäumen und jetzt ihr Letztes herzugeben.
Und endlich ist der endgültig schnellste Schienenrhythmus da, der rasende Rhythmus der Räder, der rasende, packende, hämmernde Rhythmus auf stählernen Gleisen. Dieser tolle Takt des jungen, unersättlichen Fernwehs und Heimwehs.
Kommt her ihr Hütten! Wachset rasch zu Häusern, zu großen, hell vorbeisegelnden Häusern! Und bleibt wieder zurück! Neue Häuser, Dörfer, Städte will ich haben! Und weit hinter uns zeigt noch immer ein Scheinwerfer in die unendliche Nacht.
Ein Bahnhof, den wir in unverminderter Geschwindigkeit, mit jähem Sprung über Weichen knallend, durchrasen. Der Stationsvorstand grüßt mit seiner Winkerkelle. Aus dem Wartesaal schimmert Licht. Eine Frau mit einem Rucksack über der einen Schulter geht eben hinein. Und wieder freies Land. Eine halbe Sekunde der Tunnel, und dann ein langgestreckter Wald ohne Ende.
In glücklicher Erregtheit schließe ich das Fenster. Im Gang ist’s warm und verraucht. Die hängenden Gepäckstücke schaukeln. Kochgeschirre, Stahlhelme, Gasmasken und Waffen klopfen in gleichmäßigem Takt an die Wände.
Eisenbahnen. Flugzeuge. Schiffe.
Schiffe tuten in Le Havre,
in Odessa und in Norwegens Weißen Häfen.
Zerstörer, Torpedoboote, Kreuzer, Schlachtschiffe,
mit Panzerplatten und Kanonen schwer bestückt.
Und auf der Meeresstraße von Tunis
versucht vielleicht in dieser Stunde,
ein Geleitzug heimlich zu entwischen.
Vorsichtig, denn obenauf liegt ja der gute gelbe Kuchen, setze ich mich auf meinen Rucksack und versuche, meine Beine irgendwo unterzubringen, zünde mir eine Zigarette an.
»Wart mal, lass mich auch anrauchen!« Der dicke Obergefreite neben mir beugt sich über mein aufflackerndes Feuerzeug. Und während er an seiner Zigarette zieht und sich dabei seine Lippen und Backen einige Male straffen, hallt einen Augenblick schwindlig hell eine Brücke unter uns hinweg.
»Na, wohin fährst du?«, fragt er, als wir wieder im Dunklen sitzen.
»Vorläufig mal nach Berlin«, erwidere ich. »Wohin es dann geht, weiß ich noch nicht.«
»Urlaub gehabt?«
»Ich war verwundet und dann eine Zeitlang a.v.«
»Das hab ich mir gedacht«, mischt sich sein Nachbar in unser Gespräch. »Was Urlaub betrifft, sind sie beim Kommiss verflucht sparsam geworden.«
»Es sind eben schon zu wenig Leute da«, sagt der Dicke. »Drum muss jetzt noch alles ran, was Arme und Beine hat und zumindest auf einem Auge sieht.«
»Willst du auch einen Schluck?«, wendet er sich nach einer Pause an mich. »Eine Flasche haben wir schon ausgesoffen, aber ich hab noch eine zweite, größere da.«
»Du wirst sie doch nicht meinetwegen …«
»Kannst du noch mal dein Feuerzeug anzünden!« Und während ich ihm leuchte, kramt er, die Zigarette im Mundwinkel, das eine Auge geschlossen, in seinem Wäschebeutel und holt eine, in ein Kommisshemd eingewickelte, Zwei-Liter-Flasche hervor. Grinsend entkorkt er sie und trinkt einen Riesenschluck.
Dann reicht er sie mir herüber. Durstig trinke ich den herben kühlen Wein und spüre, wie es prickelnd die Kehle hinunterrinnt, wie es wärmt, wie es köstlich belebt und mit einem Schlag wieder jene leichte Atmosphäre da ist, die das Leben um eine bestimmte Färbung, um eine neue Dimension reicher macht.
»Gut ist er! Ausgezeichnet!«, sage ich. Und während der dritte lange, stumm an der Flasche hängt, packe ich mit einem leisen Beigeschmack von Kameradgetue meinen zerquetschten Kuchen und die Flasche Slibowitz aus, die mir mein Vater beim Abschied in die Außentasche geschoben hat.
Der dritte hat Speckbrote und einige Päckchen jugoslawischer Morawa-Zigaretten. So hocken wir im Dunkeln beisammen, essen Kuchen und Brote mit jenem scharf geräucherten Speck, der immer salziger und saftiger wird, je länger man ihn kaut, trinken dazu aus beiden Flaschen in maßlosen Schlucken und rauchen die dünnen, guten Zigaretten mit dem grünen Aufdruck.
»Was für eine Strecke fahren wir denn da?«, fragen sie mich, mit vollem Mund.
»Keine Ahnung! Heute werden die Züge oft umgeleitet, wenn irgendeine Stadt bombardiert wurde. Normalerweise fährt dieser Zug auch nicht vom Nord-, sondern vom Westbahnhof ab.«
Sie erzählen mir, dass sie in Wien eine gemeinsame Braut haben, die sie abwechselnd besuchen. Dann sprechen wir von Frankreich, vom Winter 41 in Russland, von Frauen und von der politischen Lage.
Dazwischen höre ich das harte Hämmern des Zuges, und wenn wir Zigaretten anzünden, sehe ich den Widerschein der Flamme in ihren unternehmungslustigen Augen, bis ich den Alkohol spüre und erstaunt sehe, dass alles durcheinanderzugleiten beginnt und verzerrt und bedeutsamer wird, dass keiner mehr auf den andern achtet und jeder drauflosredet, in jener streitlustig-versöhnlichen Stimmung, in der man abwechselnd seine Betrunkenheit und seine Nüchternheit übertreibt, in der man ganz einer Meinung ist, obwohl jeder das Gegenteil vom anderen behauptet.
Der Dicke erzählt von seinem Sohn, was er alles aus ihm einmal machen werde Er schlägt sich dabei immer wieder mit der Hand aufs gespannte Knie Doch dann bricht er plötzlich mitten im Satz ab, rülpst dumpf, rutscht auf die Seite und versinkt in behagliches Schnarchen.
»Voll wie eine Tonne!«, sagt sein Nachbar. Eine Weile fallen wir in jene ermüdete Leere, die auch in der angeregtesten Unterhaltung irgendwann einmal eintritt. Die Gespräche um uns herum sind verstummt. Nur am Ende des Ganges höre ich noch einen erzählen und dazwischen immer wieder verhaltenes Lachen. Über allen anderen liegt Schlaf. Erschöpfter Schlaf mit seinem Geschnaufe, seinem traumleisen Sichregen und schwebend vergessendem Überallzuhause. Und jetzt ist auch wieder hart und rastlos das Hämmern auf den Schienen zu hören.
»Willst du noch einen Schluck?«, frage ich den anderen und halte ihm die Schnapsflasche hin. Keine Antwort. Auch schon versunken.
Ich aber kann noch nicht schlafen. Der ruhelose Nachtzug hält mich wach, das Wissen, dass vorn das feuerumflackerte Gesicht eines Lokomotivführers ebenso wacht und dass es hier drinnen warm rumpelt, klappert und alle Soldaten schlafen. Ich spüre die Nähe des groben Tuches ihrer Uniformen, des Leders ihrer Stiefel und Koppel, den Geruch nach Männern, Alkohol und Rauch.
*
Im September 41 hockte der junge Ersatz auf den LKWs, die über Tschudowo nach Wyborg und weiter, das südliche Newaufer entlang, möglichst rasch durch den Artilleriebeschuss in Richtung Schlüsselburg ratterten.
Verschüchterte Knaben, angespannt, lauernd, fremd, mit ihren nagelneuen Karabinern und Tornistern durcheinander gerüttelt im Halbdunkel der ächzenden Laderäume, eingelullt in den stickigen Qualm aus Staub Auspuffgasen, Pulvergeruch.
Zwanzig Mann, zwanzig Herzen und Gehirne in jedem Wagen. Doch wenn man sie lange, drei Jahre lang, anstarren könnte; so spürte man erschreckt, dass vier von ihnen tot und neun verwundet …
Ich schiebe die Schnapsflasche in den Rucksack. Jetzt, im dunklen, klopfenden Waggongang bin ich noch frei. Ich zünde mir eine Zigarette an und sehe mich unwillkürlich um, ob alle andern auch wirklich schlafen.
Da hocken sie; mit ihren kurzgeschorenen Schädeln. Ich mag diese ruppigen Soldaten. Ihr rasches Vergessenkönnen, ihre betrunkenen Stimmen, die Oberflächlichkeit ihres stets bereiten Witzes. Die Mannschaft, nur die Mannschaft, diese verträgliche Mischung von Männern jeden Alters und allen Schichten des Volkes.
So müssen sie auch drüben sein, in Frankreich, in Russland und überall. So fahren sie in Züge gepfercht an die Front oder auf Urlaub. So schlafen sie in Bunkern, frieren und leiden Hitze, schreiben mit klobigen Händen Feldpostbriefe. So sind sie tapfer und bang, roh und ungewiss. Bewusstlos oder brüllend wie Tiere liegen sie auf Verbandplätzen, und die Toten werden in Zeltbahnen gepackt und verscharrt. Wer aber nach Hause kommt, wird vom ersten Tag an, in den Alltag der Nachkriegsjahre gestoßen. Und mancher von ihnen, von seiner Frau mit schlechtem Gewissen erwartet, wird enttäuscht fühlen, dass er sich umsonst auf ein Wiedersehen gefreut hat.
Verfluchter Krieg! Verwundet, tot, vermisst, oder freudlose Fronarbeit und Selbstbefriedigung in langer Gefangenschaft. Wie schwer fassbar, zufällig, sinnlos ist doch das Schicksal so vieler Soldaten, dieses nutz- und namenlose Vergessenwerden.
Jetzt hocken sie da und fahren schlafend hinaus. Ich selbst mitten unter ihnen, hellwach noch, das Hämmern des Zugs im Ohr.
Auf Nachtmärschen werde ich wieder mittrotten müssen, Staub im Haar, auf der verschwitzten Stirn und in den Augenwinkeln. Wenn ich hundemüde bin, werde ich noch den Befehl bekommen, auf Posten zu ziehen und werde zwei Stunden später auf dem harthalmigen Stroh, neben den anderen Schläfern, in einen traumlosen Schlaf sinken können.
Hast du bei Demidow die Nebelwerfer gehört?
Und die Stalinorgel bei Welikije-Luki? Und bei Rostow und im Donbogen und an der Miusfront?
Ja, und damals am Assowschen Meer?
Unermüdlich hämmert der Zug durch die Nacht. Übernächtigt. Müde. Mensch, schnarch nicht so laut! Im alten holpernden, klappernden Takt bin ich schläfrig, so müde, so schläfrig, und schläfrig lange Gähnen …
Noch beunruhigt denken, dass man ja alles dicht bei sich hat, alle vier Gepäckstücke, dass man auf dem Rucksack hockt und, mit dem Rücken an die hölzerne Wand gelehnt, im Takt an sie zu klopfen beginnt und leiser, noch leiser, Atemzug für Atemzug ins wohlige Geborgensein von Wärme, Rauch, Schweben versinkt.
Der Kopf kippt plötzlich nach vom. Erschreckt richtet man sich halb auf – Ach ja, ich bin ja im Zug –, nickt nachgiebig und sinkt wieder willenlos und schwer. Schläfrig eingelullt in den Schlaf gewiegt werden. Schweben. Zusammenzucken. Gemurmel, irgendwas Unzusammenhängendes. Hinhorchen und verlegen fragen? Nicht mehr wiederholbar. Schlaf … Schlaf. Halbschlaf. Das blöde Knie. Und den anderen, der schwer auf meinen Fuß gerutscht ist, unwillig wegschieben. Auch von weit her hören, dass unser Zug nach langer Zeit langsamer wird und plötzlich erschreckend regungslos. Lärm. Stimmen. Leute steigen ein, drängen sich hart vorbei. Kalter Luftzug durchs offene Fenster. Dann ganz nah eine fremde Frauenstimme. Hast du Platz? Ach wo, alles überfüllt! Schreib gleich, wenn du draußen bist! Das Pfeifen der Lokomotive. Also schreib gleich … Und drängle dich nirgends vor!
Und wieder den Zug hören und unter seiner sicheren Geborgenheit nicht mehr wissen, ob wirklich eine Station war oder ob man sie nur geträumt hat.
»Los, wach auf!«
»Ha? …Uuaah…hh.«
»Schläft da wie ein Sack. So wach doch endlich auf, eine Streife ist da!« Träge richte ich mich auf. Steife Knie vor Kälte. Mein Rucksack ist auf die Seite gerutscht. Der Zug rumpelt im alten unveränderten Takt. Aber in die Leute ist Bewegung gekommen. Verschlafenes Geblinzel, Sichrecken, Rocktaschen-Aufknöpfen. Am Ende des Waggons sehe ich im Schein einer Laterne zwei Unteroffiziere mit Stahlhelmen. Sie quetschen sich eben zum nächsten Abteil durch, und der eine bleibt vor der Tür stehen, um die Leute auf dem Gang zu kontrollieren.
Eine Zigarette möchte ich rauchen. Aber ich verschiebe es besser auf später. Der Dicke neben mir lächelt verlegen, forsch. Dann sind sie endlich bei uns angelangt. »Soldbuch, Marschbefehl, Fahrschein.« Mit behandschuhter Hand blättert er im Scheine seiner Taschenlampe. Ich glaube, als Streife wirkt auch noch der femininste Mann eisern und unerbittlich. Vielleicht ist es der andere Klang der Stimme unterm Stahlhelm, das glatte riemenumspannte Kinn, das halbrunde Schild, das an zwei Ketten an seiner Brust hängt, die Pistolentasche … »Der nächste!«, sagt er.
Während ich beruhigt meine Papiere einstecke, ist der Dicke dran. Ich habe diese Wehrmachtspolizisten nie gemocht. Wenn man sie nur sieht, kriegt man schon ein schlechtes Gewissen. Irgendwas können sie auf jeden Fall auszusetzen haben.
Kaum sind sie draußen, sind auf einmal alle gesprächig. Zigaretten werden angezündet, und einige packen etwas zum Essen aus. Mit steifen Beinen stehe ich auf und lasse das Fenster herunter. Ein eiskalter Wind kommt mir entgegen. Der Mond ist weitergewandert, das Tempo langsamer geworden. Es geht in bergiges Land. Mit verhaltener Kraft durchschneidet der Zug einen Hügel und kriecht jetzt knirschend um eine endlose Kurve. Die Lokomotive spuckt Rauch, glühende Kohlenstücke und faucht hohl ihr mühseliges:
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
So schieb doch an du faules Aas!
Ja! Heiz ihr ein. Heiz ihr doch ein, verdammt noch einmal! Eine Weile sind wir hoch oben auf dem Bahndamm. Ein schütteres Stück Wald windet sich eine Wiese entlang bis fast zu uns herauf. Und fällt in eine unerwartet steile Mulde hinab, springt über die Straße ins bodenlose Dunkel. Und jetzt klingt es ganz hell und hart:
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH.
Eine Reihe Strohhaufen fährt langsam vorbei. Heuhaufen. Ein Grenzstein. Auf einmal ist ein Zaun da, läuft mit winzig-schnellen Schritten ein kleines Stück nebenher, schlägt einen unvermuteten Haken und stürzt querfeldein zu einem hellen Haus hinunter.
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
Und noch einmal Und noch einmal
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
Bis endlich die Lokomotive mit langgezogenem Geheul in den Tunnel stößt. Fenster zu! Und minutenlang sausend, zischend und kreischend, rasen die glatten schwarzen Wände vorbei. Der Qualm staut sich beengend und beengender. Und auf einmal spürt man aufhorchend, dass die Geschwindigkeit zunimmt.
Es geht wieder bergab. Bergab, bergab, schon höchste Zeit! Die Räder hämmern wieder schneller, und das pfeifende Sausen des Tunnels wird immer unerträglicher … Bis wir mit einem Satz ins Freie springen, hoch oben auf dem schwindligen Kamm. Eine Wiese stürzt steil hinab, klettert drüben bis zur halben Höhe ausschwingend hinauf. Und nun mit raschem hellem
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
jagen wir in wahnwitzigem Tempo ins Tal hinunter.
Ein schriller, langer, jauchzender Pfiff.
Wälder, Mulden, Einschnitte.
Ein Bahnwärterhäuschen. Im trüben Licht Gesicht des Bahnwärters, der gerade an einer Kurbel … Und wieder lange freie Hänge und weit drüben ein weißer unbeweglicher Berg. Ein Schwall Rauch und Dampf streicht den Zug entlang, flackert jäh auf. Bäume. Häuser. Eine Bahnschranke. Eine kleine, dunkelschlafende Haltestelle, und wieder das blitzschnelle Gemetzel über den Weichen. Dann wieder Land, Land und Wald. Und tief im Tal glitzert eine Flusswindung im Mondlicht.
SCH SCH SCH SCH SCH SCH
SCH SCH SCH SCH SCH SCH …
Und plötzlich sind zwei grelle Scheinwerferschlitze auf der Straße. Jeder Baum und Strauch blitzt einen Augenblick in ihrem Schein auf. Bald näher, bald weiter entfernt, verschwinden sie unvermutet im nächsten Wald, springen am anderen Ende wieder hervor, jagen schräg an uns heran, um uns ein Stück dicht unter uns zu begleiten. Ein Volkswagen. Deutlich sehe ich den aufgestützten Ellenbogen des Fahrers. Jetzt schneidet er eine Kurve, läuft weit weg, kommt nach einer Weile allmählich wieder heran, immer näher und höher und biegt endlich jäh über eine uns überspannende Brücke und ist für immer hinter uns gelassen.
Dann sind wir wieder mit dem Mond allein im Land. Bahnhöfe kommen, kleine, schläfrig verlassene, und irgendwo ist sekundenlang ein donnernder, heimwehbeladener Gegenzug neben uns, reißt scharf ab. Und wieder Mond und weite, stille Stoppelfelder.
Wo sind wir? Der Zug dürfte schon einige Zeit stehen, denn der Gang ist halbleer. Mit schalem Geschmack im Mund stehe ich auf, beuge mich aus dem Fenster: REGENSBURG.
Ein Eisenbahner in einem verschmierten, blauen Kittel beklopft mit einem langstieligen Hammer die Räder. Auf dem Nebengleis ein Lastzug mit Rungenwagen, auf dem die Geschütze und Fahrzeuge einer Batterie festgeklotzt sind.
»Sie soll sich zum Teufel scheren, hab ich ihr gesagt. Solche Weiber kann ich nicht brauchen!«, höre ich eine heisere Stimme und entdecke zwei pfeifenrauchende Soldaten in Übermänteln, die auf dem Trittbrett eines verklotzten Kübelwagens hocken. »Und weeste, wat se sagt, ditt verdammte Luder?«
Einige Soldaten mit Feldflaschen und Kochgeschirren kommen den Bahnsteig herauf. Unter ihnen der Dicke. »Mensch lauf, da unten gibt’s Kaffee!«, ruft er mir schon von weitem zu. Ich hake meine Feldflasche aus dem Brotbeutelring und lasse sie auch auffüllen. Dann trinke ich das bittere, herrlich heiße Gesöff und spüre seine belebende Wärme.
An sonnenroten Schornsteinen, an Fabriken und Zinskasernen vorbei, fahren wir aus der Stadt, die zu ihrem Alltag erwacht. Der Dicke schaut mit mir zum Fenster hinaus, ruft jedem hübscheren Mädchen irgendetwas zu und winkt eifrig mit beiden Armen. Doch von den Mädchen tun einige so, als ob es sie nichts anginge. Andere sehen erschrocken drein, manche lächeln auch und winken und sind auf immer entschwunden.
Nachdem die beiden ausgestiegen sind, finde ich in einem Abteil einen Platz an der Tür. Es ist warm geworden. Mit brennenden Augen versuche ich zu schlafen. Dazwischen esse ich wieder, ohne Appetit und rauche eine Zigarette nach der anderen. Heute ist alles ganz anders. Der nächtliche Rausch ist verflogen. Voll Langeweile sehe ich das Land vorbeifahren, sehe Städte mit langgestreckten, ausgebrannten Stadtteilen, steige in Bahnhöfen ohne Grund, nur von einer bedrückenden Unrast getrieben, auf den Bahnsteig und warte und hoffe, dass es bald weitergeht.
Wieder fahren wir durchs Land. Kiefernwälder. Ein Teich. Und weit drüben dreht sich ein dunkelrot gedeckter Kirchturm ganz, ganz langsam um uns herum.
Berlin, Anhalter Bahnhof.
Allmählich entleeren sich die Wagen. Ungeduldiges Gezwänge und Gestocke auf den Gängen und Plattformen. Dann schiebt sich der drängende, schlitternde Strom bepackter Soldaten, unter dem Dröhnen eines Lautsprechers, lärmend, laut schwatzend, immer breiter und dichter den Treppen und dem Ausgang zu.
ROOOO SAAAA munDEEEEEEE
schenk MIIR dein Herz UUND dein Ja
ROOOO SAAAA munDEEEEEEE
Frag DOCH nicht erst DIE Mama
Noch am Bahnsteig treffe ich Kettner. Er fängt gleich an, von seiner Fahrt zu erzählen. Dass in seinem Wagen später noch Platz genug gewesen und dass er schon so gespannt sei, was nun mit uns geschehen werde. Ob man uns hier zu Fallschirmjägern umschulen werde? Oder ob sie uns gleich weiterschicken? Und wenn ja, dann wohin?
Ein Gepäckwagen schiebt sich ununterbrochen hupend durch das zähe Gewühl, das hinter ihm sofort wieder zusammenschwappt.
ROOOO SAAAA munDEEEEEEE
schenk MIIR dein Herz UUND dein Ja
gellt eine neue Strophe. Ob ich schon einmal in Berlin gewesen sei, fährt er mit erhobener Stimme fort. Vielleicht wäre es doch am besten, gleich zum Fallschirmjäger-AOK zu fahren, um Gewissheit zu haben. Falls wir am Abend Ausgang bekommen sollten, könnten wir ja irgendwas gemeinsam unternehmen. Und was ich zu den Zerstörungen in den Städten sage, durch die wir fuhren? Aber die Schlote habe man überall rauchen gesehen. Denn das funktioniere alles noch. Das Volk sei den Gehorsam eben schon gewöhnt.
An der Sperre geht es umständlich zu. Und nachdem wir uns einzeln durchgequetscht haben, stehen wir endlich draußen an der Brandung des Verkehrs. Berlin! Altes, schnoddriges, quicklebendiges Berlin!
Im Vorraum des AOK stoßen wir auf zwei Soldaten, die, eben aus München angekommen, auf die gleiche Entscheidung warten müssen wie wir. Sie scheinen von jener selbstgefälligen Die-Ruhe-weg-haben-Krankheit befallen zu sein, werfen ununterbrochen mit Worten wie: »Nicht ärgern, nur wundern!« oder »Es geht alles vorüber!« und ähnlichem herum.
Mit jener Schreibstubenphilosophie, deren Stumpfheit weder mit dem stabilen Gleichgewicht des alten Orients etwas gemein hat, noch mit jener anderen, labilen, spanischen Ruhe, die sich aus der Selbstbeherrschung eines schwer zu zügelnden Temperaments geformt hat.
Ein dicker, sonnengebräunter Obergefreiter, in einer weißen Drillichjacke wie nach Maß, verlangt unsere Papiere und teilt uns mit, dass wir noch eine halbe Stunde zu warten hätten, da der Chef gerade im Kasino beim Abendessen sei.
Wir spazieren zum See hinunter. Der warme, helle Abend, die spiegelnde Wasserfläche und der Sand, in dem unsere Tritte lautlos geworden sind, wecken in mir den schwachen Wunsch nach Ausruhen, auf dem Rücken im Wasser liegen. Hierbleiben. Ich weiß noch von allem. Ich habe das Meer nicht vergessen, das alte brüllende Meer mit seiner schönen, kalten Einfachheit des Horizonts. Ich liebe jeden See und Strom und jedes Wasser.
»Jetzt ist es vorbei mit der Herumsitzerei in der Heimat!«, schnauzt uns der Stabsarzt an, als wir ihm vorgeführt werden. »Macht bloß, dass ihr heute Abend noch weiterkommt!«
Als Kettner zu fragen wagt, ob er noch Urlaub bekommen könne, da seine Frau knapp vor der Entbindung und doch jedem Soldaten laut Vorschrift …, wird er scharf belehrt, dass niemandem etwas zustehe: »Urlaub kann gewährt werden. Merken Sie sich das, Sie dämlicher Schlappsack!«
Also hinüber in die Schreibstube. Der Obergefreite stellt uns Marschbefehle und Fahrkarten nach Köln aus, von wo wir weitergeleitet werden sollen. Trotz unserer Enttäuschung über den sofortigen Abmarsch sind wir froh, dass es wenigstens nach Westen geht. Der Zug ist voll Soldaten. Viele von ihnen schlecht ausgerüstet, kaum ausgebildet, sehr jung oder schon zu alt. Alle aber k.v. Heiße, qualmende Dunkelheit. Endloses Gerumpel.
Am Vormittag fahren wir über die Rheinbrücke. Aus allen Fenstern schauen Soldaten, durch die Nähe des Stromes und der Stadt in aufgeräumter Stimmung. Langsam gleiten die schrägen, klobig vernieteten Traversen dicht an mir vorüber. Als der graubraune Strom tief unter unserem verlangsamten, hohlen Schienenschlagen liegt, fällt mir ein, dass ich einen wasserdichten Schwimmsack hätte mitnehmen sollen und dass dieser Strom beim Rückzug unter Umständen ein unüberwindliches Hindernis werden könnte.
In Köln trennen wir uns, da Kettners Marschbefehl nach Dellbrück ausgestellt ist, während ich mich in der Stadt bei Hauptmann Endreszewitz melden muss. Dort wird mir ein neuer Marschbefehl nach Eindhoven in Holland ausgestellt, mit dem ich noch am selben Tag weiterfahren soll.
Langsam gehe ich zum Bahnhof zurück, nur um zum Schein meine Pflicht zu erfüllen. Denn ich habe schon beschlossen, den Zug zu versäumen und hierzubleiben. Zwei oder drei Tage. Jeder Tag gewonnene Zeit. Wer weiß, vielleicht fällt gerade jetzt irgendeine Entscheidung, bei der es besser ist, in Köln zu sein als in Holland. Wenn ich es jetzt nicht riskiere, so wird es mir später sicher leidtun. Wer wird das schließlich draußen schon feststellen können. So hinterlege ich auf der Gepäckaufbewahrung meinen Rucksack. Dann hole ich Verpflegung und Zigaretten und schlendere durch die Stadt. Endlich allein. Die Zerstörungen sind gewaltiger, als ich es erwartet habe. Ganze Straßenzüge dem Erdboden gleichgemacht. Viele architektonische Kostbarkeiten vernichtet, vor allem in der Altstadt. Andere, schwerbeschädigte, haben doch noch den wunderbaren Reiz eines Torsos.
In der Nähe des Domes ein riesiger Luftschutzbunker. »Hier haben sie, bei einem von den letzten Angriffen, einige totgetreten«, erzählte mir ein alter Mann. »Wie immer stauten sich die Leute vor dem Eingang. Als aber die ersten Bomben herunterflatterten und ganz in der Nähe einschlugen, brach eine richtige Panik aus. Alle schrien und schlugen um sich und schoben sich in ihrer Todesangst wie eine wild gewordene Herde unter die Erde … Ja, und nach der Entwarnung, da lagen dann zwischen zertrampelten Koffern einige Leute vor dem Eingang. Die sahen aus! Wie blutige, staubige Säcke.«
Ich sehe mir die Treppe und den Eingang mit jenem eigenartig prickelnden Grauen an, dem ich mich beim Anblick solcher Orte nie ganz entziehen kann. Sicher alte Leute, Frauen, Kinder, denke ich im Weitergehen. Bei jeder Panik liegen die Kinder zuunterst.
»He! Sie!« Ein Oberleutnant steht vor mir. »Haben Sie keine Augen im Kopf! … Gute Lust, Sie einsperren zu lassen.«
Ich schlage die Hacken zusammen und starre in sein rot angelaufenes Gesicht. Sperr mich ruhig ein! Jetzt, wo es wieder an die Front geht, bedeuten drei Tage Bau auf jeden Fall drei Tage Aufschub.
Beim Eintritt in den riesigen Saal des Soldatenheimes schlagen mir dickschwadiger Tabakqualm, Stimmenlärm und das Dröhnen eines Lautsprechers entgegen.
ALLE DURCHBRUCHSVERSUCHE DER BOLSCHEWISTEN WURDEN HIER AUCH GESTERN UNTER ABSCHUSS VON FÜNFUNDDREIßIG PANZERN VEREITELT …
An Stühlen, an Bänken vorbei, zwänge ich mich bis zur Theke durch und finde einen Platz an einem Tisch, an dem ein paar pfeifenrauchende Gebirgsjäger sitzen …
DIE BESATZUNG DER FESTUNG BREST SCHLUG AUCH GESTERN ALLE ANGRIFFE DER NORDAMERIKANER AB, DIE IHRE, VON DEN KÄMPFEN DER LETZTEN TAGE STARK ANGESCHLAGENEN VERBÄNDE DURCH NEU ZUGEFÜHRTE TRUPPEN ERGÄNZEN MUSSTEN. GERINGE ÖRTLICHE EINBRÜCHE IM FESTUNGSVORFELD SIND ABGERIEGELT. DIE BLUTIGEN VERLUSTE DES FEINDES WAREN BESONDERS HOCH. ALLEIN VOR DEM ABSCHNITT EINER UNSERER KOMPANIEN WURDEN HUNDERTFÜNFZIG FEINDLICHE TOTE GEZÄHLT …
Die Kellnerinnen sind flink und freundliche, während sie bei uns gegen Soldaten meistens unwirsch … Da setzt man mir auch schon einen Teller Suppe, etliche Käsebrote und ein Glas Bier vor.
ZUM HEUTIGEN OKW-BERICHT WIRD ERGÄNZEND BERICHTET, IN DER ABWEHRSCHLACHT ZWISCHEN BUG UND NAREW HAT SICH DIE WESTFÄLISCHE ZWEIHUNDERTELFTE INFANTERIEDIVISION, UNTER FÜHRUNG VON GENERALLEUTNANT ECKHART, BESONDERS AUSGEZEICHNET. DAS AUF ALLEN KRIEGSSCHAUPLÄTZEN BEWÄHRTE JAGDGESCHWADER ZWEIUNDFÜNFZIG ERZIELTE UNTER FÜHRUNG SEINES KOMMODORE, EICHENLAUBTRÄGER OBERSTLEUTNANT HRABAK, SEINEN ZEHNTAUSENDSTEN LUFTSIEG.
Tosend setzt ein Marsch ein. Vergeblich versuche ich, in einer Zeitschrift zu lesen. Dieser wahnsinnige Lärm. Immer neue, dröhnende Marschlieder. Man kann sich ihrer nicht erwehren.
Und doch habe ich beobachtet, dass der Soldat den Lärm liebt. Motorengedonner auf Flugplätzen und in Kraftfahrzeughallen, Kettengerassel von Panzern, lautes Singen, Stiefelnägel. Auch will er lieber angebrüllt als mit normaler Stimme angeredet werden. Vielleicht entspringt diese Sucht nach Lärm nur der Furcht vor der Stille, vielleicht ist sie ein beruhigender Ausgleich für die angespannte Lautlosigkeit so vieler Nachtwachen. Also Notwehr? Ohne recht zu wollen, bestelle ich noch ein Glas, lasse es aber stehen und spaziere wieder in die Stadt. Vor den Kinos stehen die Leute Schlange. Wurst-, Käse-, Margarineattrappen in Schaufenstern. An einer gesperrten Straßenkreuzung wird eine Kolonne langrohriger Geschütze durchgeschleust.
Eine Weile gehe ich unschlüssige hinter einem Mädchen her, hellblond gefärbtes Haar, klappernde Holzschuhe. Doch als ich sie eben ansprechen will, schnappt sie mir ein Feldwebel vor der Nase weg. Überall Soldaten, Volkssturm, SS, Streifen.
Durch eine schmale Ruinengasse komme ich zum Rhein-Kai. Ruhig gleitet das trübe, ölfleckige Wasser vorbei. Ein Dampfer mit tiefliegenden Schleppkähnen scheint machtlos stromaufwärts zu stehen. Schaumig umspülte Brückenpfeiler.
Als ich hinaufsehe, entdecke ich zu meinem Schrecken eine Streife, die auf der Brücke jeden Wagen anhält. Es hat keinen Sinn länger zu bleiben, sage ich mir auf dem Rückweg. Die Stadt ist zerstört, ist ein von Dienststellen und Streifen übersätes Durchgangslager geworden, in dem es kaum noch Zivilleben gibt. Als Fremder kannst du hier nur im Soldatenheim sitzen oder auf der Straße herumlaufen.
Spätabends, als die meisten Lichter abgedreht sind, lege ich mich auf vier zusammengestellte Stühle und decke mich mit dem Mantel zu. Am Nebentisch spielen einige Matrosen Karten. Sie rauchen Stumpen. Einer von ihnen schlägt jedes Mal, wenn er ausspielt, mit der Faust auf den Tisch und sagt: Det isn Ding! Wat sagste!
5. September 1944
Ich werde doch schon heute abfahren. Verpflegung für drei Tage. Am Bahnhof gebe ich mein Gepäck ab und lasse meine Feldflasche auffüllen. Auf dem ersten Gleis steht ein Verwundetenzug. Unrasierte, apathische Gesichter. Schmutzige Verbände. Zwei Tote werden ausgeladen. Sie dürften unterwegs gestorben sein. Im Vorbeigehen schlagen mir aus einem offenen Fenster Eitergestank und Stöhnen entgegen. Die dumpfe, tierhafte Atmosphäre aller Verwundeten- und Gefangenentransporte.
Wie geschäftsmäßig das ist. Da schickt man Zug um Zug voll Soldaten an die Front, wo ihnen mit allen Mitteln nach dem Leben getrachtet wird. Die Getöteten verscharrt man an Ort und Stelle. Die Verwundeten aber werden zurücktransportiert, zusammengeflickt und wieder hinausgeschafft.
Durch weite Kartoffelfelder fahren wir der holländischen Grenze entgegen. Die Dämmerung bricht herein. Und als wir in Kaldenkirchen, der letzten deutschen Station, halten, ist es Nacht geworden.
Ein Mann mit einer Laterne geht durch den Gang. Dann stehen wir lange und rauchen im Dunkeln. Plötzlich hören wir draußen jemanden deutlich sagen: »Ja, der Zug kann nur bis Venlo fahren. Die Strecke nach Eindhoven ist unterbrochen.« Dann ist es still.
Wir horchen in die Finsternis und besprechen besorgt, was los sein könnte, lassen das Fenster hinunter, schauen nach Westen hinaus. Undurchdringliche Nacht. Vereinzelte schwere Regentropfen im kühlen Herbstwind. Irgendwo da draußen liegt wieder einmal die Front, von der man nie genau weiß, wie weit entfernt sie noch ist. Diese mühselig und sinnlos bewegte Grenze mit all ihrem angst- und tapferkeitserfüllten Leben, mit ihrer trügerischen Ruhe in der Nacht und lauernden tödlichen Waffen.
Langsam fährt der Zug an. Vorsichtig, wie in einen Bergschacht, tastet er sich durch die Nacht, die stumm, voll Geheimnisse vor uns liegt. »Dabei ist diese Strecke am Tage sicher nichts Besonderes«, sage ich. Und wir müssen über die bange Stimmung lachen, in die wir unwillkürlich geraten sind.
In Venlo stürmen wir den Wartesaal und sehen im Schein unserer Taschenlampen holländische Plakate, die, wie die Plakate und Ladenschilder jedes Landes, in Strich und Farbe etwas typisch Fremdes haben.
»Hier bekommst du nichts, wenn du kein holländisches Geld hast«, sagt mir ein Eisenbahner, als ich am Morgen in der Bahnhofsrestauration Kaffee bestellen will. Woher soll ich nur Gulden beschaffen? Irgendwas verkaufen. Am besten meine Stiefel. Die Schuhe passen mir ohnehin besser. Man kann mit ihnen länger marschieren und, wenn’s zurückgeht, auch schneller laufen.
So warte ich einen günstigen Augenblick ab, schlage die Stiefel in eine Decke und schlendere harmlos, vorsichtig, mit schlechtem Gewissen in ein nahes Viertel winkeliger Gassen. Alles blitzsauber. Die Mauern, Türen, Fenster mit Blumentöpfen. Kleine gepflegte Vorgärten, von weiß gestrichenen Zäunen umgrenzt.
An einer Quergasse schrecke ich zurück. Vier Soldaten kommen in eiligem Gleichschritt. Rasch in den nächsten Hausflur. »… sind gleich da. Noch ’ne Straße und dann links um die Ecke«, schlägt eine unternehmungslustige Stimme zu mir herein. »Und is’ sie ooch tatsächlich in Ordnung, die Olle, oder gibst du bloß an?« »Mensch, ich sagte dir doch, Titten wie ’n Ballon. Vorgestern hatte … st… her…«, verhallt das Gemisch aus Gespräch und Stiefelnägeln.
Als ich wieder auf die Straße trete, sehe ich sie, nun schon laufend, eine Querstraße weiter um die Ecke biegen. Ich muss die Sache rasch erledigen. Da mir gerade ein Holländer entgegenkommt, spreche ich ihn an. Er erschrickt zuerst. Ich schlage die Decke ein wenig zurück, zeige ihm die Stiefel. Da versteht er endlich.
Ängstlich sieht er sich um. Und führt mich in ein Haus und durch einen schmalen Gang, in dem es nach Bohnerwachs riecht, in eine weißgetäfelte Küche. »Sohn!«, sagt er und zeigt auf einen jungen Burschen, der, die Hände in den Hosentaschen, eine Zigarette im Mundwinkel, am Türstock lehnt und mich kalt ansieht. Die beiden scheinen misstrauisch zu sein. Da sie leise und holländisch miteinander sprechen, werde auch ich misstrauisch. Was für einen Keil hat doch dieser Krieg zwischen uns getrieben!
Wie viel ich dafür haben möchte, fragen sie mich. »Sagen wir … zwanzig Gulden?«, schlage ich unsicher vor. Zu meiner Überraschung sind sie sofort einverstanden. Vielleicht ist der Preis sonst höher. Unbeholfen schiebe ich das Geld in die Hosentasche. Sie bieten mir eine Tasse Kaffee an. Hoffentlich nicht vergiftet, denke ich einen Augenblick, während ich ihn trinke.
»Du, Decke verkaufen?«, fragt der Alte. »Nein, nein, die brauche ich unbedingt.« Plötzlich wird mir heiß. Ich habe es auf einmal eilig und bin froh, als ich endlich wieder unbehelligt im Bahnhof bin. Gerade rechtzeitig. Denn alles ist im Aufbruch begriffen. Ein Oberfeldwebel ist da, um uns geschlossen abzuholen.
Die Weiterleitungsstelle liegt in einem Schulhaus aus rotem Backstein. Der Oberfeldwebel führt uns durch die hallende Einfahrt in den Hof, lässt halten, nimmt uns die Papiere ab und ordnet an, dass niemand das Gebäude verlassen darf.
Das ganze Haus voll Soldaten. Doch die Besetzung ist nie die gleiche. Fast täglich kommen neue dazu, täglich werden welche abgeschoben. Zum Teil sind es Versprengte aufgeriebener Einheiten, die sich entweder in Gruppen oder einzeln durchgeschlagen haben. Viele von ihnen haben nichts mehr außer ihrem Brotbeutel mit den allernötigsten Dingen.
Unter diesen Versprengten gibt es einige schlaue Burschen, die die Gelegenheit, im Trüben zu fischen, nutzen und immer in dem Streifen Land zwischen der Front und den Weiterleitungsstellen herumvagabundieren. Sie sind nicht leicht zu fassen. Werden sie von einer Streife aufgegriffen, machen sie irgendeine unkontrollierbare Meldung und werden zu einer neuen Einheit geschickt, von der sie oft schon am selben Tag wieder verschwunden sind, bevor sie jemand als »Neue«, kennengelernt hat.
Im Speisesaal gibt es auch eine Kantine. Lärm. Biergläser. Verschiedenste deutsche Mundarten. Alles spricht von VORNE. An jedem Tisch ein paar Versprengte, die von der Front die tollsten Dinge erzählen. Jeder umringt von zaghaft staunenden Zuhörern, die aus dem Hinterland kommen. Viele Fragen stellen, nicht genug hören können und alles bis ins kleinste Detail wissen möchten.
Überall jene alte, prahlerische Rückzugstimmung. Jeder Versprengte ist, nach unglaublichen Heldentaten, der einzig Überlebende. Jeder trägt den Marschallstab im Tornister. »Mensch! Was haben wir nicht alles zurückgelassen! Was ist da nicht alles den Tommys und Amis in die Hände gefallen! Nie in ihrem Leben haben die solche Dinge gesehen!« »Und wie hinterlistige und undankbar sich die Zivilbevölkerung gegen uns verhalten hat! Doch wir kommen wieder zurück! Und dann geht’s diesem Gesindel an den Kragen!«
Unfassbar, dieser unsachliche Optimismus. Als ob es keine Wirklichkeit gäbe! Aber die Dümmsten sind ja immer am ehesten geneigt, einen Gegner zu unterschätzen.
Gegen drei Uhr nachmittags müssen wir im Hof antreten. Einige Leute werden in Marsch gesetzt. Wir kommen erst morgen dran und werden für diese Nacht auf verschiedene Klassenzimmer aufgeteilt. Die hallenden Gänge stinken nach verstopften Klosetts. Eine Abfalltonne. Aufeinandergetürmte Schulbänke. In den Klassenzimmern ist Stroh auf dem Boden ausgebreitet. An einer Wand unseres Raumes hängt eine lange Hakenleiste mit vielen hölzernen Haken. Darüber einige Märchenbilder. Die große, grau verwischte Tafel ist mit obszönen Zeichnungen vollgekritzelt.
Kaum sind wir da, tritt hinter uns ein Unteroffizier ein. Alle sind auf einmal eifrig beschäftigt. Ich stehe ihm am nächsten. Zu dumm! Da brüllt er auch schon: »SIE hier!«
Ich höre nichts.
»HE!«
Verdammt noch einmal! Idiot! Unendlich langsam drehe ich mich um.
»JA, SIE! Stellen Sie sich bloß nicht so stur an! Und noch der andere dort, HE! Ja, SIE! Kommen Sie mit!«
Also müssen wir eine Schulbank zur Feldküche hinuntertragen und dort zerhacken. Fluchend machen wir uns an die Arbeit. Die Willkür bei der Einteilung zu solchen Arbeitsdiensten hat mich oft wütend gemacht, ja, es gibt genug Soldaten, die sich allein aus diesem Grund lieber an die Front, als in die Kaserne wünschen.
Als wir fertig sind, bekommen wir vom Koch, einem dicken Unterfeldwebel, einen Klumpen Kunsthonig und etliche Stumpen. Das versöhnt uns wieder ein wenig.
Am Abend lege ich mich angezogen in eine Ecke aufs Stroh. Das Zimmer ist schlecht verdunkelt, wie man es oft bei Soldaten findet. Aber Fliegeralarme sind hier kaum zu befürchten. »Du musst dich nur immer an ein Dorf oder eine Stadt halten, wenn Flieger kommen. Da bist du sicher. Die schonen diese Brüder!«, sagt mein Nachbar, »während unsere nicht einmal die eigenen Leute …«
Ein unerbittlich schriller Pfiff reißt uns aus dem Schlaf. »In zwanzig Minuten marschfertig im Hof antreten!« Fröstelnd, verschlafen hören wir die Verlesung der Namen und bekommen unsere Soldbücher zurück. Die Schreibstube hat über Nacht ganze Arbeit geleistet. Man hat uns in kleine Gruppen eingeteilt, die jeweils zusammenbleiben müssen.
In französischen Viehwaggons rollen wir aus dem Bahnhof in die fremde, windige Ebene. Rote Bauerngehöfte, Felder, Windmühlen. Ein Panzergraben, tief in die gelbe Erde geschnitten. Schnurgerade stille Kanäle, Hindernisse für später.
Dann hält der Zug auf freier Strecke, an der Stelle, an der der Bahndamm vorgestern von Partisanen gesprengt wurde. Von den hohen Waggons springen wir auf den schlackigen Schotter hinunter, nehmen das Gepäck, das uns der letzte heruntergibt, in Empfang und stolpern nach vorn. Dürres, verbranntes Gras, ölige Schwellen. Die Lokomotive des verunglückten Gegenzuges hat sich tief in den Sand gewühlt. Zwei Waggons sind, völlig zertrümmert, gegeneinander getürmt und die folgenden zum Teil den Bahndamm hinuntergekullert.
Eisenbahner sind zusammen mit Pionieren bei der Arbeit. Sie tun sehr fachmännisch und kommandieren fast alle. Sie haben ihre Mützen aus den Stirnen geschoben. Die strähnigen Muskeln ihrer braunen, tätowierten Oberkörper glänzen verschwitzt in der Sonne. Und als wir schon einige hundert Meter weit weg sind, hören wir noch immer ihr rhythmisches: »Zuuuu … GLEICH! Zuuuu … GLEICH!«
»Wie hat sich das zugetragen?«, frage ich den Feldwebel, der unsere Gruppe führt, da ich ihn vorhin mit einem Eisenbahner sprechen gesehen habe.
»Sprengkörper haben sie gelegt«, erwidert er grimmig. »Ein Glück, dass es kein Personenzug war. Das ist auch das Einzige, was diese feigen Banditen können: Sabotieren und sprengen, statt offen zu kämpfen!« »Na und, hat man sie erwischt?« »Eben nicht. Dafür hat die Feldgendarmerie einen Haufen Holländer eingefangen und erschossen. War ohnedies zu wenig. In Russland hätten wir in einem solchen Fall das Zehnfache umgelegt.«
Ich sehe ihn von der Seite an. Riesiges Kinn, glattrasiert. Du empfindlicher Rohling, was für eine weiche Auffassung du vom Krieg hast! Gegnerische Partisanen nennt ihr leichtfertig Banditen, während ihr den eigenen – Schlageter, Andreas Hofer et cetera – großartige Denkmäler errichtet. Feindliche Kriegsmittel lehnt ihr ab, nicht aber den Krieg selbst. Und was ihr immer für Unterschiede zwischen den Slawen und den übrigen Europäern macht. Zehn Russen sind so viel wie ein Holländer oder ein Franzose.
Vor einem Bauernhof machen wir halt. »Seht mal nach, ob ihr nicht etwas Milch und Tabak organisieren könnt!«, sagt der Feldwebel. Ich bringe es nicht über mich, jemanden um etwas zu bitten, noch dazu Holländer.
Nach der kurzen Rast marschieren wir wieder nach Westen, in Richtung Weert, wo unser Divisionsstab liegen soll.
Saftgrüne Weiden. Pappeln. Getreideseen wellen im Wind. Hier und da zweigt ein Karrenweg ab, führt ins weite Land. Sandige, vielspurige Wege, die uns fremd bleiben und die für die Leute hier die einzige unersetzbare Heimat sind.
Das ist also Limburg, das Land, aus dem der gute Käse kommt, den ich als Kind neugierig in Schaufenstern gesehen, ohne mir unter dem Namen ein Land vorstellen zu können. Ein kurzes Stück durch ein Dorf marschieren wir auf einer harten, roten Backsteinstraße. Doch gleich hinter den letzten Häusern beginnt wieder das zähe, klebrige Asphaltband.
Anfangs haben wir noch gesprochen und gelacht. Doch allmählich sind wir immer wortkarger geworden. Der Rucksack drückt schwer. Durst. Flimmernde Hitze. Am liebsten möchte ich mich in den Schatten legen! Dem Gefreiten vor mir zieht der Rucksack die Schultern schief nach hinten. Sein roter Hals nickt rhythmisch wie der eines Zugpferdes. Sein Kochgeschirr und der Trinkbecher an seinem schaukelnden Brotbeutel klappern im Takt seiner kurzen, festen Säbelbeine.
»Wenn doch endlich ein Wagen daherkäme!«, knurrt einer. »Bloß kein Auto anhalten!«, sagt ein anderer, ein Versprengter. »Zu Fuß ist es sicherer!« Und er erzählt uns, dass hier Autos fast nur noch bei Nacht fahren. Denn die scharfäugigen, wendigen JABOS kreisen am Tag in großer Höhe und peitschen oft blitzschnell die Straßen entlang, um direkt aus der Sonne über Fahrzeuge herzufallen, sie in Brand zu schießen und Augenblicke später wieder, weit und flach am Horizont wiegend, zu verschwinden. »Wir kommen schon noch zurecht«, schließt er. »Wäre doch ein Wahnsinn, sich jetzt noch eine Kugel in den Bauch jagen zu lassen!«
In Weert übernachten wir in einer Kaserne, in der die abgezogene Divisionsstabskompanie untergebracht war. Am Abend durchstöbern wir kahle Räume. Zurückgelassene Papiere, leere Konservenbüchsen, Gerümpel. Ein Berg Gasmasken, gute Fallschirmjägerschuhe, Gewehrreinigungsgeräte. Es hat keinen Sinn, etliche Paar Schuhe mitzunehmen. Man hätte bloß schwer zu tragen und würde sie beim Rückzug ja doch wegwerfen. So suche ich mir nur zwei wasserdichte Gasplanenbeutel aus, die zum Verpacken von Schreibmaterial und Büchern geeignet sind.
In einem anderen Raum, der offenbar früher eine Schreibstube war, ein Hitlerbild, einige Fotografien von Flugzeugtypen, durchwühle ich die Fächer der beiden Schreibtische. Werfe Meldungsbögen und Wachbücher auf den Boden und finde zu meinem Erstaunen in einer Lade einen Stoß ungestempelter, unbeschriebener Marschbefehle und Fahrscheine, von denen ich, durch diesen unvermuteten Fund erregt, einige in meine Rocktasche schiebe. Dann hab ich auf einmal genug von der Herumsucherei.
Division, Regiment, Bataillon, Kompanie. Der alte Weg, den jedes kleine Rädchen der Kriegsmaschinerie zurücklegen muss, bis es an seinen Platz gelangt. Den stillen Noordervaart-Kanal entlang marschieren wir unter sonnigem, wolkenlosem Himmel in Richtung Loosen, wo unser Bataillonsstab liegt.
Schlingpflanzen. Bemooste Steine. Boote voll Wasser. Eine Zeit lang zieht links ein Wald mit uns, öffnet hie und da eine schmale, tiefe Schneise nach Süden. Präg dir alles ein! Wer weiß, was vielleicht schon in den nächsten Tagen …
Vom Bataillon werden wir sofort zum Verbandsplatz weitergeschickt, der in einem Gehöft am Ostrand des Dorfes untergebracht ist.
Ein Sanitätsunteroffizier erklärt uns an Hand der Karte die Lage der HKL: Unsere Kompanien liegen am nördlichen Ende des Zuid-Willems-Vaart-Kanals, wo dieser sich in einem anfänglich spitzen Winkel in den Canal de la Campine und den Noordervaart-Kanal gabelt.
»Die Bevölkerung von Loosen ist schon beunruhigt. Niemand weiß, wie er sich jetzt noch gegen uns verhalten soll«, sagt er, als wir in der Abenddämmerung auf Tragbahren vor dem Haus sitzen. »Sie lauern schon alle auf unseren Rückmarsch und fürchten sich doch davor, wie vor einer Operation. Jeder hofft, dass wenigstens sein Haus das Ganze gut überstehen möge. Man sieht hier auch nur noch alte Leute und Kinder. Die übrigen Männer, die Mädchen, das Vieh und die Fahrräder, werden versteckt gehalten.«
Zertrampelte Gemüsebeete vor uns. Ein Ziehbrunnen neben dem Schuppen. Weit draußen in der Ebene schwimmen vereinzelte Kugelbäume in flachen Nebelstreifen.
Nach Einbruch der Dunkelheit kommt der Unterarzt in einem Sanitätswagen angefahren und bringt vom Regimentsverbandsplatz ausgeheilte Kranke und vier Medizinstudenten, die infolge nicht bestandenen Physikums vom Studium abgelöst, an die Front geschickt worden sind. Sie haben keinerlei Erfahrung, prahlen aber ein wenig mit ihrem theoretischen Wissen.
Wir bekommen Rot-Kreuz-Ausweise, Armbinden, Sanitätstaschen, Verbandsmaterial und jeder seine »Eiserne Ration«. Dann werden wir vom Unterarzt auf die Kompanien aufgeteilt: Ich mit einem der Medizinstudenten zur Dritten. »Wir haben hier keinen Platz für euch«, sagt der Unterarzt. »Ihr müsst also wieder ins Dorf zurück und euch bei euren Trossen melden.«
Der Tross der dritten Kompanie liegt mit seiner Feldküche und einigen Gepäckwagen in einer Geflügelfarm, in der es aber kein einziges Huhn mehr gibt, wie uns der Furier bei der Begrüßung erzählt. Lauwarmer Kaffee, Brot und Vierfruchtmarmelade, ehe wir uns auf der Schreibstube melden müssen.
Der Spieß dürfte noch einer von jenen alten Soldaten aus dem Hunderttausendmannheer sein. Mit diesen Leuten hat es eine eigene Bewandtnis: Sie sind unglaublich zäh, werden nie krank und scheinen allen Situationen gewachsen zu sein. Mögen sie auch wie die Löcher saufen und um vier Uhr morgens sinnlos betrunken auf dem Boden ihrer Stube liegen, eine Stunde später sind sie wieder in der Lage, einen Tagesmarsch anzuführen, bei dem alle anderen eher zusammenbrechen als sie. Als Vorgesetzte sind sie meistens sehr scharf, aber unpersönlich gerecht und daher bei den Soldaten beliebter als die zu weichen Vorgesetzten.
Noch in der Nacht werden wir geweckt. Ein Obergefreiter von unserer Kompanie ist da, um uns mitzunehmen. Die glatte Straße hallt unter unseren Schritten, als wir durchs dunkle, langgezogene Dorf marschieren. Dann geht es über eine Brücke, von der uns der Obergefreite sagt, dass sie, wie die meisten Kanalbrücken in Holland, verschiebbar sei, da eine Schleuse unter ihr liege. »Aha!«, murmeln wir, nebeneinander übers feuchtkalte Geländer gebeugt, obwohl wir nichts sehen.
Dann tappen wir lautlos auf der Sandstraße einen Stausee entlang in einen Wald. Allmählich beginnt die erste zaghafte Dämmerung die Stämme und das stille Geäst der Baumkronen neblig-grau zu umspinnen.
Der Obergefreite erzählt uns, dass man ihm gestern auf dem Regimentsverbandsplatz zwei Zähne gezogenen habe, obwohl sie bestimmt noch zu retten gewesen wären. »Dieser Hund von einem Zahnarzt!«, sagt er immer wieder. »Wenn der mir im Frieden zwischen die Finger kommt! Alle Zähne würd ich ihm einschlagen!«
Wir wundern uns, wie regungslos die Front vor uns liegt. Doch der Obergefreite sagt, dass es erst seit einer Woche so ruhig sei, da sie drüben wahrscheinlich einen Großangriff vorbereiten, Tag und Nacht könne man Motorengeräusche herüberhören. Die ganze HKL sei daher schon mit wachsender Spannung geladen.
Noch in der Morgendämmerung treffen wir bei der Kompaniebefehlsstelle ein. Der Kompaniechef, ein junger, blonder Oberleutnant, rasiert sich gerade. Breitbeinig steht er in seiner Reithose da, nimmt kaum Notiz von uns und teilt uns, mit einem Taschenspiegel in verschiedene Richtungen deutend, zu den Zügen ein. Ich muss zum zweiten Zug, der etwa sechshundert Meter südlich von hier liegt. »Bleiben Sie nur ja in Deckung!«, ruft er mir noch nach. »Sonst knallen die von drüben Sie ab wie einen Hasen!«
2.
Die Zugbefehlsstelle liegt in einem Kiefernwäldchen gut gedeckt. Der Zugführer, ein untersetzter, sommersprossiger Oberfeldwebel, schreibt meine Daten auf und erklärt mir die Lage der Stellung. Sechzig Meter vor uns ist ein Damm. Dahinter der Kanal de la Campine, an dessen Westufer der Feind liegt.
»Wir kennen schon gegenseitig unsere Schützenlöcher«, sagte er. »Die MGs sind ganz darauf eingestellt. Kaum hebt einer den Kopf, schon fetzt einer von der Gegenseite drauf los. Deshalb werden Sie hier fast nur mit Kopf- und Halsschüssen zu tun haben.« Am Ende möchte er wissen, wie es zu Hause mit der Stimmung ist.
Soll ich ihm die Wahrheit sagen? »Na … nicht besonders«, Herr Oberfeldwebel, drücke ich verlegen herum. »Das hab ich mir gedacht. Die wollen wohl nicht mehr. Lüttjens!«, ruft er dann. Ein Unteroffizier, der mit einigen anderen am Wegrand sitzt, erhebt sich. »Das ist Unteroffizier Lüttjens, mein zbV. Er wird ihnen alles Nötige erklären. Haben Sie sonst noch eine Frage? Ich muss jetzt zum Chef.«
Der Unteroffizier führt mich in den niedrigen Bunker und zeigt mir meinen Platz. Sauber gefaltete Decken. Ein Fernglas. Kochgeschirre auf einem Wandbrett. »Wo kommst du denn her?«, fragt er mich, als ich, auf dem Strohlager kniend, meinen Mantel vom Rucksack schnalle. »Aus Wien.« »Was? Aus Wien bist du? Mensch, da lag ich vor zwei Jahren im Lazarett. Kennst du da zufällig eine Familie Wessely?« »Wessely ist bei uns ein häufiger Name.«
»Mensch, die haben eine hübsche Tochter. Schreibt mir jetzt noch manchmal.« Wir kriechen wieder aus dem Bunker und setzen uns zu den anderen auf den mit braunen Kiefernnadeln übersäten Waldboden.
Ein rothaariger Obergefreiter bietet mir eine belgische Zigarette an. »Der Zugführer ist nicht so arg«, sagt er. »Der tut bloß so zackig.« Er zieht ein riesiges Feuerzeug in Bombenform aus seiner Hosentasche. Große flackernde Flamme. Dann lehnt er sich an einen Baumstamm zurück und fährt, beim Sprechen den Rauch von sich blasend, fort: »Also wieder einer, den man zum Fallschirmjäger gemacht hat.«
Ich erwidere, dass ich gar keine Fallschirmjägerausbildung bekommen und dass man mich ohne vorherige Schulung …
»Da kannst du ohne Sorge sein, die haben wir auch nicht.«
»Wieso?«, frage ich erstaunt. »Seid ihr keine richtigen Fallschirmjäger?«
»Ach wo! Fallschirmjäger ist jetzt nur noch ein Name. Und eine Uniform. Du wirst über unsere Luftwaffe noch staunen. Nichts mehr da. Alles zur Infanterie gegangen.« »Das habe ich schon in Venlo gehört«, sage ich. »Aber wozu macht man denn das? Da könnten sie einem doch gleich zur Infanterie überstellen, wenigstens die Neueingezogenen.«
»Man sagt, dass es die anderen abschreckt, wenn sie etwas von deutschen Fallschirmjägern hören«, meint der Unteroffizier.
»Was die das schon abschrecken wird!«, sagt der Rothaarige. »Glaubst du, dass drüben die Mannschaft was davon erfährt? Und wenn schon, so greifen sie eben mehr mit ihrem Material als mit ihren Menschen an. Und dann gibt’s Zunder und uns geht’s wieder an den Kragen.«
»Die werden bald merken, was für einen zusammengewürfelten Haufen sie vor sich haben!«, stimmt ein anderer zu. »Das eine kaputte MG nur noch zur Zierde herumgeschleppt wird.«
»Der Zugführer ist eben ein Arschloch. Uns gegenüber reißt er sein Maul auf, aber kaum kommt so ein junger Leutnant daher, macht er sich vor Ehrfurcht glatt in die Hose.« »Dabei ist er im Gefecht nicht feige«, sagt der Unteroffizier.
»Ja«, lacht der Rothaarige auf, »da ist er sogar ein Draufgänger.« Und sie erzählen mir, dass dieser Zugführer auf ihrem Rückzug durch Nordfrankreich und Belgien selbst in den kritischsten Situationen, sich wirklich bewährt habe.
Inzwischen dürfte es sich herumgesprochen haben, dass ein Neuer da ist, denn es sind noch einige andere vom Zug dazugekommen. Einer von ihnen möchte wissen, was in der Heimat los ist, was man im Radio über die Front hört.
Ich erzähle von den Bombenangriffen, von verschärften Rationierungsmaßnahmen, dass die Leute zu Hause schon recht kriegsmüde sind. »Und was die Front betrifft, war ich sehr überrascht, dass sie schon so weit zurückgezogen ist. Nach dem OKW-Bericht müsstet ihr nämlich noch mindestens fünfzig Kilometer weiter im Westen liegen.« »Der ganze OKW-Bericht ist doch ein Schwindel!«, sagt der Rothaarige mit einer wegwerfenden Handbewegung.





























