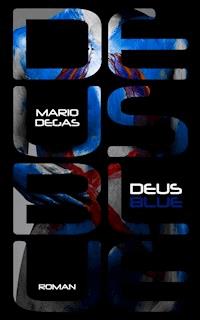
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Am 12. März 2066 verlor Sid Kindred Frau und Kind. Der Verlust ließ ihn nie wieder los. 20 Jahre später sucht Sean Leto immer noch nach seiner wahren Bestimmung. Als ein alter Weggefährte sich Hilfe suchend an ihn wendet, stürzt er sich in ein Abenteuer, welches sein Schicksal nachhaltig und unausweichlich zu verändern droht. Doch ist es mehr als der Zufall, der seinen Weg vorgibt; es ist Dankbarkeit, die ihn antreibt und seinem Ziel immer näher bringt: Sids Tochter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Degas
Deus Blue
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Die Wahl
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Widmung
Für Opa
Zitat
»Du bist nicht weggerannt!?«
1
Die Musik war schon da, als die Bäume kamen.
Ich stapfte durch den Wald, meinen Wald; inmitten der Natur blickte ich links und rechts. Ich war kleiner als in meiner Erinnerung, ein Kind noch, so schien es mir. Hände und Füße waren dort, wo man sie erwartete, baumelten teilnahmslos in der Luft oder taten Schritt für Schritt. Ein Gesicht hatte ich nicht, nicht hier, nicht jetzt. Schnell hatte ich mich an die Umgebung gewöhnt. Sie war mir keine Unbekannte, weder hier noch dort. Ab und zu verirrte sich ein Lichtstrahl durch die dichten Baumkronen, da, wo sie überall aus dem Boden sprossen, Titanen der Natur, einer größer als der andere und mit einer klaren Botschaft an die Menschheit: Wir sind noch hier, auch wenn ihr uns fast vergessen habt; wir gedeihen, existieren; wir leben.
Die Bäume flüsterten leise mit sich selbst, ihre Stimmen vom Wind in die Welt getragen. An diesem Ort, der mich so magisch anzog, vernahm man die Melancholie ihres Daseins. Ich kam mir einsam vor, trotz oder gerade wegen der Bäume, die in mir weder Freund noch Feind erkannten. Sie wogten hin und her und veränderten mit ihrem Schattenspiel die Landschaft um sie herum.
Doch nicht die Schatten beunruhigten mich: Was mir eine Gänsehaut bereitete, war die Stille. Weder der Wind mit seinem Geraschel noch das monotone Hin und Her der Zweige und Sträucher konnte diese Stille, die dem Verlust nachfolgte, vertreiben. Etwas blieb dem Wald fern. Etwas, das hier hingehörte. Der Flora fehlte die Fauna. Lerche, Reh und Wildschwein waren vielleicht einmal ein Bestandteil dieser Natur gewesen, doch nun waren sie es nicht mehr. Ihr Fernbleiben im Hier und Jetzt kündete von der akuten Lage der Situation. Kein Tier trieb sich mehr in diesen Wäldern herum; nirgendwo vernahm man noch das Scharren im Waldboden und das Grunzen zwischen Zypressen und Tannen.
Es war die wahr gewordene Vision der Zukunft, in der alles den Bach runterging. Doch was bedeutete das für mich, der ich hier war? Ich war ein Fremder und doch willkommen am Ort meiner Erinnerung. Hätte man mich wie einen Käfer zerdrückt, ich wäre einfach aufgewacht.
Plötzlich fing ich an zu laufen, rannte durch das flache Gras, vorbei an Mammutbäumen, immer weiter und weiter, fort von meinem Ausgangspunkt. Das Atmen verschaffte sich die benötigte Freiheit. Es war mir, als lauschte ich nicht mehr bloß den Bäumen und der Musik.
Die Sonnenstrahlen blendeten mich. Erst als ich eine gute Strecke zurückgelegt hatte, wurde ich wieder langsamer. Ich blickte nach oben, wo der Himmel all sein Blau aufbot. Mit der rechten Hand schirmte ich die Sonne so weit ab, dass sie mir nicht mehr die Sicht nahm und ich dennoch die Wärme auf meiner Haut genießen konnte. So schön und rein, neckte sie mich und ließ mich dabei vergnügt glucksen. Ich hatte sie schon vermisst, die Sonne, wie sie über uns schwebt und uns zum Lachen animiert. Gleichzeitig wünschte ich mir, ich hätte sie wahrhaftig gekannt, wüsste, wie sie war, als es sie für uns Menschen noch gab. Was ich kennengelernt hatte, waren bloß Geschichten, erzählt von denen, die mit ihr aufwuchsen. Doch wie die Sonne einmal aus dem Himmel herab schien, so schien sie seit einiger Zeit auch in mir. Ich meinte oder glaubte es zumindest, dass ich nur ihretwegen hier war. Sie war mir ein Trost, als ich ihn brauchte, und diente mir als imaginäre Zuflucht.
Unvorbereitet jagte mir ein Schauer über den Rücken, als wäre da noch eine Empfindung; etwas Kaltes, das sich wie ein Film über mir ausbreitete. Es war weit, weit weg und doch auf einmal so nah. Die Kühle gewann die Oberhand und vertrieb die wärmende Sonne.
Ich ging ein paar Schritte, blieb dann aber abrupt stehen. Ich war nicht mehr länger alleine im Wald – eine Person stand mir direkt gegenüber, keine zwanzig Schritte entfernt. Regungslos verharrte sie vor einem natürlichen Teich, auf dem einzelne Blätter trieben. Ich konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, in welche Richtung die Person schaute, denn ihr Gesicht war von einem weißen Schleier verdeckt; ein schöner Schleier, aber unvollkommen, denn da, wo ein Hochzeitskleid hätte sein müssen, trug sie etwas, das aussah wie das Fell eines Tieres, nein, das Fell mehrerer Tiere. Flicken von Tierfell und Tierhaut, willkürlich aneinandergereiht, über Brust, Bauch, Beine gespannt, verteilt über den gesamten Körper mit seinen weiblichen Rundungen. Es war, als würde sie die Tiere des Waldes auf ihrer Haut spazieren tragen – surreal, aber auf eine besondere Art schön, ein Fabelwesen, welches einer Fantasiewelt entliehen war. Der Anblick führte zu einer Veränderung an mir: Sie betraf meine Wangen, die sich nach oben wölbten und mir ein Grinsen ins Gesicht zauberten.
Ihre Arme und Hände bildeten die sprichwörtliche Ausnahme. Dort war sie ganz der Mensch, der sie unter all dem Schein zu sein schien. Bei genauerer Betrachtung sprang mir ein Detail besonders ins Auge: Am Ringfinger der linken Hand trug sie eine funkelnde Sache. Ich erkannte den Ring, der einmal ein Verlobungsgeschenk war. Sie trug ihn nicht mehr, sondern wieder.
Ich war so auf den Ring fixiert, dass ich nicht bemerkte, wie sich die Tierhäute und -felle von ihr lösten und zu Boden fielen. Es fing am Hals an und setzte sich bis zu den Füßen fort. Manche Teile lösten sich dabei schneller als andere, blätterten sanft ab oder zerbröselten in viele kleine Stücke. Mit der letzten Feder ging auch die Scham, und da stand sie nun, wie Gott sie schuf. Am Ende musste sogar ihr Schleier dran glauben. Doch statt ihres Gesichts sah man nur mehr eine Maske.
Mein Körper, jung, wie er war, verstand die Zeichen nicht – keine äußerliche Regung, kein Zucken der Schultern und kein Pochen der Lenden gingen von mir aus. Mein Geist jedoch, weit entfernt und doch so nah, setzte das Puzzle zusammen. Mein Gegenüber, die Frau, der ich mein Herz einmal geschenkt hatte, gab eine tadellose Vorstellung ab. Sie vereinte eine zurückliegende Vergangenheit, eine zur Wirklichkeit gewordene Gegenwart und eine vormals erdachte Zukunft auf sich. Der Ring, das Tierfell, der Schleier und die Maske – sie alle waren untrügliche Beweise für das, was hinter uns lag, uns ausmachte und verband; sie waren mir Nervennahrung und Wunschvorstellung zugleich. Ich wusste nur nicht auf sie zu reagieren, blieb ich doch immer noch wie ein Baum an Ort und Stelle stehen, umringt von den wahren Bäumen. Ich wartete auf ein Wort von ihr, doch ich wartete vergeblich – wenn einer sprach, dann war es der Wald.
So ergriff ich denn die Initiative: Ich setzte mich in Bewegung, ging langsamen Schrittes auf sie zu, ohne sie auch nur für einen kurzen Moment aus den Augen zu verlieren. Auf halbem Wege spürte ich einen Widerstand. Mein rechter Fuß hatte sich in einer Baumwurzel verhakt, die zuvor noch nicht dort war. Ich verlor das Gleichgewicht und stürzte wie ein Sack Steine zu Boden. Dabei sah ich immer und immer wieder den Fall aus meiner Perspektive, sah, wie sich meine Hände verzweifelt in den Boden krallten, um den Sturz zu federn, und sah, wie das Gras mir näher und näher kam.
Dann wurde es dunkel.
Das Flackern der Leuchtstoffröhre über mir holte mich zurück. Obwohl mein Gesicht völlig vom Wasser bedeckt war, vernahm ich das überschwängliche Blitzen nur zu deutlich, das den Raum ein ums andere Mal erhellte. Ich stützte mich vom Beckenboden ab, auf den ich flach und steif gelegen hatte, und tauchte mit dem Kopf voran auf. Sofort sprudelte Antonin Dvorak über mich herein. Aus den von der Decke hängenden Lautsprecherboxen ertönte seine Streicherserenade, die mir so vertraut schien. Ich blickte zum Rand des Beckens, wo, eingefasst in ein LED-Modul und halb vom Wasser bedeckt, die Ziffern 5 6 1 4 standen – ich hatte fast eine Stunde ausgehalten. Es war mein neuer persönlicher Rekord, nur wurde der von der Badeleitung nicht gerne gesehen, empfahl diese doch höchstens dreißig-minütige Ausflüge ins Reich der Träume – wie man das Abtauchen in die atembare Flüssigkeit auch nannte –, wollte man keine bleibenden Schäden – welche Schäden genau, verschwieg man – davontragen. Doch für einen Träumer war es schwierig, die Kontrolle über sich und seinen Geist zu behalten, machte dies doch den Kick aus. Jeder Gedanke war frei und inspirierte zum nächsten freien Gedanken, bevor beim nächsten Besuch vielleicht schon ein neues Erlebnis auf einen wartete.
Das Tadpole-Badehaus war eine der ersten Einrichtungen ihrer Art und dementsprechend schlicht aufgebaut. Die Kabinen, welche jeweils ein mannsgroßes Becken beherbergten, waren unscheinbar und auf Luxus, wie eine Heizlüftung, musste man verzichten – ein Missstand, über den ich hinwegsehen konnte, schätzte ich doch die Abgeschiedenheit des Bades und die damit einhergehende Diskretion. Jedes Mal, wenn ich eine Auszeit von der Arbeit oder der Wirklichkeit brauchte, verschlug es mich ins Wasser. Schlaf und Traum waren dabei das Ziel jedes Gastes. Und es stimmte: Nirgendwo war man seinen Träumen so nah wie in einem der Pole-Badehäuser.
Ich stieg aus dem Becken, war die Wärme doch bereits verschwunden, womit nur noch die Kälte blieb. Auf einem Stuhl neben der Tür lagen meine Jeans und das Shirt, daneben, unachtsam auf dem Marmorfußboden abgelegt, ein gesponsortes Handtuch in der Trendfarbe Schweinchenrosa. Ich trocknete mich eilig ab und schlüpfte in meine Klamotten. Dabei entging mir nicht die Überwachungskamera, die bewegungslos und einsam in der Ecke hing. Dass sie außer Betrieb war, erkannte man nur an dem durchtrennten Kabel. Jemand hatte dem Spuk wohl auf seine Weise ein Ende bereiten wollen. Mich schockten die Kameras nicht – nicht mal die im Bad –, hatte ich mich doch bereits an sie gewöhnt.
Unter meiner Jacke lagen mein Waffenholster samt Pistole und meine Dienst-Erkennungsmarke. Ich hängte mir das Holster um die Schultern und quetschte die Marke in die Hosentasche, bevor ich die Kabine verließ. Die Musik pausierte für einen kurzen Moment, als ich die dünne, die ganze Zeit über unverschlossene Tür öffnete und mit einem dumpfen Klicken ins Schloss zurückfallen ließ.
In die Gänge verirrte sich nur wenig Licht, sodass man sich an die meist weit entfernten Lichtquellen halten musste, wollte man den Weg nach draußen finden. Ich orientierte mich am blaustichigen Quadrat vor mir, welches mich geradewegs auf die Tür mit der Aufschrift »Realität« zuführte – das Wort war behelfsmäßig mit wasserfester Farbe angebracht. Rechts davon an der Rezeption kauerte ein junger Spund, ein Deck in der Hand, der mit sich selbst Bube-Dame-Ass spielte. Er blickte kurz auf und grunzte dabei, was man, wenn man es darauf anlegte, auch als »Hals- und Beinbruch« interpretieren konnte. An diesem Punkt gab es kein Zurück mehr: Die Realität hatte mich wieder.
Neu New York traf mich mit voller Wucht, doch ich war vorbereitet. Ich stand am Rand des Cardos, was Lärm, Lichter und noch mehr Lärm bedeutete. An jeder Hausfassade prangte mindestens eine Neonreklame; mal winzig klein, mal überdimensional groß und in XXL. Werbung und Propaganda hielten sich dabei die Waage; wichtig war die Präsenz auf den Straßen und das Vorhandensein im Gedächtnis der Einwohner dieser Stadt, die tagtäglich damit konfrontiert wurden. Was einem auch unmittelbar begrüßte, wenn auch nicht im beiderseitigen Einverständnis, war der Gestank nach Verwesung und Abfall, der durch die Schachtdeckel nach oben strömte, raus aus dem Untergrund, rein in die Oberwelt. Hier oben war man dies gewohnt. Es war wie mit dem Licht; es verfolgte einen auf Schritt und Tritt und ließ nie mehr ganz von einem ab.
Während einem der Gestank in der Nase hing – dem man sich immerhin zeitweise entziehen konnte – und einem die unzähligen Tafeln und Leinwände auf blendende Weise das Gelbe vom Ei auftischten, kristallisierten sich die Ahs und Ohs und das, was sonst noch so gesagt wurde, als ein Kauderwelsch unterschiedlichster Sprachen heraus. Ich verstand weder Chinesisch noch Russisch oder Suaheli, nur einige Brocken Latein hatte mir Quentin beigebracht. Und doch nannte ich es Heimat, weil es genau das war.
Es regnete wie so häufig, was der Betriebsamkeit am Cardo jedoch keinen Abbruch tat. Von überall strömten Menschen herbei, die die Straßen für sich beanspruchten. Ich stieg eine Metalltreppe hinab und entfernte mich durch das Gewühl der Menge vom Tadpole. Sofort sehnte ich mich nach einem Regenschirm, der schon lange zur Neu New Yorker Überlebensausrüstung gehörte. Wenn es auch so viel Ungewisses in dieser Stadt gab, auf eines konnte man sich fast immer verlassen: Regen.
Bis zu meinem Cloud waren es keine hundert Meter, weshalb ich mich eiligen Schrittes vorwärts zwang. Ich hatte an der Hauptstraße geparkt, wo ein Einsatzwagen der Polizei weniger auffiel. Als ich meinen Cloud erreichte, fiel mir das rote Blinken auf, welches schwach von der Frontscheibe des Wagens ins Innere schien. Ich wusste sofort: Es gab Arbeit für mich.
Ich berührte den Türgriff, worauf der biometrische Scanner meinen Fingerabdruck überprüfte. Es knackste leise, als sich die Schwebetür nach oben hin aufschob. Ich schüttelte noch schnell meinen Mantel ab, bevor ich mich in den Schalensitz warf und die Tür hinter mir zuzog. Der Lärm erstarb umgehend, indes sich der Umgebungssensor des Clouds einschaltete und das blinkende Display immer noch nach Aufmerksamkeit gierte. Ich schaltete den Bordcomputer ein. Dies setzte eine Kaskade von LEDs in Gang. Ein leises Surren begleitete die Elektronik bei ihrem Start. Auf der Frontscheibe baute sich derweil – halbtransparent – ein Schriftzug auf:
DIE EINHEIT – THE UNIT
Darunter erschien das Wort:
AUTORISIERUNG_ _ _
Ich führte das Ritual zu Ende, indem ich zur Mittelkonsole sprach: »Leto, Sean.«
Es war wie bei Sesam öffne dich, der Sendung auf dem überregionalen Kanal: Den Cloud konnte man, hatte man sich einmal Zutritt verschafft, ohne jegliche zusätzliche Kontrollen bedienen, was auch das Fliegen mit einschloss; wollte man jedoch in das System hinein, bedurfte es der Eingabe des bei der ersten Inbetriebnahme hinterlegten Namens mitsamt einhergehendem Abgleich des Stimmerkennungsmusters. Die Einheit wollte sichergehen, dass sich niemand Unbefugtes über die streng vertraulichen Dateien hermachte, war jeder Cloud doch so etwas wie ein Hochleistungscomputersystem im fliegenden Zustand und enthielt damit einen nicht unerheblichen Teil von Neu New Yorks Wissen.
Ich war dankbar für die Unterscheidung, hatte es doch seine positiven Seiten. Nicht bloß, dass es einem ein Gefühl von Sicherheit vermittelte – was nicht schaden konnte; was mich anging, so vergaß ich wenigstens nie meinen Namen.
Etwas prallte gegen die Karosserie und ließ mich wieder ernst werden: Ein älterer Mann hatte sein Gleichgewicht verloren und war auf die Motorhaube geknallt, in der Hand eine Flasche mit hochprozentigem Inhalt. Im nächsten Moment hatte er sich jedoch wieder aufgerappelt und stolzierte, flatterig wie ein Pfau auf den nächsten Wagen zu. Ich blieb derweil im Wagen und wandte mich wieder dem Computer und dem Blinken zu.
Mit der rechten Hand tippte ich MESSAGE in das kurz zuvor aufgepoppte Feld. Das rötliche Aufleuchten erstarb daraufhin und wurde von einem grünlichen »Die Farbe der Hoffnung«-Dauerleuchten abgelöst. Die Nachricht ließ mich jedoch innehalten:
»RÄUBER AM BAHNDEPOT«
»Räuber«, wiederholte ich flüsternd zu mir selbst. Sofort dachte ich an Quentin ... und an eben jenen Räuber mit der Hundeschnauze und dem Stummelschwänzchen. Wie lange war es her, dass wir ihn in der Natur zurückgelassen hatten? 15 Jahre? Vielleicht mehr? Es wollte mir in diesem Moment nicht einfallen, zu sehr war ich von der Nachricht überrascht. Sie wirbelte meinen Gedankenhaushalt wild durcheinander und sorgte für ein Schaudern. Ich hatte immer noch den rechten Arm vor der Frontscheibe erhoben. Unbeabsichtigt tippte ich das Wort Räuber an, woraufhin eine Erklärung aufsprang:
Räuber:
Einbrecher
Schurke
Dieb
Ich ergänzte die Auflistung in Gedanken: bester Freund. Spielkamerad. Tod.
Nur langsam fiel die Starre von mir ab. Ich beruhigte meine Nerven, indem ich mehrmals kräftig ein- und ausatmete, wie ich es in solchen Momenten immer tat. Was es auch war, ich musste zum Bahndepot und der Wahrheit ins Auge sehen.
2
Während des Fluges spürte ich die Anspannung. Sie war da, obwohl ich sie nicht wollte, nicht schon wieder. Meine Hände umklammerten das Steuerportal mit einem Druck, der ganz sicher für einen Abdruck auf der Gummierung sorgen musste.
Der Bordcomputer wies mir den Weg; die Navigationssoftware blendete allerhand Pfeile auf der Frontscheibe ein – die Sprache, die damit einherging, das Quäken der Computerstimme hatte ich vorsorglich deaktiviert. Ich brauchte weder das eine noch das andere, wusste ich doch, wo mein Ziel lag.
Über der Stadt war alles ruhig. Nur wenig Gegenverkehr machte sich links und rechts von mir breit, sodass ich gut und schnell vorankam. Ich flog die übliche Route, um in den C-Sektor zu gelangen. Dort lag verlassen, aber im Herzen Neu New Yorks gelegen, das Bahndepot.
Als ich die Grenze nach C überflogen hatte, wies die Elektronik mich darauf hin, dass ich in einem neuen Bereich angelangt war. Es war immer dieselbe Leier: Sobald man den Sektor oder die Ebene wechselte, reagierte der Cloud auf die Veränderung und quittierte dies mit einem volltönenden, manchmal nervtötenden Geräusch. Alles war zur Gänze durchchoreografiert, um einem zu helfen – um einem das Denken abzunehmen. Für den Piloten in seiner Luftschleuder diente es als Hinweis und Warnung zugleich: Achtung, hier herrschen andere Gesetze. Achte auf dich und deinen Untersatz.
Die Neonlichter und der Schein der Lampen reduzierte sich drastisch, je näher ich dem Rand Neu New Yorks kam. Was sich unter mir ausbreitete, war ein Vorgeschmack auf die Hölle, oder, wie wir es nannten, den Untergrund, der nur eine Etage tiefer unter dem Gestein der Oberschicht lag. Eines hatten Oberwelt und Untergrund gemeinsam: Beiden machte das Fernbleiben der Sonne zu schaffen, die gegen die undurchdringliche Wolkendecke keinen Stich schaffte.
Den C-Sektor dominierte einstmals geschäftige, aber jetzt bloß noch brachliegende Industrie. Fabriken, bereits nicht mehr in Betrieb, schlummerten kollektiv im Nebel. An jeder Kreuzung sah man halb verfallene Gebäude und Bürokomplexe, wovon nur noch wenige von Menschen bewohnt waren. Ich drückte einige Knöpfe auf der Mittelkonsole und bedeutete dem Cloud, sich in den Sinkflug zu begeben.
Das Bahndepot tauchte blass schimmernd vor mir auf. Die Züge, oder das, was noch von ihnen übrig war, funkelten in der Stille. Ich parkte vor dem Eingang zum Depot. Einen Moment dachte ich daran, meine Pistole ins Handschuhfach zu legen. Mein Verstand riet mir jedoch dazu, sie vorsorglich mitzunehmen. Ich wusste nicht, welche Art Räuber mich da draußen erwartete. Ich hoffte auf klein und flauschig, rechnete aber unterbewusst mit groß und gefährlich und damit einhergehend mit Herzschmerz statt einer unbändigen Freude als Teil des Wiedersehens. Seit der Botschaft dachte ich unentwegt an meinen kleinen Freund. Wer, wenn nicht Quentin, konnte sie mir geschickt haben? Sollte ich es für das halten, was es vermutlich nicht war: Einen Hinweis auf ein neues Experiment meines Ziehvaters, ausgeheckt im stillen Kämmerlein, um der Überraschung die Würze zu geben? Ich wusste es nicht. Aber am Ende triumphierten die grauen Zellen über den Rest. Ich prüfte die Pistole ein letztes Mal und steckte sie dann zurück ins Holster.
Als die Fahrertür aufschwang, war mir erst, als wäre sie nicht geöffnet wurden. An der anhaltenden Stille hatte sich nichts geändert. Dies, so sagte ich mir, hatte seine Gründe: Nirgendwo in der Oberwelt war es so ruhig wie tief in den Eingeweiden von Sektor C. Hier konnte man noch einsam sein.
Behutsam betrat ich das Depot, vorbei an einem Schild mit der Aufschrift Trains Ldt. Die Farbe der Buchstaben blätterte mit jedem Windzug mehr und mehr ab, sodass teilweise nur noch ein schwarzer Rand übrig blieb. Allem hier setzte die Zukunft zu; einer Zukunft, in der für Nostalgie außerhalb der Häuser und Wohnungen kein Platz mehr war.
Jeder kannte die Geschichte des Bahndepots, war mit ihr vertraut. Vor zwanzig Jahren fuhren vom Depot aus noch Züge quer durch Neu New York und in die Bezirke außerhalb. Hauptsächlich zu dem Zweck, Waren wie Klamotten oder Arzneien von A nach B zu befördern. Das alles geschah im Namen der Exekutive. Trains Ldt. war ein rein verstaatlichtes Unternehmen und lebte, wie man zu sagen pflegte, von der Hand in den Mund. Anfangs hielt es die Exekutive für kostengünstiger, Waren auf Schienen statt auf dem Luftweg zu transportieren. Doch die stetige Technologisierung machte auch vor den Zügen nicht halt. Bald schon sattelte man auf Luftschiffe um, die, effizient hoch hinaus kommend, als riesige Wolken am Himmel schwebten. Nur wenige Züge konnten dem Zerfall entgehen, diejenigen, die für den Personenverkehr unerlässlich waren und auf das Depot nicht mehr angewiesen waren. In meiner Wohnung stand die Miniaturausgabe eines dieser Kolosse, die ohne Unterbrechung 24 Stunden am Stück durch die Stadt und das angrenzende Umland fuhren.
Ich blickte mich um auf der Suche nach irgendetwas oder irgendjemanden. Das Depot war aufgegeben, ich wusste jedoch, dass es nicht verlassen war. Menschen nutzten die Fläche weiterhin, wenn auch nur äußerst selten zur Arbeit. Als im Untergrund der Platz zum Leben rar wurde, verschlug es viele Bewohner an die Oberfläche. Das Depot wurde ein Zufluchtsort für die Zugezogenen. Die stillgelegten Züge und ausrangierten Waggons wurden zu Schlafstätten und Wohnheimen umfunktioniert. Für die modernen Nomaden, die sich an diesem ihnen so neuen Standort niederließen, hatte es nicht besser laufen können.
Wenn da nicht die Exekutive gewesen wäre. Diese sah es nicht gerne, dass immer mehr Menschen, ob legal oder illegal, in die Oberwelt strömten. Recht bald wurde dem in Form der Einheit ein Riegel vorgeschoben. Sie sollte für Ordnung sorgen, wo diese bereits verloren geglaubt schien. Das Depot wurde geräumt. Familien verloren ihr Zuhause und landeten sprichwörtlich in der Gosse. Ich stand damals auf der Seite des Räumtrupps, auf der Seite der Einheit und gehörte zu den Gewinnern. Es war einer meiner ersten Einsätze für die Einheit. Jung und naiv, wie ich war, hätte ich alles getan, ohne mir zuvor darüber den Kopf zu zerbrechen. Heute wusste ich, dass es keinen Grund gab, die Menschen von hier zu vertreiben; heute zählte ich mich nicht mehr zu den Gewinnern. Ich zählte mich zu den Verlierern.
Das Heute war die Vergangenheit in der Gegenwart. Was hatte überwogen nach all der Zeit: Gewinner oder Verlierer?
Langsam zog sich der Regen zurück. Was blieb, waren die Wasserlachen entlang meines Weges und der Matsch unter meinen Schuhen. Ich stampfte an den Gleisen entlang, die tief in den Boden eingesunken waren oder öffentlichkeitswirksam über den Grund zu schweben schienen. Es waren Schienen nach alter Bauweise und nicht die so sehr nach Metall glänzenden Stahlplatten, die sich just in diesem Moment durch die Straßen Neu New Yorks schlängelten. Dieser Ort atmete das Vergangene auf jedem Quadratmeter. Vor mir türmte sich der Kadaver eines Zuges auf, die Lok verschmiert mit Graffiti; der Stahl verbogen und deformiert. Viele Waggons waren noch mit Holz verkleidet oder waren es zumindest einmal gewesen. Überall lag Holz verteilt herum, abgesplittert oder abgerissen.
In der Ferne hörte ich den Antrieb eines Clouds, der weit über mir dahinschoss – nicht auszumachen am Horizont, da verdeckt von all den anderen Wolken.
Ich stand jetzt inmitten des Bahndepots flankiert von Verfall und Aufgabe. Wie ich es häufiger tat, blickte ich auch jetzt auf mein Handgelenk, wo der Zeiger meiner Uhr sich unnachgiebig links herum drehte und nicht, wie üblich, rechts. Ein Unikat, war das Zifferblatt meiner Uhr doch ab Werk spiegelverkehrt. Es war kurz nach halb sechs am Abend. Schon so spät, dachte ich bei mir. In einer halben Stunde würde sich das Alarmsignal meiner Uhr bemerkbar machen, mich vertreiben oder erinnern. Ich hoffte auf die Zeit, die mir zeigen würde, was für meine Augen noch unsichtbar war.
Kaum hatte ich darüber nachgedacht, spürte ich eine Regung, die nicht von mir ausging. Ich war plötzlich kein einsamer Cowboy mehr.
»Detective«, sprach eine tiefe Männerstimme direkt hinter mir. Ich drehte mich geschwind auf dem Absatz herum.
Ein Mann stand zwischen zwei Waggons. Er sah alt aus, geradezu zerbrechlich. Mit seinem zerzausten schulterlangen Haar und dem langen, zerfledderten Stoffmantel um seine Schultern entsprach er nicht dem Archetyp eines Kriminellen. Dennoch griff ich instinktiv an meine Pistole, zog sie aber nicht aus dem Holster. Ich wartete auf ein weiteres Wort oder sogar einen ganzen Satz – doch weder das eine noch das andere kam.
Er machte keinerlei Anstalten den Hampelmann zu spielen und blieb dabei ruhig und gelassen auf einem Punkt stehen. Seine Augen suchten nach etwas in meinem Gesicht.
»Sind Sie der Räuber?«, fragte ich in einem freundlichen Tonfall. Er antwortete nicht.
Etwas ging von ihm aus, es war aber keine Gefahr. Ich schätzte mein Gegenüber auf Mitte sechzig, betrachtete das Gesicht, die Furchen um Nase und Mund, die Falten auf der Stirn.
»Ein Sturm zieht auf«, kam von ihm.
Ich sah hoch zum Himmel, erblickte aber keine bedrohlich wabernden Wolken, die sonst immer einem Sturm vorausgingen.
»Sind Sie der Auslöser?« Standardfrage Nummer eins. »Haben Sie sich Hilfe suchend an die Einheit gewandt?« Standardfrage Nummer zwei. Ich fügte – nicht mehr nach Lehrbuch – hinzu: »Haben Sie nach uns verlangt?«
»Nach Ihnen«, antwortete er. »Nur nach Ihnen, Detective.«
Ich musterte ihn noch eingehender, als ich es bereits schon getan hatte: »Kennen wir uns?«
»Du hast dir Rang und Titel zu eigen gemacht, wie ich sehe. Und doch fällt es dir schwer, dich zu erinnern!?« Er schloss die Augen, öffnete sie dann aber wieder abrupt. »Was ist von deiner Vergangenheit geblieben?«
»Sagen Sie mir Ihren Namen, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen«, entfuhr es pflichtschuldigst meinen Lippen.
»Was ist ein Name wert, wenn die Geschichte bereits geschrieben steht, Sean?«
Ich war erstaunt: »Sie wissen, wer ich bin?«
»Der kleine Sean; das warst du einmal. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wer du jetzt bist.« Er zeigte mir ein Lächeln. »Als ich dich fand, warst du zwölf. Eine einsame Seele, die von ihrer Mutter im Stich gelassen wurde.«
»Wer sind Sie?«, wollte ich noch einmal wissen. Diesmal mit mehr Nachdruck.
Er schien davon unbekümmert: »Du hattest die Wahl, ob du bei deiner toten Mutter bleiben oder das Risiko eingehen solltest, eine neue Familie zu finden. Weißt du noch, wie du dich entschieden hast?«
»Woher wissen Sie das von meiner Mutter?«
»Dass sie dir geraubt wurde?« Es war eine Frage, die mich aufs Geratewohl traktierte. Ich dachte, ich hätte dieses Kapitel als geschlossen abgetan und den Schlüssel irgendwo tief in mir vergraben. Jetzt grub ein mir Fremder ihn vor meinen Füßen wieder aus.
»Es waren die Drogen und der Alkohol.«
»Dante und Vergil«, ergänzte er.
»Ihr Wissen ist weitverbreitet«, sagte ich, nicht ohne Ironie, um der Situation die Anspannung zu nehmen.
»Ich weiß einiges und doch ist es nicht genug. Dass Quentin dich bei sich aufnahm, ist jedoch kein Geheimnis.« Quentin ... »Er war dir ein Vater, als du einen am dringendsten brauchtest. Und Räuber ...« Er unternahm eine kurze Pause. »Räuber mochtest du sofort.«
Ich wusste nicht, was ich sagen, noch wie ich auf all das reagieren sollte. Es kam mir geradezu unwirklich vor, diesen Mann vor mir zu haben, der mich so sehr kannte, wobei ich nicht wusste, wer er war. Mutter, Quentin, Räuber, ja, selbst mich, Sean – er konnte Kapitel aufsagen, in denen sie alle mitspielten.
Ich beschloss, in die Offensive zu gehen: »Warum beantworten Sie nicht meine Fragen?«
»Dafür ist es noch zu früh, für anderes ist es wiederum zu spät. Sobald du dazu bereit bist, wirst du selbst die Antworten auf all deine Fragen finden.«
»Wofür bereit?«
Er sah sich in der Gegend um, als würde er nach jemandem Ausschau halten.
»Wir haben nicht mehr viel Zeit, Sean.« Zügig griff er an die Innenseite seines Mantels. Ich reagierte blitzschnell und zog meine Pistole. »Sachte, Mister.« Ich zielte auf sein Knie.
Er hielt erst in der Bewegung inne, kramte dann aber dennoch in seiner Tasche herum. Zum Vorschein kam ein matt schimmernder Gegenstand. Keine Waffe, so viel stand schnell fest, woraufhin ich dazu überging, meine Pistole an der Seite herabbaumeln zu lassen, jedoch jederzeit wieder bereit, mich einer plötzlich auftretenden Gefahr zu stellen.
»Du müsstest wissen, was das ist. Gerade jetzt, wo du selber ein Rad im Getriebe der Einheit bist.« Er warf den Gegenstand vor mir in den Schlamm, damit ich ihn besser sehen konnte. Es war eine Polizeidienstmarke der Einheit von Neu New York. Ich hob sie auf und fuhr mit dem Daumen darüber. Das Metall fühlte sich warm und kalt an. Das Logo war teilweise verdeckt, von etwas, das nach blauer Farbe aussah, die bereits zur Gänze eingetrocknet war und sich nicht mehr abkratzen ließ.
Der Alte sprach weiter: »Sie kamen an einem Zwölften; Polizeimänner. Sie stürmten das Gebäude, in dem ich mich zu der Zeit mit meiner Frau Mel aufhielt.«
Bei der Aussprache des Namens blickte er nach oben hoch zu den Wolken, wobei sein Adamsapfel sichtbar auf und ab hüpfte.
»Sie war schwanger. Der Zwölfte war der Tag, an dem sie unsere Tochter gebar. Ich war auf dem Weg zu ihr, um sie zu ermuntern und ihr bei der Geburt beizustehen, wurde aber aufgehalten.« Er deutete auf die Marke in meiner Hand. »Allein Mels Schreie trieben mich voran. Ich war verzweifelt und wollte zu ihr, nichts ahnend was mich erwarten würde.«
Er versuchte eine Träne zu unterdrücken, was ihm aber nicht gelang.
»Ich kam zu spät.«
Mir versetzte das Geschilderte einen Stoß. Was blieb, war ein mulmiges Gefühl. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Mel lag bereits im Sterben, als ich sie im Hof fand – blutüberströmt und in Tränen aufgelöst. Wie so oft stand Gott an diesem Tag nicht auf unserer Seite. Er nahm mir den Menschen, den ich über alles liebte. Doch ...« Er fixierte mich so plötzlich, dass mir der Atem stockte. »Unsere Tochter hat es geschafft. Zoe hat es geschafft. Sie lebte.«
»Zoe ...?« Kaum hörbar sprach ich den Namen aus und schnappte dabei nach Luft.
Er tat dasselbe. »Wenn der Preis auch hoch war: Drei der apokalyptischen Reiter hatten wir zu diesem Zeitpunkt bereits vertrieben.«
Im Stillen ging ich sie durch: Sieg, Krieg und Hungersnot, sofern er die ersten drei meinte.
»Doch dem vierten und letzten Reiter konnten wir nicht entkommen.«
Furcht, Krankheit, Niedergang; auch genannt: der Tod.
»Sid.« Ich wusste nicht, warum er mir plötzlich in den Sinn gekommen war.
Er schaute betreten drein, nur um mich im nächsten Moment mit seinem Blick zu durchbohren. Dieser eine Blick genügte; er machte uns aufs Neue miteinander bekannt.
»Die Erinnerung, wie!?«
»Ich wusste, dass da noch etwas ist.«
»Irgendwann tut man gut daran.«
Ich versuchte, mehr aus ihm rauszubekommen: »Wo ist sie jetzt? Deine Tochter?«
Er musste erst wieder seine Abgründe heraufbeschwören: »Ich habe sie überall gesucht. Mein Schutzschild, meine Göttin ...« Konsterniert schüttelte er den Kopf.
»Du weißt es nicht!?«, stellte ich fest.
»Nein.« Das Schütteln hörte gar nicht mehr auf. »Die Einheit streckte mich nieder, nahm mir Frau und Tochter und warf mich in eine dunkle Gefängniszelle. Neun Jahre lang aller Hoffnung beraubt, war ich niemands Niemand. Bevor ich ein Vater sein konnte, wurde es schwarz um meine Zukunft. Ich konnte nicht wissen und wusste es auch nicht. Zukunft?« Er stockte, dann: »Gefängnis.« Seine Miene erhellte sich kaum merklich: »Bis heute. Denn jetzt bist du hier.«
Ich lauschte und wagte es nicht, etwas zu sagen.
»Ich war mir sicher, dass du hierherkommen würdest. Räuber ließ dich nicht mehr los. Mit der Vergangenheit konnte ich dich ködern und die Vergangenheit ist es auch, die ich von dir will. Du bist hier und ich brauche deine Hilfe.«
Ich sah die vier Reiter, wie sie wild tobend in Kampfstellung auf mich zugaloppierten.
»Du glaubst, ich kann sie finden?«
»Nein, ich glaube es nicht.« Wieder eine Pause. »Ich weiß es. Der Glaube war mir in den letzten Jahren kein treuer Begleiter. Ich konnte mich nicht auf ihn berufen, wenn es darauf ankam, und werde es wohl auch nie können, solange mein Herz noch schlägt. Verlassen kann ich mich nicht auf ihn, noch auf sonst irgendjemanden. Mit einer Ausnahme.«
Ich wollte auf ihn zugehen, aber er bedeutete mir mit einer Handbewegung, auf Distanz zu bleiben. Ein Hustenanfall begleitete die Geste. »Ich bin krank und langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende. Mein Gedächtnis hat nachgelassen und mit der Kraft steht es auch zum Schlechten. Leider werde ich nicht jünger, noch gesünder.« Von seiner Stimme war jetzt kaum mehr als ein Flüstern zu hören.
Ich blendete die Waffe in meiner Hand aus. Einen Feind sah ich nicht vor mir. »Du erinnerst dich noch an so viel«, versuchte ich ihn zu motivieren.
»Die Erinnerung hat viele Gesichter. Und auf die Perspektive kommt es schon lange nicht mehr an. Deine Mutter? Räuber? Mel? Selbst Zoe?«
Überraschend setzte er sich in Bewegung und schlurfte zur offen stehenden Tür des Waggons zu seiner Rechten. Ich behielt ihn dabei im Auge. Irgendetwas wurde im Inneren des Waggons angehoben und zur Seite gelegt, nur konnte ich nicht sehen, was es war.
»Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, kaum dass ich wieder in Freiheit war. Ich dachte auch schon einmal, ich hätte Zoe gefunden – keine zwei Jahre ist dies her.«
Als er einen Schritt zurücktat, sah ich, dass er etwas in seiner Hand hielt. Nur dieses Mal war es keine Marke.
»SID«, schrie ich. Panik und Unbehagen schlugen um mich.
Es war eine Pistole und ich zweifelte nicht eine Sekunden daran, dass sie echt war.
Ich riss den Arm hoch und legte abermals auf ihn an.
»Mach jetzt keine Dummheiten.« Er stampfte zu seiner alten Position zurück. »Ich bitte dich, Sid. Leg die Waffe weg.«
Als er nicht reagierte, rief ich noch einmal lauter: »SID.«
Der Erfolg war anders, als ich ihn mir erhofft hatte: »Jeder Anfang ist schwer, so wie jedes Ende schwer ist, wenn es denn unausweichlich scheint. Dass das Ende kommt, wissen wir, doch wann es uns heimsucht, wissen wir in der Regel nicht. Das kostete Mel das Leben, so wie es meines veränderte.« Er streichelte behutsam über den Lauf der Pistole. »Hör mir gut zu, Sean.«
Zitterte ich?
»Die Lösung liegt zu deinen Füßen, sobald die Gegenwart in die Zukunft übergeht. Sei mein Sturm, werde mein Räuber. Grabe in meinem Innersten, am Ort meines Selbst; nutze die Kunst und finde den Schutz, den ich dir gab. Ich bürdete dir eine Last auf und werde sie dir wieder aufbürden. Diese Last treibt dich weiter zu dem, der du bist. Denn du bist ich. Und du weißt es. Gehe den Weg, den du mit mir gingst. Am Ende wirst du es sehen ...«
Tausend Fragezeichen schwirrten vor meinem Kopf herum: »Sehen, wer ich bin?«
»Sehen, was sie sieht. Mit Zoes Augen sehen. Das bist du ihr schuldig. Finde sie, nicht meinet-, sondern ihretwegen. Sie muss wissen, wer sie ist.«
Ich klammerte mich an einen zerbrechlichen Strohhalm: »Wir werden sie gemeinsam finden, Sid.«
Er lächelte. »Ja, das werden wir.«
Ein mir nur allzu bekanntes Rauschen näherte sich mit rasendem Tempo. Es befand sich weit weg und im nächsten Moment fast direkt über uns.
Sid hatte sich bereits entschieden. Er schloss die Augen und senkte den Kopf. »Verzeih mir, Sean.«
»NEIN.«
Ein Licht von oben blendete mich. Im selben Augenblick schrie ich auf, sprintete los, als der Schuss auch schon die Eintracht durchriss. Ich strauchelte, fing mich aber sogleich wieder. Alles geschah so schnell. Im Bruchteil einer Sekunde war es vorbei.
Als der Kegel des Suchscheinwerfers über mir abzog, sah ich dem Tod ins Antlitz.
Sid hatte die Waffe gegen sich selbst erhoben. Sein lebloser Körper lag eingesackt zwischen den Schienen. Die Waffe lag rauchend daneben, ihren ehemaligen Inhalt verschossen. Es war nicht schwer, zu erkennen, wo die Kugel steckte: Aus Sids Kopf rann Blut, welches sich unaufhaltsam auf die Steine ergoss und sich mit dem Matsch darunter vermischte.
Mein Herz raste und drohte jeden Moment aus meiner Brust zu springen. Ich machte mich bereit, es aufzufangen, spürte aber umgehend die Hitze, die aus meinen Knochen Wackelpudding machte. Flugs knickte ich ein und fand mit meinem Knie den Boden.
Zoe. Ihr Name war Zoe.
Hinter mir vernahm ich das Zischen der Flügeltüren. Jemand kam schweren Schrittes auf mich zugestapft.
»Partner.« Diese Stimme. »Sean.« Viggo. »Alles okay bei dir?«
Ich erkannte aus dem Augenwinkel die 2 – für Second Detective –, die in seine Uniform eingestickt war.
»Mir scheint, der Zug ist bereits abgefahren.« Eine andere Stimme, etwas weiter weg noch, die ich nicht zuordnen konnte.
Ich erhob mich langsam und drehte mich halb zu beiden um. Viggo legte dabei seine Hand auf meine Schulter.
»Was ist hier passiert, Sean?«
Ich sah den Leichnam an – Sids Leichnam. »Er hatte eine Waffe«, antwortete ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
»So wie du!?« Er musterte meine Pistole, die ich im Anfangsstadium einer Paralyse, so schien mir, immer noch umklammert hielt.
Ein junger Kerl, Typ Streifenpolizist in Ausbildung, stampfte an uns vorbei und ging vor dem Leichnam in die Hocke.
»Nicht anfassen«, gebot ich ihm, hörte mich dabei aber alles andere als überzeugend an, weil Schwäche und Müdigkeit die Worte umrahmten.





























