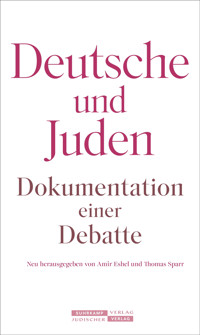
Deutsche und Juden E-Book
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Deutsche und Juden – ein ungelöstes Problem« hieß eine Diskussion, die im August 1966 im Rahmen des Jüdischen Weltkongresses in Brüssel stattfand. Fünf Männer ungefähr einer Generation, Deutsche und Juden, fragten, was beide Nationen verbindet und was sie trennt, berichteten von ihren Erfahrungen, Ängsten und Hoffnungen. 21 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Shoah, ein Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel kamen Historiker und Politiker zum ersten Mal öffentlich zusammen, um sich auszutauschen. Die Konfrontation blieb nicht aus, ungelöste historische Fragen kamen auf, die sich mit politischen Beschwichtigungen nicht aus der Welt schaffen ließen. Diese Debatte dauert bis heute an.
Dieser Band dokumentiert die Beiträge, die damals in der edition suhrkamp erschienen, und ergänzt sie durch neue Beiträge, die das spannungsvolle Verhältnis zweier Nationen neu beleuchten und zeigen, was Deutsche und Juden verbindet, was sie trennt.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Deutsche und Juden
Dokumentation einer Debatte
Mit einem Vorwort von Amir Eshel und Thomas Sparr
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Der Band Deutsche und Juden erschien 1967 im Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main (edition suhrkamp 196).
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe im Jüdischen Verlag.
© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-633-77954-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
»Deutsche und Juden«. Vorwort von Amir Eshel und Thomas Sparr
Quellen
Literatur
Einleitung
Nahum Goldmann
Vier Reden
Gershom Scholem
Golo Mann
Salo W. Baron
Eugen Gerstenmaier
Grußbotschaft von Karl Jaspers
Bibliographische Notiz
Anhang
Peter Szondi: Über
Deutsche und Juden
Fußnoten
Informationen zum Buch
»Deutsche und Juden«
Vorwort von Amir Eshel und Thomas Sparr
Am 4. August 1966 fand während des zehntägigen Jüdischen Weltkongresses mit Hunderten von Delegierten in der belgischen Hauptstadt eine Diskussion über »Deutsche und Juden – ein ungelöstes Problem« statt. Eingeladen hatte der damalige Präsident des Jüdischen Weltkongresses Nahum Goldmann, der sowohl das Thema setzte wie die Diskussionsteilnehmer auswählte: fünf Männer, die im Wesentlichen einer, nämlich seiner, Generation angehörten. Zwei davon waren jüdische Historiker, drei nichtjüdische Deutsche, unter diesen wiederum waren ein Historiker, ein Politiker und ein Philosoph. Sie alle waren aus Israel, den USA und aus Deutschland angereist. Der Philosoph Karl Jaspers hatte aus Basel eine Grußbotschaft gesandt, die verlesen wurde.
Beim Attribut »nichtjüdisch« muss man sogleich einschränken: Golo Mann stammte mütterlicherseits aus einer jüdischen Familie, Karl Jaspers war durch seine jüdische Ehefrau Gertrud, von der er sich nicht trennte, dem nationalsozialistischen Terror, der Entrechtung und Bedrohung besonders ausgesetzt. Das galt auf andere Weise auch für Eugen Gerstenmaier.
Einundzwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit Millionen von Toten, darunter sechs Millionen von Deutschen ermordeten Jüdinnen und Juden, trafen sich zum ersten Mal offiziell Deutsche und Juden, um über ihre geteilte Vergangenheit, ihre Gegenwart zu sprechen und einen Blick in die getrennte wie die gemeinsame Zukunft zu wagen.
Die Einladung von Nahum Goldmann zu dieser Diskussion auf dem Jüdischen Weltkongress ist ein fast schon vergessenes historisches Ereignis. Sie war damals ein Politikum – was den Ort anging, Brüssel, das langsam zum Zentrum der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft heranwuchs und die Zentrale der Nato beheimatete. Eine deutsch-jüdische Zusammenkunft wie diese wäre damals in Deutschland noch undenkbar gewesen. Auch der Zeitpunkt, ein Jahr nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel, war politisch aufgeladen; 1966 war auch das Jahr, in dem der 90-jährige Konrad Adenauer zum ersten und einzigen Mal das Land besuchte, und sein Aufenthalt in Jerusalem hätte fast in einem Eklat geendet.
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten war eine Voraussetzung der Brüsseler Zusammenkunft. Deutsche und Juden begegneten sich von 1965 an formal und protokollarisch als Bürgerinnen und Bürger souveräner Staaten: als Deutsche und Israelis. Das war keine Selbstverständlichkeit, die DDR unterhielt während der 41 Jahre ihrer Existenz zu keiner Zeit diplomatische Beziehungen zu Israel. In Visaangelegenheiten und ähnlichen Fällen wurden die rumänischen Botschaften in Tel Aviv und Ostberlin tätig.
Natürlich gab es auch vordem Begegnungen und Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland, etwa im Handelsverkehr. Es gab eine israelische Handelsmission in Köln, eine deutsche in Tel Aviv. Deutsche Rüstungsfirmen lieferten bereits in den 1950er Jahren Waffen nach Israel. Doch Westdeutschland hatte lange gezögert, außenpolitisch vollwertige Beziehungen zum jüdischen Staat aufzunehmen, um nicht die traditionell guten Beziehungen zu arabischen Staaten zu gefährden.
Der 1936 in Genf von Nahum Goldmann mitgegründete World Jewish Congress vertritt bis heute in über 100 Ländern jüdische Gemeinden und Organisationen und setzt sich gegenüber Regierungen, Parlamenten und Organisationen für die Belange seiner Mitglieder ein. Man nennt ihn auch »den diplomatischen Arm des jüdischen Volkes«. Früher war er insbesondere bei Entschädigungsfragen von Jüdinnen und Juden nach der Zeit des Nationalsozialismus involviert, bei Ansprüchen seitens Israels, auch bei Initiativen gegen Antisemitismus. Heute nimmt er unter anderem eine aktive Rolle bei der Einschätzung des Kriegs der Hamas gegen Israel nach dem 7. Oktober 2023 ein.
Das Thema »Deutsche und Juden – ein ungelöstes Problem« greift eine Gedankenfigur des späten 19. wie des frühen 20. Jahrhunderts auf, mit der vor allem Juden »Deutschtum« und »Judentum« verglichen. Heinrich Heine sprach von der »innigen Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Völkern der Sittlichkeit, den Juden und den Germanen«, Hermann Cohen veröffentlichte 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, seine Schrift »Deutschtum und Judentum«, in der er den deutschen Idealismus mit dem jüdischen Monotheismus in Analogie setzte. Deutschland sei, heißt es an anderer Stelle, »das Mutterland der abendländischen Judenheit«; es gebe so etwas wie »eine seelische Verwandtschaft von Deutschtum und Judentum«.
In Was ist Deutsch? konnte Dieter Borchmeyer zeigen, dass auf diese Frage Juden und Jüdinnen die tiefsten, nachhaltigsten Antworten gegeben haben. Doch nicht nur Juden haben den Mythos von einer besonderen deutsch-jüdischen Wahlverwandtschaft genährt, auch Deutsche haben daran mitgewirkt, vor allem der Dichter Stefan George mit seinem Bild von den »verkannten Brüdern«. Die Intensität und Leidenschaftlichkeit der jüdischen George-Rezeption erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass Georges Lyrik ein Bild von Juden schuf, das ihnen erlaubte, zu sein, was ihnen in der Wirklichkeit verwehrt blieb: Deutsche und Juden. George schuf den Mythos von einer deutsch-jüdischen Wahlverwandtschaft, einer inneren Ähnlichkeit von Deutschen und Juden.
»Deutsche und Juden« war auch das Lebensmotiv Nahum Goldmanns, sowohl aus biografischen Gründen wie auch in seinem Nachsinnen über seinen Lebensweg. 1894 im damals russischen Vishnevo geboren, kam er 1900 als Kind nach Frankfurt am Main, wo der Vater, ein früher Zionist, in der jüdischen Gemeinde unterrichtete. Goldmann studierte in Marburg, Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaft und Philosophie und bereiste 1913 für einige Monate das damals unter osmanischer Herrschaft stehende Palästina. Anschließend veröffentlichte er das Buch Eretz Israel. Reisebriefe aus Palästina. Er arbeitete als Journalist und Autor und begründete 1929 zusammen mit dem Schriftsteller und Philosophen Jakob Klatzkin die Encyclopaedia Judaica, ein Pionierprojekt jüdischer Kultur und Wissenschaft in der Weimarer Republik. Goldmann entkam der Verhaftung durch die Nationalsozialisten nach der Machtübertragung, weil er sich 1933 zur Beerdigung seines Vaters in Palästina aufhielt.
Nachdem ihm die deutsche Staatsangehörigkeit 1935 entzogen worden war, ging Goldmann nach New York, wo er eine Schlüsselrolle bei der Gründung des Jüdischen Weltkongresses einnahm. Über Jahre repräsentierte er zudem die Jewish Agency, die zentrale Institution für die jüdische Einwanderung nach Palästina und ins spätere Israel.
Goldmann war auch ein enger Freund Konrad Adenauers, mit dem er 14 Jahre zuvor die Verhandlungen über die deutschen Reparationszahlungen im niederländischen Wassenaar, die der Bundesrepublik den Weg in die westliche Staatengemeinschaft geebnet hatten, vorbereitet hatte. Kurz vor dem Treffen in Brüssel, im Mai 1966, hatte Goldmann den Altbundeskanzler auf dessen Reise nach Israel begleitet. Der israelische Premierminister Levi Eshkol gab in seiner Residenz ein Abendessen für den Gast aus Deutschland und bemerkte in seiner Tischrede, die von deutscher Seite geleisteten Zahlungen könnten nur ein Anfang sein. Adenauer reagierte empört und wies umgehend den deutschen Botschafter Rolf Pauls an, den Rückflug für den nächsten Morgen zu organisieren. Eshkol versuchte den aufgebrachten Gast zu beruhigen, indem er darauf verwies, er habe doch Adenauers Verdienste bei den Verhandlungen gewürdigt. Doch Adenauer erwiderte kühl, es spiele keine Rolle, was der Ministerpräsident von ihm persönlich halte, er habe »das deutsche Volk beleidigt«. Mit Mühe gelang es Goldmann schließlich am späten Abend im Hotel King David, Adenauer zu beschwichtigen, der daraufhin die Reise in Israel fortsetzte.
Seiner Autobiografie gab Goldmann den Titel Mein Leben als deutscher Jude. Es war der Rückblick auf das Leben eines »Doppelmenschen«. In seiner Schrift »Von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums« von 1916 betonte er, der zu dieser Zeit – inmitten des Ersten Weltkriegs – wie zahlreiche Juden seiner Generation patriotisch gesinnt war, »dass die künftige Weltkultur in ihrem tiefsten Wesen deutsch sein wird, dass Deutschland in Zukunft mehr noch als bisher die Mission haben wird, Herz und Zentrum unserer Weltkultur zu sein«.
Gegen solche Vorstellungen erhob gleich der erste Redner in Brüssel seine Stimme: Gershom Scholem, 1897 in Berlin geboren und damit fast im gleichen Alter wie Goldmann, der bedeutende Historiker der jüdischen Mystik. Von Jugend an entschieden zionistisch gesinnt, wanderte er nach dem Studium und der Doktorarbeit 1923 nach Palästina aus. Seine Rede kehrt die Perspektive genau um: Er spricht von »Juden und Deutschen«, und unter diesem Titel erschien später auch sein Beitrag, in dem er sich gegen jede Vorstellung einer deutsch-jüdischen Symbiose wandte und den Fokus auf das Trennende richtete: »[W]ir können gar nicht nachdrücklich genug von den Juden sprechen, wenn wir von ihrem Schicksal unter den Deutschen reden. Die Atmosphäre zwischen den Juden und den Deutschen kann nur bereinigt werden, wenn wir diesen Verhältnissen mit der rückhaltlosen Kritik auf den Grund zu gehen suchen, der hier unabdingbar ist. Und das ist schwierig. Für die Deutschen, weil der Massenmord an den Juden zum schwersten Alpdruck ihrer moralischen Existenz als Volk geworden ist; für die Juden, weil solche Klärung eine kritische Distanz zu wichtigen Phänomenen ihrer eigenen Geschichte verlangt.«
Ausdrücklich wandte sich Scholem dagegen, die deutsch-israelischen Beziehungen in die historische Betrachtung einzubeziehen – und damit gegen das, was die Zusammenkunft eben doch bestimmte.
Der zweite Redner war Golo Mann, 1909 als Sohn von Thomas und Katja Mann in München geboren, der Jüngste in der Runde. Er hatte nach 1933 in der Emigration in Frankreich und den USA gelebt und wurde in den 1950er Jahren zu einem namhaften Historiker, der später als freier Schriftsteller arbeitete. Seine politischen Essays erregten immer wieder Anstoß, und so erging es auch seiner Brüsseler Rede, die ein Parcours durch persönliche Erinnerungen war: »Da meine Mutter aus einer jüdischen oder überwiegend jüdischen Familie stammt, da unter den Opfern des Nazismus auch nahe Verwandte von mir waren, da mein Vater Deutschland 1933 in Protest für immer verließ und auch ich selber als junger Mensch damals emigrierte, so könnte ich vielleicht behaupten, mich Ihnen gegenüber ›entlastet‹ zu fühlen. Aber ich kann es nicht.« Er habe – und damit wird Golo Mann zum eigentlichen Widersacher seines Vorredners – »die große Mehrzahl der deutschen Juden immer als Deutsche angesehen«.
Scholem nannte dies ein »Geschreibsel« und schrieb im Dezember 1966 an George Lichtheim, er halte Golo Manns Vortrag »für grauenhaft schlecht«: »Ich hatte nicht einmal Lust, mit ihm darüber mich auszusprechen, obwohl ich mit ihm zusammen Mittag gegessen habe. Das ist ein Herr, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.«
Immer wieder kam Scholem auf diese Rede zurück, etwa wenn er einem amerikanischen Historiker schrieb, eigentlich sei ein Gespräch mit den beiden Mitrednern aus Deutschland Golo Mann und Eugen Gerstenmaier nicht möglich, oder auch in seinem ausführlichen Antwortbrief von November 1966 aus Jerusalem an Lisl Mühlstein, die sein »Gespräch« mit den Deutschen für verfrüht und verfehlt hielt: »Sie fragen, warum wir nicht ein Gespräch mit den Zulukaffern oder Burmesen für wichtiger halten als mit den Deutschen, die vor noch nicht 25 Jahren unsere Familien ermordet haben. Die Antwort liegt auf der Hand. Es ist gerade der Albdruck – täuschen wir uns nicht, der auf beiden Seiten lastet – dieser Vergangenheit, der durch das sogenannte Schweigen nicht beseitigt wird. Ich habe nicht gefunden, dass die, die dieses Gespräch ablehnen, damit in eine seelisch sicherere Lage gekommen sind als die, die solches Gespräch bereit waren zu führen. Und dass es freilich keine Patentlösung und Auflösung solchen Albdrucks geben kann, die mit irgendwelchen erprobten Mitteln herzustellen wäre, ist mir durchaus klar.«
Der nächste Redner, Salo Wittmayer Baron, war einer der bedeutendsten Vertreter jüdischer Geschichte im 20. Jahrhundert. Im Jahr 1895 im damals österreichisch-ungarischen, heute polnischen Tarnów geboren, wurde er mit 24 Jahren vom Jüdischen Theologischen Seminar in Wien als Rabbiner ordiniert und erwarb drei Doktortitel: in den Rechtswissenschaften, den politischen Wissenschaften und der Philosophie. Rabbi Stephen Wise brachte ihn 1927 an das Jewish Institute of Religion in New York, 1930 wurde er Professor für jüdische Geschichte und Literatur an der Columbia University. Von dort aus baute er über Jahrzehnte, bis zu seiner Emeritierung 1963, die Jüdischen Studien als interdisziplinäres Feld von Forschung und Lehre in den USA wie international auf.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte Baron an der Sichtung und Sammlung wie der Verteilung der verbliebenen jüdischen Kulturgüter in Europa mit. Während des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, bei dem er eng mit Hannah Arendt zusammenarbeitete, gab er ein herausragendes historisches Gutachten über die Vernichtung des europäischen Judentums während der Zeit des Nationalsozialismus ab, in dem er auch an das Schicksal von Juden in seiner Heimatstadt Tarnów erinnerte.
Er war Autor des vielbändigen Werkes A Social and Religious History of the Jews und des weithin diskutierten Aufsatzes »Ghetto and Emancipation«, in dem sich Baron gegen das »lacrymose« Verständnis jüdischer Geschichte wehrte, also gegen eine Fokussierung auf das, was Jüdinnen und Juden im Laufe der Jahrhunderte erlitten hatten.
Der Reichtum an historischer Forschung wie dessen Paradigmen flossen in die Brüsseler Rede des New Yorker Forschers mit ein: Anders als Scholem, der jede Form von deutsch-jüdischer Symbiose in Abrede stellte, hob Baron das Wechselspiel von friedlichem Zusammenwirken und Verfolgung in der deutsch-jüdischen Geschichte hervor: »Nicht alle Deutschen haben den Judenhass geteilt. Zu allen Zeiten hat es einzelne Personen und Gruppen gegeben, die ihren jüdischen Nachbarn mit Toleranz, ja mit Freundlichkeit begegnet sind.« Er sah »Lichtpunkte in der Finsternis über den jüdisch-deutschen Beziehungen während der vergangenen Jahrhunderte«, und sein aus dem Jahr 1966 in die Zukunft gerichteter Blick fiel positiv aus: Spätere Generationen von Juden würden wieder Fuß zu fassen versuchen in Deutschland. Es gebe »Grund zur Hoffnung«.
Salo W. Baron starb im europäischen Schicksalsjahr 1989 im Alter von 94 Jahren. Seither ließen und lassen sich viele osteuropäische Jüdinnen und Juden im vereinigten Deutschland nieder, auch Tausende von Israelis leben heute in Berlin. Von allen Reden weist jene von Baron die weitreichendste prognostische Kraft auf. Sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl für jüdische Geschichte an der Columbia University Yosef Hayim Yerushalmi nannte ihn »den größten jüdischen Historiker des 20. Jahrhunderts«.
Der Theologe Eugen Gerstenmaier, 1906 in Kirchheim an der Teck geboren, gehörte zum Widerstandskreis um den 20. Juli 1944 und wurde in der Zeit des Nationalsozialismus verhaftet. Von 1954 bis 1969 war er Bundestagspräsident und prägte das zweithöchste Amt der Bundesrepublik mit dem hohen protokollarischen Gewicht auf die ihm eigene Weise, nämlich nicht nur repräsentativ, sondern auch politisch intervenierend. Vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1962 war Gerstenmaier der ranghöchste deutsche Politiker, der Israel besucht hatte, entsprechend verstand er seine Rede von Beginn an als eine politische. Er habe »die schwersten Zweifel, ob es einem Deutschen, der nicht für sich, sondern für sein Land sprechen soll, möglich ist, mit seiner Stimme über den Abgrund zu dringen, der Juden und Deutsche trennt«. Wer immer ihm diesen Auftrag erteilt haben mag, Gerstenmaier sah sich in der repräsentativen Rolle und endete: »Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass ich deshalb dem Jüdischen Weltkongress und seinem Präsidenten Dr. Nahum Goldmann umso mehr für die Noblesse danke, mit der er hier deutsche Stimmen vernehmbar gemacht hat. Dafür danke ich Ihnen nicht nur persönlich. Dafür dankt der Deutsche Bundestag dem Jüdischen Weltkongress.«
Karl Jaspers, 1883 in Oldenburg geboren, war der älteste Teilnehmer an dem Podiumsgespräch, ein Lehrer von Golo Mann, von dem er sich später entfremdete. Krankheitsbedingt konnte der Philosoph nicht persönlich an dem Kongress teilnehmen, stattdessen sandte er eine Grußbotschaft, die man im Kontext seines Werks verstehen kann: Schon 1946 hatte er in Heidelberg eine Schrift über die Schuldfrage veröffentlicht, 1965 folgte das Buch Wohin treibt die Bundesrepublik?, in einer Zeit, als nationalsozialistisches Gedankengut in Deutschland wieder erstarkte, was man auch außerhalb Deutschlands mit Sorge beobachtete. Jaspers stellte in seinem Beitrag die elementare Frage nach Schuld und Verantwortung: »Der Massenmord an sechs Millionen Juden, vollzogen im Namen des Deutschen Reiches, wird zwar von fast allen Menschen mit Abscheu verurteilt, aber die Fragen, was aus ihm folgt, wie Juden und Deutsche nach ihm miteinander leben können, sind nicht eindeutig beantwortet.«
Die deutschen Redner in Brüssel waren nicht in den Nationalsozialismus verstrickt. Sie wären sonst auch nicht eingeladen worden.
Siegfried Unseld bekundete bereits in einem Brief an Nahum Goldmann vom 25. Juli 1966 sein Interesse an einem Abdruck der in Brüssel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gehaltenen Reden. Der Band 196 der edition suhrkamp nimmt die Reden auf, lässt aber die Diskussion weg. Zuvor erschienen die Reden in einem Heft der Neuen Rundschau, ebenfalls ohne die Diskussionsbeiträge. Die zweifache Publikation zeigt, für wie bedeutsam man sie hielt.
Wir dürfen sicher davon ausgehen, dass Gershom Scholem Unseld auf die Reden – vor allem auch auf seine eigene – hinwies. Er schrieb dem Verleger am 24. Oktober 1966, nachdem beide sich über das Erscheinen von Scholems Hauptwerk Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen im Suhrkamp Verlag geeinigt hatten (das Buch war 1957 zuerst im Rhein Verlag in der Schweiz erschienen): »Ich gebe nochmal meiner Freude Ausdruck, dass meine Bücher nunmehr von Ihnen betreut werden sollen, und erhoffe mir davon eine freundschaftliche und in den Ergebnissen erfreuliche Zusammenarbeit.«
Es erhoben sich in Brüssel auch Stimmen gegen die Einladung von Deutschen in diesem Forum. Der in Ungarn geborene Rabbiner Bernard Bergman aus New York beschwor die Kongressteilnehmer: »Wir rufen jeden Juden auf, seine Beziehungen zu Deutschland auf ein Minimum zu reduzieren. Das Blut unserer Geschwister schreit auf und fordert uns auf, keine Verständigung mit Deutschland zu haben.« Moshe Erem, Mitglied der Knesset, berichtete davon: »The Israel Executive unanimously appealed to Dr. Goldmann to avoid a matter that had a profound emotional effect on the majority, perhaps the entirety, of the Jewish people. This was not done.« Anstelle von Monologen jener, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hätten, sollte es eine nachhaltige Diskussion über das Wiedererstarken des Antisemitismus und des »Faschismus« im gegenwärtigen Deutschland geben. Eine deutliche Anspielung auf die Wahlerfolge der NPD in einzelnen Bundesländern 1966. In jenem Jahr war die NPD in Hessen mit 7,9 Prozent in den Hessischen Landtag, in München mit 7,4 Prozent der Wahlstimmen in den Bayerischen Landtag eingezogen. Im Jahr darauf sollten sich ähnliche Wahlerfolge in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern fortsetzen.





























