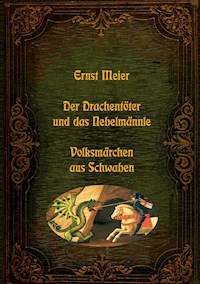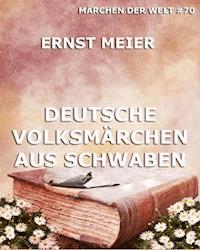
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Inhalt: Vorrede. 1. Der Schäfer und die drei Riesen. 2. Das Vöglein auf der Eiche. 3. Der Räuber und die Hausthiere. 4. Aschengrittel. 5. Der kranke König und seine drei Söhne. 6. Donner, Blitz und Wetter. 7. Von drei Schwänen. 8. Die vier Brüder. 9. Die Schultheißen-Wahl. 10. Hans und der Teufel. 11. Christus und Petrus auf Reisen. 12. Die drei Schwestern. 13. Die Sonne wird Dich verrathen. 14. Der Löwe, der Bär und die Schlange. 15. Der Spielmann und die Wanzen. 16. Der Räuber Matthes. 17. Die goldene Ente. 18. Der Büttel im Himmel. 19. Das Posthorn. 20. Der Himmelsreisende. 21. Der dumme Hans. 22. Fläschlein, thu deine Pflicht! 23. Der arme Fischer. 24. Die Rübe im Schwarzwalde. 25. Der Sohn des Kohlenbrenners. 26. Der Schäfer und die drei Jungfrauen. 27. So lieb wie das Salz. 28. Hans ohne Sorgen. 29. Hans und die Königstochter. 30. Die Brautschau. 31. Das Schiff, das zu Waßer und zu Lande geht. 32. Die zwölf Geister im Schloße. 33. Der angeführte Teufel. 34. Der Schneider und die Sündflut. 35. Der Schneider im Himmel. 36. Die Tochter des Armen und das schwarze Männlein. 37. Das tapfere Schneiderlein. 38. König Blaubart. 39. Der Engel auf Erden. 40. Der Arme und der Reiche. 41. Der Müller Hillenbrand. 42. Der Sohn des Kaufmanns. 43. Eschenfidle. 44. Der erlöste Kapuziner. 45. Der Klosterbarbier. 46. Die schwarzen Männlein. 47. Wie ein Schneider von Einer Elle Tuch fünf Viertel gestohlen at. 48. Die junge Gräfin und die Waßerfrau. 49. Die drei Raben. 50. Der Schatz im Keller. 51. Der faule Frieder. 52.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
Aus dem Munde des Volks gesammelt und herausgegeben
Ernst Meier
Inhalt:
Ernst Heinrich Meier – Biografie und Bibliografie
Vorrede.
1. Der Schäfer und die drei Riesen.
2. Das Vöglein auf der Eiche.
3. Der Räuber und die Hausthiere.
4. Aschengrittel.
5. Der kranke König und seine drei Söhne.
6. Donner, Blitz und Wetter.
7. Von drei Schwänen.
8. Die vier Brüder.
9. Die Schultheißen-Wahl.
10. Hans und der Teufel.
11. Christus und Petrus auf Reisen.
12. Die drei Schwestern.
13. Die Sonne wird Dich verrathen.
14. Der Löwe, der Bär und die Schlange.
15. Der Spielmann und die Wanzen.
16. Der Räuber Matthes.
17. Die goldene Ente.
18. Der Büttel im Himmel.
19. Das Posthorn.
20. Der Himmelsreisende.
21. Der dumme Hans.
22. Fläschlein, thu deine Pflicht!
23. Der arme Fischer.
24. Die Rübe im Schwarzwalde.
25. Der Sohn des Kohlenbrenners.
26. Der Schäfer und die drei Jungfrauen.
27. So lieb wie das Salz.
28. Hans ohne Sorgen.
29. Hans und die Königstochter.
30. Die Brautschau.
31. Das Schiff, das zu Waßer und zu Lande geht.
32. Die zwölf Geister im Schloße.
33. Der angeführte Teufel.
34. Der Schneider und die Sündflut.
35. Der Schneider im Himmel.
36. Die Tochter des Armen und das schwarze Männlein.
37. Das tapfere Schneiderlein.
38. König Blaubart.
39. Der Engel auf Erden.
40. Der Arme und der Reiche.
41. Der Müller Hillenbrand.
42. Der Sohn des Kaufmanns.
43. Eschenfidle.
44. Der erlöste Kapuziner.
45. Der Klosterbarbier.
46. Die schwarzen Männlein.
47. Wie ein Schneider von Einer Elle Tuch fünf Viertel gestohlen hat.
48. Die junge Gräfin und die Waßerfrau.
49. Die drei Raben.
50. Der Schatz im Keller.
51. Der faule Frieder.
52. Hans holt sich eine Frau.
53. Simson, thu dich auf!
54. Der lustige Ferdinand oder der Goldhirsch.
55. Der kluge Martin.
56. Die gescheidte Ziege.
57. Drei Rosen auf Einem Stiel.
58. Der Drachentödter.
59. Der langnasige Riese und der Schloßergesell.
60. Die Schlange und das Kind.
61. Das Nebelmännle.
62. Bruder Lustig.
63. Der Räuberhauptmann und die Müllerstöchter.
64. Die drei Handwerksburschen.
65. Die drei Wünsche.
66. Die Geschichte von einer Metzelsuppe.
67. Ei so beiß!
68. Die fünf Handwerksburschen auf Reisen.
69. Die drei todten Schwestern.
70. Der Rathsherr und das Büble.
71. Der Tod des Hühnchens.
72. Der König Auffahrer des Meers.
73. Die drei Federn des Drachen.
74. Der Knabe, der zehn Jahr in der Hölle diente.
75. Der Hahn mit den Goldfedern.
76. Ein Lügen-Märchen.
77. Die zwei Mädchen und der Engel.
78. Hui in mein' Sack!
79. Die Reise zum Vogel Strauß.
80. Hähnle und Hühnle.
81. Kätzle und Mäusle.
82. Jokele.
83. Wie ein ehrliches Fräulein frühstückt.
84. Der Birnbaum auf der Haide.
85. Eine Kinder-Predigt.
86. Noch eine Predigt.
87. Kinder-Märlein.
88. Was die Gans Alles trägt.
89. Der Brief im Ei.
90. Die schmale Brücke.
Anmerkungen.
Deutsche Volksmärchen aus Schwaben
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849603038
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ernst Heinrich Meier – Biografie und Bibliografie
Geboren am 17. Mai 1813 zu Rusbend in Schaumburg-Lippe und studierte, vorzugsweise unterstützt von der Prinzessin Karoline von Schaumburg-Lippe, zu Göttingen. Als Schüler Heinrich Ewald’s begleitete er diesen bei seiner durch bekannte Umstände herbeigeführten Vertreibung aus Göttingen und siedelte mit ihm 1838 noch Tübingen über, wo er sich im J. 1811 habilitierte. Bei dem hässlichen Streit, welchen Ewald in der Folge mit Baur anfing. trat M. auf die Seite des letzteren, was ihm statt der früheren Gönnerschaft Ewald’s nunmehr dessen grimmige Feindschaft und eine ihn sein Lebelang begleitende wütende literarische Verfehdung eintrug. in welcher Ewald nach seiner Art auch sein äußeres Fortkommen nach Kräften zu hindern suchte. Trotzdem ward M. 1848 außerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen zu Tübingen, an welcher Universität es später ordentlicher Professor ward und wo er nach längerer schmerzhafter Krankheit am 2. März 1866 gestorben ist. (Allg. Zeit. 1866. Beilage zu Nr. 81.) M. war eine Natur von außerordentlicher Empfänglichkeit und geistiger Beweglichkeit, welche von den verschiedensten Gebieten angezogen wurde, dabei von einer gewissen Leichtigkeit in der Produktion und mit einem Talent für anmutige, selbst poetische Form begabt. Sein Lerntrieb und Schaffensdrang rasteten nie; was ihm abging, war die Methode. Seine Arbeiten umfassen die Fächer der alttestamentlichen, der orientalischen und der deutschen Literatur. – Von den Arbeiten zum Alten Testament erschien zuerst der Joelcommentar 1841, in welchem er im Wesentlichen in den Spuren Ewald’s ging sowohl in Betreff der Komposition des Buchs als in der Ansicht von der Abfassungszeit, welche er nur etwas genauer auf die Periode von 860–850 festzustellen sich bemühte. – Danach folgte die „Erklärung der ersten 23 Kapitel des Jesajah,“ 1850, welche allerdings bewies, dass der Verfasser in seinem geistreich-ästhetisierenden Wesen zur Erfassung der eigentlichen Tiefe des Prophetismus unfähig war (vgl. Ewald’s Jahrbb. d. bibl. W. Bd. III, S. 212–215). Ähnliches gilt in Bezug auf den religiösen Gehalt der hebräischen Lyrik von seiner „Erklärung der poetischen Bücher des Alten Testaments“, 1850, 1854 (vgl. Ewald a. a. O. S. 215 f., Bd. V, S. 249 f.). Es erfolgte darauf die Erläuterung des Hohenliedes, 1854, mit kritischer Textausgabe, bei der es allerdings nicht ohne große Willkürlichkeiten abgeht, indem der Verfasser sich bis zu selbstgedichteten Einschiebseln versteigt (vgl. Ewald a. a. O. Bd. VI, S. 109–111). Ähnliches gilt auch von seiner Übersetzung und Erklärung des Deborahliedes, 1859. – Dies führt uns auf des Verfassers systematische Arbeiten über die hebräische Poesie. Angelegentlich beschäftigte er sich namentlich in denselben mit der Erforschung der eigentümlichen Form dieser Dichtung, sowohl in der Schrift: „Die Form der hebräischen Poesie“, 1853, als in seiner „Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Hebräer“, 1856, S. 67–79. Das regelnde Prinzip seiner Metrik ist der Accent. Jede Verszeile enthält zwei betonte Silben oder Hebungen, denen beliebig viel Senkungen vorhergehen und eine unbetonte Silbe nachfolgen kann, aber nicht muss. Die Bestimmung der jedesmaligen zwei Hebungen wird aber vom Verfasser mit größter Willkür ausgeführt und die Anarchie der Senkungen macht den Vers bald verschwindend kurz, wie z. B. in Dt. 32,2 da WortLiqḥischon ein selbständiges metrisches Glied bildet, bald wieder auffällig lang, man vgl. die Beispiele in der „Gesch. d. p. N. 146, 182.Sba simplexwird bald gerechnet, bald nicht, demDages fortebald Einfluss verstattet, bald nicht. Schon im Druck nehmen sich diese Verschen meist seltsam genug aus. Andere Mängel siehe bei Ewald a. a. O. Bd. III, S. 216, Bd. V, S. 219 f. Sonst liest sich die Geschichte d. poet. N. angenehm, die Darstellung ist elegant und die metrischen Übertragungen, an sich selbst betrachtet, sind oft wahre Meisterstücke (vgl. bes. die Beispiele S. 65, 66). Die geschichtliche Übersicht ist in einem gewissen genialen Zuge leicht hingeworfen, aber voller kritischer Wagnisse, denen die feste Grundlage mangelt. Verwirrend ist die Miteinbeziehung der Sagengeschichte und der prophetischen Literatur. Ein Mangel ist auch bei dieser Behandlung des Stoffes die rein weltliche Betrachtung der Sache, in welcher die religiöse Tiefe des Gehalts zu wenig zu ihrem Rechte kommt. (Ewald’s Besprechung a. a. O. Bd. VIII, S. 121–123 ist unwürdig.) – Eine besondere Liebhaberei hatte der Verfasser auch für lexikographische Studien. In seinem „hebräischen Wurzelwörterbuch,“ 1845, ist aus der richtigen Beobachtung, dass eine ältere Periode der Sprache da war, in welcher das Gesetz der Dreibuchstabigkeit der Wurzeln noch nicht bestand, die verhängnisvolle Folgerung gezogen, es müsse gelingen, alle dreibuchstabige Worte, welche uns das hebräische Lexikon bietet, auf eine zweilautige Wurzel zurückzuführen. Diese Voraussetzung verleitete den Verfasser dazu, einen Schematismus auszukünsteln, nach welchem er sämtlichevoces triliteralesaus denbiliteralesdurch Reduplikation entstehen ließ und zwar so, dass manchmal der erste Wurzellaut vorn, manchmal hinten wiederholt wird, oder so, dass der zweite Wurzellaut hinten noch einmal antritt, oder so, dass zum Ersatz der fehlenden Reduplikation Vokalverstärkung eintritt. Auf diese Weise wird nun der ganze hebräische Wortschatz durch eine Art Durchschlag getrieben, in welchem er bald Kopf, bald Schwanz stecken lassen muss, ohne dass man immer einsähe, weshalb im einzelnen Falle gerade dieser unter den drei Buchstaben das Opfer seiner Existenz zu bringen hat. – Noch trügerischer ist die Feststellung der Grundbedeutungen, die vom Verfasser mit seltsamer Monotonie auf die Begriffe zusammenziehen und trennen gebracht werden, wobei man das Bedürfnis der Ursprache nicht begreift, gerade dies so oft zum Ausdruck zu bringen. Im Einzelnen sind die etymologischen Verknüpfungen der abgeleiteten Worte mit dem vermeintlichen Grundworte mit einem gewissen findigen Scharfsinn zu Stande gebracht, der sich aber über die Sicherheit seiner Resultate täuscht. Man vergleiche zu dieser Frage: Grill, in der Zeitschr. der deutschen morgenl. Ges. Bd. XXVII, S. 440–443, Olshausen, Lehrb. der hebr. Spr. 1861, S. 14–19, Stade, Lehrb. der hebr. Gr., 1879, S. 15. – von seiner Übersetzung und Erklärung der prophetischen Bücher des Alten Testaments 1863 gilt im Wesentlichen das oben über Jesaia Gesagte. Ein ganz besonderes Interesse wandte M. der phönikischen Paläographie zu, zu deren Förderung er auch Studienreisen nach den Sammlungen in Holland, England und Frankreich unternahm. Seine erste Veröffentlichung auf diesem Gebiete, „Erklärung phönikischer Sprachdenkmale“, die man auf Cypern, Malta und Sizilien gefunden, 1860, zeigte allerdings einen auf diesem Gebiete sehr gefährlichen geistreichen Dilettantismus, der im Sprachlichen die wesentlichsten Gesetze verletzte und den alten Steinmetzen zutraute, mit vieler Mühe einen Unsinn wie diesen in Stein gemeißelt zu haben: „Der Lampenmeister, der da bringt die Zunge in den Ölbehälter.“ Im Übrigen vgl. Blau in der Zeitschr. der deutschen morgenl. Ges. Bd. XVIII, S. 636–638. – Auf einem gesicherteren Boden bewegte sich die Abhandlung „Ueber die nabatäischen Inschriften“ (Zeitschr. d. D. M. G. Bd. XVII, S. 575 bis 645), 1863, in welcher M. mit einem sehr reichen Material die Ansicht Beer’s und Levy’s vom aramäischen Sprachcharakter der genannten Inschriften neu begründete und damit die Deutung dieser Denkmale wesentlich förderte (vgl. den Nachtrag v. Sprenger a. a. O. Bd. XVIII, S. 300–302). Im J. 1865 erfolgte die Abhandlung über „die phönikische Opfertafel von Marseille nebst dem Bruchstück einer neuentdeckten Opfertafel von Carthago“ (a. a. O. Bd. XIX, S. 90–119.), welche manche glückliche Kombinationen enthielt; freilich schadete dem Verfasser auch hier oft seine bei derartigen Untersuchungen wenig angebrachte Geistreichigkeit, die ihn veranlasste, schillernden Phantomen nachzujagen (vgl. a. a. O. J. J. Unger, Bd. XXIV, S. 182–187). Zur Sache s. auch Schröder, Die phöniz. Sprache, 1869, S. 237–248. Rastlos arbeiten!), aber auch schnell fertig, ließ er 1866 eine Erklärung der Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ézer folgen („Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes,“ Bd. IV, H. 4), die zu den früher von Munk, Levy, Blau u. a. gegebenen Erklärungen manche Verbesserungen brachte, selbst aber durch Schlottmann’s gründliche Arbeit (1868) überholt wurde. Seine bewegliche Natur suchte sich auch in der orientalischen Numismatik einheimisch zu machen. Er war ein fleißiger Sammler besonders arabischer Münzen und brachte es zu einer werthvollen Sammlung, welche in den Besitz des Münzkabinets der Universität Tübingen übergegangen ist. Dass auch seine Deutungen der „Werthbezeichnungen auf muhammedanischen Münzen“ (Zeitschr. d. deutschen morgenl. Ges., Bd. XVIII, S. 760–774) nicht ohne Förderung der Sache geblieben sind, hat der bewährte Kenner der morgenländischen Münzkunde Stickel in seinem Nachworte zu obiger Abhandlung (S. 775–780) anerkannt. Freilich hat der Letztere zugleich darauf hingewiesen, wie viele Momente noch in weitere Untersuchung gezogen werden müssen, ehe man von einem abschließenden Resultat reden könne. – Außerdem war M. auch in der indischen Literatur und im Sanskrit bewandert und brachte die erstere durch geschmackvolle Übersetzungen dem Verständnis der Gebildeten näher. So erschien 1847 die Übersetzung von Nal und Damajanti, 1852 die der Sakuntala, welche sich sehr angenehm liest. Dasselbe gilt von den Übersetzungen der „morgenländischen Anthologie“, in der ausgewählte Stücke aus der hebräischen, arabischen, persischen u. a. Literatur mitgeteilt werden (erschienen im bibliograph. Institut von Meyer in Hildburghausen). Seine an Herder erinnernde Begeisterung für Völker- und Volkspoesie führte ihn auch der deutschen Literatur zu. Er sammelte deutsche Kinderreime und Kinderspiele (1851), deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche (1852), deutsche Volksmärchen (1852), schwäbische Volkslieder, die er auf Reisen durch Schwaben zusammenbrachte. Auch eigne deutsche Gedichte gab er 1852 unter dem Namen Ernst Minneburg heraus. – Seiner edlen oben genannten fürstlichen Wohltäterin setzte er 1865 ein biographisches Denkmal.
Vorrede.
Seit die Brüder Grimm vor vierzig Jahren in ihren Kinder- und Hausmärchen1 das unergründlich reiche Wesen des deutschen Volksmärchens uns wieder erschloßen und den schlichten, reinen Ton, in welchem diese epischen Nachklänge einer längst vergangenen Zeit erzählt sein wollen, in musterhafter Weise getroffen, seitdem hat sich die Liebe der Jungen und Alten von Jahr zu Jahr diesen Ueberlieferungen mehr zugewandt. Fast überall hat man nach solchen einfältigen Erzählungen gelauscht und eine nicht unbedeutende Zahl derselben dem Untergange entzogen. Indes bilden die eigentlichen Märchen immer nur eine verhältnismäßig kleine Beigabe zu den weit reicheren Sagensammlungen. Eine besondere Märchensammlung aus einer bestimmten Gegend Deutschlands besitzen wir außer der Grimm'schen Sammlung nicht; diese aber erstreckt sich, obgleich sie auch aus Süddeutschland einzelne Beiträge enthält, doch wesentlich auf Mittel-und Norddeutschland, speciell auf Heßen; und selbst die späteren Nachlesen deutscher Volksmärchen gehören fast ausschließlich den nord- und mitteldeutschen Gebieten an2. Nur im äußersten Norden, bei einem nahverwandten Stamme, der einst mit uns denselben Götterhimmel theilte, ist eine besondere Sammlung erschienen, die, unmittelbar aus frischer Ueberlieferung geschöpft, sich der der Brüder Grimm würdig an die Seite stellt: ich meine die norwegischen Volksmärchen von Asbjörnsen und Moe, deutsch von Bresemann, 1847.
Der deutsche Süden dagegen, und namentlich der schwäbische Theil desselben, ist bis jetzt fast noch völlig unvertreten geblieben3. Und doch besitzt er an Sagen, Märchen und andern alten Ueberlieferungen so reiche und ungeahnte Schätze wie nur irgend ein anderer deutscher Landesstrich.
In Beziehung auf Märchen mag die vorliegende Sammlung davon Zeugnis geben. Ich habe dieselben, wie alle verwandten Volksüberlieferungen, mit wißenschaftlichem Interesse gesammelt, daher Treue und Wahrheit mein höchstes Ziel war4. Ich wollte nur wiedergeben, was ich hörte, und habe jeden verschönernden Zusatz, jeden ausfüllenden Zug selbst bei offenbaren Lücken, sorgfältig vermieden.
Was außerdem die Darstellung betrifft, so konnte ich einzelne Stücke, die ein Blinder in Bühl erzählte, bei einem ziemlich langsamen und wiederholten Vortrage fast wörtlich nachschreiben. Alle übrigen Märchen sind wenigstens immer unmittelbar nach der mündlichen Mittheilung aufgezeichnet und zwar mit möglichster Beibehaltung des Ausdrucks und der eigenthümlichen, stehenden Wendungen.
Die ganze Ausdrucksweise, der das Volk bei diesen Erzählungen sich bedient, ist immer so gehalten, wie man etwa Kindern dieselben vortragen würde, und diesen Maaßstab muß meiner Meinung nach auch der schreibende Nacherzähler im Allgemeinen vor Augen haben. Dabei hält das Volk sich einfach an die Handlung und entwickelt rasch und schmucklos in echt epischer Weise nur diese, ohne Lob oder Tadel darüber auszusprechen, und noch weniger ergeht es sich in breiter, hochtrabender Ausmalung des Gefühls und des subjectiven Eindrucks, wie dieß z.B. noch in Bechsteins Märchenbuche nicht selten vorkommt. Da liest man in der bezauberten Prinzessin Sätze wie folgende, S. 29.:
»Nachdenklich und mit hochschlagendem Herzen schritt der ehrliche Meister über die vom Abenddämmer umsponnene Heimathflur seinem Dörflein zu. Schon sah er in Gedanken seinen ältesten Sohn, Hellmerich, den er ungleich mehr liebte als seinen andern, Hans, im Königsschloß, und die holde Prinzessin als seine hochverehrteste Schnur.«
Und so geht es fort. Würde ein mündlicher Erzähler in diesem überladenen Tone ein wirkliches Märchen vortragen, es müßte die Kinder im höchsten Grade langweilen und die Erwachsenen zum Lachen nöthigen; beim Lesen bleibt es vollends ohne Wirkung. Form und Inhalt widersprechen sich hier, indem die Einfachheit und Wahrheit, die Kindlichkeit und Unschuld einer echt epischen Erzählung unter solch falschem Schmucke zur Karikatur verzerrt wird und nothwendig verloren gehen muß. Es entsteht hierdurch eine widerwärtige Zwittergattung in der schönen Literatur, eine Gattung, die den Inhalt der Volks-oder Naturpoesie mit dem äußerlich abgeborgten Schmucke der Rhetorik und Kunstpoesie behängt und auf die Art weder der Volksdichtung noch der Kunstdichtung ein Genüge thut. Zu dieser Gattung gehören sowohl die innerlich höchst leblosen, selbsterfundenen oder zusammengeleimten Märchen, als namentlich auch alle novellenartig zugestutzten und modern ausgesponnenen Volkssagen. Daß übrigens selbstständige Dichtungen, wie z.B. Fouque's Undine und Chamisso's Peter Schlemihl nicht zu dieser Zwittergattung gehören, versteht sich von selbst; denn in diesen Stücken haben Form und Inhalt, Körper und Geist zu vollkommener Befriedigung sich durchdrungen und vermählt.
Was die epischen Stoffe betrifft, welche diesen schwäbischen Märchen zur Grundlage dienen, so gehören sie bekanntlich einem großen Theile nach der mythischen Götter- und Heldensage an und müßen ein uraltes Gemeingut aller deutschen Stämme gewesen sein. Deshalb finden sich auch hier die altheidnischen Elemente und selbst die stehenden Charaktere der Grimm'schen Märchen in ähnlicher Weise wieder, aber vielfach eigenthümlich und mit neuen, überraschenden Zügen. Auf's mannigfaltigste und immer neu ist z.B. das bekannte Thema behandelt, wie ein Jüngling, gewöhnlich der jüngste und anscheinend dümmste von drei Brüdern, eine Jungfrau, die entweder dem Teufel verfallen ist, oder theils von einem Drachen, theils von drei Riesen in Verwahrung gehalten wird, befreit, dann sie heirathet und mit ihr unermeßliche Schätze gewinnt. So z.B. Nr. 1, der Schäfer und die drei Riesen; Nr. 5, der kranke König und seine drei Söhne; Nr. 29, Hans und die Königstochter; Nr. 58, der Drachentödter u.s.w. Siegfried (der nordische Sigurd), der göttliche Held voll unbewußter Hoheit, der die Kriemhild vom Drachen erlöst, blickt hier überall deutlich durch. Umgekehrt werden auch Männer durch kühne Jungfrauen aus der Gewalt böser Mächte befreit. Die Schwester zieht aus, um die zu Raben verwünschten Brüder zu suchen und zu erlösen und besteht glücklich alle Gefahren; oder es gelingt ihr, einen Schatz zu gewinnen, den die Brüder nicht hatten heben können, und deshalb einer feindlichen, dämonischen Gewalt verfallen waren, aus der sie nun durch die Schwester befreit werden; vgl. Nr. 72. Verwandt ist damit die Erlösung durch Liebe überhaupt, wie in Nr. 57.
Im Einzelnen finden sich hier die echt mythischen Erzählungen vom Glasberge (dem glänzenden Götterberge), Nr. 49, 73; vom Kraut des Lebens, oder von Früchten, die dem kranken König allein helfen können, Nr. 5; von Jungfrauen, die ein Schwanenkleid haben und damit fortfliegen (Schwanen-Jungfrauen), Nr. 7; von Wunschdingen, z.B. von dem Fläschlein, das jeden Wunsch gewährt, Nr. 22, und besonders eigenthümlich in dem Märchen von einem Hahn mit Goldfedern, Nr. 75. Auch die Sagen von dem Sack, von dem Ranzen, in den man Alles hineinwünschen kann, gehören hieher; vgl. Nr. 78. Mythisch ist ferner der weißagende Vogel in Nr. 72; die goldene Ente, an der Alles hängen bleibt, Nr. 17; der Stab, vor dem die Höllenthür sich aufthut, Nr. 16; das Schiff, das zu Waßer und zu Lande geht, Nr. 31, und anderes, was schon die Brüder Grimm in den Anmerkungen zu ihrer Sammlung genauer nachgewiesen haben.
Außer viel Bekanntem und Verwandtem wird man in der vorliegenden Sammlung auch Einiges finden, das völlig neu ist. Dahin gehört unter andern das merkwürdige Stück Nr. 6, Donner, Blitz und Wetter, worin altmythische Erinnerungen, namentlich an Donar, klar vorliegen. Ferner die schönen Märchen Nr. 25, der Sohn des Kohlenbrenners, und Nr. 42, der Sohn des Kaufmanns, die meines Wißens sonst nicht vorkommen5. Wo sich ähnliche Märchen bei Grimm finden, habe ich dieß angegeben und gelegentlich auch einige andre Sammlungen berücksichtigt.
Sehr merkwürdig sind die Berührungen mit Erzählungen in 1001 Nacht, auf die bereits Grimm bei 7 Märchen hingewiesen. – Seit den Kreuzzügen war der Verkehr mit den Arabern sehr lebhaft und so könnte durch mündliche Ueberlieferung (namentlich auch durch die spanischen Araber,) manches morgenländische Märchen uns zugeführt worden sein, wie ja auch die Erzählung von den sieben weisen Meistern und Einzelnes in andern Volksbüchern, z.B. im Herzog Ernst, nachweisbar dem Orient angehört. Andrerseits aber enthält jene arabische Märchensammlung, die als Schriftwerk erst spät unter uns bekannt geworden ist, nicht wenige Züge, die offenbar germanischen Ursprungs sind. Dahin möchte ich unter andern die Erwähnung von Schwanenjungfrauen rechnen. Einzelne weitere Berührungen mögen sich daraus erklären, daß der eigentlich mythische Haupttheil dieser Märchen den mit uns stammverwandten Indern angehört.
Eine besondere Eigenheit der schwäbischen Märchen ist es, daß einige noch, ganz wie die mehr geschichtlichen Sagen, sich an bestimmte Oertlichkeiten knüpfen. So z.B. Nr. 16, das Märchen vom Räuber Matthes; Nr. 22, Fläschlein, thu deine Pflicht; Nr. 59, der langnasige Riese und der Schloßergesell; Nr. 61, das Nebelmännle; Nr. 74, der Knabe, der zehn Jahre lang in der Hölle gedient, u.a.m. Ich habe deshalb einige Stücke der Art, z.B. die Befreiung der Jungfrau von einem Drachen, die sich an das Dorf und ehemalige Schloß Drackenstein knüpft, der Sagensammlung zugetheilt.
Mögen Kinder und Unverbildete an diesen anspruchlosen Märchen, die einen reichen Schatz echter Poesie enthalten, sich nicht minder erfreuen, als ich selbst beim Suchen und Sammeln derselben mich stets erfreut und erfrischt habe.
Tübingen, im Winter 1852.
Dr.Ernst Maier.
Fußnoten
1 1. Bd. 1812. 2. Bd. 1814.
2 So z.B. Kuhns märkische Sagen und Märchen, 1843 (16 Märchen enthaltend), und desselben Verf. Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche, 1848 (mit 19 Märchen). Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder aus den Herzogthümern Schleswig-Holstein und Lauenburg, 1845 (mit 38 Märchen). E. Sommers Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen, 1846 (mit 11 Märchen). Wolfs deutsche Sagen, 1845 (mit 40 Märchen). – Auch in Bechsteins deutschem Märchenbuche beschränken sich die neuen Stücke auf Thüringen. Darunter kommt aber manches entschieden Unechte und Selbsterfundene vor, wie ich hier nur beiläufig bemerken will. So ist z.B. die Rosenkönigin, S. 35, wohl erst durch die bezauberte Rose von Ernst Schulze veranlaßt worden. Ebenso ist das Märchen S. 39, wie der Teufel den Branntewein erfunden, ein modern-didaktisches und gewiß nicht volksthümliches Stück.
3 Diese Worte, die ich schon im Jahr 1850 geschrieben, passen jetzt nicht ganz mehr, indem wir kürzlich durch J. W. Wolf eine treffliche Sammlung von 51 Märchen, hauptsächlich aus dem Odenwalde, erhalten haben. Allein von Schwaben, dem eigentlichen Herzen Süddeutschlands, gelten sie noch heute.
4 Vgl. meine deutschen Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben. Tüb. 1851; ferner: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben, die demnächst in 2 Bänden zu Stuttgart erscheinen werden. Auch eine Sammlung schwäbischer Volkslieder habe ich vorbereitet.
5 Dieß letzte Märchen findet sich jetzt auch in der Wolf'schen Sammlung aus dem Odenwalde: des Todten Dank, S. 243. Auch sonst enthält sie manches Verwandte, das aber in der schwäbischen Ueberlieferung, wie z.B. der goldene Hirsch, S. 73, bei mir Nr. 54: der lustige Ferdinand, einfacher geblieben ist.
1. Der Schäfer und die drei Riesen.
Es war einmal ein Edelmann, der besaß viel Geld und Gut und bekam immer noch mehr; das kam aber daher, weil er seine einzige Tochter dem Teufel versprochen hatte. Dieser Edelmann hielt sich auch eine große Heerde Schaafe und hatte beständig einen eigenen Hirten, der sie hüten mußte; allein mit seinen Schaafen wollt's ihm nicht glücken. Es waren nämlich in der Nähe des Schloßes drei Thäler, und wenn ein Hirt in eins derselben die Heerde trieb, so wurde sie jedesmal von einem Riesen zerrißen und auch der Hirt wurde umgebracht. So oft nun der Edelmann einen neuen Schäfer annahm, sagte er ihm zwar jedesmal: »Du darfst überall hüten, wo Du willst, nur nicht in den drei Thälern; denn da wird Dir's schlecht gehen!« Allein die Schäfer konnten es immer nicht laßen und wollten es doch wenigstens Einmal probiren, und trieben in eins der drei Thäler und kamen niemals wieder lebendig heraus.
So hatte der Edelmann auch einmal wieder seine ganze Schaafheerde mitsammt dem Schäfer verloren, kaufte sich aber sogleich eine andere und suchte nun einen Hirten für dieselbe. Da meldete sich eines Tags ein junger hübscher Bursch bei ihm, und da derselbe ihm wohl gefiel, vertraute er ihm die Heerde an, sagte ihm aber zugleich, wie es seinen Vorgängern nun schon mehrmals ergangen sei und warnte ihn, daß er doch ja, so ihm sein Leben lieb wäre, die drei Thäler meiden möchte. Der Bursch sagte nein, er wolle auch nicht dahin »fahren« und hütete eine Weile anderswo mit seinen Schaafen, so daß ihm kein Leid geschah. Allein er mußte doch im Stillen immer an die drei Thäler denken und meinte: »Ich möchte doch sehen, wer mir da etwas thun könnte; wollt's Niemand rathen! es sollt' ihm übel bekommen!« Und so zog er eines Morgens ganz wohlgemuth in das eine Thal, fand vortreffliches Gras darin und hütete dort bis Mittag, ohne daß ihm etwas aufgestoßen wäre. Dann trieb er seine Heerde auf's Feld, wo er sein Nachtlager hatte, aß daselbst zu Mittag und führte nachher abermals seine Schaafe in das verbotene Thal und blieb darin bis gegen Abend.
Da kam mit einem Male ein gewaltiger Riese auf den Schäfer zu und sprach: »Was machst Du da mit Deinen Grasmücken?« »Das geht Dich nichts an!« sagte der Schäfer. »Das will ich Dir zeigen!« sprach der Riese und wollte sein Schwert ziehen und dem Hirten zu Leibe gehen; allein ehe er das Schwert aus der Scheide brachte, wobei er sich ein wenig bücken mußte, hob der Schäfer seine »Schippe« (Hirtenstecken) in die Höhe und schlug den Riesen auf den Kopf, daß er betäubt umfiel; dann gab er ihm noch ein paar Hiebe auf den Kopf, daß er vollends todt war. Hierauf nahm er das Schwert und die Kleider des Riesen und warf den Leichnam in's Gebüsch.
Wie sich nun aber der Schäfer nach seiner Heerde umsah, erblickte er plötzlich ganz nahe ein schönes Schloß und gieng in dasselbe hinein und kam in ein prächtiges Zimmer, darin stand ein Tisch, der war gedeckt, und auf dem Tische stand eine Flasche Wein, woneben ein Zettel lag, und auf diesem Zettel standen die Worte:
Wer diese Flasche trinkt
Und dieses Schwert regiert,
Der zwingt den Teufel.
Das las der Schäfer, dachte aber nichts weiter dabei und ließ den Wein stehen, legte auch das Riesenschwert so wie die Kleider des Riesen in das Zimmer und besah sich das Schloß. Da fand er denn unten im Stalle einen prächtigen Schimmel, ließ aber Alles in dem Schloße und zog mit seinen Schaafen heim.
Weil's ihm nun das erste Mal so geglückt war, so konnte er's nicht laßen und zog am folgenden Morgen auch in das zweite Thal, nahm aber, um sich beßer wehren zu können, einen langen Spieß mit. Als er nun ein paar Stunden hier gehütet hatte, kam wieder ein Riese, der war noch größer als der erste und sprach: »Was machst Du da mit Deinen Grasmücken?« »Was geht's Dich an?« sprach der Schäfer. »Das will ich Dir gleich zeigen,« sagte der Riese und zog sein Schwert; allein der Schäfer legte sogleich seinen Spieß ein und rannte auf den Riesen los, traf aber eine Rippe, so daß die Spitze nicht sehr tief eindrang und der Riese schon sein Schwert schwang, um dem Schäfer den Kopf abzuschlagen; der aber zog schnell seinen Spieß heraus und sprang zurück, worauf der Riese den Hieb in die Luft that und zu Boden fiel. Sogleich sprang der Schäfer nun wieder herzu und bohrte ihm seinen Spieß tief in den Leib, daß er alsbald todt war. Dann zog er dem Riesen die Kleider aus, warf den Leichnam in's Gebüsch und wollte eben mit dem Schwerte fortgehen, als er wieder ein schönes Schloß vor sich sah. Er gieng hinein und fand ein Zimmer, darin war ein gedeckter Tisch, auf dem Tische aber stand eine Flasche Wein und daneben lag ein Zettel mit den Worten:
Wer diese Flasche trinkt
Und dieses Schwert regiert,
Der zwingt den Teufel.
Kurz, alles war hier gerade so wie in dem ersten Schloße. Der Schäfer legte wieder die Kleider und das Schwert des Riesen in das Zimmer und ließ den Wein stehen. Als er aber das Schloß besah, fand er hier ebenfalls ein Pferd unten im Stalle; dieß war aber ein Fuchs. Alsdann gieng er mit seiner Heerde heim.
Als der Schäfer am andern Morgen »ausfuhr,« dachte er unterwegs: »Ei, ich möchte doch auch wißen, wie's in dem dritten Thale aussieht!« und zog auch sogleich mit seinen Schaafen dahin. Wie er aber in das Thal trat, kam ihm alsbald ein ungeheurer Riese entgegen; der hatte eine Haut, grad wie Eichenrinde sah sie aus, und langes Moos wuchs in seinem Gesichte, daß es dem Schäfer schier angst ward; denn er hatte keine Waffen bei sich als bloß seine Schippe. Allein er besann sich nicht lange, sondern als der Riese brüllte: »was willst Du hier?« sprach er: »das sollst Du schon sehen!« und nahm rasch einen Stein auf die kleine Schaufel, die an der Schippe sich befindet, und warf nach dem Riesen. Der Stein aber traf nur den Bauch des Riesen, daß er's kaum spürte. Sogleich nahm der Schäfer einen zweiten Stein auf die Schippe und warf und traf die Brust des Riesen; allein das that ihm noch nichts; nun rückte er aber immer näher heran, und als er endlich schon ganz nahe war, da warf der Schäfer einen dritten Stein mit seiner Schippe, und der traf gerade die Stirn des Riesen, daß er umstürzte und mausetodt war. Sogleich stand auch wieder ein prächtiges Schloß da, in das trug der Schäfer das Schwert und die Kleider, die er dem Riesen abgenommen, und fand in einem Zimmer auch wieder eine Weinflasche mit dem Spruche: daß wer den Wein trinke und das Schwert führe, der könne den Teufel bezwingen, ganz so wie in den beiden andern Schlößern; allein er ließ alles stehen, rührte den Wein nicht an und sah bloß zu, ob in dem Stalle auch wieder ein Pferd stehe. Ja, es stand richtig eins darin, und war ein Rappe.
Darauf zog der Schäfer ganz vergnügt nach Haus, und als ihn nach einiger Zeit der Edelmann einmal fragte: »bist Du auch schon in den drei Thälern gewesen?« Da antwortete er: »ja wohl, ich bin darin gewesen.« Da ward der Edelmann bitterböse, und wollte den Burschen auf der Stelle fortjagen; weil er aber so sehr bat, daß der Edelmann ihn doch behalten möge, so gab er's endlich zu und sagte: »Nun, so magst Du bleiben und kannst dem Gärtner helfen und Mist und Waßer tragen; aber die Schaafe kann ich Dir nicht länger laßen.« Das war dem Burschen ganz recht, und so half er dem Gärtner bei seiner Arbeit.
Da geschah es, daß die Zeit nahe war, wo der Edelmann seine Tochter dem Teufel übergeben sollte, wie der Böse sich's ausbedungen hatte. Darüber entstand große Trauer im Schloß, und der Edelmann hatte keine Ruhe und Rast, und klagte dem Gärtner seine Noth. Der aber wußte auch keinen Rath, und erzählte seinem Gehülfen die Geschichte und sagte: »morgen muß unser Herr seine Tochter dem Teufel übergeben und auf den Berg bringen; wer da helfen könnte, der hätte auch sein Glück gemacht.« »Wie war das?« fragte der junge Bursch und ließ sich die ganze Geschichte noch einmal genau erzählen. Darauf sagte er nichts mehr. Es fiel ihm wieder ein, was er in den drei Schlößern gelesen hatte, und er nahm sich auch sogleich vor, daß er die Jungfrau erlösen wollte; denn er hatte Mitleiden mit ihr, da er sie oftmals gesehen hatte, und sie so brav und wunderschön war. Deshalb begab er sich am folgenden Morgen in das nächste Thal, gieng in das Schloß und dann in das Zimmer, trank die Flasche Wein aus, nahm das Wammes des Riesen und hieng sich's um, obwohl es ihm viel zu weit und zu lang war, und wie ein Mantel auf die Erde hieng; endlich nahm er auch das Schwert, setzte sich auf den Schimmel und jagte davon dem Berge zu, wo der Teufel die Jungfrau holen wollte. Und wie er dort hinkam, war's grad ein Uhr, und der Edelmann stand mit seiner Tochter schon da und meinte, es sei der Teufel, als er den Reiter erblickte. Der Teufel kam aber alsbald in der Gestalt einer Schlange und fuhr auf den Reiter los; der zog sein Schwert und kämpfte dreiviertel Stunden lang mit der Schlange und erlegte sie endlich; dann ritt er, ohne ein Wort zu reden, wieder fort nach dem Schloße, führte den Schimmel in seinen Stall, legte das Schwert und das Kleidungsstück des Riesen in das Zimmer, und begab sich nach Haus an seine Arbeit.
Nun meinte der Edelmann, seine Tochter sei erlöst und gieng vergnügt mit ihr heim; allein alsbald erschien der Teufel und sagte: »morgen Mittag um ein Uhr mußt Du mit Deiner Tochter wieder auf den Berg kommen!« Da jammerte alles auf's Neue in dem Schloße, und durch den Gärtner erfuhr es auch der Gehülfe, daß der Teufel noch nicht zufrieden sei, obwohl er heute schon von einem fremden Manne überwunden worden wäre.
Da begab sich der Gärtnerbursch am andern Morgen in das zweite Schloß, trank die Flasche aus, die auf dem Tische stand, hieng sich das Leibchen des Riesen und sein Schwert um, setzte sich auf den Fuchs und ritt wieder nach dem Berge. Alsbald erschien auch der Teufel als feuriger Drache und kämpfte mit dem Reiter, bis dieser endlich nach dreiviertel Stunden den Drachen besiegte und ihm mit dem Schwerte den Kopf abschlug. Dann wandte er sogleich sein Roß um und wollte es wieder in das Riesenschloß bringen, hörte aber noch, wie eine Stimme aus der Erde dem Edelmann zurief als dieser auch gerade fortwollte: »Du mußt morgen um dieselbe Zeit noch einmal mit Deiner Tochter hierher kommen!« Das hörte der Bursch noch und dachte: »schon recht! ich werde auch dabei sein!« und jagte davon, ohne sich dem Edelmann zu erkennen zu geben, und brachte Alles wieder an den Platz, wo er's genommen hatte.
Am folgenden Morgen zog er nun in das dritte Schloß, trank den Wein und bewaffnete sich mit der Riesenjacke und dem Riesenschwerte, und bestieg den Rappen und ritt dem Berge zu. Der Edelmann aber dachte: »zweimal ist deine Tochter jetzt erlöst worden; wer weiß, was beim dritten Male geschehen könnte!« Deshalb war er entschloßen, daheim zu bleiben. Allein es befiel ihn alsbald eine große Angst und Unruhe, so daß er nicht länger in seinem Schloße zu bleiben wagte, und nun auch zum dritten Male seine Tochter dem Teufel entgegenführte. Dießmal aber kam der Teufel als ein feuriger Adler durch die Luft gefahren und schoß auf den Reiter so wild hernieder, daß es grausig anzusehen war wie dieser mit dem Ungethüme streiten mußte; aber nach dreiviertel Stunden war auch der Adler besiegt. In dem Augenblick aber, wo der Bursch dem Adler den Todesstoß gab, traf derselbe mit der einen Flügelspitze noch die Hand des Reiters, daß es eine große Wunde gab. Das sah der Edelmann noch und dankte Gott, als Alles glücklich überstanden war. Der Reiter aber eilte sogleich fort, brachte das Pferd in seinen Stall, und legte das Kleid so wie das Schwert in das Zimmer und kehrte zum Schloße des Edelmanns zurück, als ob nichts vorgefallen wäre. Allein am andern Morgen, als er schon im Garten an der Arbeit war, that ihm die Hand so weh, daß er den Verband losmachte, um zu untersuchen, wie die Wunde aussähe. Dabei überraschte ihn der Edelmann und fragte sogleich, woher er die Wunde habe? Der Bursch wollte das lange nicht gestehen; allein der Edelmann ließ ihm keine Ruhe und nahm ihn sogleich mit in das Schloß, denn er vermuthete ganz fest, daß er der Retter seiner Tochter sei. Und da gestand ihm denn endlich der Bursch auch Alles, wie er die drei Riesen erlegt und durch den Wein und die Riesenschwerter den Teufel bezwungen habe, ganz wie es auf den Zetteln gestanden. Da dankte ihm der Edelmann tausendmal und sprach: »nun mußt Du auch meine Tochter heirathen!« Der Bursch aber sagte: »ja, wenn sie mich nur mag!« »O gewiß!« sprach der Vater und holte die Tochter her und sagte zu ihr: »sieh, das ist Dein Erretter, den sollst Du zum Manne haben!« »O mein Leben wollt' ich für ihn laßen!« rief die Tochter aus und herzte und küßte ihn, und ward seine liebe treue Gemahlin ihr Leben lang.
2. Das Vöglein auf der Eiche.
Ein Holzhauer arbeitete oftmals im Walde, und um keine Zeit zu verlieren, ließ er sich von seiner Frau das Eßen in den Wald bringen. Da schlachtete die Frau eines Tags ihr eigen Kind und kochte es und brachte es dem Manne hinaus; der aß nun das Fleisch ohne Arg. Als er aber heimgieng, hörte er im Walde auf einer Eiche ein Vöglein singen und verstand ganz deutlich die Worte:
Zwick, zwick,
Ein schönes Vöglein bin ich!
Meine Mutter hat mich kocht,
Mein Vater hat mich geßt.
Als der Mann nach Hause kam, erzählte er seiner Frau, was er von dem Vöglein gehört hatte und fragte nach seinem Kinde. Die Frau sagte: »Das Kind liegt schon im Bett und schläft; was Du mir aber da von dem Vöglein erzählst, das kann ich nimmermehr glauben.« Und obgleich der Mann es ihr ganz fest versicherte, daß er die Worte genau so gehört habe, so wollte sie es doch nicht zugeben und sagte, daß er sich getäuscht haben müße.
Am andern Morgen früh gieng der Mann wieder in den Wald, und wie er an die Eiche kam, sang dort das Vöglein dasselbe Lied, welches es gestern gesungen hatte. Da verwunderte er sich noch mehr und gieng auf der Stelle wieder heim, um seine Frau zu holen, damit sie selbst es hören möchte. Und so wie sie nun mit einander an den Eichbaum kamen, da sang das Vöglein:
Zwick, zwick,
Ein schönes Vöglein bin ich!
Meine Mutter hat mich kocht,
Mein Vater hat mich geßt.
Kaum aber war das Lied aus, so fiel der Eichbaum krachend um und schlug die böse Frau todt. Dem Holzhauer aber geschah kein Leid.
3. Der Räuber und die Hausthiere.
Da war einmal ein Müllerknecht, der hatte seinem Herrn schon viele Jahre lang treu und fleißig gedient, und war alt geworden in der Mühle, also, daß die schwere Arbeit, die er hier zu verrichten hatte, endlich über seine Kräfte gieng. Da sprach er eines Morgens zu seinem Herrn: »Ich kann Dir nicht länger dienen, ich bin zu schwach; entlaß mich deshalb und gib mir meinen Lohn!« Der Müller sagte: »jetzt ist nicht die Wanderzeit der Knechte; übrigens kannst Du gehen, wenn Du willst, aber Lohn bekommst Du nicht.« Da wollte der alte Knecht lieber seinen Lohn fahren laßen, als sich noch länger in der Mühle so abquälen, und verabschiedete sich von seinem Herrn.
Ehe er aber das Haus verließ, gieng er noch zu den Thieren, die er bis dahin gefüttert und gepflegt hatte, um ihnen Lebewohl zu sagen. Als er nun zuerst von dem Pferde Abschied nahm, sprach es zu ihm: »wo willst Du denn hin?« »Ich muß fort,« sagte er; »ich kann's hier nicht länger aushalten.« Und wie er dann weiter gieng, so folgte das Pferd ihm nach. Darauf begab er sich zu dem Ochsen, streichelte ihn noch einmal und sprach: »jetzt b'hüt di Gott, Alter!« »Wo willst Du denn hin?« sprach der Ochs. »Ach, ich muß fort; ich kann's hier nicht länger aushalten,« sagte der Müllerknecht und gieng traurig fort, um auch noch von dem Hunde Abschied zu nehmen. Der Ochs aber zog hinter ihm her wie das Pferd, und ebenso machten es die übrigen Hausthiere, denen er Adieu sagte, nämlich der Hund, der Hahn, die Katze und die Gans.
Als er nun draußen im Freien war und sah, daß die treuen Thiere ihm nachzogen, redete er ihnen freundlich zu, daß sie doch wieder umkehren und daheim bleiben möchten. »Ich habe jetzt selber nichts,« sprach er, »und kann für euch nicht mehr sorgen.« Allein die Thiere erklärten ihm, daß sie ihn nicht verlaßen würden und zogen vergnügt hinter ihm drein.
Da kamen sie nach etlichen Tagen in einen großen großen Wald; das Pferd und der Ochs fanden hier gutes Gras; auch die Gans und der Hahn ließen sich's schmecken; die andern Thiere aber, die Katze und der Hund, die mußten Hunger leiden wie der alte Müllerknecht, und knurrten und murrten nicht darüber. Endlich, als sie ganz tief in den Wald hineingekommen waren, sahen sie auf einmal ein schönes großes Haus vor sich stehen; das war aber fest zugeschloßen; nur ein Stall stand offen und war leer, und von hieraus konnte man durch eine Scheuer in das eigentliche Haus kommen. Weil nun Niemand in dem Hause zu sehen war, so beschloß der Knecht, mit seinen Thieren daselbst zu bleiben, und wies einem jeden seinen Platz an. Das Pferd stellte er vorn in den Stall, den Ochsen führte er an die andere Seite; der Hahn bekam seinen Platz auf dem Dache, der Hund auf dem Miste, die Katze auf dem Feuerheerde, die Gans hinterm Ofen. Dann reichte er jedem sein Futter, das er in dem Hause reichlich vorfand, und er selbst aß und trank was er mochte, und legte sich dann schlafen in ein gutes Bett, das in der Kammer fertig dastand.
Als es nun schon Nacht war und er fest schlief, kam der Räuber, dem dieß Waldhaus gehörte, zurück. Wie der aber in den Hof trat, sprang sogleich der Hund wie wüthend auf ihn los und bellte ihn an; dann schrie der Hahn vom Dache herunter: »Kikeriki! Kikeriki!« also, daß es dem Räuber angst und bange wurde; denn er hatte in seinem Leben noch keine Hausthiere gesehen, die mit dem Menschen zusammenleben, sondern kannte bloß die wilden Thiere des Waldes. Deshalb nahm er Reißaus und sprang eilig in den Stall; aber da schlug das Pferd hinten aus und traf ihn an die Seite, daß er um und um taumelte und sich nur mit Mühe noch in die hintere Seite des Stalles flüchten konnte. Kaum aber war er hier angekommen, so drehte sich auch schon der Ochs um und wollte ihn auf seine Hörner nehmen. Da bekam er einen neuen Schrecken und lief, was er konnte, durch die Scheuer hindurch und dann in die Küche, um ein Licht anzuzünden und zu sehen, was da los sei. Wie er nun auf dem Heerde herumtastete und die Katze anrührte, fuhr die auf ihn los und kratzte ihn dermaßen mit ihren Tatzen, daß er halsüberkopf davonsprang und sich eben in der Stube hinter den Ofen verkriechen wollte. Da wachte aber die Gans auf und schrie und schlug mit den Flügeln, daß es dem Räuber höllenangst wurde und er sich in die Kammer flüchtete. Da schnarchte nun der alte Müllerknecht in dem Bette so kräftig wie ein schnurrendes Spinnrad, daß der Räuber meinte, die ganze Kammer sei mit fremden Leuten angefüllt. Da überfiel ihn ein arges Grauen und Grausen, kannst du glauben, und er lief schnell zum Hause hinaus und rannte in den Wald hinein, und stand nicht eher still, als bis er seine Raubgesellen gefunden hatte.
Da fieng er nun an zu erzählen: »Ich weiß nicht, was mit unserm Hause vorgegangen ist; es wohnt ein ganz fremdes Volk darin. Als ich in den Hof trat, sprang ein großer wilder Mann auf mich zu und schalt und brüllte so grimmig, daß ich dachte, er würde mich umbringen. Ein anderer reizte ihn noch auf und rief vom Dache herunter: ›gib'm au für mi! gib'm au für mi!‹ (gib ihm auch für mich!) Da mir's der Erste schon arg genug machte, so wollte ich nicht warten, bis ihrer etwa mehre über mich herfielen, und flüchtete mich in den Stall. Aber da hat ein Schuhknecht (Schuster) mir einen Leisten an die Seite geworfen, daß ich's noch spüre; und als ich dann hinten in den Stall kam, stand da ein Gabelmacher und wollte mich mit seiner Gabel aufspießen; und als ich in die Küche kam, saß da ein Hechelmacher und schlug mir seine Hechel in die Hand; und als ich in die Stube sprang und mich hinterm Ofen verstecken wollte, da schlug mich ein Schaufelmacher mit seiner Schaufel; als ich aber endlich in die Kammer lief, da schnarchten darin noch so viele andere, daß ich nur froh sein mußte, als ich lebendig wieder draußen war.«
Als die Räuber dieß hörten, entsetzten sich alle so sehr, daß keiner Lust hatte, in das Haus zu gehen. Nein, sie meinten, die ganze Umgegend sei durch dieß fremde Volk unsicher geworden und zogen noch in selbiger Nacht fort, weit weg in ein anderes Land, und sind nie wieder gekommen.
Da lebte nun der Müllerknecht mit seinen treuen Thieren in Ruh und Frieden in dem Hause der Räuber, und brauchte sich nicht mehr zu plagen in seinen alten Tagen; denn der schöne Garten neben dem Hause trug ihm jährlich mehr Obst, Gemüse und allerlei Nahrung, als er und seine Thiere verzehren konnten.
4. Aschengrittel.
Ein junges Mädchen hatte eine Stiefmutter und zwei Stiefschwestern, die es alle mit einander beständig zankten und quälten und neckten, also, daß das arme Kind schon früh recht viel zu leiden hatte. Es mußte alle Arbeiten im Hause thun, und ihre jüngern Schwestern durften ihr befehlen, was sie nur wollten; und das thaten sie denn auch und gebrauchten sie zu den niedrigsten Arbeiten, als ob sie eine gewöhnliche Dienstmagd wäre. Sie mußte Waßer holen, Schuhe und Kleider putzen, das Haus kehren, die Schüßeln spülen, und bekam immer alte, abgetragene Kleider. Aus Spott wurde sie von der Stiefmutter und den Schwestern bloß Aschengrittel genannt; denn um sie zu ärgern, warfen sie zuweilen eine Handvoll Linsen in die Asche und sagten ihr, daß sie sie wieder herauslesen sollte.
Da geschah es, daß der Vater einmal eine Reise machen wollte und seine Töchter fragte, was sie sich wünschten, daß er ihnen mitbringe. Da wünschten sich die beiden jüngsten schöne Kleider und goldene Ohrringe und Halsketten, die ihnen der Vater auch mitzubringen versprach. Aschengrittel aber wünschte sich bloß das erste Zweiglein, welches der Vater unterwegs mit seinem Hute berühre. Die Schwestern lachten und spotteten darüber, weil's ihnen gar zu dumm vorkam; allein Aschengrittel kümmerte sich nicht darum und war ganz vergnügt, als der Vater ihr einen kleinen Haselzweig mitbrachte; denn der hatte wirklich zuerst seinen Hut berührt. Aschengrittel steckte den Zweig aus Freude an seine Brust und trug ihn beständig bei sich. Als es nun am folgenden Tage zum Brunnen gieng, um Waßer zu schöpfen, da kam mit einem Male aus dem Brunnen ein »Zwergle,« ein kleines altes Männlein, das hatte einen ganz weißen Bart und sagte zu Aschengrittel: es dürfe für sich drei gute und drei böse Wünsche thun, die sollten ihm gewährt werden. Da wollte aber Aschengrittel die bösen Wünsche nicht nehmen und wünschte sich zum ersten: daß doch ihre Mutter und die Schwestern künftig freundlich gegen sie sein möchten. Darüber verwunderte sich das Zwerglein und sagte: »ich sehe wohl, daß Du ein gutes Herz hast, und will Dir deshalb dieß goldne Stäblein schenken, das wird Dir Alles verschaffen, was Du Dir nur wünschen magst. Du darfst nur mit dem Stabe zum Brunnen gehen und damit auf den Brunnenrand klopfen und Deinen Wunsch aussprechen, so wird er alsbald Dir erfüllt werden.« Und wie das Männlein dieß gesagt hatte, war es mit einem Male wieder verschwunden. Aschengrittel aber verwahrte das Stöcklein sehr wohl und war fröhlich und guter Dinge.
Da trug sich's zu, daß der junge König einen großen Ball veranstaltete; denn er gedachte sich zu vermählen und wollte gern sehen, welches wohl die schönste Jungfrau im Lande sein möchte. Auf diesen Ball giengen auch die Schwestern von Aschengrittel; aber Aschengrittel selbst durfte nicht hinkommen, weil es so zerrißene und schmutzige Kleider anhabe, sagten sie. Kaum aber waren alle fort, so that Aschengrittel flink seine Hausarbeit, dann wusch und kämmte es sich, holte sein goldenes Stäblein hervor und gieng damit zum Brunnen und klopfte auf den Rand und wünschte sich ein schönes Ballkleid mit allem Schmuck, der dazu gehöre. Mit einem Male lag ein wunderschönes Kleid und der prächtigste Schmuck von Gold und Perlen daneben. Schnell legte Aschengrittel alles an und gieng in's Schloß auf den Ball. Da kannte nun Niemand das schöne Fräulein. Sie war aber so wunderschön anzusehen, daß man die Augen gar nicht von ihr wegwenden konnte, weshalb denn auch der junge König den ganzen Abend hindurch am meisten und am liebsten mit ihr tanzte und sehr vergnügt war. – Mit einem Male aber, noch ehe die andern fortgiengen, war Aschengrittel verschwunden. Dem Könige that das sehr leid, weil er gar nicht wußte, wer die Jungfrau war und wo sie wohnte. Deshalb veranstaltete er bald einen zweiten Ball. Da machte es Aschengrittel ebenso wie das erste Mal und hatte einen noch weit kostbareren Schmuck und schien so schön, daß der König sich ganz in sie verliebte und sie gar nicht mehr von seiner Seite ließ. Zuletzt bat er sich's sogar aus, daß er sie nach Haus begleiten dürfe; allein Aschengrittel wußte sich wieder allein fortzuschleichen. Nun hatte der junge König keine Ruhe mehr, bis daß der dritte Ball gegeben wurde. Da erschien auch Aschengrittel wieder und der König meinte, sie sei dießmal noch viel schöner als die beiden früheren Male, und war über die Maßen glücklich. Damit sie aber nicht noch einmal ihm entschlüpfe und damit er endlich erfahre, wo sie wohne, so ließ er alle Thüren des Schloßes bis auf eine verschließen, an dieser einen aber die Schwelle mit Pech bestreichen. Nun gab er beständig Achtung auf Aschengrittel und gedachte sie nach Haus zu begleiten, und sah auch richtig, wie sie eben sich fortschleichen wollte. Da gieng er ihr nach; allein Aschengrittel hatte ihn auch gesehen und lief, was sie nur konnte, zu der Thür hinaus, und ließ lieber ihren einen goldenen Schuh, der an dem Pech stecken blieb, im Stich, als daß sie den König mit nach Haus genommen hätte.
Der junge König aber war doch froh, daß er wenigstens Etwas von dem lieben Mädchen bekommen hatte; und außerdem war der goldne Schuh so schön, so sein und zierlich, wie er noch nie einen gesehen hatte. Deshalb ließ er gleich am folgenden Tage bekannt machen: daß das Fräulein, welchem dieser Schuh passe, seine Gemahlin werden solle, und gieng selbst damit von Haus zu Haus, damit alle jungen Mädchen ihn anprobiren möchten.
Da kam er auch in das Haus, wo Aschengrittel wohnte, und die Stiefmutter führte sogleich ihre beiden Töchter in die Kammer, um den Schuh anzuprobiren, und beredete die eine, als sie nicht hineinkommen konnte, sich die große Zehe abzuschneiden, was sie auch that; allein es war umsonst. Die andere Schwester schnitt sich ein Stück von der Ferse ab; aber es half ihr auch nichts. – Den König aber hat es angeschauert, wie er in dem Schuh noch Blutflecken erblickte, und er sprach:
Gru, Gru!
Der Schuh ist voll Blut!
Das ist nicht die rechte Braut.