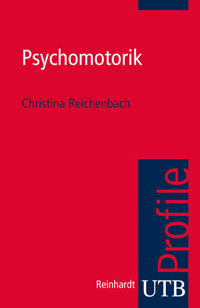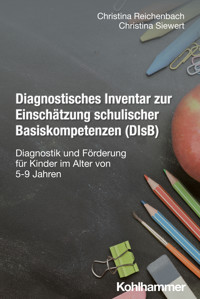
Diagnostisches Inventar zur Einschätzung schulischer Basiskompetenzen (DIsB) E-Book
Christina Reichenbach
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wie können die Schulfähigkeit und -bereitschaft eines Kindes sinnvoll und kindorientiert eingeschätzt werden? Dieses Buch bietet ein qualitatives diagnostisches Verfahren zur Überprüfung der Basiskompetenzen für Kinder im Schuleingangsbereich (5-9 Jahre), das sich in der Praxis bereits bewährt hat. Es stellt anschaulich alle Entwicklungsbereiche (Bewegung, Sprache, Kognition, Wahrnehmung und sozial-emotionale Entwicklung) theoretisch fundiert vor. Daran schließt sich eine strukturierte, alltagsnahe Aufgabensammlung für jeden einzelnen Entwicklungsbereich an. Diese Aufgaben ermöglichen es, prozessbegleitend individuelle Entwicklungen zu beschreiben und Erkenntnisse zur möglichen Förderung im Praxisalltag zu erhalten. Das DIsB eignet sich insbesondere für die Arbeit von HeilpädagogInnen, ErzieherInnen und (sonder-)pädagogischen Fachkräften, da es Diagnostik und Förderung optimal miteinander verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Schulfähigkeit
1.2 Bedürfnisse von Praktikerinnen an eine Schuleingangsdiagnostik
1.2.1 Welche Verfahren und Materialien werden in der diagnostischen Praxis angewendet?
1.2.2 Welche Vorteile dieser diagnostischen Verfahren werden gesehen?
1.2.3 Was sind Wünsche für diagnostische Verfahren?
1.2.4 Welche Entwicklungsbereiche sind relevant?
1.2.5 Welche Aufgaben sind besonders geeignet, um diese Entwicklungsbereiche zu erfassen?
2 Bildungsvereinbarungen
2.1 Bildungsziele und Bildungsbereiche
2.1.1 Bildungsbereiche in Deutschland
2.1.2 Bildungsbereiche in Österreich
2.1.3 Bildungsbereiche in der Schweiz
2.2 Schulfähigkeitsprofil als Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule
2.3 Umsetzung der Bildungsvereinbarungen in der Praxis
3 Verständnis von Entwicklung und Entwicklungsbereichen
3.1 Entwicklung
3.2 Bewegung
3.2.1 Modell von Bewegung
3.2.2 Definitionen von Bewegungsdimensionen
3.3 Intelligenz und Kognition
3.3.1 Modell kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten
3.3.2 Definitionen von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
3.4 Sozial-emotionale Entwicklung
3.4.1 Modell von sozial-emotionaler Entwicklung
3.4.2 Definitionen von Dimensionen sozial-emotionaler Entwicklung
3.5 Sprache und Kommunikation
3.5.1 Modell von Sprache und Kommunikation
3.5.2 Definitionen von Dimensionen zur Sprache und Kommunikation
3.6 Wahrnehmung
3.6.1 Modell von Wahrnehmung
3.6.2 Definitionen von Wahrnehmungsbereichen und -dimensionen
3.7 Bedeutung für den Schuleintritt
3.8 Lerntypen
4 Diagnostik und Förderung
4.1 Verständnis Diagnostik
4.2 Diagnostische Methoden
4.3 Verständnis Förderung
4.4 Verständnis von Diagnostik und Förderung als Einheit
4.5 Begründung einer individuellen statt altersnormierten Diagnostik
4.6 Arbeit mit Diagnostischen Inventaren
5 »Bedienungsanleitung« für den Umgang mit dem DIsB
5.1 Menüfragen
5.2 Beschreibung und Erklärung des Aufgabenbogens
6 Praxisteil
6.1 Aufgabenübersicht
6.2 Aufgaben für den Bereich Bewegung
6.3 Aufgaben für den Bereich Intelligenz und Kognition
6.4 Aufgaben für den Bereich sozial-emotionale Entwicklung
6.5 Aufgaben für den Bereich Sprache und Kommunikation
6.6 Aufgaben für den Bereich Wahrnehmung
6.6.1 Auditive Wahrnehmung
6.6.2 Raum-Zeit-Wahrnehmung
6.6.3 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
6.6.4 Visuelle Wahrnehmung
6.7 Diagnostische Menüs – Beispiele
6.7.1 Diagnostisches Menü: »Abenteuerinsel« (von Sophie Guttzeit, Bochum)
6.7.2 Diagnostisches Menü für den Bereich: Wissen vom und Zeichnung des eigenen Körpers (von: Manuela Grenzdörfer, Hannover)
7 Tabellarische Übersicht diagnostischer Verfahren im Schuleingangsbereich
8 Literaturverzeichnis
Quellen der diagnostischen Verfahren (alphabetisch sortiert)
Die Autorinnen
Dr. Christina Reichenbach hat die Professur »Heilpädagogik« mit dem Schwerpunkt Förderung, Bildung und Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung an der Evangelischen Hochschule Bochum.
Dipl.-Päd. Christina Siewert ist als Lehrkraft in den Bildungsgängen »Heilpädagogik« und »Sozialpädagogik« im Diakonie-Kolleg Hannover tätig.
Christina Reichenbach/Christina Siewert
Diagnostisches Inventar zur Einschätzung schulischer Basiskompetenzen (DIsB)
Diagnostik und Förderung für Kinderim Alter von 5 – 9 Jahren
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Ein Großteil der Abbildungen wurde von Daniela Gulatz in Zusammenarbeit mit den Autorinnen erstellt.Umschlagsabbildung: iStock.com/karandaev1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-045168-1
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-045169-8epub: ISBN 978-3-17-045170-4
Vorwort
Mit diesem Buch legen wir ein Verfahren zur Diagnostik im Schuleingangsbereich vor, in dem wir auf die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Erfassung von Kompetenzen zur Schulfähigkeit in Praxis und Theorie reagieren.
Da wir selbst die Erfahrung gemacht haben, dass eine kooperative Zusammenarbeit von Fachleuten sehr gewinnbringend ist, haben wir das Verfahren »Diagnostisches Inventar zur Einschätzung schulischer Basiskompetenzen« (DIsB) entwickelt, welches sowohl eine Anwendung von verschiedenen Fachleuten als auch eine Kooperation dieser ermöglicht.
Unser Verständnis von Diagnostik und Förderung ist sehr durch unseren Mentor Prof. Dr. Dietrich Eggert geprägt. Er inspirierte uns stets in Form von Anregungen und Diskussionen und daher möchten wir ihm im Besonderen danken.
Spezielle Unterstützung haben wir bei Frau Prof. Dr. Tanja Jungmann erhalten, die das Kapitel zur »Sprache und Kommunikation« (▸ Kap. 3.5) verfasst und bei dem Kapitel »Intelligenz und Kognition« (▸ Kap. 3.3) mitgewirkt hat.
Um den Anwenderinnen1 vielfältige Arbeitsmaterialien zu den Aufgaben bereitzustellen, wurden von Frau Daniela Gulatz zahlreiche Zeichnungen bzw. Abbildungen erstellt. Dafür danken wir ihr herzlich.
Während der Beschäftigung mit diesem Thema haben uns viele Menschen bestärkt. Insbesondere möchten wir uns bei denjenigen Praktikerinnen bedanken, die unsere Rohfassungen inhaltlich und kritisch Korrektur gelesen haben. Weiterhin danken wir denjenigen Praktikerinnen und Institutionen, die an unserer Untersuchung teilgenommen und somit einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.
Trebnitz, März 2024Christina Reichenbach & Christina Siewert
Endnoten
1Im weiteren Text werden wir zur besseren Leserlichkeit und aufgrund der Annahme, dass das Buch vorwiegend Pädagoginnen lesen werden, stets die weibliche Form verwenden. Es sind stets alle Geschlechter angesprochen.
1 Einleitung
1.1 Schulfähigkeit
Es gibt zahlreiche diagnostische Verfahren und Materialien zur Diagnostik schulischer Basiskompetenzen. Diese Fülle an Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik mit ihren jeweiligen ausgewählten Inhalten verwundert nicht, da die Komponenten, die Schulfähigkeit ausmachen, nicht einheitlich festgelegt sind. In der Regel soll mit derartigen Verfahren geprüft werden, »ob ein schulpflichtiges Kind den Anforderungen der Schule gewachsen ist« (Schmidt-Atzert u. a., 2021, 673).
Die Frage, die sich nun die eine oder andere Leserin stellen mag: »Warum dann ein weiteres Verfahren zu diesem Bereich?«, ist daher durchaus berechtigt.
Bei einer genauen Durchsicht der Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik und aufgrund unserer eigenen praktischen Erfahrungen haben wir festgestellt, dass die entsprechenden Verfahren zumeist sehr speziell auf schulische Fähigkeiten und Fertigkeiten, vorwiegend im kognitiven Bereich, ausgerichtet sind. Hinzu kommt, dass sie in der Regel für einen Entwicklungsbereich und/oder eine Anwenderinnengruppe konzipiert sind. Zudem geben sie wenig bis keine Hinweise für eine Förderung.
Eine Schuleingangsdiagnostik soll sicherstellen, dass ein Kind mit dem Schuleintritt, zum Zeitpunkt der Einschulung, mit den erwarteten schulischen Anforderungen nicht überfordert wird (vgl. Schmidt-Atzert u. a., 2021). Um individuellen Bedürfnissen von Kindern im Schulbetrieb entgegenzukommen, sind Schuleingangsuntersuchungen aus unserer Sicht durchaus nützlich, wenn sie frühzeitig beginnen. Nur wenn die Kinder langfristig bereits im vorschulischen Bereich individuell begleitet und hinsichtlich schulrelevanter Anforderungen gefördert werden, ist es gewährleistet, dass die Kinder die Kompetenzen, die im schulischen Bereich gefordert werden, erfüllen können. Denn es ergibt keinen Sinn, wenn erst kurz vor Beginn der Schule festgestellt wird, dass ein Kind entsprechende Anforderungen der Schule nicht erfüllt.
Mit diesem Buch wollen wir ein Verfahren vorlegen, das die oben genannten Lücken füllt und das
sowohl Grundschullehrerinnen, Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Ärztinnen und/oder Pädagoginnen/Therapeutinnen nutzen können, die mit Kindern im Schuleingangsbereich arbeiten,
es ermöglicht, sowohl einzelne Entwicklungsbereiche in den Blick zu nehmen als auch einen Gesamtüberblick von Entwicklung zu erhalten,
eine Einschätzung der individuellen Entwicklung ermöglicht,
alltagsnahe Förderhinweise zur Entwicklungsanregung bietet.
Dadurch, dass das vorliegende Verfahren »Diagnostisches Inventar zur Einschätzung schulischer Basiskompetenzen« (DIsB) die genannten Aspekte erfüllt, ist die Möglichkeit zur fortlaufenden Einschätzung von Kompetenzen eines Kindes von der Zeit des Kindergartens bis in den Grundschulbereich und damit einer Prozessdiagnostik gegeben.
Diese fortlaufende Einsetzbarkeit des Verfahrens kommt dem Gedanken entgegen, dass Schulfähigkeit u. a. als ein Resultat der vorschulischen Lerngeschichte verstanden wird. Schulfähigkeit hängt nicht allein vom Entwicklungsstand des Kindes ab, sondern von der Qualität der Angebote im vorschulischen Bereich und des Anfangsunterrichts. Schulfähigkeit beinhaltet neben den Fähigkeiten auch erlernte Fertigkeiten (vgl. Schmidt-Atzert u. a., 2021). Damit ist eine Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule unabdingbar. Nur so kann verstanden werden, warum sich ein Kind wie entwickelt und welche Anregungsbedingungen in der Umwelt wesentlich für den individuellen Lernerfolg eines Schülers oder einer Schülerin sind bzw. sein können (vgl. Kammermeyer/Martschinke, 2018).
Insbesondere muss Schulfähigkeit immer im Zusammenhang mit den Anforderungen und Bedingungen der jeweiligen Institution (z. B. Schule) gesehen werden (vgl. Kammermeyer/Martschinke, 2018).
Dementsprechend ist es neben dieser beobachtenden und beschreibenden Entwicklungsdiagnostik erforderlich, die Eltern/Bezugspersonen des Kindes einzubeziehen, um weitere Informationen zu erhalten, die dann gegebenenfalls eine deutlichere Erklärung des Entwicklungsverlaufs ermöglichen.
Darüber hinaus sind Überlegungen zu Ursachen und/oder anderen erklärenden Bedingungen des individuellen Entwicklungsverlaufs abzuklären.
Das DIsB stellt das Kind in seiner individuellen Entwicklung in den Vordergrund der Betrachtung, wobei pädagogischen Fachkräften durch die umfangreiche Aufgabensammlung Anregungen für eine individuelle Förderung des Kindes gegeben werden.
Wer mit diesem Buch bzw. dem Verfahren DIsB arbeitet, erhält die Möglichkeit, die Entwicklung eines Kindes individuell zu beschreiben und anhand von einzelnen Entwicklungskomponenten deren Bedeutung für die Anforderungen in der Schule zu erkennen.
Wenn die Anwenderin dieses Buches bzw. Verfahrens zu dem Schluss kommt, dass die gemachten Beobachtungen allein nicht ausreichen, kann es erforderlich sein,
eine weitere heilpädagogische Fachkraft (z. B. bei entwicklungsbezogenen Besonderheiten),
eine Fachärztin (z. B. bei Sehbeeinträchtigungen, Hörbeeinträchtigungen),
eine Psychologin (z. B. bei scheinbar tiefenpsychologisch begründeter Problematik) und/oder
eine weitere pädagogische/therapeutische Fachkraft hinzuziehen.
Zur (Er-)Klärung und besseren Anwendbarkeit umreißen wir zunächst unser Verständnis von Entwicklung im Allgemeinen und definieren die einzelnen Entwicklungskomponenten im Speziellen.
1.2 Bedürfnisse von Praktikerinnen an eine Schuleingangsdiagnostik
Ziel dieses Buchs ist es nicht, etwas Neues zu erfinden, sondern unser Augenmerk auf die Bedürfnisse der Praktikerinnen zu richten.
Unser Hauptanliegen ist, nicht allein auf unseren Erfahrungen beruhend ein diagnostisches Verfahren für den Schuleingangsbereich vorzulegen, sondern möglichst viele Erfahrungen, Anliegen und Bedürfnisse von Praktikerinnen zu berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir eine umfangreiche Bedarfsanalyse mittels Fragebogen bei Praktikerinnen im Schuleingangsbereich durchgeführt, an der insgesamt 105 Fachkräfte (Lehrerinnen, Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Motopädinnen) teilgenommen haben. Von den befragten Personen waren einige in mehreren Arbeitsfeldern tätig (Kindergarten, Kindertagesstätte, Grundschule, Verein, Ambulanz, Praxis, Frühförderstelle, Kinder(wohn)heim, Förderschule).
Dabei war es uns wichtig, folgenden Fragen nachzugehen:
1.
Welche Verfahren und Materialien werden in der diagnostischen Praxis angewendet?
2.
Welche Vorteile dieser diagnostischen Verfahren werden gesehen?
3.
Was sind Wünsche an diagnostische Verfahren?
4.
Welche Entwicklungsbereiche sind relevant?
5.
Welche Aufgaben sind besonders geeignet, um diese Entwicklungsbereiche zu erfassen?
Im Folgenden werden wir hier zunächst die Ergebnisse zu den ersten vier Fragestellungen skizzieren. Die Antworten der fünften Frage haben wir in der Zusammenstellung der Aufgaben berücksichtigt.
1.2.1 Welche Verfahren und Materialien werden in der diagnostischen Praxis angewendet?
Es zeigte sich, dass ca. die Hälfte der befragten Praktikerinnen selbständig entwickelte Beobachtungsbogen und/oder selbst entwickelte Screenings für die Beobachtung von Kindern nutzen. Ein Großteil der Praktikerinnen bevorzugt bei der Schuleingangsdiagnostik neben der eigenen Beobachtung die Anwendung von standardisierten Tests und/oder Screenings. Dabei gab es keinen Unterschied der Aussagen zur Anwendung in Abhängigkeit von der Institution, d. h., dass bspw. sowohl Lehrerinnen als auch Erzieherinnen die genannten Einschätzungsmethoden nutzen.
Die Vielfalt der Screenings war größer und bezog sich neben grundlegenden Schuleingangsfähigkeiten auch bereits auf konkrete Schulfächer (z. B. Mathe oder Deutsch).
Ein Überblick zu Verfahren im Bereich der Schuleingangsdiagnostik findet sich im Anhang dieses Buchs (▸ Kap. 7). Dort wird eine Übersicht hinsichtlich der Art/Methode des Verfahrens (Test, Screening, Inventar) und den darin angesprochenen Entwicklungsbereichen (z. B. Motorik, Wahrnehmung, Sprache) gegeben.
1.2.2 Welche Vorteile dieser diagnostischen Verfahren werden gesehen?
Im Folgenden werden die von den Praktikerinnen als wesentlich genannten Vorteile, ungeachtet der speziellen Aussagen zu einzelnen Verfahren, zusammenfassend dargestellt.
Ziele des Verfahrens
Erfassung vieler Entwicklungsbereiche
Erkennen von Stärken und Förderbedürfnissen
Durchführung
Übersichtlichkeit und klare Struktur des Verfahrens
Möglichkeit, dass zwei Fachkräfte ein Kind über einen längeren Zeitraum beobachten können
Gut erklärte Aufgaben
Spielerische Elemente, welche der Freude der Kinder entgegenkommen
Einfache Handhabung
Aufgaben, die keinen erhöhten Materialbedarf erfordern
Auswertung/Interpretation
Klare Ergebnisse
Möglichkeit der Nutzung der Ergebnisse für Gespräche mit Bezugspersonen (v. a. Eltern)
Konkrete Formulierung von altersentsprechenden Kompetenzen
1.2.3 Was sind Wünsche für diagnostische Verfahren?
Einführend sei gesagt, dass ca. 1/3 der befragten Praktikerinnen keine Angaben zu Wünschen an diagnostischen Verfahren vermerkte, auch wenn explizit Unzufriedenheit mit dem genutzten Verfahren genannt wurde. Die übrigen 2/3 der befragten Praktikerinnen nannten Wünsche, die einen hohen Überschneidungsbereich mit den angegebenen Vorteilen diagnostischer Verfahren aufweisen.
Ziele des Verfahrens
Einblick in verschiedene Entwicklungsbereiche
Ermöglichung von Förderempfehlungen und praktische Aufgaben zur Förderung
Durchführung
Geringer Zeitaufwand
Leichte Handhabbarkeit, Praktikabilität
Wenig materieller Aufwand
Auswertung/Interpretation
Genaue, umfangreiche Formulierungen
Genaue Anhaltspunkte, was ein Kind können muss (Richtlinien)
Zum Teil zeigte sich eine aus unserer Sicht paradoxe Zusammenstellung von Wünschen, z. B. wurden zugleich eine hohe Ökonomie in Form einer kurzen Durchführungsdauer und eine ganzheitliche Einschätzung der Entwicklung des Kindes gewünscht. Warum dies paradoxe Züge aufweist, wird in Kapitel 4 deutlich, in dem wir unser Verständnis von einer förderungsorientierten Diagnostik aufzeigen (▸ Kap. 4).
Außerdem wünschte sich ein Großteil der Praktikerinnen mehr Zeit für eine diagnostische Untersuchung, was sicherlich verständlich, jedoch institutionell bedingt ist, somit kann diesem Wunsch von außen nicht direkt entgegengekommen werden.
1.2.4 Welche Entwicklungsbereiche sind relevant?
Die Fragebogenerhebung ergab, dass ein Großteil der Praktikerinnen nicht direkt übergeordnete Entwicklungsbereiche nannte, sondern sofort speziell auf einzelne Dimensionen von Entwicklungsbereichen sowie auf Fähigkeiten und Fertigkeiten einging.
Im Folgenden sehen Sie eine überblicksartige Darstellung der genannten Entwicklungsbereiche und der darin wesentlich enthaltenen Entwicklungsdimensionen. An anderer Stelle in diesem Buch wird unter Berücksichtigung dieser Nennungen eine Auswahl von wesentlichen Begriffen zusammengestellt und definiert (▸ Kap. 3).
Sicherlich hat jede Einzelne bei der Benennung von Schlagworten ihr eigenes Verständnis im Kopf, jedoch wurde dies nicht erfasst. Daher werden wir für dieses Buch die wesentlichen Begriffe definieren, um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für die Anwendung zu haben.
1.
Sprachentwicklung/Sprachkompetenz (Wortschatz, Aussprache, Verbaler Ausdruck, Zuhören, Begriffsbildung, Kommunikationsfähigkeit, Sprach-/Sprechfähigkeit, Grammatik, Anweisungsverständnis, Sprachverständnis, Artikulation, Lautbildung, Sprachgedächtnis, Phonologische Bewusstheit, Satzbildung)
2.
Motorische Entwicklung (Feinmotorik, Grobmotorik, Gesamtkörperkoordination, Gleichgewicht, Graphomotorik, Körperwahrnehmung, Handmotorik, Augen-Hand-Koordination, Lateralität, Rhythmus)
3.
Kognitive Entwicklung (Ausdauer/Konzentration, Mathematische Kompetenz, Mengenverständnis, Arbeitsverhalten, Leistungsfähigkeit, Logisches Denken, Motivation, Kreativität, Merkfähigkeit, Aufgabenverständnis, Zahlenbegriff, Textverständnis)
4.
Wahrnehmung (Visuelle Wahrnehmung, Auditive Wahrnehmung, Kinästhetische Wahrnehmung, Taktile Wahrnehmung, Vestibuläre Wahrnehmung, Raum-Zeit-Wahrnehmung)
5.
Soziale Kompetenz/Entwicklung (Personale Kompetenz, Interaktionsfähigkeit, Bedürfnisse Anderer akzeptieren, Eigene Bedürfnisse artikulieren können, Selbständigkeit, Gruppenfähigkeit, Regelverständnis, Frustrationstoleranz, Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie Verantwortung, Beziehungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie, Emotionale Belastbarkeit); Selbstkonzept (Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Eigenkompetenz, Selbstorganisation, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbststeuerung, Anstrengungsbereitschaft, Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle, Körperschema).
1.2.5 Welche Aufgaben sind besonders geeignet, um diese Entwicklungsbereiche zu erfassen?
Der Einblick in die zahlreichen und differenzierten Vorstellungen der Praktikerinnen hinsichtlich wesentlicher Aufgaben zur Erfassung von Entwicklungskomponenten war sehr hilfreich. Eine Übersicht zu allen genannten und beschriebenen Aufgaben an dieser Stelle würde den Rahmen sprengen. Jedoch haben wir die entsprechenden Aufgaben für die in diesem Buch vorliegende Material- und Aufgabensammlung genutzt und ergänzt. Die Ergänzung betrifft dabei nicht allein die Art der Aufgaben, sondern v. a. mögliche Differenzierungen bzw. Variationen von Aufgabeninhalten.
Die von den Praktikerinnen zusammengestellten Aufgaben bildeten einen Grundstock für unsere Aufgabenauswahl zu einzelnen Entwicklungsbereichen. Neben den erwähnten Differenzierungen war es uns, im Sinne der Praktikerinnen, zudem ein Anliegen, für diese Aufgaben Beobachtungshinweise sowie Interpretationsmöglichkeiten anhand ausgewählter Entwicklungsdimensionen vorzuschlagen.
2 Bildungsvereinbarungen
Die Debatte über neue Bildungsvereinbarungen hinsichtlich des Übergangs vom Elementar- zum Primarbereich wurde bereits in den 1970er Jahren vom Deutschen Bildungsrat gefordert. In Deutschland hat jedes Bundesland eigene Vereinbarungen und Bildungspläne, die es umzusetzen gilt. Aufgrund fehlender Vorgaben des Bundes kann also jedes Bundesland für sich die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und (Grund-)Schulen regeln. Die Vereinbarungen und Empfehlungen fallen im Vergleich der Bundesländer sehr unterschiedlich aus (vgl. Schneider/Toyka-Seid, 2023). Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden Bildungsinstitutionen (Kindergarten/Kindertagesstätte und Schule) unterschiedlichen Ministerien zugeordnet sind. Dementsprechend ist die Kooperation in der Praxis erschwert. Das Ziel ist es, einen nahtlosen Übergang zwischen Kindergarten/Kindertagesstätten und Schule zu erreichen.
Einen gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen stellen
»die Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Kindertageseinrichtungen dar und wird durch die Bildungspläne auf Landesebene konkretisiert, ausgefüllt und erweitert. Innerhalb des gemeinsamen Rahmens gehen alle Länder eigene, den jeweiligen Situationen angemessene Wege der Ausdifferenzierung und Umsetzung. Bildungspläne sind Orientierungsrahmen mit jeweils länderspezifischer Verbindlichkeit, auf deren Grundlage die Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten träger- oder einrichtungsspezifische Konzeptionen erstellen« (JFMK/KMK, 2022, 4).
Ein zentraler Gedanke der Bildungsvereinbarung ist das Bildungsverständnis, welches von der Tätigkeit des Kindes selbst ausgeht. Laut Schäfer wird unter Selbstbildung »die Tätigkeit, die Kinder verrichten müssen, um das, was um sie herum geschieht, aufnehmen und zu einem inneren Bild ihrer Wirklichkeit verarbeiten zu können«, verstanden (2004, 7). Es geht demnach darum, sich in der Auseinandersetzung mit der Welt die Welt selbsttätig und im Dialog mit anderen lernend zu erschließen.
2.1 Bildungsziele und Bildungsbereiche
Es können Bildungsziele und Bildungsbereiche voneinander unterschieden werden.Als Bildungsziele werden vom Institut für Menschenrechte (Artikel 29 – Recht auf Bildung) benannt:
»Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,
a)
die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
b)
dem Kind Achtung vor den Menschen-rechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
c)
dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;
d)
das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e)
dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. (...)« (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte/recht-auf-bildung)
2.1.1 Bildungsbereiche in Deutschland
Nach Durchsicht der Bildungsvereinbarungen der einzelnen 16 Bundesländer zeigt sich, dass:
die Anzahl der genannten Bildungsbereiche und/oder Unterbereiche pro Bundesland stark variiert,
unterschiedliche (Unter-)Bereiche pro Bundesland genannt werden,
verschiedene Begrifflichkeiten für Unterbereiche genutzt werden,
es keine einheitlichen übergeordneten Bildungsbereiche gibt,
der Umfang der Bildungspläne stark variiert (zwischen 10 und 505 Seiten),
die angesprochenen Altersgruppen sich unterscheiden und zum Teil nicht direkt in den Rahmenrichtlinien genannt werden.
Wir haben im Folgenden die genannten Bildungsbereiche einzelnen übergeordneten Kategorien zugeordnet (fett markiert). Im Überblick stellen sich demnach zusammengefasst folgende Bildungsbereiche heraus (Stand März 2023):
Da die Unterschiede so gravierend sind, findet sich im Folgenden ein Kurzüberblick zu den Bildungsbereichen der Bundesländer sowie Hinweise auf die angesprochene Altersgruppe sowie den Umfang des jeweiligen Bildungsplans (vgl. https://www.bildungsserver.de/bildungsplaene-fuer-kitas-2027-de.html).
Tab. 2:Bildungsbereiche pro Bundesland
Bundesland
Letzte Veröffentlichung
Umfang Seiten
Lebensalter
Bereiche
Baden-Württemberg
2011
47
0 – 6 (–10)
Körper
Sinne
Sprache
Denken
Gefühl und Mitgefühl
Sinn, Werte und Religion
Bayern
2019
505
0 – 6 (–18)
Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder
-
Wertorientierung und Religiosität
-
Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
Sprach- und medienkompetente Kinder
-
Sprache und Literacy
-
Informations- und Kommunikationstechnik, Medien
Fragende und forschende Kinder
-
Mathematik
-
Naturwissenschaften und Technik
-
Umwelt
Künstlerisch aktive Kinder
-
Ästhetik, Kunst und Kultur
-
Musik
Starke Kinder
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
Gesundheit
Berlin
2014
181
0 – 6
Gesundheit
Soziales und kulturelles Leben
Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur, Medien
Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel
Mathematik
Natur-Umwelt-Technik
Brandenburg
2004
33
0 – 6
Körper, Bewegung und Gesundheit
Sprache, Kommunikation und Schriftkultur
Musik
Darstellen und Gestalten
Mathematik und Naturwissenschaft
Soziales Leben
Bremen
2021
10
0 – 10
Sprache
Mathematik
Ästhetische Bildung
Naturwissenschaftliches Lernen (Natur, Umwelt und Technik)
Gesellschaftswiss. Lernen (Gesellschaft, Geschichte, Kultur)
Körper, Gesundheit, Ernährung
Bewegung, Sport
Hamburg
2012
116
0 – 6
Körper, Bewegung und Gesundheit
Soziale und kulturelle Umwelt
Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien
Bildnerisches Gestalten
Musik
Mathematik
Natur – Umwelt – Technik
Hessen
2019
151
0 – 10
Starke Kinder
-
Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
-
Gesundheit
-
Bewegung und Sport
-
Lebenspraxis
Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder
-
Sprache und Literacy
-
Medien
Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder
-
Bildnerische und darstellende Kunst
-
Musik und Tanz
Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder
-
Mathematik
-
Naturwissenschaften
-
Technik
Verantwortungsvoll und werteorientiert handelnde Kinder
-
Religiosität und Werteorientierung
-
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur
-
Demokratie und Politik
-
Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern
2020
384
0 – 10
Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation
Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität, kultursensitive Kompetenzen
Elementares mathematisches Denken, Welterkundung sowie technische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen
Medien und digitale Bildung
Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten
Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
Niedersachsen
2021
135
0 – 6
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Körper – Bewegung – Gesundheit
Sprache und Sprechen
Lebenspraktische Kompetenzen
Mathematisches Grundverständnis
Ästhetische Bildung
Natur und Lebenswelt
Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Nordrhein-Westfalen
2018
145
0 – 10
Bewegung
Körper, Gesundheit und Ernährung
Sprache und Kommunikation
Soziale und (inter-)kulturelle Bildung
Musisch-ästhetische Bildung
Religion und Ethik
Mathematische Bildung
Naturwissenschaftlich-technische Bildung
Ökologische Bildung
Medien
Rheinland-Pfalz
2020
242
0 – 18
Wahrnehmung
Sprache
Bewegung
Künstlerische Ausdrucksformen
Gestalterisch-kreativer Bereich
Musikalischer Bereich
Theater, Mimik, Tanz
Religiöse Bildung
Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen
Interkulturelles und interreligiöses Lernen
Mathematik – Naturwissenschaft – Technik
Naturerfahrung – Ökologie
Körper – Gesundheit – Sexualität
Medien
Saarland
2018
200
0 – 6
Körper, Bewegung, Gesundheit
Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung
Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien
Bildnerisches Gestalten
Musik
Mathematische Grunderfahrungen
Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
Sachsen
2011
212
0 – 10
Somatische Bildung
Soziale Bildung
Kommunikative Bildung
Ästhetische Bildung
Naturwissenschaftliche Bildung
Mathematische Bildung
Sachsen-Anhalt
2013
153
0–Schulalter
Körper
Grundthemen des Lebens
Sprache
Bildende Kunst
Darstellende Kunst
Musik
Mathematik
Natur
Technik
Schleswig-Holstein
2020
66
0 – 14
Musisch-ästhetische Bildung und Medien – oder: sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen
Körper, Gesundheit und Bewegung – oder: mit sich und der Welt in Kontakt treten
Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation – oder: mit Anderen sprechen und denken
Mathematik, Naturwissenschaft und Technik – oder: die Welt und ihre Regeln erforschen
Kultur, Gesellschaft und Politik – oder: die Gemeinschaft mitgestalten
Ethik, Religion und Philosophie – oder: Fragen nach dem Sinn stellen
Thüringen
2019
288
0 – 18
Sprachliche und schriftsprachliche Bildung
Physische und psychische Gesundheitsbildung
Naturwissenschaftliche Bildung
Mathematische Bildung
Musikalische Bildung
Künstlerisch-ästhetische Bildung
Philosophisch-weltanschauliche Bildung
Religiöse Bildung
Medienbildung
Zivilgesellschaftliche Bildung
Für Deutschland sieht es so aus, dass in allen Bildungsbereichen das Ziel besteht, die Kompetenzen eines Kindes im Schuleingangsbereich zu unterstützen und/oder herauszubilden. Stehen ursprünglich oben genannte Bildungsziele (z. B. Entwicklung der Persönlichkeit und Vorbereitung auf das Leben), so wird in der Praxis oftmals weiterhin die Überprüfung einzelner Funktionsbereiche bzw. Fertigkeiten im Schuleingangsbereich in den Vordergrund gerückt. Diese werden z. B. durch ärztliche Schuluntersuchungen und Schuleingangsuntersuchungen vor Ort überprüft. Zur Überprüfung dienen durch Schulen und Ämter individuell zusammengestellte oder ausgewählte Schuleingangsscreenings.
2.1.2 Bildungsbereiche in Österreich
Im Unterschied zu Deutschland, wo die Bildungsbereiche durch die Bundesländer bestimmt sind, stellt in Österreich ein Bildungsrahmenplan für das ganze Land die Basis im Elementarbereich dar. Hier gilt ein bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan. Dieser umfasst folgende Bildungsbereiche (vgl. Ämter der Landesregierungen der österreichischen Bundesländer, 2009):
Emotionen und soziale Beziehungen
Ethik und Gesellschaft
Sprache und Kommunikation
Bewegung und Gesundheit
Ästhetik und Gestaltung
Natur und Technik
2.1.3 Bildungsbereiche in der Schweiz
In der Schweiz gibt es einen »Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung« für Kinder im Alter von 0 – 4 Jahren (vgl. Wustmann Seiler/Simoni, 2016) mit dem Ziel, dass dieser landesweit getragen wird. Dieser Orientierungsrahmen umfasst sechs Leitprinzipien:
Physisches und psychisches Wohlbefinden
Kommunikation
Zugehörigkeit und Partizipation
Stärkung und Ermächtigung
Inklusion und Akzeptanz von Verschiedenheit
Ganzheitlichkeit und Angemessenheit
Die Kantone mit ihren Gemeinden sind zuständig für die Regelung und den Vollzug des obligatorischen Bildungsbereichs (Primar- und Sekundarstufe I) (vgl. https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/bildungsgesetze).
2.2 Schulfähigkeitsprofil als Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule
Durch das Schaffen von angemessenen individuellen Lernsituationen und -angeboten soll ein fließender Übergang zum Schuleintritt und zum Anfangsunterricht für das Kind ermöglicht werden.
Schulfähigkeit ist somit »keine einseitige Vorleistung des Kindes, sondern gemeinsame Aufgabe aller an der Erziehung und Bildung des Kindes Beteiligten. Das sind Familie, Kindergarten, Schule, das Kind selbst und weitere Bildungsumwelten, die das Kind umgeben« (Speck-Hamdan, 2005, 248).
Somit ist es erforderlich, dass eine Kooperation bzw. Erfahrungs- und Kompetenzaustausch zwischen den Bildungseinrichtungen und weiteren sozial bedeutenden Bezugspersonen und dem Kind selbst stattfinden. Schulfähigkeit ist demnach als Brückenkonzept zu verstehen, in dem institutsübergreifendes Arbeiten stattfindet, in der die Individualität eines Kindes anerkannt wird.
2.3 Umsetzung der Bildungsvereinbarungen in der Praxis
Das vorliegende Verständnis von Schulfähigkeit schlägt sich ebenso in der Art der Diagnostik bzw. des diagnostischen Vorgehens nieder. Sowohl für Erzieherinnen, Heilpädagoginnen als auch für Grundschullehrerinnen sind (förder-)diagnostische Prozesse unverzichtbarer Bestandteil der eigenen Arbeit im Hinblick auf die das Kind erwartenden schulischen Anforderungen. Diagnostik muss demnach in der Praxis folgenden Anforderungen gerecht werden:
Erfassung der Lernausgangslage
Prozesshaftigkeit
Variable Aufgabenstellungen mit verschiedenen Komplexitäten
Anknüpfung an bereits bestehende individuelle Kompetenzen
Hinweise für Fördermaßnahmen in alltäglichen Situationen
Beobachtung in alltäglichen Situationen
Möglichkeit der Selbsttätigkeit des Kindes
Berücksichtigung von Heterogenität
Berücksichtigung der Umfeldbedingungen des Kindes
Das vorliegende Verfahren »Diagnostisches Inventar zur Einschätzung schulischer Basiskompetenzen« (DIsB) stellt eine Möglichkeit dar, institutionsübergreifend förderdiagnostisch zu arbeiten. Das heißt, dass die Materialien primär für pädagogische Fachkräfte in Kindergärten/Kindertagesstätten und Grundschulen entwickelt wurden.
Die Erfassung der Lernausgangslage ist einerseits dadurch gegeben, dass spezielle Aufgaben und Situationen einbezogen sind, die im Rahmen unserer Untersuchung von pädagogischen Fachkräften als geeignet angesehen wurden. Weiterhin haben wir diese um Aufgaben aus ausgewählten bestehenden Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik ergänzt. Das heißt, dass in den vorliegenden Materialien solche Aufgaben und Situationen wiederzufinden sind, die eine Erfassung der individuellen Lernausgangslage ermöglichen.
Wie in Kapitel 4 näher beschrieben wird, gehen wir von einer Diagnostik aus, die prozessorientiert ist, d. h., dass es nicht um eine einmalige Erfassung von Fertigkeiten geht, sondern um eine fortlaufende Einschätzung kindlicher individueller Kompetenzen (▸ Kap. 4). Aus diesem Grund können und sollten die im DIsB vorliegenden Aufgaben gezielt mehrfach prozessbegleitet genutzt werden.
Die Grund-Aufgabenstellungen haben wir jeweils dahingehend differenziert, dass die Anwenderin unterschiedliche Schwierigkeitsgrade mit einer Aufgabe erfassen kann. Da die »Grund-Aufgaben« aus anderen Verfahren übernommen wurden, wird die Originalaufgabe und somit Anforderung »fett« markiert.
Da wir davon ausgehen, dass ein Kind durch verschiedene Anregungen und selbsttätiges Handeln in seiner Entwicklung voranschreitet, haben wir eine Vielzahl von Differenzierungen für jede Aufgabe entwickelt. Der Einsatz der Aufgaben kann insofern variabel erfolgen, dass der Komplexitätsgrad gefunden wird, in dem das Kind die Aufgabe bewältigen kann. Diese Differenzierungen sind als Möglichkeit zu verstehen, um verschiedene Komplexitätsgrade zu erfassen. Sie sind jedoch individuell jederzeit durch das Kind und/oder die pädagogische Fachkraft erweiterbar.
Somit besteht die Möglichkeit, dass die individuellen Kompetenzen des Kindes jeweils erfasst und im Förderprozess genutzt bzw. an diesen angeknüpft werden können.
Da wir von einer förderungsorientierten Diagnostik ausgehen, ist es selbstverständlich, dass die vorliegenden Aufgaben sowohl zur Diagnostik als auch zur Förderung eines Kindes genutzt werden können. Wir sehen jede diagnostische Situation auch als Fördersituation an und jede Fördersituation dient einer Diagnostik. In unserem Sinne kann jede diagnostische Situation in den Alltag eingebunden werden und sollte individuell und variabel auf das Kind abgestimmt sein.
Wie bereits angedeutet, sind die förderdiagnostischen Situationen des vorliegenden Verfahrens DIsB darauf ausgerichtet, dass das Kind eigenaktiv handeln und selbständig Ideen entwickeln kann (vgl. SGB VIII, §1, Abs. 1). Es ist wünschenswert, dass die pädagogische Fachkraft dem Kind Raum und Möglichkeiten bietet, sich selbst kreativ einzubringen. Nur so kann ein erfolgreicher Wechsel zwischen Eigenaktivität und Umweltanregungen gelingen, die es ermöglicht, die Potenziale des Kindes auszuschöpfen und dessen Selbständigkeit zu fördern.
Aus unserem Verständnis von Entwicklung, welches näher in Kapitel 3 beschrieben wird, geht hervor, dass der Einbezug der Lebensumwelt(en) eine wesentliche Rolle im Rahmen förderdiagnostischer Prozesse einnimmt. Die Familie als einer der wichtigsten Bezugspunkte des Kindes trägt wesentlich zur Entwicklung des Kindes bei. Die Eltern bzw. die Familie als die engsten Bezugspersonen sind in der Regel als »Expertinnen und Experten« ihres Kindes anzusehen. Abhängig von den Eltern sammelt das Kind tagtäglich Erfahrungen über sich, über die Familie, über räumliche und zeitliche Strukturen sowie mit der materiellen Umwelt. Demzufolge ist es, auch im Sinne der Bildungsvereinbarungen, für ein förderungsorientiertes Lernen wichtig, die Eltern, bedeutende Bezugspersonen und Peers mit einzubeziehen und den Austausch mit ihnen zu suchen.
3 Verständnis von Entwicklung und Entwicklungsbereichen
Im folgenden Kapitel wird zunächst ein allgemeines Verständnis von Entwicklung und Entwicklungsbedingungen dargelegt. Weiterhin werden die Entwicklungsbereiche (Bewegung, Kognition, sozial-emotionales Verhalten, Sprache und Wahrnehmung) definiert. Dabei beziehen wir uns nicht allein auf unsere eigenen Erfahrungen und unser eigenes Verständnis, sondern haben pädagogische Fachkräfte (Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Lehrerinnen) und Literatur einbezogen.
In unserer bereits beschriebenen Bedarfsanalyse haben wir pädagogische Fachkräfte gefragt, welche Entwicklungsbereiche für sie einen hohen Stellenwert in ihrer praktischen Arbeit in Bezug auf Schuleingangsdiagnostik haben (▸ Kap. 1.2). Dabei stand v. a. die Frage im Vordergrund: »Welche Entwicklungsbereiche sind entscheidend für den Eintritt in die Schule?«.
Die Auswertung der 105 Fragebogen ergab die Nennung verschiedener Entwicklungsdimensionen, die den oben genannten Entwicklungsbereichen zugeordnet wurden.
Zudem passen die genannten Entwicklungsbereiche mit den empfohlenen, überwiegend übereinstimmenden Bildungsbereichen der Länder überein (▸ Kap. 2).
3.1 Entwicklung
Es gibt verschiedene Definitionen, wie Entwicklung verstanden werden kann. Diese Definitionen können grob in vier Richtungen unterschieden werden:
Abb. 1:Entwicklungsrichtungen, eigene Darstellung
a)
Subjekt/Person passiv – Umwelt passiv (Biogenetische (organismische) Organisation)
b)
Subjekt/Person aktiv – Umwelt passiv (Strukturgenetische (konstruktivistische und systemische) Konstruktionen)
c)
Subjekt/Person passiv – Umwelt aktiv (Umweltdeterministische (exogenistische bzw. mechanistische) Konzeptionen)
d)
Subjekt/Person aktiv – Umwelt aktiv (interaktionistische (handlungstheoretische bzw. ökologische) Konzeptionen) (vgl. Montada u. a., 2018; Reichenbach, 2016).
Unser Verständnis von Entwicklung entspricht der interaktionistischen (handlungstheoretischen bzw. ökologischen) Konzeption. Dementsprechend werden wir im Folgenden ausschließlich auf diese Konzeption eingehen und diese näher beschreiben.
Gemeinsame Kernannahme interaktionistischer Modelle ist, dass der Mensch und seine Umwelt ein Gesamtsystem bilden und, dass Mensch und Umwelt aktiv und in Veränderung begriffen sind (vgl. Schneider/Lindenberger, 2018). Entwicklung wird dabei als eine über das Handeln der Person selbst konstituierte Lebensgeschichte verstanden. Das Individuum produziert seine eigene Entwicklung, es wird am Handeln angesetzt und die Umweltkontexte werden eingebunden. Somit finden eine Subjekt-Umwelt-Interaktion und damit eine gegenseitige Beeinflussung statt. Auf der Grundlage dieser Annahme gehen wir auch von einem lebenslangen Lernen aus, da jede Person lebenslang handelt und lebenslang in Interaktion mit der Umwelt steht. Alle Personen sind in ständiger Entwicklung (vgl. Montada u. a., 2018).Im Speziellen lehnen wir uns an die Definition von Bronfenbrenner an, der Entwicklung wie folgt definiert:
»Entwicklung [ist] als dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt [zu verstehen]« (Bronfenbrenner, 1989, 19).
In dem Entwicklungstheoretischen Modell von Bronfenbrenner werden Umweltkontexte unterschieden, näher erläutert und deren Interaktionen beschrieben.Person-Umwelt-Interaktionen findet in unterschiedlichen Systemen statt:
Mikrosystem
Mesosystem
Exosystem
Makrosystem
Chronosystem
Abb. 2:Systeme der Person-Umwelt-Interaktion nach Bronfenbrenner (eigene Darstellung nach http://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner)
Das Mikrosystem »ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich in dem ihr eigentümlichen, physischen und materiellen Merkmalen erlebt« (1989, 38). Das heißt, bei dieser ersten Ebene handelt es sich um den unmittelbaren Lebensbereich, der die sich entwickelnde Person umgibt (z. B. Familie). In diesem Lebensbereich kann der Mensch leicht in Interaktionen mit anderen Menschen treten. Hierbei geht es vorwiegend darum, wie ein Mensch sich in seinem direkten, unmittelbaren Lebensbereich wahrnimmt.
Das Mesosystem »umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist (für ein Kind etwa die Beziehung zwischen Elternhaus, Schule und Kameradengruppe in der Nachbarschaft; für einen Erwachsenen, die zwischen Familie, Arbeit und Bekanntenkreis)« (1989, 41). Ein Mesosystem umfasst demnach eine Vielzahl von Mikrosystemen, welche miteinander verbunden sind, d. h. in einem Austausch stehen. Eine Erweiterung vom Mikrosystem zum Mesosystem findet statt, wenn die sich entwickelnde Person in einen neuen Lebensbereich eintritt und/oder mit Anderen in Beziehung tritt.
Unter dem Exosystem versteht Bronfenbrenner »einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht oder die davon beeinflußt werden« (1989, 42). Das Exosystem umfasst demnach einen Bereich, der außerhalb der Reichweite der Person liegt, von dem sie aber trotzdem beeinflusst wird (z. B. die Arbeitsbedingungen der Eltern, sie nehmen Einfluss auf den sozialen Status des Kindes, schulische Bedingungen, gesetzliche Regelungen für diesen Bereich usw.) (vgl. Eggert/Reichenbach/Lücking, 2007).
Das Makrosystem »bezieht sich auf die grundsätzliche, formale und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niederer Ordnung (Mikro-, Meso- und Exo-), die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen, oder bestehen könnten, einschließlich der ihnen zugrunde liegende Weltanschauungen und Ideologien« (Bronfenbrenner 1989, 42). Es ist demnach ein umfassender Lebensbereich, der allen drei Ebenen gemeinsam ist und auf allen drei Ebenen Einfluss auf den Menschen nehmen kann (z. B. gesellschaftliche und kulturelle Normen, politische Ausrichtungen, ethnischer Hintergrund u. a.).
Das Chronosystem meint markante biographische Übergänge, z. B. Schuleintritt. Ökologische Übergänge kommen lebenslang vor und finden z. B. statt, »wenn eine Person ihre Position in der ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereichs oder beider verändert« (1989, 43). Solche Übergänge stellen Entwicklung dar und haben Einfluss auf die weiteren Entwicklungsschritte. Sie können normativ oder nicht-normativ erfolgen, wobei mit nicht-normativen Übergängen solche gemeint sind, die zu früh oder zu spät eintreten (z. B. verfrühte Einschulung mit fünf Jahren).
Von allen fünf Ebenen können sowohl entwicklungsfördernde als auch entwicklungshemmende Einflüsse ausgehen. Der Mensch selbst kann versuchen, innerhalb dieser Ebenen einzuwirken, was jedoch immer abhängig ist von der Mitarbeit anderer.
Da sich ein Kind in Interaktion mit seiner Umwelt individuell entwickelt, ist dieses Konzept für eine Beschreibung der individuellen Ziele und des pädagogischen Handelns sehr nützlich. Hierbei wäre es wichtig, dass Eltern, Schule, Lehrkräfte und andere bedeutende Bezugspersonen gemeinsam für die Entwicklung des Kindes arbeiten.
Insgesamt kann gesagt werden, dass Entwicklung unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Diese Einflüsse betreffen sowohl Reifungsprozesse, Entwicklungsaufgaben (Rollen, Identität, Lebensziele), kritische Lebensereignisse bzw. ökologische Übergänge (z. B. Übergang von Kindergarten zur Schule), epochal bedingte Einflüsse (z. B. Arbeitslosigkeit, Normen) sowie unkalkulierbare Einflüsse (z. B. Zufallsbegegnungen mit biographischer Tragweite, Unfälle, Erkrankungen) (vgl. Montada u. a., 2018).
Diese Ausführungen verdeutlichen die hohe Relevanz von Interaktionsprozessen zwischen Kind und seinen Bezugssystemen (insbesondere zwischen Familie, Kindergarten, Schule).
In dem vorliegenden Buch haben wir versucht, Anregungen für Diagnostik und Förderung zusammenzustellen, die sowohl von Erzieherinnen als auch von Lehrerinnen angewandt werden können. Der Entwicklung und den Entwicklungsbedingungen eines Kindes kann nähergekommen bzw. sie können differenzierter betrachtet werden, je intensiver der Austausch der Bezugssysteme (Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Lehrerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte) des Kindes untereinander ist.
Weiterhin bietet die Arbeit mit diesem Buch, mit dem Verfahren DIsB, eine gemeinsame Grundlage für die Erfassung, Beschreibung und Einschätzung von Entwicklungsdimensionen. Auch wenn nicht die Möglichkeit zu einem direkten Austausch von Informationen zu einem Kind zwischen Erzieherinnen, Heilpädagoginnen und Lehrerinnen gegeben ist, so kann, wenn gemeinsam mit diesem Buch und Verfahren gearbeitet wird, ein gemeinsames Verständnis von Entwicklung und deren Entwicklungsbereichen geschaffen werden. Dies ermöglicht Transparenz hinsichtlich Beobachtungen, Beschreibungen und Fördervorschlägen.
Sicherlich ist die eine oder andere Aufgabe auch dazu geeignet, durch die pädagogischen Fachkräfte an die Eltern weiter vermittelt zu werden, um die Entwicklung des Kindes in seinem nahen Umfeld gezielt anzuregen.
Nachdem unser allgemeines Verständnis von Entwicklung dargelegt wurde, werden wir im Folgenden auf einzelne Entwicklungsbereiche eingehen. Das vorliegende Buch befasst sich mit diagnostischen und förderungsorientierten Situationen zu den Entwicklungsbereichen:
Bewegung (▸ Kap. 3.2),
Intelligenz und Kognition (▸ Kap. 3.3),
Sozial-emotionale Entwicklung (▸ Kap. 3.4),
Sprache und Kommunikation (▸ Kap. 3.5) sowie
Wahrnehmung (▸ Kap. 3.6).
Da es auch hier keine einheitlichen Vorstellungen hinsichtlich des Verständnisses und der Definitionen einzelner Entwicklungsdimensionen dieser Entwicklungsbereiche gibt, möchten wir nachfolgend unser Verständnis diesbezüglich darlegen. Somit wird der oben genannte Anspruch auf Transparenz im Hinblick auf das zugrundeliegende Modell sowie die Bezugspunkte ermöglicht.
Sollte die Anwenderin ein anderes Verständnis von Entwicklung sowie einzelner Entwicklungsbereiche haben, was aufgrund einer anderen theoretischen Fundierung durchaus vorkommen kann, so sind die Aufgaben in diesem Buch sicherlich auch anwendbar. Die Interpretation der Beobachtung obliegt dann jedoch ausschließlich der Anwenderin. In jedem Fall sollte sie dann ihr vorhandenes theoretisches Verständnis und ihre Bezugsquellen begründen und deutlich herausstellen, sodass auch in diesem Fall die erforderliche Transparenz gegeben ist.
3.2 Bewegung
Häufig werden die Begriffe »Motorik« und »Bewegung« in der Literatur und auch im Praxisalltag synonym verwendet. Es gibt vielfältige Begriffsdefinitionen, wobei die einzelnen Begriffe nicht einheitlich genutzt werden (vgl. Willimczik/Singer, 2009).
Den Begriff Motorik haben wir in diesem Zusammenhang nicht gewählt, da er »alle an der Steuerung und Kontrolle von Haltung und Bewegung beteiligten Prozesse und damit auch sensorische, perzeptive, kognitive und motivationale Vorgänge« (Singer/Bös 1994, 17) umfasst.
Wir möchten hier zunächst allein auf die zu sehende Bewegung eingehen. Die an der Motorik beteiligten Bereiche, z. B. Wahrnehmung und Kognition, werden hier aus pragmatischen Gründen speziell betrachtet. Natürlich sind die Entwicklungsbereiche miteinander verknüpft. Das wird anhand unserer beispielhaft aufgeführten Hypothesen und Interpretationsvorschläge deutlich.
Wir bevorzugen in unserem Buch den Begriff »Bewegung« und lehnen uns dabei an Schnabel/Thieß (1993, 149) an: Bewegung wird als eine zeitliche und räumliche sowie zielgerichtete »Ortsveränderung des Körpers als Folge regulierter Muskeltätigkeit« verstanden.
Vereinfacht ist (menschliche) Bewegung sichtbar und beschreibbar, während die Motorik die nicht beobachtbare (latente) Innenseite der Bewegung ist
Dabei können einer Bewegung als äußere Kennzeichen bestimmte
Bewegungsmerkmale (z. B. Rhythmus, Fluss, Präzision, Tempo),
Bewegungsparameter (z. B. Schnelligkeit) oder
Bewegungsfähigkeiten (z. B. Gleichgewicht, Kraft) zugeordnet werden.
Wir werden in unseren Ausführungen die genannten Bewegungsmerkmale, Bewegungsparameter und Bewegungsfähigkeiten unter Bewegungsdimensionen zusammenfassen.
Genannte Bewegungsdimensionen der pädagogischen Fachkräfte werden im Folgenden mit der Anzahl der Nennungen aufgezeigt, wobei Mehrfachnennungen als auch keine Nennungen vorgekommen sind:Dimensionen von Bewegung (72x)
Feinmotorik (38x)
Grobmotorik (29x)
Augen-Hand-Koordination (5x)
Gesamtkörperkoordination (5x)
Gleichgewicht (4x)
Handmotorik (3x)
Graphomotorik (2x)
Rhythmus (1x)
Wie aus der Nennung deutlich wird, umfassen die genannten Bewegungsdimensionen v. a. Kompetenzen hinsichtlich schulischer Erfordernisse. So sind die genannten Bewegungsdimensionen beispielhaft für folgende Anforderungen in der Schule erforderlich: Umgang mit Arbeitsmaterialien, Sitzhaltung, Schreiben, Lesen.
Aus unserer Sicht sind die genannten Bewegungsdimensionen ebenso bedeutend, jedoch möchten wir diese um weitere ergänzen. Dabei beziehen wir uns grundlegend auf das Modell von Eggert und Ratschinski (1993), welches folgende Bewegungsdimensionen enthält:
Abb. 3:Bewegungsmodell, eigene Darstellung nach Eggert/Ratschinski (1993)
Die von Eggert und Ratschinski herausgestellten Bewegungsdimensionen können als die wesentlichen Dimensionen von Bewegung bezeichnet werden, da sie am häufigsten in der Literatur, aber auch insgesamt von Expertinnen genannt werden (vgl. Reichenbach, 2016).
3.2.1 Modell von Bewegung
Abb. 4:Modell von Bewegung, eigene Darstellung
Wie aus dem Modell zu erkennen ist, wurde das von Eggert und Ratschinski (1993) entwickelte Modell zugrunde gelegt (hier fett markiert) und durch die in unserer Untersuchung von den pädagogischen Fachkräften und uns genannten Bewegungsdimensionen ergänzt. Somit beinhaltet das Modell theorie- und praxisgeleitete Vorstellungen von bedeutenden Entwicklungsfaktoren für den Entwicklungsbereich Bewegung.
3.2.2 Definitionen von Bewegungsdimensionen
Das Grundprinzip des Modells besteht darin, dass die einzelnen Bewegungsdimensionen miteinander verknüpft sind, wobei es keine hierarchische Ordnung gibt (▸ Kap. 1).
Um mit dem Modell besser umgehen zu können, definieren wir nachfolgend die einzeln genannten Bewegungsdimensionen (vgl. Schnabel/Thieß, 1993; Ratschinski, 1987; Röthig/Prohl u. a. (Hrsg.), 2007; Wydra, 2009; Baur u. a., 2009; Meinel/Schnabel, 2015; Geraedts, 2020).
Tab. 3:Bewegungsdimensionen und Definitionen
Bewegungsdimension
Definition
Augen-Fuß-Koordination (AFK)
Situationen, die ein Zusammenspiel von Augen und Fuß/Füßen erfordern, z. B. gegen einen Ball treten.
Augen-Hand-Koordination (AHK)
Situationen, die ein Zusammenspiel von Augen und Hand/Händen erfordern, z. B. klatschen, greifen.
Feinmotorik
Feinkoordinative Bewegungen sind v. a. Bewegungen der Hände, Füße und des Kopfes. Es handelt sich um kleinräumige Bewegungen, z. B. Mimik, Umgang mit Stift und Schere, Schulterbewegungen. Sie erfordern eine hohe Bewegungspräzision, Bewegungsgeschicklichkeit sowie Bewegungskombination (vgl. Schnabel/Thieß, 1993).
Fluss
Bewegungsmerkmal, das den Grad der Kontinuität in einem großräumigen und kleinräumigen Bewegungsablauf kennzeichnet (vgl. Schnabel/Thieß, 1993).
Gelenkigkeit/
Beweglichkeit
Beweglichkeit beinhaltet die beiden Komponenten Gelenkigkeit (Bezug zu Gelenken) und Dehnfähigkeit (Bezug zu Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln). Demnach sind Gelenkigkeit und Dehnfähigkeit als körperregionsspezifisch anzusehen (z. B. Kopf, Schulter, Ellenbogen, Hand, Finger, Rumpf, Hüfte, Knie, Fuß, Zehen). Beide Kompetenzen können sowohl isoliert als auch aufgabenspezifisch betrachtet werden (vgl. Ratschinski, 1987; Wydra, 2009).
Gesamtkörperkoordination
Koordination, d. h. das Zusammenspiel einzelner Bewegungsdimensionen in Einzel- und Teilbewegungen des Körpers, z. B. an der Tafel schreiben. Gesamtkörperkoordination umfasst das Zusammenspiel einzelner Bewegungsdimensionen des gesamten Körpers in komplexeren Handlungssituationen, z. B. Handball oder Fußball spielen.
Gleichgewicht
Das Gleichgewicht ist eine koordinative Fähigkeit, welche bei allen Bewegungshandlungen von Bedeutung ist (z. B. sitzen, gehen, laufen, ...).
Das Gleichgewicht ermöglicht es, Lageveränderungen des Körperschwerpunktes im Verhältnis zur Stützfläche zu regulieren.
Es können statisches und dynamisches Gleichgewicht unterschieden werden.
Das statische Gleichgewicht ist für die Beibehaltung der Körperhaltung/Körperposition erforderlich (z. B. sitzen, stehen)
Das dynamische Gleichgewicht ist für die Aufrechterhaltung der Körperhaltung/Körperposition in Bewegung zuständig (z. B. balancieren, drehen, springen) (vgl. Schnabel/Thieß, 1993).
Graphomotorik
Bewegungsanforderungen, die für das Zeichnen und Schreiben erforderlich sind. Wird Graphomotorik allein unter dem Bewegungsaspekt betrachtet, beinhaltet es ein Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen wie z. B. Hand- und Fingerbeweglichkeit, Bewegungssteuerung, Koordination der Sitzhaltung.
Grobmotorik
Bewegungen, bei denen mehrere Körperteile gleichzeitig beansprucht werden. Grobmotorik betrifft das Gesamte (Körpermotorik), z. B. laufen, fangen, hüpfen, klettern.
Kraft/Ausdauer
Fähigkeit der Muskulatur, einen Widerstand zu überwinden. Dabei kann Kraft körperregionsspezifisch und situationsspezifisch betrachtet werden. Situationsspezifisch können Sprung-, Stoß-, Wurf-, Zug- oder Stemmkraft unterschieden werden. Körperregionsspezifisch können z. B. Arm-, Bein- und Fingerkraft unterschieden werden.
Weiterhin kann Kraft und die damit verbundene Anforderung als dynamisch oder statisch charakterisiert werden: dynamisch, z. B. hüpfen, werfen, schießen; statisch, z. B. stehen, sitzen (vgl. Ratschinski, 1987; Fetz, 1969).
Rhythmus
Verknüpfung von Ordnung und Dauer einer Bewegung. Ordnung bezieht sich auf die Wiederholung spezieller nacheinander ablaufender Bewegungen. Dauer meint eine zeitliche Aufeinanderfolge und ist immer mit dem Einbezug der Anfangs- und Endpunkte eines Zeitintervalls verbunden (vgl. Eggert/Bertrand, 2002).
Schnelligkeit/Tempo
Tempo meint die zeitliche und räumlich-zeitliche Dimension von Bewegungen. Die Veränderung des Tempos wird in Form von positiver Beschleunigung (Steigerung) oder negativer Beschleunigung (Verzögerung) beschrieben. Tempo beinhaltet somit sowohl Schnelligkeit als auch Langsamkeit. Um einen Bewegungsablauf sowohl schnell als auch langsam durchführen zu können, muss dieser sicher beherrscht werden.
Als Bezugssystem zur Beschreibung von Tempo gilt ein Vergleich, entweder individuell mit einem zeitlichen Abstand oder von mindestens zwei Personen (vgl. Ratschinski, 1987; Schnabel/Thieß, 1993).
3.3 Intelligenz und Kognition
(Tanja Jungmann & Christina Siewert & Christina Reichenbach)
Viele Theorien gehen von verschiedenen Intelligenzen oder Fähigkeitssystemen aus, von denen nur wenige durch psychometrische Tests erfassbar sind, während die Mehrzahl aus dem beobachtbaren Verhalten erschlossen werden müssen, z. B. beim Lösen von Problemen, bei der Bewältigung von neuen Aufgaben.
Intelligenz und kognitive Fähigkeiten sind dabei Begriffe, die häufig synonym verwendet werden. Dies ergibt unserer Ansicht nach keinen Sinn, da die allgemeine Intelligenz über die Lebensspanne hinweg stabil bleibt. Sie umfasst Faktoren, die weitestgehend umweltunabhängig sind, wie Abstraktionsfähigkeit, schlussfolgerndes Denken und Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Was sich dagegen in Abhängigkeit von der Umwelt verändert und damit im pädagogischen Sinne veränderbar ist, sind die kognitiven Fähigkeiten.
Diese sind z. B. sprachliche Fähigkeiten, motorische Fähigkeiten und musikalische Fähigkeiten, die sich wiederum in spezifischen, kulturabhängigen Fertigkeiten niederschlagen. In unserer Kultur sind dies z. B. Lesen, Schreiben und Rechnen oder auch Fußballspielen und Klavierspielen.Dementsprechend kann zwischen fluider und kristalliner Intelligenz unterschieden werden:
»Fluide Intelligenz umfasst grundlegende Prozesse des Denkens und ist weitgehend unabhängig von Erfahrung, d. h., wird als genetisch determiniert angenommen. Kristalline Intelligenz umfasst die Fähigkeit, erworbenes Wissen anzuwenden; sie gilt als überwiegend kulturabhängig« (https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/intelligenz-kristalline-und-fluide).
Vor diesem Hintergrund ist es unseres Erachtens unumgänglich, die allgemeine Intelligenz und kognitive Fähigkeiten differenziert zu betrachten und uns insbesondere für den Schuleingangsbereich auf die kognitiven Fähigkeiten zu konzentrieren.
Die allgemeine Intelligenz (z. B. Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Reaktionszeit) ist über die Lebensspanne relativ stabil.
Kognitive Fähigkeiten entwickeln sich über die Lebensspanne und variieren damit in Abhängigkeit vom Alter und individuellen Umweltbedingungen.
Unter Kognition verstehen wir Informationsverarbeitungsprozesse (mit anderen Worten die allgemeine Intelligenz), in denen Neues gelernt und Wissen verarbeitet und miteinander vernetzt wird (mit anderen Worten die Fähigkeiten und die Fertigkeiten).
Menschen unterscheiden sich in ihren globalen Fähigkeiten, komplexe Zusammenhänge zu begreifen, sich effizient und effektiv an eine neue Umgebung anzupassen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Herausforderungen und Hindernisse durch Nachdenken zu bewältigen bzw. zu überwinden. Die kognitiven Fähigkeiten sind abhängig vom jeweils betrachteten Bereich, ihr Einsatz und damit die Fertigkeiten variieren situationsabhängig. Jeder Mensch hat ein individuelles Leistungsprofil, das durch relative Stärken, aber auch Schwächen charakterisierbar ist.
Kognitive Fähigkeiten können sich auf eher globaler und in weiterer Form auf spezifischer Ebene in Fertigkeiten unterscheiden.Auf der globalen Ebene können folgende Fähigkeiten benannt werden:
Abstraktes Denken
Arbeitsverhalten
Aufmerksamkeit/Konzentration
Denkstrategien
Handlungsplanung
Kreativität
Logisches Schlussfolgern
Gedächtnis/Merkfähigkeit
Problemlöseverhalten
Reflexionsfähigkeit
Verständnis (z. B. Aufgabenverständnis)
Vorstellungsvermögen
Wissen
Diese globalen Fähigkeiten können bereichsspezifisch eingesetzt werden. Auf der spezifischen Ebene sind es dann Fertigkeiten; diese sind z. B. in Anlehnung an Gardner (2006, 2005)2:
sprachliche Fertigkeiten,
musische Fertigkeiten,
logisch-mathematische Fertigkeiten,
räumliche Fertigkeiten,
körperlich-motorische Fertigkeiten,
personale Fertigkeiten.
Die von den pädagogischen Fachkräften genannten Bereiche zu Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten spiegeln diese Vielfalt und Komplexität wider und werden im Folgenden mit der Anzahl der Nennungen aufgezeigt, wobei Mehrfachnennungen als auch keine Nennungen vorgekommen sind:Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (41x)
Ausdauer/Konzentration (28x)
Mathematische Kompetenz (10x)
Mengenverständnis (9x)
Arbeitsverhalten (8x)
Logisches Denken (6x)
Motivation (6x)
Handlungskompetenz (5x)
Zahlenbegriff (5x)
Merkfähigkeit (4x)
Kreativität (3x)
Aufgabenverständnis (3x)
Formenverständnis (3x)
Leistungsfähigkeit (2x)
Farben benennen (2x)
Textverständnis (1x)
Pränumerische Fähigkeiten (1x)