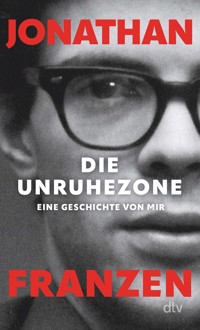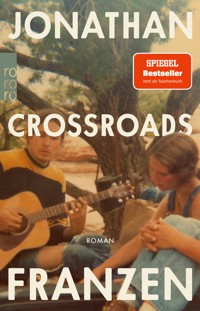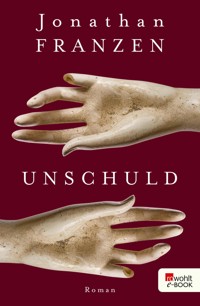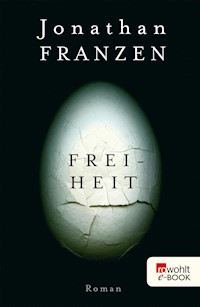9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Atemlos ist das zu lesen. Ein Roman von epischer Wucht.» (FAZ) St. Louis, die einst blühende Stadt im Mittelwesten Amerikas, bekommt einen neuen Polizeichef. Es ist S. Jammu, eine Frau aus Indien: zart, jung, sympathisch. Doch kaum hat sie ihr Amt angetreten, greift Gewalt um sich. Eine Bombe explodiert. Auch Martin Probst, Erbauer des städtischen Wahrzeichens «The Arch», und seine Frau Barbara – das Vorzeige-Ehepaar, von vielen um sein Glück beneidet – erleben Gefahr, süße Verlockungen und Angst. «Man tut sich schwer, den Roman überhaupt einmal aus der Hand zu legen.» (NZZ) «Hochspannung pur.» (Welt am Sonntag)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 916
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jonathan Franzen
Die 27ste Stadt
Deutsch von Heinz Müller
Der Autor dankt der Artist Foundation of Boston und dem Massachusetts Council for the Arts and Humanities für deren Unterstützung im Jahr 1986.
Hinweis des Übersetzers: Die für das Romangeschehen relevante Mehrdeutigkeit des englischen Wortes Indians (dt. Inder und/oder Indianer) lässt sich im Deutschen leider nicht wiedergeben.
Für meine Eltern
Diese Geschichte spielt in einem Jahr, das vage an 1984 erinnert, und in einer Stadt, die sehr an St.Louis erinnert. Viele öffentliche Errungenschaften, Ereignisse und Gegenstände, die es wirklich gegeben hat, wurden verschiedenen Figuren und Gruppierungen zugeschrieben; diese sollten mit realen Personen oder Körperschaften nicht verwechselt werden. Leben und Ansichten der Figuren sind frei erfunden.
1
In den ersten Tagen des Juni gab Polizeichef William O’Connell vom St.Louis Police Department bekannt, dass er in den Ruhestand gehen werde, und ohne die Kandidaten zu berücksichtigen, die von der städtischen Oberschicht, der schwarzen Bürgerschaft, der Presse, dem Polizeibeamtenverband und dem Gouverneur von Missouri favorisiert wurden, berief der Polizeiverwaltungsrat für die fünfjährige Amtszeit eine Frau, die vorher bei der Polizei von Bombay, Indien, tätig gewesen war. Die Stadt war entsetzt, aber die Frau – eine S.Jammu – trat ihren Posten an, ehe sie jemand daran hindern konnte.
Das geschah am 1.August. Am 4.August, als der begehrteste Junggeselle von St.Louis eine Prinzessin aus Bombay heiratete, beschäftigte der Subkontinent die Lokalpresse erneut. Der Bräutigam war Sidney Hammaker, Geschäftsführer der Hammaker-Brauerei, des Vorzeigebetriebs der Stadt. Der Braut sagte man märchenhaften Reichtum nach. Presseberichte von der Hochzeit bestätigten Gerüchte, dass sie ein auf elf Millionen Dollar versichertes Brillantcollier besaß und eine achtzehnköpfige Dienerschaft in das im Vorort Ladue gelegene Hammaker-Anwesen mitgebracht hatte. Anlässlich der Hochzeit fand ein Feuerwerk statt, dessen verkohlte Reste im Umkreis einer Meile auf den Rasenflächen niedergingen.
Eine Woche später begannen die Sichtungen. Eine zehnköpfige indische Familie wurde auf einer Verkehrsinsel einen Block östlich vom Cervantes Convention Center gesehen. Die Frauen trugen Saris, die Männer dunkle Anzüge, die Kinder Turnhosen und T-Shirts. Und alle trugen sie Zeichen verhaltenen Unmuts im Gesicht.
Anfang September gehörten Szenen wie diese bereits zum Alltag. Man sah Inder, die sich ohne erkennbaren Grund auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Kaufhaus Dillard’s und dem St.Louis Centre aufhielten. Man beobachtete, wie sie auf dem Parkplatz des Art Museum Decken ausbreiteten und auf einem Primuskocher Essen zubereiteten, wie sie auf dem Bürgersteig vor der National Bowling Hall of Fame Karten spielten, zum Verkauf stehende Häuser in Kirkwood und Sunset Hills besichtigten, vor dem im Stadtzentrum gelegenen Amtrak-Bahnhof Schnappschüsse machten und sich um die hochgeklappte Motorhaube eines Delta 88 scharten, der auf dem Forest Park Parkway liegen geblieben war. Die Kinder schienen ausnahmslos gut erzogen zu sein.
Der Frühherbst war auch die Zeit eines anderen, vertrauteren Besuchers aus dem Osten, des Verschleierten Propheten von Khorassan. Eine Gruppe von Geschäftsleuten hatte den Propheten im 19.Jahrhundert durch einen Zauber heraufbeschworen, um für wohltätige Zwecke Spenden zu erwirken. Jedes Jahr kehrte Er – verkörpert in einem anderen angesehenen Bürger, dessen Identität stets ein gut gehütetes Geheimnis blieb – zurück, und mit Seinen überkonfessionellen Mysterien brachte Er heiteren Glanz in die Stadt. Es stand geschrieben:
Auf seinem Throne saß Mokanna, der große Prophet,
gepriesen von Millionen, in blindgläub’gem Gebet.
Sein Antlitz war verborgen, von einem Schleier fein,
denn blenden tat die Sterblichen sein heller Glorienschein.
Aus Gnade trug Er den Schleier und lüftete ihn nicht,
bis die Menschen dort unten konnten ertragen sein Licht.
Es regnete nur ein einziges Mal im September, am Tag der Prophetenparade. Wasser strömte in die Schalltrichter der Tuben, und Trompeter bekamen Schwierigkeiten mit ihren Mundstücken. Die Pompons erschlafften und befleckten die Hände der Mädchen mit Farbe, die sie, wenn sie ihr Haar zurückstrichen, auf ihrer Stirn verschmierten. Mehrere Festwagen versanken in den Fluten.
Am Abend des Prophetenballs, dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres, rissen Sturmböen überall in der Stadt Stromleitungen von den Masten. Im Khorassan-Saal des Hotels Chase-Park Plaza gingen kurz nach dem Einzug der Debütantinnen die Lichter aus. Kellner eilten mit Leuchtern herbei, und kaum waren die ersten Kerzen angezündet, erhob sich aufgeregtes Getuschel: Der Thron des Propheten war leer.
Auf dem Kingshighway Boulevard raste ein schwarzer Ferrari 275 an den fensterlosen Supermärkten und den festungsartigen Kirchen der North Side vorbei. Beobachter hätten hinter dem Steuer eine schneeweiße Robe ausmachen können, auf dem Beifahrersitz eine Krone. Der Prophet fuhr zum Flughafen. Er parkte auf der Feuerwehrzufahrt und eilte in die Lobby des Hotels Marriott.
«Haben Sie ’n Problem?», fragte ein Hotelboy.
«Ich bin der Verschleierte Prophet, du Blödmann.»
Im obersten Geschoss blieb Er vor einer Tür stehen und klopfte. Die Tür wurde von einer großen dunkelhäutigen Frau im Jogginganzug geöffnet. Sie war sehr schön. Sie brach in Gelächter aus.
Als der Himmel aufhellte, weit im Osten, über Südillinois, waren die Vögel die ersten, die es bemerkten. In den Bäumen an den Flussufern, Grünanlagen und Plätzen begann es zu rascheln und zu zwitschern. Es war der erste Montagmorgen im Oktober. Die Vögel der Innenstadt wachten auf.
Nördlich des Geschäftsviertels, dort, wo die ärmsten Leute wohnten, wehte eine morgendliche Brise den Geruch von Suff und saurem Schweiß aus Durchgängen, in denen sich nichts regte; das Knallen einer Tür war blöckeweit zu hören. Auf dem Güterbahnhof in der Innenstadtsenke, umgeben vom Gesumm schadhafter Trafos und unvermittelt bebenden Gitterzäunen, dösten Männer mit Eisenbahnermützen in klotzigen Stellwerkstürmen vor sich hin, während unter ihnen Güterzüge rangierten. Dreisternehotels und Privatkliniken standen verloren am Hang. Nach Westen hin wurde das Land hüglig und gesündere Bäume fassten die Wohngegenden ein, doch das war nicht mehr St.Louis, das war schon die Vorstadt. Auf der South Side drängten sich Reihen um Reihen kubischer Ziegelhäuser, wo Witwen und Witwer in ihren Betten lagen und die Jalousien, in einer früheren Epoche heruntergelassen, den ganzen Tag geschlossen blieben.
Aber kein Teil der Stadt war so tot wie das Zentrum. Hier im Herzen von St.Louis, im Schatten des auch nachts pausenlos dröhnenden Verkehrs auf den vier Schnellstraßen, gab es jede Menge Parkplätze. Hier balgten sich die Spatzen, pickten die Tauben. Hier erhob sich das Rathaus, eine giebelreiche Kopie des Pariser Hôtel de Ville, in zweidimensionaler Pracht aus dem flachen Gelände. Die Luft in der Market Street, der Hauptstraße von St.Louis, war mild. Zu beiden Seiten hörte man die Vögel singen, einzeln und im Chor – wie auf einer Waldwiese. Wie in einem Garten.
Die Hüterin dieses Friedens hatte die Nacht schlaflos in der Clark Avenue verbracht, ein wenig südlich vom Rathaus. Im fünften Stockwerk des Polizeipräsidiums breitete Chief Jammu die Morgenzeitung unter der Schreibtischlampe aus. In ihrem Büro war es noch dunkel, und vom Kragen abwärts sah sie mit ihren schmalen, hochgezogenen Schultern, den knochigen Knien in Strümpfen und den ruhelosen Füßen wie ein Schulmädchen beim Lernen aus.
Ihr Kopf wirkte älter. Als sie sich über die Zeitung beugte, zeigten sich im seidig schwarzen Haar über dem linken Ohr weiße Strähnen. Wie Indira Gandhi, die an diesem Oktobermorgen noch am Leben und indische Premierministerin war, neigte Jammu zu einseitigem Ergrauen. Ihr Haar ließ sie so lang wachsen, dass sie es im Nacken feststecken konnte. Sie hatte eine hohe Stirn, eine schmale und gebogene Nase und breite Lippen, die blutleer aussahen, bläulich. Wenn sie ausgeruht war, beherrschten die dunklen Augen ihr Gesicht, aber an diesem Morgen waren sie trübe und von Tränensäcken beschwert. Fältchen schnitten in die zarte Haut um ihren Mund.
Sie blätterte den Post-Dispatch um und fand, was sie suchte, ein Foto von sich, aufgenommen an einem guten Tag. Sie lächelte darauf, mit gewinnendem Blick. Die Bildunterschrift – «Jammu: Das Persönliche im Visier» – rief dasselbe Lächeln in ihr wach. Der begleitende Artikel von Joseph Feig trug den Titel EIN NEUANFANG. Sie begann zu lesen.
Kaum jemand wird sich daran erinnern, aber der Name Jammu ist vor fast zehn Jahren in den amerikanischen Zeitungen schon einmal aufgetaucht. Es war das Jahr 1975, und der indische Subkontinent befand sich in Aufruhr, nachdem Premierministerin Indira Gandhi den Ausnahmezustand verhängt und ihre politischen Widersacher in die Schranken gewiesen hatte.
Neben vielen widersprüchlichen, von der Zensur verstümmelten Berichten geisterte auch eine kuriose Meldung über das so genannte Puri-Projekt durch die westliche Presse. Mit dieser von der Polizeibeamtin Jammu ins Leben gerufenen Initiative war die Polizei von Bombay, so schien es zumindest, in den Lebensmittelgroßhandel eingestiegen.
Schon damals hörte sich die Sache verrückt an. Aber da Jammu aufgrund einer Laune des Schicksals inzwischen die Polizeichefin von St.Louis ist, fragt man sich hier, ob das Puri-Projekt wirklich so verrückt war, wie es noch heute den Anschein hat.
Bei einem Interview in ihrem geräumigen Büro an der Clark Avenue spricht Jammu über die Vorgeschichte des Puri-Projekts.
«Bevor Mrs.Gandhi die Verfassung außer Kraft setzte, war der Subkontinent wie Gertruds Dänemark – durch und durch verrottet. Aber dank der Einführung des Präsidialregimes konnte die Polizei etwas dagegen tun. Allein in Bombay verhafteten wir 1500Straftäter pro Woche und beschlagnahmten Hehlerware und Gelder im Wert von 30Millionen Rupien. Als wir nach zwei Monaten Bilanz zogen, stellten wir fest, dass wir kaum einen Schritt weitergekommen waren», erinnert sich Jammu.
Das Präsidialregime stützt sich auf eine Klausel der indischen Verfassung, die der Zentralregierung in Zeiten des Notstands diktatorische Vollmachten erteilt. Daher wurde die neunzehnmonatige Ära des Präsidialregimes auch als Notstandsregierung bezeichnet.
1975 hatte die Rupie etwa den Wert von zehn US-Cent.
«Ich war damals Stellvertreterin des Polizeichefs», sagt Jammu, «und schlug ein anderes Vorgehen vor. Warum nicht versuchen, die Korruption mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, da Drohungen und Verhaftungen nichts fruchteten? Warum nicht selbst ins Geschäft einsteigen, unsere Ressourcen nutzen und einen freieren Markt durchsetzen? Wir entschieden uns für die wichtigste Warengruppe: Lebensmittel.»
Also wurde das Puri-Projekt entwickelt. Puri, ein frittiertes Fladenbrot, ist in Indien Grundnahrungsmittel. Am Ende des Jahres 1975 galt Bombay bei westlichen Journalisten als einzige Stadt Indiens, deren Geschäfte gut gefüllt und deren Preise gemäßigt waren.
Natürlich stand Jammu bald im Mittelpunkt des Interesses. Ihr Projekt, über das in der amerikanischen Tagespresse, in Time und Newsweek ausführlich berichtet wurde, stieß auch bei unseren Polizeibehörden auf Beachtung. Niemand aber hätte für möglich gehalten, dass sie eines Tages Sheriffstern und Dienstrevolver des Polizeichefs von St.Louis tragen würde.
Doch Colonel Jammu, die gerade am Beginn ihres dritten Amtsmonats steht, hält das für die normalste Sache der Welt. «Ein guter Polizeichef betont das persönliche Engagement in allen Bereichen der Polizeiarbeit», sagt sie. «Einen Revolver zu tragen ist Zeichen meiner Dienstauffassung. Sicher», fügt sie hinzu und lehnt sich in ihren Chefsessel, «eine tödliche Waffe ist er auch.»
Jammus offener, mutiger Führungsstil hat sich im wahrsten Sinne des Wortes weltweit herumgesprochen. Als die Suche nach einem Nachfolger für den vormaligen Polizeichef William O’Connell in einem Patt der zerstrittenen Fraktionen zu enden drohte und ein Kompromisskandidat benötigt wurde, fiel ihr Name als einer der ersten. Und obwohl sie in den Vereinigten Staaten über keinerlei Polizeierfahrung verfügte, wurde ihre Ernennung nur wenige Tage nach dem Vorstellungsgespräch vom Polizeiverwaltungsrat bestätigt.
Für viele kam es überraschend, dass die Inderin die staatsbürgerlichen Voraussetzungen für diese Dienststellung erfüllte. Aber Jammu ist in Los Angeles geboren, ihr Vater war Amerikaner, und ihre Nationalität hat sie stets gehütet wie einen kostbaren Schatz. Schon als Kind träumte sie davon, in Amerika zu leben.
«Ich bin schrecklich patriotisch», sagt sie lächelnd. «Neubürger wie ich sind das oft. Ich möchte viele Jahre in St.Louis leben. Ich bin gekommen, um zu bleiben.»
Jammu spricht mit leicht britischem Akzent, und ihre Gedanken sind von frappierender Klarheit. Ihre zarte und zerbrechliche Gestalt könnte kaum weiter vom Klischee eines rabiaten amerikanischen Polizeichefs entfernt sein. Doch ihre Laufbahn spricht eine andere Sprache.
1969, fünf Jahre nach dem Eintritt in den indischen Polizeidienst, wurde sie Stellvertreterin des Polizei-Generalinspekteurs der Provinz Maharashtra. Fünf Jahre später, mit nur 31Lenzen, hatte sie es an die Spitze der Polizei von Bombay geschafft. Mit 35 ist sie nun die jüngste Polizeichefin in der Geschichte von St.Louis und die erste Frau in diesem Amt.
Bevor sie zur indischen Polizei stieß, erwarb sie einen Abschluss in Elektrotechnik an der Universität Srinagar in Kaschmir. Im Anschluss studierte sie drei Semester Volkswirtschaft in Chicago.
«Ich habe hart gearbeitet, aber auch viel Glück gehabt», bekennt sie. «Ohne die gute Presse für das Puri-Projekt hätte ich diesen Job wohl kaum bekommen. Das Hauptproblem war natürlich immer, dass ich eine Frau bin. Es war nicht einfach, gegen fünftausend Jahre geschlechtlicher Diskriminierung anzukämpfen. Vor meiner Beförderung zur Kommissarin trug ich eine Männeruniform», erinnert sie sich.
Erfahrungen wie diese spielten offenbar eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung des Verwaltungsrats. Für eine Stadt, die nach wie vor gegen ihr «Verlierer-Image» ankämpfen muss, ist die unorthodoxe Wahl ein geschickter PR-Schachzug. St.Louis ist jetzt die größte Stadt der USA mit einem weiblichen Polizeichef.
Der Vorsitzende des Polizeiverwaltungsrats, Nelson A.Nelson, meint, St.Louis könne sich etwas darauf zugute halten, dass Frauen Zugang zu städtischen Regierungsämtern hätten. «Das ist Gleichstellung im wahrsten Sinne des Wortes», stellt er fest.
Jammu hingegen scheint von dem Thema nichts zu halten. «Ja, ich bin eine Frau. Na und?», sagt sie lächelnd.
Eins ihrer Hauptziele ist es, die Straßen sicherer zu machen. Zu den Leistungen ihrer Vorgänger auf diesem Gebiet will sie nicht Stellung nehmen, aber sie sagt, dass sie in enger Zusammenarbeit mit dem Rathaus ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung der Straßenkriminalität entwickeln wird.
«Die Stadt braucht einen Neuanfang, ein gründliches Großreinemachen. Wenn wir die Unterstützung der Wirtschaft und der Bürgergruppen bekommen – wenn es uns gelingt, den Menschen vor Augen zu führen, dass es sich um ein die ganze Region betreffendes Problem handelt–, dann bin ich überzeugt, dass wir die Straßen in sehr kurzer Zeit wieder sicher machen können.»
Polizeichefin Jammu sieht keinen Grund, ihre Absichten zu verhehlen. Dabei ist anzunehmen, dass alle ihre Bemühungen auf erbitterten Widerstand stoßen werden. Aber ihre Verdienste in Indien beweisen, dass sie kein Fliegengewicht ist, sondern eine politische Kraft, die man im Auge behalten sollte.
«Nehmen Sie das Puri-Projekt als Beispiel», sagt sie. «In einer Situation, die aussichtslos schien, haben wir eine ganze Reihe neuer Maßnahmen ergriffen. Vor jedem Bahnhof errichteten wir Basare. Damit haben wir unser Image verbessert und auch das Arbeitsklima. Erstmals seit Jahrzehnten hatten wir keine Schwierigkeiten mehr, qualifizierten Nachwuchs anzuwerben. Die indische Polizei galt als korrupt und gewalttätig, was vor allem auf den Mangel an gut ausgebildeten und verantwortungsbewussten Beamten zurückzuführen war. Das Puri-Projekt brachte die Dinge ins Rollen.»
Kritiker äußern die Befürchtung, dass eine Polizeichefin, die an die autoritären indischen Verhältnisse gewöhnt ist, nicht das nötige Feingefühl für die rechtlichen Belange der Bürger von St.Louis mitbringt. Charles Grady, Sprecher der örtlichen Sektion der Amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU, geht sogar so weit, die Entlassung Jammus zu fordern, bevor es zum «Verfassungsdebakel» komme.
Jammu weist diese kritischen Stimmen energisch zurück. «Die Reaktion der liberalen Gruppierungen hat mich ziemlich überrascht», sagt sie. «Ihre Befürchtungen, so glaube ich, gründen sich auf ein hartnäckiges Misstrauen gegenüber der Dritten Welt. Sie übersehen, dass die indische Regierungsform zutiefst von westlichen Idealen geprägt ist, in erster Linie natürlich von den britischen. Sie übersehen den Unterschied zwischen den gewöhnlichen indischen Polizeibeamten und dem nationalen Offizierskorps, dessen Mitglied ich war. Unsere Ausbildung entsprach den Normen des britischen Staatsdienstes. Die Anforderungen waren hoch. Wir waren ständig hin und her gerissen zwischen der Loyalität gegenüber unseren Beamten und der Treue zu unseren Idealen. Meine Kritiker übersehen, dass es genau dieser Konflikt war, der mir eine Tätigkeit in den USA attraktiv erscheinen ließ.
Heute», fährt sie nach einer Pause fort, «fällt mir am Puri-Projekt auf, wie amerikanisch unser Ansatz war. Einer bankrotten und fehlgeleiteten Ökonomie haben wir eine kräftige Dosis freie Marktwirtschaft verpasst. Bald waren die Vorräte der Hamsterer nur noch die Hälfte des Einkaufspreises wert. Die Schwarzhändler bettelten um Kundschaft. Was wir erreicht haben, war ein echtes Wirtschaftswunder im kleinen Rahmen», sagt Jammu in Anspielung auf den deutschen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wird sie in St.Louis ähnliche Wunder vollbringen können? Ihre Vorgänger haben beim Amtsantritt vor allem auf Loyalität, Qualifikation und technische Ausstattung gepocht. Für Jammu heißen die wesentlichen Punkte: Erneuerung, harte Arbeit und Selbstvertrauen.
«Unsere Beamten haben zu lange ihre Aufgabe darin gesehen, den Verfall von St.Louis so korrekt wie möglich zu verwalten», sagt sie und fügt sarkastisch hinzu: «Auf die Stimmung in der Stadt hat das Wunder gewirkt.»
Wie nicht anders zu erwarten, reagierten viele, besonders die älteren unter den städtischen Beamten, auf Jammus Berufung mit Skepsis. Aber die Ansichten ändern sich bereits. Die wohl häufigste Einschätzung, die man in der Stadt zu hören bekommt, lautet: «Sie ist in Ordnung.»
Nach fünf Minuten Gespräch mit Joseph Feig hatte Jammu ihren Achselschweiß wahrgenommen, einen muffig-animalischen Geruch. Feig hatte eine gute Witterung; einen Lügendetektor brauchte er nicht.
«Ist Jammu nicht eine Stadt in Kaschmir?», fragte er.
«Im Winter ist Jammu die Hauptstadt.»
«Aha.» Ein paar lange Sekunden musterte er sie eindringlich. Dann fragte er: «Wie ist das, wenn man mitten im Leben einfach in ein anderes Land geht?»
«Ich bin schrecklich patriotisch», sagte sie lächelnd. Sie war überrascht, dass er die Frage nach ihrer Vergangenheit nicht weiter vertiefte. Diese Interviews gehörten zu den Initiationsriten in St.Louis, und Feig, ein erfahrener Redakteur, galt als Nestor des Lokaljournalismus. Als er mit seinem zerknitterten Jackett und dem wochenalten Bart, grau und grimmig, in ihr Büro trat, hatte er sie so sehr an einen Detektiv erinnert, dass sie rot geworden war. Sie war auf das Schlimmste gefasst gewesen:
FEIG: Colonel Jammu, Sie behaupten, dass Sie der Gewalttätigkeit der indischen Gesellschaft entkommen wollen, dem menschlichen Elend und den Kastenproblemen. Aber es bleibt eine Tatsache, dass Sie fünfzehn Jahre lang einer Polizeimacht vorstanden, die für ihre Brutalität berüchtigt ist. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, Colonel. Wir wissen Bescheid über Indien. Zerschmetterte Ellbogen, gezogene Zähne, Vergewaltigungen mit Waffengewalt. Kerzen, Säure, Stockschläge, Elektroschocks –
JAMMU: Die Missstände waren, als ich den Dienst antrat, im Wesentlichen beseitigt.
FEIG: Colonel Jammu, wenn man sich klar macht, dass Mrs.Gandhi ein fast obsessives Misstrauen gegen ihre Untergebenen hegt, und sich vor Augen führt, welche zentrale Rolle Sie selbst im Puri-Projekt gespielt haben, dann stellt sich die Frage, ob Sie nicht irgendwie mit der Premierministerin verwandt sind. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau Polizeichefin wird, erst recht eine Frau mit einem amerikanischen Vater –
JAMMU: Ich sehe nicht, welche Bedeutung meine Verwandtschaftsverhältnisse für St.Louis haben sollten.
Aber nun wurde der Artikel gedruckt, unumstößlich, unwiderruflich. In den Fenstern von Jammus Büro wurde es Tag. Sie stützte das Kinn in die Hände und ließ die Druckbuchstaben verschwimmen. Mit dem Artikel war sie zufrieden, doch Feig machte ihr Sorgen. Warum erging sich dieser offenkundig intelligente Mann in Plattitüden? Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Vielleicht knüpfte er schon die Schlinge und «gewährte» ihr das Interview wie eine letzte Zigarette im Morgengrauen, während er seine Enthüllungen hinter ihrem Rücken zu einem effizienten Hinrichtungskommando formierte…
Ihr Kopf sank vornüber. Sie knipste die Lampe aus, und mit einem trockenen Klatschen sackte ihr Oberkörper über der Zeitung zusammen. Sie schloss die Augen, begann sofort zu träumen. In dem Traum war Joseph Feig ihr Vater. Er interviewte sie. Als sie von ihren Triumphen sprach, dem köstlichen Nachgeschmack der Lügen, die die Leute hören wollten, der Flucht aus Indien mit seiner stickigen Atmosphäre, lächelte er. In seinem Blick entdeckte sie das traurige, geteilte Wissen um die Leichtgläubigkeit der Welt. «Du bist eine Kratzbürste», sagte er. Sie schob sich über den Schreibtisch, schmiegte den Kopf in die Ellenbeuge. Kratzbürste, dachte sie. Dann hörte sie den Interviewer auf Zehenspitzen hinter ihren Sessel schleichen. Sie streckte die Arme nach hinten, um nach seinen Beinen zu tasten, aber ihre Hände griffen ins Leere. Sein stachliges Gesicht strich ihr Haar beiseite und streifte ihren Nacken. Seine Zunge kam aus dem Mund. Schwer, warm, wie Teig drückte sie gegen ihre Haut.
Schaudernd wachte sie auf.
Jammus Vater war 1974 umgekommen, als ein Hubschrauber mit ausländischen Journalisten und südvietnamesischen Militärs nahe der kambodschanischen Grenze von einer Rakete der Kommunisten getroffen wurde. Ein zweiter Hubschrauber filmte den Absturz und entkam nach Saigon. Jammu und ihre Mutter hatten die Nachricht aus der Pariser Ausgabe der Herald Tribune, dem einzigen Verbindungsglied zwischen dem Mann und ihnen. Mehr als zehn Jahre zuvor hatte Jammu erstmals seinen Namen erfahren, aus einer Zeitung, die über eine Woche alt war. Seit Jammu Fragen stellen konnte, war die Mutter ausgewichen und hatte, wann immer Jammu auf ihren Vater zu sprechen kam, jede Auskunft brüsk verweigert. Dann, im Frühjahr bevor sie ihr Studium aufnahm, hatte ihre Mutter das Schweigen gebrochen. Sie saßen beim Frühstück auf der Veranda, Maman mit ihrer Herald Tribune und Jammu mit ihrem Mathematikbuch. Maman schob ihr die Zeitung hin und strich mit einem langen Fingernagel über einen Artikel am Fuß der Titelseite.
WACHSENDE SPANNUNGEN AN DER
CHINESISCH-INDISCHEN GRENZE
Peter B.Clancy
Jammu las ein paar Absätze, ohne zu wissen, warum. Fragend blickte sie auf.
«Das ist dein Vater.»
Mamans Ton war sachlich wie immer. Sie sprach nur englisch mit Jammu, und das mit einer Geringschätzung, als würde sie jedem Wort misstrauen. Jammu überflog den Artikel erneut. Vergeltungsschläge. Separatisten. Düstere Perspektiven. Peter B.Clancy.
«Ein Reporter?», fragte sie.
«Hm.»
Ihre Mutter wollte über ihn nicht sprechen. Sie hatte eingeräumt, dass es ihn gab, doch der Wissbegier ihrer Tochter begegnete sie mit Spott. Da sei nichts zu erzählen, sagte sie. Sie hätten sich in Kaschmir kennen gelernt. Sie hätten das Land verlassen und zwei Jahre in Los Angeles gelebt, wo Clancy irgendeinen Abschluss gemacht habe. Dann sei sie zurückgekehrt, allein mit ihrem Baby, nach Bombay, nicht nach Srinagar, und dort sei sie geblieben. Nichts in ihrem nekrologartigen Bericht ließ vermuten, dass Clancy mehr für sie gewesen war als ein lästiges Stück Gepäck. Jammu begriff – es hatte nicht geklappt. Und es war auch egal. Die Stadt war voll von Mischlingen, und Maman pfiff auf die öffentliche Meinung. Für die Presse war sie der «lachende Immobilienschakal». Weil sie gut lachen hatte, wenn sie zur Bank ging. Sie war Spekulantin und Slum-Lord, und zwar eine der erfolgreicheren in dieser Stadt der Spekulation und Slums.
Jammu öffnete die Schreibtischlade, wählte zwei Schmerztabletten und eine Amphetaminpille aus und spülte sie mit dem restlichen Kaffee hinunter. Ihre nächtliche Lektüre hatte sie schneller beendet als geplant. Es war erst halb sieben. In Bombay war es schon fünf Uhr am Nachmittag– Indien leistete sich die Marotte, eine halbe Stunde zwischen den weltweit üblichen Zeitzonen zu liegen–, und Maman saß wahrscheinlich zu Hause im Obergeschoss und genehmigte sich den ersten Drink. Jammu griff zum Telefon, rief das Fernamt an und gab die Nummer durch.
Während die Verbindung den halben Globus umrundete, rauschte es im Hörer. In Indien rauschten die Ortsgespräche genauso. Maman meldete sich.
«Ich bin’s», sagte Jammu.
«Oh. Hallo.»
«Hallo. Gibt’s was Neues?»
«Nein. Ohne deine Freunde ist die Stadt wie leer gefegt.» Ihre Mutter lachte. «Heimweh?»
«Eigentlich nicht.»
«Apropos – hat dich die Aufgeklärte Despotin angerufen?»
«Haha.»
«Im Ernst. Sie ist in New York. Die Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung hat begonnen.»
«Das ist tausend Meilen von hier entfernt.»
«Na, einen Anruf könnte sie sich leisten. Aber sie lässt es sein. Ja. Sie lässt es einfach sein. Heute Morgen hab ich gelesen… liest du noch Zeitungen?»
«Wenn ich die Zeit dazu habe.»
«Verstehe. Wenn du die Zeit dazu hast. Ich wollte sagen, dass ich heute Morgen was über ihren Minigipfel mit amerikanischen Intellektuellen gelesen habe. Leitartikel auf der Titelseite. Asimov, Sagan… Futurologen. Sie ist ein Phänomen. Schau sie dir an, du lernst etwas. Auch wenn sie nicht unfehlbar ist. Auf dem Foto war zu sehen, dass Asimov Rippchen gegessen hat. Aber egal – wie ist es in St.Louis?»
«Gemäßigt. Sehr trocken.»
«Und du mit deinen Nebenhöhlen. Wie steht’s mit Singh?»
«Singh ist Singh. Muss jeden Augenblick kommen.»
«Lass ihn bloß nicht an deine Buchführung ran.»
«Er macht aber meine Buchführung.»
«Du Dickkopf. Ich werde Bhandari schicken müssen, gegen Monatsende, damit er alles prüft. Singh ist nicht–»
«Hierher? Du schickst Karam her?»
«Nur für ein paar Tage. Etwa am Neunundzwanzigsten kannst du mit ihm rechnen.»
«Bitte nicht Karam. Ich kann ihn nicht ausstehen.»
«Und ich kann Singh nicht ausstehen.» Jammu hörte ein leises Geräusch, das Klingeln von Eiswürfeln. «Hör zu, Liebes, wir reden morgen weiter.»
«Na gut. Bis dann.»
Maman und Indira waren blutsverwandt, Kaschmir-Brahmanen mit einem gemeinsamen Urgroßvater auf der Nehru-Seite. Dass Jammu noch im Jahr des Amtsantritts von Indira Gandhi in den indischen Polizeidienst aufgenommen wurde, kam nicht von ungefähr. Natürlich war dann niemandem befohlen worden, sie zu befördern, aber gelegentliche Anrufe aus dem Ministerium erinnerten die zuständigen Beamten daran, dass man Jammus Karriere «mit Interesse» verfolgte. Im Lauf der Jahre hatte auch sie Hunderte solcher Anrufe erhalten, die ähnlich vage blieben, selbst wenn konkrete Anliegen dahinter standen. Ein hoher Justizbeamter des Bundesstaats Maharashtra signalisierte, dass ihm an der Eröffnung eines bestimmten Strafverfahrens gelegen sei, ein Führer der Kongresspartei machte seinem Ärger über die Geschäfte eines bestimmten Oppositionspolitikers Luft. Anrufe von Regierungsstellen oberhalb der Gouverneursebene waren jedoch selten; Indira maß Detailkenntnissen große Bedeutung zu, aber nur im Rahmen der Tagesordnung. Wie jeder Entscheidungsträger war sie darauf bedacht, sich bei fragwürdigen Aktionen möglichst gute Rückendeckung zu verschaffen, und fragwürdig waren Jammus politische Aktionen allemal. Nur einmal hatte sie privat mit Indira gesprochen – kurz nachdem sie mit ihrer Mutter das Puri-Projekt ausgebrütet hatte. Jammu flog nach Delhi und verbrachte siebzig Minuten im Garten von Madams Residenz an der Safdarjang Road. Madam, auf einem Segeltuchstuhl sitzend, musterte sie aufmerksam, die hervorquellenden Augen braun, der Kopf schräg gelegt und die Lippen zu einem Lächeln verzogen, das von Schnalzlauten begleitet war, ein Lächeln, in dem Jammu nichts als Mechanik sah. Madam wandte den Kopf um eine Vierteldrehung zur Seite und richtete den Blick auf das Rosenspalier, hinter dem Gewehrläufe patrouillierten. «Ihnen ist bestimmt klar», sagte sie, «dass dieses Großhandelsprojekt nicht funktionieren wird. Sie sind doch eine vernünftige junge Frau. Aber wir werden es trotzdem finanzieren.»
In Jammus Vorzimmer knarrten Schuhe. Sie fuhr hoch. «Wer…» Sie räusperte sich. «Wer ist da?»
Balwan Singh trat ein. Er trug eine graue Bügelfaltenhose, ein weißes Maßhemd und eine azurblaue Krawatte mit feinen gelben Streifen. Er wirkte so kompetent und Vertrauen erweckend, dass er sich, wenn er zu ihr heraufkam, selten ausweisen musste. «Ich bin’s», sagte er und legte eine weiße Papiertüte auf Jammus Schreibtisch.
«Du hast gelauscht.»
«Ich, gelauscht?» Singh stellte sich ans Fenster. Er war groß und breitschultrig, und sein heller Teint verdankte einem mittelasiatischen Vorfahren zusätzliches Gold. Nur eine alte Freundin und Exgeliebte wie Jammu konnte bemerken, wann die Anmut seiner Bewegungen die Grenze zur Affektiertheit überschritt. Nach wie vor bewunderte sie ihn, als Zierde. Für einen Mann, der noch im Juli im Schmutz von Dharabi gehaust hatte, hätte er auffallend – und verdächtig – adrett ausgesehen, wäre er unter seinen so genannten Genossen in Bombay, deren Geschmack eher zu Velours, Kunstfasern und schlampigen Pullovern tendierte, nicht exakt genauso gekleidet gewesen. Singh war ein Marxist der ästhetischen Art, der mit der Idee des Revolutionsexports zum Teil zumindest deshalb kokettierte, weil der den Export europäischer Moden nach sich zog. Sein Herrenausstatter lag am Marine Drive. Jammu argwöhnte seit langem, dass Singh dem Sikhismus in früher Jugend entsagt hatte, weil er einen Bart entstellend fand.
Singh deutete mit einem Nicken auf die Tüte. «Wenn du möchtest, ist da Frühstück für dich.»
Sie nahm die Tüte auf den Schoß und öffnete sie: zwei Schoko-Doughnuts und ein Becher Kaffee. «Ich hab mir ein paar Bänder angehört», sagte sie. «Wer hat die Mikrophone in den Toiletten des St.Louis Club installiert?»
«Ich.»
«Hab ich mir gedacht. Baxtis Mikros klingen wie mit Kaugummi verklebt. Deine kommen ganz gut. Ich hab ein paar brauchbare Gespräche gehört. General Norris, Buzz Wismer–»
«Seine Frau ist ein Miststück», sagte Singh abwesend.
«Wismers Frau?»
«Ja. Bev heißt sie. Von allen Frauen hier, die Asha niemals verzeihen werden, dass sie Sidney Hammaker geheiratet hat, oder Hammaker niemals verzeihen werden, dass er Asha geheiratet hat – und solche Frauen gibt es in Mengen–, ist Bev die Schlimmste.»
«Auf allen Bändern höre ich dieselben Klagen», sagte Jammu. «Zumindest von den Frauen. Die Männer lassen durchblicken, dass sie, was Asha betrifft, ‹schwankend› sind. Immerzu betonen sie Ashas Intelligenz.»
«Womit sie ihre betörende Schönheit meinen.»
«Und ihren märchenhaften Reichtum.»
«Wismer gehört jedenfalls zu den Schwankenden. Bev macht das wütend. Ständig hackt sie auf ihm rum.»
Jammu warf den Deckel des Kaffeebechers in den Papierkorb. «Warum lässt er sich das bieten?»
«Er ist sonderbar. Ein scheues Genie.» Singh runzelte die Stirn und setzte sich aufs Fensterbrett. «Von den Wismer-Jets habe ich zum ersten Mal vor zwanzig Jahren gehört. Keiner baut bessere Flugzeuge.»
«Und das heißt?»
«Das heißt, er ist nicht der Mann, den ich in ihm vermutet habe. Die Stimme täuscht.»
«Du hast dir eine Menge Bänder angehört.»
«Hundertfünfzig Stunden etwa. Was glaubst du, was ich den ganzen Tag mache?»
Jammu zuckte die Schultern. Sie konnte sicher sein, dass Singh nicht übertrieb. Sein Arbeitseifer war über jeden Verdacht erhaben. Da ihn nichts ablenkte (außer gelegentlich ein blonder Boy) und er niemandem verantwortlich war (außer ihr), hatte er genügend Zeit, ein geordnetes Leben zu führen. Ein herrliches Leben. Sie, die zwei Jobs von jeweils sechzig Wochenstunden gleichzeitig erledigte, war in dieser Hinsicht nicht mit Singh zu vergleichen. Ihr Fuß begann aus eigenem Antrieb zu wippen, das Amphetamin wirkte also. «Ich ziehe dich von Wismer ab», sagte sie.
«Ach ja?»
«Und setze dich auf Martin Probst an.»
«Gut.»
«Das heißt, du musst ganz von vorn anfangen. Wismer kannst du vergessen, deine hundertfünfzig Stunden auch.»
«Das waren nur die Bänder. Sagen wir, dreihundert Stunden.»
«Baxti hat mir die Akte von Probst gebracht. Du fängst sofort an.»
«Hast du dir das eben erst überlegt?»
«Nein. Ich habe mit Baxti bereits geredet, er hat mir die Akte bereits übergeben, und deshalb bist du hier. Um sie mitzunehmen.»
«Schön.»
«Also nimm sie mit.» Sie wies mit dem Kopf auf einen teefleckigen Ordner neben der Schreibtischlampe.
Singh ging zum Schreibtisch und nahm den Ordner. «Noch was?»
«Ja. Leg ihn hin.»
Er legte den Ordner wieder hin.
«Hol mir ein Glas Wasser, und dreh die Heizung auf.»
Er verließ den Raum.
Martin Probst war der Bauunternehmer, der den Gateway Arch errichtet hatte, das Wahrzeichen der Stadt. Er war auch Vorsitzender des «Städtischen Wachstumsvereins», einer gemeinnützigen Organisation, die sich aus den Geschäftsführern der großen Firmen und Geldinstitute im Raum St.Louis zusammensetzte. Der Wachstumsverein war ein Muster an Effizienz und Gegenstand fast allumfassender Ehrerbietung. Brauchte jemand Sponsoren für ein städtisches Sanierungsvorhaben – der Wachstumsverein spürte sie auf. Wollte eine Bürgerinitiative den Bau einer Schnellstraße verhindern – der Wachstumsverein zahlte die Verkehrsstudie. Wenn Jammu die Machtstrukturen von St.Louis ändern wollte, kam sie am Wachstumsverein nicht vorbei.
Singh kehrte mit einem Pappbecher zurück. «Hat Baxti vor, neue Welten zu erobern?»
«Hol dir einen Stuhl und setz dich.»
Er gehorchte.
«Baxtis Fähigkeiten sind doch ganz offensichtlich beschränkt. Wozu also die Diskussion?»
Er schüttelte eine Nelkenzigarette aus einer karamellfarbenen Packung, zündete ein Streichholz an und schirmte die Flamme gegen einen imaginären Luftzug ab. «Weil ich nicht verstehe, warum wir tauschen sollen.»
«Ich fürchte, da musst du mir vertrauen.»
«Fürchte ich auch.»
«Worum es geht, weißt du wahrscheinlich – um Probsts charmante Frau Barbara, um seine charmante achtzehnjährige Tochter Luisa. Sie wohnen, was interessant ist, in Webster Groves. Ein reicher Vorort, aber bei weitem nicht der reichste. Sie haben allerdings einen Gärtner, der auf dem Grundstück wohnt… Baxti bezeichnet die Atmosphäre im Haus als ‹sehr friedvoll›.»
«Mikros?»
«In Küche und Esszimmer.»
«Das Schlafzimmer wäre aufschlussreicher gewesen.»
«So viele Frequenzen haben wir nicht. Und im Schlafzimmer steht ein Fernseher.»
«Schön. Was noch?»
Jammu schlug die Probst-Akte auf. Blinzelnd entzifferte sie Baxtis Hindigekritzel. «Es fängt damit an, dass er keine Gewerkschaftsmitglieder einstellt. In den sechziger Jahren gab es da einen großen Rechtsstreit. Sein Chefanwalt war Charles Wilson, Barbaras Vater, mittlerweile sein Schwiegervater. So haben sie sich kennen gelernt. Probsts Angestellte haben noch nie gestreikt. Er zahlt nach Tarif oder sogar darüber und versichert seine Leute. Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Rente, manches davon einzigartig in der Branche. Paternalismus vom Feinsten. Probst ist kein Vashni Lal. Er genießt die, in Anführungsstrichen, Reputation, sich auf allen Geschäftsebenen persönlich zu engagieren.»
«Das Persönliche im Visier.»
«Haha. Gegenwärtig ist er Vorsitzender des Wachstumsvereins, seine Amtszeit geht bis nächsten Juni. Das ist wichtig. Außerdem: seit 1976 im Vorstand des Zoos. Vorstandsmitglied beim Botanischen Garten, beim East-West-Gateway-Koordinierungsausschuss. Fördermitglied bei Channel 9.Das ist weniger wichtig. Wie man so sagt, tanzt er auf vielen Hochzeiten. Baxti hat einiges zusammengetragen. Alte Zeitungen durchgeackert, mit Leuten geredet…»
«Das hätte ich gern gehört.»
«Sein Englisch wird langsam besser. Der Globe-Democrat scheint in Probst einen Heiligen des American Way of Life zu sehen – vom Tellerwäscher zum Millionär. 1950 ein Niemand, in den Sechzigern Bauherr des Gateway Arch, parallel dazu der Rohbau des Stadions, dann noch eine ganze Reihe weiterer Projekte. Wenn das nicht bezeichnend ist.»
«Er streckt sich nach der Decke.»
«Tun wir doch alle.»
Singh gähnte. «Und er ist wirklich so wichtig.»
«Ja.» Jammu zwinkerte im Rauch der Nelkenzigarette. «Gähn mich nicht an. Er ist der Primus inter Pares beim Wachstumsverein, und wenn wir wollen, dass das Kapital in die Innenstadt fließt, sind das die Leute, die wir bearbeiten müssen. Er ist parteilos und in seiner Unbestechlichkeit wie Jesus. Er ist ein Symbol. Ist dir aufgefallen, wie sehr diese Stadt in Symbole verliebt ist?»
«Du meinst den Arch?»
«Den Arch, den Verschleierten Propheten, den ganzen ‹Spirit of St.Louis›-Mythos. Und Probst offenbar auch. Wir brauchen ihn, und sei es nur der Stimmen wegen, die er bringen wird.»
«Wann hast du das alles entschieden?»
Jammu zuckte die Schultern. «Ich hatte mich nicht weiter mit ihm befasst, bis ich letzte Woche mit Baxti sprach. Gerade hatte er Probsts Hund aus dem Weg geschafft, ein erster Schritt, Probst in die Krise–»
«Ach ja, die Krise.»
«Obwohl es bis dahin nichts als ein bloßer Terrorakt war. Immerhin, eine hübsche Aktion.»
«Ja?» Singh zupfte einen Fetzen Zigarettenpapier von der Zungenspitze, betrachtete es und schnipste es fort.
«Probst hat seinen Hund spazieren geführt. Baxti fuhr im Lieferwagen vorbei, und der Hund rannte ihm nach. Bei einer Firma für Medizinbedarf hatte Baxti eine Geruchsessenz aufgetrieben. Den Geruch läufiger Hündinnen. Dann einen Lappen damit getränkt und den Lappen vor der Hinterachse befestigt.»
«Hat Probst keinen Verdacht geschöpft?»
«Anscheinend nicht.»
«Was hindert ihn daran, einen neuen Hund zu kaufen?»
«Vermutlich hätte sich Baxti auch um den gekümmert. An dem Punkt musst du die Taktik überdenken. Dass Probst auf den Unfall offenbar nicht reagiert hat, ist für mich Grund genug, dass du ihn übernehmen sollst.»
Das Telefon klingelte. Es war Randy Fitch, der Vorsitzende des städtischen Haushaltsausschusses. Er teilte Jammu mit, er habe verschlafen und könne daher den Achtuhrtermin nicht einhalten. Freundlich und geduldig versicherte ihm Jammu, das sei nicht weiter schlimm. Sie legte auf. «Musst du diese Dinger hier drinnen rauchen?», fragte sie.
Singh öffnete das Fenster und warf den Stummel hinaus. Ein schwaches Flussaroma wehte mit dem Luftzug herein. Unten auf dem Tucker Boulevard fuhr ein Bus mit Gedröhn auf die Spruce-Street-Kreuzung zu. Die Morgensonne tauchte Singh in orangefarbenes Licht. Er sah aus, als würde er, ungerührt, eine gigantische Explosion verfolgen. «Weißt du», sagte er, «die Arbeit mit Buzzy und Bevy hat mir schon fast Spaß gemacht.»
«Da bin ich mir sicher.»
«Buzz bezeichnet Probst und dessen Frau als gute Freunde.»
«Wirklich?»
«Die Probsts finden sich ab mit Bev. Ich habe den Eindruck, dass es ‹nette› Leute sind. Zuverlässige.»
«Gut. Eine schöne Aufgabe für dich.» Jammu legte ihm den Ordner in die Hände. «Aber keine Mätzchen, verstanden?»
Singh nickte. «Verstanden.»
2
1870 war St.Louis die viertgrößte Stadt Amerikas. Ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt, der größte Binnenhafen des Landes, ein Umschlagplatz für den halben Kontinent. Nur New York, Philadelphia und Brooklyn hatten mehr Einwohner– Zeitungen in Chicago, der dichtauf folgenden fünftgrößten Stadt, stellten allerdings die Behauptung auf, bei der Volkszählung von 1870 seien neunzigtausend St.Louisianer zu viel gezählt worden, und hatten Recht damit. Alle Städte aber sind Ideen. Sie erschaffen sich selbst, und die Welt nimmt sie nach Belieben wahr oder ignoriert sie.
Als St.Louis 1875 von seinen Lokalpropheten zur natürlichen Hauptstadt der Nation erklärt wurde, der es bestimmt sei, zur größten Stadt des Landes aufzusteigen, machte man sich daran, ein entscheidendes Hindernis auf diesem Weg beiseite zu räumen. Das Hindernis war die St.Louis County, der Teil des Staates Missouri, zu dem die Stadt nominell gehörte. Ohne die Stadt war die St.Louis County gar nichts – eine große Fläche Farmland und Wald im Gebiet zwischen zwei Flüssen. Trotzdem beherrschte die County seit Jahrzehnten schon die Stadt. Instrument war eine urtümliche Verwaltungsbehörde, der County Court. Die sieben «Richter» waren notorisch korrupt und gegenüber den städtischen Belangen gleichgültig. Ein Farmer, der eine Straße zu seinem Hof bauen lassen wollte, konnte die Richter billig kaufen – mit Geld oder Wählerstimmen. Wenn aber die Stadt Grünanlagen oder Straßenbeleuchtung brauchte, hatte der County Court nichts beizusteuern. Für eine aufstrebende Provinzstadt war die engstirnige Behörde ein Ärgernis; für die viertgrößte Stadt Amerikas war sie untragbar.
Eine Gruppe einflussreicher Geschäftsleute und Juristen überzeugte die Vordenker einer neuen Verfassung für den Staat Missouri, dass Vorkehrungen für eine Gemeindereform in den Entwurf einzubringen seien. Ungeachtet aller Behinderungen durch den County Court entwarf die Gruppe eine Strategie für die Ausgliederung von St.Louis aus der St.Louis County, über die im August 1876 von den Bewohnern des Verwaltungsbezirks abgestimmt werden sollte.
Vor der Wahl hatte sich die Kritik an dieser Strategie vor allem auf einen Punkt konzentriert – die Ausweitung des städtischen Landbesitzes von einundzwanzig auf einundsechzig Quadratmeilen, wobei so etwas wie Abfindungen gezahlt wurden. Die Landbewohner erhoben Einspruch gegen den «Landraub» der Stadt. Der Globe-Democrat sah in der Annexion «von Getreidefeldern und Melonenäckern und in deren Besteuerung als städtisches Eigentum» ein empörendes Unrecht. Die Verfechter der Ausgliederung aber beharrten darauf, dass die Stadt diese Flächen für Parks und Industrieanlagen der Zukunft dringend nötig habe.
Bei einer Wahl, die der County Court durchführte, entschieden sich die Wähler mit knapper Mehrheit dagegen. Betrugsvorwürfe wurden laut. Den Kritikern fiel es nicht schwer, einen Richter des Oberlandesgerichts (einen Louis Gottschalk, der den Reformvorbehalt für die Verfassung von 1875 persönlich ausgearbeitet hatte) dafür zu gewinnen, dass er eine Untersuchungskommission einsetzte und die Wahl überprüfen ließ. Ende Dezember präsentierte die Kommission ihr Ergebnis: Die Ausgliederung war befürwortet worden, mit einer Mehrheit von 1253Stimmen. Sofort erhob die Stadt Anspruch auf ihr neues Land und gab sich eine neue Gemeindeordnung, und fünf Monate später, nachdem alle Revisionen abgewiesen waren, löste sich der County Court auf.
Jahrzehnte vergingen. Bald zeigte sich, dass die einundsechzig Quadratmeilen nicht ausreichten. Schon 1900 platzte die Stadt aus allen Nähten, und die County weigerte sich, weitere Flächen abzutreten. Die alteingesessenen Fabriken nahmen Reißaus vor den Zerstörungen, die sie angerichtet hatten. Neue Fabriken ließen sich in der County nieder. In den dreißiger Jahren zogen verarmte schwarze Familien aus den ländlichen Südstaaten zu und beschleunigten die Abwanderung der Weißen in die Vororte. Um 1940 schrumpfte die Stadtbevölkerung bereits, und damit sanken auch die Steuereinnahmen. Altehrwürdige Wohnquartiere verkamen und waren nur noch alt. Siedlungsprojekte wie Pruit-Igoe, in den fünfziger Jahren begonnen, scheiterten spektakulär in den Sechzigern. Bemühungen um eine Neubelebung der Stadt führten dazu, dass betuchte Bewohner der County in einige exklusive Wohnlagen zogen, halfen aber der kränkelnden Stadt nicht weiter. Jedermann beklagte den Zustand der städtischen Schulen, doch darin erschöpfte sich der Reformwille schon. Die siebziger Jahre, als riesige Asphaltwüsten die halb leeren Bürogebäude im Zentrum ersetzten, wurden zur Ära der Parkplätze.
Mittlerweile hatten natürlich die meisten amerikanischen Städte ähnliche Probleme. Verglichen mit St.Louis aber war selbst Detroit eine blühende Metropole, war selbst Cleveland eine familienfreundliche Großstadt. Andere Städte hatten Optionen, gute Nachbarn, eine Chance, sich zu behaupten. Philadelphia nutzte sein Umland, Pittsburgh konnte auf die Unterstützung der Allegheny County rechnen. Das abgeschnittene und eingeschnürte St.Louis hingegen war 1980 auf Platz siebenundzwanzig der amerikanischen Großstädte abgerutscht. Es hatte nur noch 450000Einwohner, kaum halb so viele wie 1930.
Die Lokalpropheten waren in der Defensive. Hatten sie einst die Vorrangstellung der Stadt beschworen, klammerten sie sich nun an jedes Überlebenszeichen. Vierzig Jahre lang hatten sie gepredigt: «St.Louis schafft den Aufstieg.» Sie verwiesen auf den Gateway Arch (192Meter hoch und nicht zu übersehen). Sie verwiesen auf das neue Kongresszentrum, auf drei neue Hochhäuser und zwei riesige Einkaufsmärkte. Auf Slumsanierungsprojekte, Verschönerungsprogramme und Pläne für eine Gateway Mall, die der Prachtstraße in Washington Konkurrenz machen sollte.
Aber Städte sind Ideen. Welchen Eindruck gewannen die Leser der New York Times, wenn sie sich aus der Ferne ein Bild von St.Louis machen wollten? Vielleicht hatten sie den Artikel über eine neue städtische Verordnung gelesen, die das Wühlen in Mülltonnen unter Strafe stellte. Oder den Bericht über die bevorstehende Einstellung des schwächelnden Globe-Democrat. Oder die Geschichte von den Gaunern, die leer stehende Gebäude abrissen, jeden Tag ein anderes, und die Ziegel an Baufirmen außerhalb des Staates verkauften.
Warum traf es gerade St.Louis?
Die Propheten gaben sich nicht geschlagen und verkniffen sich diese Frage. Dasselbe galt für die alten Verfechter des Fortschritts, die die Stadt mit ihren guten Absichten in den Ruin getrieben hatten. Längst hatten sie ihre Wohnsitze und Aktivitäten aufs Land verlegt. Die Frage stellte sich, wenn überhaupt, im Stillen – in der Stille der leeren Straßen und, beharrlicher noch, in der Stille des Jahrhunderts, das zwischen dem aufblühenden und dem toten St.Louis lag. Was wird aus einer Stadt, an die sich kein Lebender erinnert, aus einem Zeitalter, dessen Untergang kein Lebender betrauert? Nur St.Louis wusste es. Die Stadt war der einzige Zeuge ihres Schicksals, einer ganz besonderen Tragödie, die nirgendwo sonst besonders war.
Nach dem Gespräch mit Jammu brachte Singh die dicke Probst-Akte in sein Apartment im West End, las sie von vorn bis hinten durch, rief Baxti achtmal an, um sich Verschiedenes erklären zu lassen, und in der Absicht, den Schauplatz zukünftiger Verbrechen zu besichtigen, fuhr er am nächsten Morgen hinaus nach Webster Groves.
Die Probsts bewohnten eine dreigeschossige Villa an einer langen und breiten Straße, dem Sherwood Drive. Barbara Probst war pünktlich losgefahren. Dienstags, genau wie donnerstags, arbeitete sie in der Beschaffungsabteilung der Universitätsbibliothek von St.Louis und kam um halb sechs nach Hause. Der Dienstag war auch der Tag, an dem der Gärtner frei hatte. Als das Piepen in Singhs Ohrhörer erstarb und nur noch statisches Rauschen vernehmbar war (Baxti hatte Barbaras BMW mit einem Positionsmelder versehen, der eine Reichweite von einem Kilometer besaß), hörte er die zwei im Haus platzierten Mikrophone ab, stellte fest, dass alles ruhig war, und näherte sich dem Haus zu Fuß. Während der Schulstunden waren Fußgänger am Sherwood Drive so rar wie auf einem Friedhof.
Singh hatte sich als Gasmann verkleidet. Er trug eine Umhängetasche aus schwarzem Leder. In der Hosentasche hielt er OP-Handschuhe zur Vermeidung von Fingerabdrücken bereit. Er stieg eine rote Ziegeltreppe hinab und öffnete die Kellertür mit dem Schlüssel, den er von Baxti erhalten hatte. Die Massen von Gerümpel beeindruckten ihn. Insbesondere die vielen abgefahrenen Reifen, die vielen Plastikblumentöpfe, die vielen Kaffeebüchsen. Er ging nach oben in die Küche. Dem Geruch nach war hier vor kurzem renoviert worden – es roch nach frischer Tapete, frischen Stoffen, frischer Abdichtmasse und frischer Farbe, einer Mischung daraus. Ein Geschirrspüler vibrierte in der Trockenphase. Singh entfernte die Haube des Hitzemelders über dem Herd, ersetzte die Batterie des Senders, steuerte das Mikro aus (was Baxti grundsätzlich vergaß), befestigte die Haube und wiederholte denselben Vorgang im Esszimmer.
Baxti hatte Probsts Arbeitszimmer und Barbaras Schreibtisch und Schränke bereits durchgesehen, die Adressbücher, die stornierten Schecks und die alte Korrespondenz, deshalb konzentrierte sich Singh auf das Zimmer der Tochter Luisa. Er verschoss zwei Meter Mikrofilm, hielt alles fest, was interessant sein konnte. Gegen Mittag war er fertig. Er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und öffnete eine Tüte M&Ms (machten keine Krümel). Gerade kaute er die letzten, zwei gelbe, als er vor dem Haus eine ihm bekannte Stimme hörte.
Er stellte sich ans Fenster. Luisa kam mit einer Freundin die Einfahrt herauf. Singh schlüpfte in das benachbarte Gästezimmer, schob die Umhängetasche unters Bett, kroch hinterher, und während die Mädchen unter ihm die Küche betraten, zog er die Staubborte glatt. Wortlos öffneten sie Kühlschrank und Küchenbuffet, gossen sich Getränke ein und raschelten mit Plastiktüten. «Die besser nicht essen», sagte Luisa.
«Warum?»
«Meine Mutter merkt das.»
«Und die hier?»
«Nein, lieber nicht.»
Sie stiegen die Treppe hoch, gingen am Gästezimmer vorbei und verschwanden in Luisas Zimmer. Singh lag mucksmäuschenstill. Drei Stunden später hatten die Mädchen das Fernsehen satt und verließen mit Feldstechern das Haus. Singh, wieder am Fenster, schaute ihnen bis zur nächsten Ecke nach. Dann ging er in den Keller und kam, Notizen in sein Zählerbuch machend, die Außentreppe herauf.
In seiner Zweitwohnung in Brentwood entwickelte und vergrößerte er die Fotos. Er blieb drei Nächte und zwei Tage in der Wohnung, studierte die Unterlagen und arbeitete sich durch einen Teil der Probst-Telefonate, von denen bereits mehr als hundert Stunden aufgezeichnet waren. Er wärmte tiefgekühlte Fertiggerichte auf. Er trank Leitungswasser und schob ab und zu ein Nickerchen ein.
Als Luisa am Freitagabend ausging, wartete er auf der Lockwood Avenue in dem grünen zweitürigen LeSabre, den er zwei Monate zuvor geleast hatte. Für sich sprach er den Namen französisch aus: LeSab. Luisa holte vier Freunde aus der Nachbarschaft ab und fuhr nach Forest Park, wo sie sich auf einen Hügel setzten – und hinabrollten, wieder hochkletterten und das Gras zertrampelten–, einen Hügel, der Art hieß. Art Hill. Ganz oben stand das Museum. Als es dunkel wurde, fuhren die Jugendlichen zehn Meilen Richtung Südwesten zu einem Minigolfplatz am Highway 366, der sich Mini-Links nannte. Singh parkte den LeSab auf der anderen Straßenseite und beobachtete die Jugendlichen, die bunte Bälle durch die Öffnung eines Totempfahls schossen, mit seinem Fernglas. Die Gesichter der zwei Jungs waren weich und flaumig wie die der drei Mädchen. Alle kicherten und zeigten das fröhlich auftrumpfende, in jedem Land abstoßend wirkende Renommiergehabe von Teenagern.
Am nächsten Abend, einem Samstag, rauchte Luisa mit ihrer schulschwänzenden Freundin Stacy Marihuana in einem dunklen Park, danach gingen sie ins Kino und sahen einen Softporno – ein Vergnügen, auf das Singh verzichtete. Am Sonntagmorgen lud Luisa mit einer anderen Freundin Utensilien zur Vogelbeobachtung in den BMW und entfernte sich gen Westen. Singh folgte ihnen nur bis zur Grenze der County. Er hatte genug gesehen.
Auf dem Niemandsland, das von der bogenförmigen Autobahnauffahrt von East St.Louis, Illinois, eingefasst wurde, stand ein Lagerhaus, in dem Singh ein Loft besaß, seine dritte und bevorzugte Wohnung. Besorgt hatte sie ihm Prinzessin Asha – das Haus gehörte zum Immobilienbesitz der Hammaker-Brauerei–, und die Kosten für den grünen Spannteppich in den drei Zimmern, die Kücheneinrichtung und die Dusche im Bad hatte sie übernommen. Das Loft hatte keine Fenster, nur Dachluken aus Mattglas. Die Türen waren aus Stahl. Die Räume maßen gut drei Meter fünfzig in der Höhe, waren brandsicher und schalldicht. Wenn sich Singh ins Innere des Lofts zurückzog, konnte er überall sein. Mit anderen Worten: war er nicht mehr in St.Louis. Daher seine Vorliebe für die Wohnung.
Der dunkle Schatten einer Taube zeichnete sich auf dem Mattglas ab, ein zweiter Schatten gesellte sich hinzu. Singh schlug die Akte Probst auf, die vor ihm auf dem Boden lag. Die ganze Woche hatte ihn Jammu am Telefon gedrängt, einen Plan auf die Beine zu stellen, der Probst auf ihre Seite ziehen würde. Sie hatte es furchtbar eilig. Zusammen mit dem Bürgermeister und einem bestochenen Stadtrat entwarf sie bereits Reformen der städtischen Steuergesetze, Reformen, die nur dann in Kraft gesetzt werden konnten, wenn es in der Zwischenzeit gelang, einen Teil der Bevölkerung mitsamt ihrem Reichtum aus der County Richtung Osten zurückzulocken. Aber die County wachte eifersüchtig über ihre Pfründen. Nichts außer einer Wiedervereinigung mit der Stadt konnte sie dazu bewegen, der Stadt zu Hilfe zu kommen. Und da die Wähler in der County jegliche Kooperation mit der Stadt ablehnten, waren sich Singh und Jammu einig, dass sie die Vereinigung nur befördern konnten, indem sie sich auf Privatpersonen konzentrierten, die in der regionalen Politik das Sagen hatten, die über Platzierung und Gewichtung von Investitionen Entscheidungen trafen. Nicht mehr als ein Dutzend Katalysatoren waren nach Jammus Meinung vonnöten, wenn man sie alle dazu bringen konnte, unwissentlich an einem Strang zu ziehen. Und wenn man Jammus Nachforschungen trauen konnte, hatte sie diese zwölf bereits beisammen. Wie zu erwarten, waren sie alle männlich, nahmen sie alle an Versammlungen des Wachstumsvereins teil, und die meisten von ihnen waren Geschäftsführer, die ihre Aktionäre gut im Griff hatten. Das waren die, die Jammu «rumkriegen» musste.
Was sie machen würde, wenn sie sie «rumgekriegt» hatte, wenn jedes einzelne Gebrechen der Stadt geheilt und sie über ihre Rolle als Polizeichefin hinausgewachsen war, um zur Heldin von Mound City zu werden, der Stadt, die auf dem Boden indianischer Grabhügel stand, verriet sie nicht. Vorerst ging es bloß um das Wie.
Im Kampf gegen ihre Feinde in Bombay und auf Vorteile für ihre Verwandten bedacht, hatte Jammu die Idee entwickelt, ihre Zielpersonen in eine «Krise» zu versetzen, die deren Urteilskraft stark beeinträchtigte. Die mildeste Form der Krise, die in Bombay am leichtesten herbeizuführen war, beruhte auf der Angst vor der Einkommensteuer. Dutzende von Bürgern, auf deren Denken Jammu Einfluss nehmen wollte, wurden auf ihre Veranlassung hin so lange mit maßlos überzogenen Steuerprüfungen gequält, bis sie bei Tag und bei Nacht an nichts anderes mehr dachten als an Steuern. Dann trat sie in Aktion und machte Beute. Sie bat die Zielperson um Dinge, die ihr unter normalen Umständen niemals gewährt worden wären, sie trieb die Zielperson zu Dummheiten, die sie ein halbes Jahr zuvor nicht im Traum begangen hätte, sie veranlasste die Zielperson zu Investitionen, die zu vermeiden es hundert gute Gründe gab… Natürlich konnte man von dieser Methode keine Wunder erwarten. Jammu brauchte am Anfang irgendeinen Hebel. Oft genügte schon die Anfälligkeit der Zielperson für ihren Charme.
Die Krise hatte gegenüber den üblicheren Formen der Nötigung zwei Vorteile. Erstens wirkte sie indirekt. Sie entstand in einem Lebensbereich, der nichts mit Jammu, der Polizei und oft auch nichts mit der öffentlichen Sphäre zu tun hatte. Zweitens war sie flexibel. Jede Situation ließ sich herbeiführen, jede Schwäche der Zielperson konnte kultiviert werden. Jammu hatte den ihr gefährlichen Jehangir Kumar, einen Mann, der gern trank, in einen unheilbaren Alkoholiker verwandelt. Als Mr.Vashni Lal, der in Poona wiederholt Schwierigkeiten mit seinen unterbezahlten Schweißern bekam, versucht hatte, Jammu um ihren Posten bei der Polizei zu bringen, hatte sie ihm einen Arbeitskampf beschert, einen blutigen Aufstand, den ihre eigenen Polizeikräfte niederschlagen mussten. Sie hatte Linke in Gewissenskonflikte gestürzt, hatte aus Rechten Paranoiker werden lassen. Sie hatte die schlimmsten Ängste tüchtiger Geschäftsleute ausgenutzt, indem sie ihnen schlaflose Nächte bereitete, und von der Esslust eines rivalisierenden Polizeibeamten profitiert, indem sie ihm einen übereifrigen bengalischen Koch schickte, dessen Künsten er eine Gallenoperation und die vorzeitige Pensionierung verdankte. Singh höchstpersönlich war in das Leben eines Playboys getreten, eines Millionärs aus Surat, der bald danach starb, und hatte ihn im Dienste des Puri-Projekts impotent gemacht.
Wegen der Austauschbarkeit von Führungskräften achtete Jammu darauf, dass ihre Zielpersonen in St.Louis funktionsfähig blieben. Sie sollten ihre Positionen behalten, nur ihre Spielräume mussten beschnitten werden. Und an diesem Punkt – an dem es darum ging, nach einem Weg in die Krise, nach Mitteln der Beeinträchtigung zu suchen – bekam Singh Schwierigkeiten mit Martin Probst.
Probst hatte keine Schwächen.
Er war ehrlich, kompetent, ohne Laster und bis zur Selbstgefälligkeit gelassen. Für einen Bauunternehmer hatte er eine sagenhaft reine Weste. Er bewarb sich nur um Aufträge, für die ein klar erkennbarer Bedarf bestand. Er bezahlte unabhängige Gutachter, die seine Arbeit prüften. Jeden Juli schickte er seinen Angestellten einen ausführlichen Geschäftsbericht zu. Die einzigen ihm verbliebenen Feinde waren die Gewerkschaften, die er 1962 verprellt hatte, doch die spielten in der Lokalpolitik von St.Louis keine Rolle mehr.
Auch sein Privatleben schien in bester Ordnung zu sein. Singh hatte sich ein paar häusliche Dispute angehört, aber sie waren nichts als Unkrautpflänzchen zwischen solidem Straßenpflaster. Offenbar war es dieses friedliche Image der Familie Probst, das St.Louis an ihm am meisten bewunderte. Singh hatte sich ein paar Probst-Stellen aus der Bändersammlung herausgesucht, die R.Gopal für Jammu katalogisiert hatte. Auf einem Band sprach Bürgermeister Pete Wesley mit dem Schatzmeister des East-West-Gateway-Koordinierungsausschusses.
Wesley (u. R.Crawford, Samst., 10.Sept., 10.15Uhr, Rathaus)
P.W.: Nein, ich hab noch nicht mit ihm geredet. Aber ich hab Barbara am Donnerstag beim Baseball gesehen, und ich hab sie gefragt, ob er sich schon mal Gedanken gemacht hat.
R.C.: Beim Baseball.
P.W.: Verrückt, was? Bei einer anderen Frau würde man denken, die hat sie nicht alle.
R.C.: Du meinst, weil sie allein hingeht.
P.W.: Ich verstehe nicht, wie die das macht. Jede andere… Kannst du dir vorstellen, dass sich so jemand wie Betty Norris ganz allein in die Loge setzt?
R.C.: Was hat Barbara gesagt?
P.W.: Wir haben eine ganze Weile geredet. Wie Martin dazu steht, habe ich nicht rausgekriegt, aber sie war ziemlich entschieden.
R.C.: Wofür?
P.W.: Oh, positiv. Eindeutig positiv. Die Frau ist prima. Und bei dieser kleinen Familie – ist es nicht erstaunlich, wie oft man ihnen begegnet?
Ripley (Rolf und Audrey, Montag, 5.Sept., 22.15Uhr)
A.R.: Kommt dir Luisa nicht wie eins von den Kindern vor, denen was zustoßen könnte? Sie war so nett heute. Alles an ihr ist perfekt. Denkt man da nicht automatisch, dass ihr was Schreckliches zustoßen könnte? (Pause.) Wie eine Puppe, die man kaputt machen kann. (Pause.) Findest du nicht?
R.R.: Nein.
Meisner (Chuck und Bea, Samst., 10.Sept., 1.30Uhr)
C.M.: Das war Martin. Ob wir gut nach Hause gekommen sind. (Pause.) Ich bin sicher, er hätte kein Auge zugetan, ohne uns das gefragt zu haben. (Pause.) Sah ich wirklich so besoffen aus?
B.M.: Wir alle, Chuck.
C.M.: Komisch, dass man ihnen so was kaum anmerkt. Ich meine, bei ihnen hat man ein gutes Gefühl.
B.M.: Sie sind ein ganz besonderes Paar.
C.M.: Ja. Ein ganz besonderes.
Schade, dachte Singh, dass R.Gopal nicht mehr die Zeit hatte, derartige Mitschnitte zu sortieren und in eine brauchbare Form zu bringen. «Über diese Phase sind wir hinaus», hatte Jammu gesagt. «Für Gopal hab ich was anderes.»
Murphy (Chester, Jane, Alvin, 19.Sept., 18.45Uhr)
JANE: Weißt du, wen ich heut gesehen habe, Alvin? Luisa Probst. Erinnerst du dich?
ALVIN: (kauend) Kann sein.
JANE: Sie ist ein sehr hübsches Mädchen geworden.
ALVIN: (kaut)
JANE: Ich dachte, es wäre nett, wenn du sie irgendwann mal anrufst. Sie würde sich sicher freuen, von dir zu hören.
ALVIN: (kaut)
JANE: Ich sag ja nur, es wäre nett.
ALVIN: (kaut)
JANE: Ich hatte sie als ein bisschen pummlig in Erinnerung. Das sind bestimmt, na, drei Jahre, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich komme ja nicht mehr nach Webster Groves. Aber ihre Mutter sehe ich ständig (Pause.) Es wäre, glaube ich, sehr, sehr nett, wenn du sie mal anrufst.
CHES: Hör auf, Jane.
Ein sehr hübsches Mädchen. Ein besonderes Paar. Singh vermied den Rückschluss, dass Probsts Machtposition in der Stadt durch seine nette Familie begünstigt wurde, aber offensichtlich war die Familie eine Quelle ungewöhnlicher Kraft. Und Kraft dieser Art konnte leicht zur Schwäche werden. Das hatte selbst Baxti erkannt. In seinem Abschlussbericht hatte er geschrieben:
UnBestechlich in Jahr 72, und schlimmer.
(1972 hatte ein Mitglied des Slumsanierungskomitees Schmiergeld verlangt, und Probst war mit der Geschichte an die Presse gegangen.)
Außer Moral hat er kaine Sünden. Wenn er stürbt, ist jeder Mann moralisch. Das ist der Schlüssl. Tod in der Luft. Erste Schritt: Hund. Zweite Schritt: Tochter. Dritte Schritt: Frau. Kette von Verluste. Und alleine stehen. Er liebt seine Hund. Gibt ihm Kuschelnahme. Und kaine Hund…???
Das war Baxtis Denkstil. Sein Informationsstil auf Hindi war etwas leichter zu verstehen.
Singh schloss den Ordner und schaute kurz auf zu den verschwommenen Tauben auf dem Dachfenster. Baxti war unbeholfen, aber nicht dumm. Er hatte die Sache richtig angepackt. Als Bürger der westlichen Welt war Probst a priori sentimental. Um ihn in die Krise zu versetzen, musste man den Prozess der Heimsuchungen vielleicht nur beschleunigen, die Verluste von zwanzig Jahren auf drei oder vier Monate komprimieren. Die Vorfälle würden unzusammenhängend sein, eine «Pechsträhne», wie es Baxti irgendwo anders formuliert hatte. Und der Prozess konnte schrittweise vorangetrieben werden – so lange, bis Probst bereit war, Jammu öffentlich zu unterstützen, und den Wachstumsverein anwies, dasselbe zu tun.
Nun denn, als Nächstes war die Tochter dran. Um die letzte Lücke in Baxtis Recherche zu füllen, hatte Singh Luisas Briefe, Tagebücher und Notizbücher gelesen, er hatte ihre persönlichen Besitztümer sprechen lassen, und obwohl er kein Kenner der amerikanischen Jugend war, fand er Luisa ausgesprochen typisch. Ihr Gebiss war orthopädisch korrigiert. Sie hatte weder Krankheiten noch Parasiten. Sie war, mehr oder weniger, blond und 1,68 groß, und sie wusste ihren Wohlstand wirksam zu präsentieren. Sie hatte schon Freunde gehabt, aber den letzten vor kurzem verabschiedet. Ihr gehörten eine TEAC-Stereoanlage, 175Schallplatten, kein Auto, kein Computer, ein Schmetterlingsnetz und ein Tötungsglas, ein Diaphragma in Originalverpackung mit einer winzigen Tube Gynol II, ein kleiner Fernseher, über 40Pullover, über 20 Paar Schuhe. Ihr Sparkonto wies ein Guthaben von 3700Dollar auf, und sie besaß, obwohl das keine Bedeutung für sie hatte, annähernd 250000Dollar auf Gemeinschaftskonten und in Treuhandfonds. Das Verhältnis von 37 zu 2500 war der mathematische Ausdruck für ihren Abstand vom Erwachsensein. Sie schwänzte die Schule und konsumierte Rauschmittel; sie war eine Heimlichtuerin.
Singh musste entscheiden, wie sie sich von ihrer Familie isolieren ließ. «Keine Mätzchen», hatte Jammu gesagt. Das Gegenteil von «Mätzchen» war die Anwendung von Gewalt. Aber es war eine Sache, nach Baxtis Art Probsts Hund umzubringen, und eine andere, gleich als Erstes die Familie zu traumatisieren. Traumata erzeugten Leid, kathartische Weinkrämpfe. Ganz nett. Doch die Krise erzeugten sie nicht.
Auch die anderen Standardtechniken waren für Luisa kaum geeignet. Singh konnte sie nicht entführen; Entführungen bedeuteten zu viel Schrecken und Leid. Schmeicheleien brachten nichts, er konnte ihr nicht einreden, dass sie irgendeine Begabung hatte, weil das nicht zutraf, und sie war nicht naiv genug, um zum Besten gehalten zu werden. Bestechung schied ebenfalls aus. Jammu hatte einen Bankier in der Zürcher Talstraße, der mit Kusshand ein Konto eröffnen würde, aber Luisa fehlte für Geld noch der Sinn. Sie war auch zu jung, um sich à la Mission Impossible einreden zu lassen, dass ein enger Bekannter oder Verwandter gegen sie Ränke schmiedete. Für Narkotika war sie natürlich nicht zu jung, und Singh war ein exzellenter Dealer, aber Drogen und Traumata lagen eng beieinander. Politische Indoktrination hätte möglicherweise Erfolg gehabt, doch so etwas kostete zu viel Zeit.
Es blieb ihm wenig anderes übrig, als das Mädchen zu verführen. Obwohl sie als Technik zu den Mätzchen zählte, war die Verführung für liebebedürftige Zielpersonen in einem Alter, in dem man zu Heimlichkeiten und Abenteuern neigt, ideal. Das einzig Schwierige war der Zugriff. Luisa war nie allein – außer zu Hause oder im Auto oder in Geschäften oder beim Vogelbeobachten oder in der Bibliothek (und Singh war klug genug, keine Bekanntschaften in amerikanischen Bibliotheken zu machen). Wo hatte ein Fremder Gelegenheit, sie kennen zu lernen?
Als Mann kam selbstverständlich nur Singh infrage. Einen anderen gab es nicht. Baxti? Eher hätte sie es mit einem Alligator getrieben. Singh war makellos. In härteren Zeiten hatte er als Dressman für Krawatten gearbeitet. Er war Mr.Makellos persönlich. Man sagte ihm, der Grund seien seine Zähne. Gut möglich. Makellos war er auf jeden Fall. Makellos und – um den Punkt nicht zu strapazieren – unwiderstehlich. Im Umgang mit Amerikanern war er ein Profi. Hatte er nicht erst letzte Woche…?
Das Problem war der Zugriff. Egal, womit er Luisa köderte – indem er ihr Gutscheine für eine Bar oder Freikarten für ein Konzert schickte–, immer würde sie eine Freundin mitbringen. Manchmal fuhr sie allein zum Vogelbeobachten, das schon, aber Singh hatte von Vögeln keine Ahnung. Er würde Wochen brauchen, um sich in «Vogelkunde» Wissen anzueignen, und die Vorstellung, seine Zeit für Kreaturen zu verschwenden, die mutwillig Flüssigexkremente verspritzten (Singh war kein Naturfreund), fand er widerlich. Zu schade, dass Luisa nicht Messer sammelte. Er besaß Exemplare, für die ausgebuffte Sammler ihre Schwester verhökert hätten. Das burmesische Häutemesser…