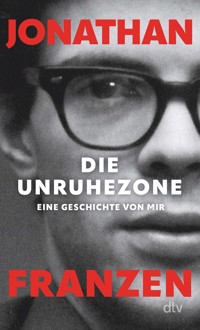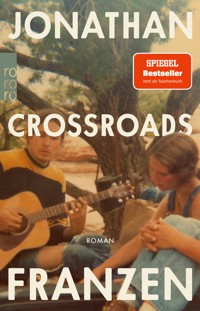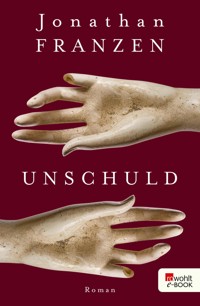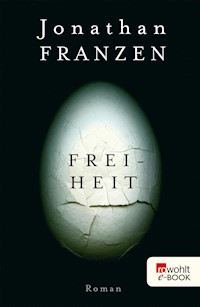2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner dritten Essaysammlung nimmt uns Jonathan Franzen mit auf ferne Kontinente, in Wüsten, auf tropische Inseln, ja sogar auf eine Luxuskreuzfahrt in die Antarktis. Allein auf Deck, bei rauem Wind und eisiger Kälte, ausgestattet mit seinem Fernglas und viel Geduld, hält er Ausschau nach dem, was es in wenigen Jahren wohl nicht mehr geben wird: Kaiserpinguine, die auf Eisbergen stehen. Und er erinnert sich an seinen verstorbenen Onkel Walt – einen Mann, der trotz schwerer Schicksalsschläge niemals aufhörte, das Leben zu lieben. - Einsichten eines der größten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart, der mit sich selber ringt. Und mit einigen der wichtigsten Themen unserer Zeit. Klug, aufrüttelnd und notwendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jonathan Franzen
Das Ende vom Ende der Welt
Essays
Über dieses Buch
EINSICHTEN EINES DER GRÖSSTEN AMERIKANISCHEN SCHRIFTSTELLER DER GEGENWART – KLUG, AUFRÜTTELND, NOTWENDIG
Ein Essayist, schreibt Jonathan Franzen, sei ein Feuerwehrmann, «dessen Aufgabe es ist, direkt in die Flammen der Schande hineinzulaufen, wenn alle anderen vor ihnen fliehen». Seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren führt der weltweit gefeierte Autor großer Romane ein zweites Leben als unerschrockener Essayist. Jetzt, da der technologische Fortschritt die Menschen gegeneinander aufbringt, ja Hass zwischen ihnen schürt und der Planet von widernatürlichen Katastrophen heimgesucht wird, legt er einen neuen Essayband vor, der uns humanere Wege aufzeigt, in dieser Welt zu leben.
Seine große Liebe gilt der Literatur und den Vögeln, und «Das Ende vom Ende der Welt» ist ein leidenschaftliches Plädoyer für beides. Während in den neuen Medien eigene Vorurteile eher noch untermauert würden, so Franzen, lade die Literatur dazu ein, «sich zu fragen, ob man selbst vielleicht ein bisschen oder sogar vollkommen falschliegt, und sich vor Augen zu führen, warum jemand anders einen wohl hassen könnte». Worüber er auch schreibt – immer sind seine Essays skeptisch gegenüber vorgefassten Meinungen, selbstkritisch und voller Ironie. Auch Vögel verschont er nicht (die «alles töten, was man sich vorstellen kann»), aber seine Reportagen und Reflexionen – über Meeresvögel in Neuseeland, Zweigsänger in Ostafrika, Pinguine in der Antarktis – sind sowohl bewegende Hymnen auf ihre Schönheit und Anpassungsfähigkeit als auch ein scharfsinniger, kluger Aufruf zur Rettung all dessen, woran uns etwas liegt.
Vita
Jonathan Franzen, 1959 geboren, erhielt für seinen Weltbestseller «Die Korrekturen» 2001 den National Book Award. Er veröffentlichte außerdem die Romane «Die 27ste Stadt», «Schweres Beben», «Freiheit» und «Unschuld», das autobiographische Buch «Die Unruhezone», die Essaysammlungen «Anleitung zum Alleinsein» und «Weiter weg» sowie «Das Kraus-Projekt». Er ist Mitglied der amerikanischen Academy of Arts and Letters, der Berliner Akademie der Künste und des französischen Ordre des Arts et des Lettres. 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der WELT-Literaturpreis verliehen, 2015 erhielt er für seinen Einsatz zum Schutz der Wildvögel den EuroNatur-Preis. Er lebt in Santa Cruz, Kalifornien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «The End of the End of the Earth» im Verlag Farrar, Straus and Giroux, New York
Copyright © 2018 by Jonathan Franzen
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlaggestaltung Titelei Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Design: Rodrigo Corral, Foto: Jeroen W. Mantel
ISBN 978-3-644-00066-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Kathy, wieder,
und zur Erinnerung an Martin Schneider-Jacoby
und Mindy Baha El Din
Der Essay in finsteren Zeiten
Wenn ein Essay, etymologisch betrachtet, ein Versuch ist – etwas Gewagtes, Unbestimmtes, Unzuverlässiges, etwas, das allein auf der persönlichen Erfahrung und Subjektivität des Autors fußt –, dann könnte es scheinen, als lebten wir in einem goldenen Zeitalter der Essayistik. Auf welcher Party man am Freitagabend war, wie man von einem Flugbegleiter behandelt wurde, was man vom politischen Aufreger des Tages hält: Die Grundannahme sozialer Medien besteht darin, dass noch das winzigste subjektive Mikronarrativ es wert ist, nicht nur privat, wie in einem Tagebuch, notiert, sondern auch mit anderen geteilt zu werden. Dieser Grundannahme entspricht jetzt der amerikanische Präsident. Die herkömmliche Berichterstattung harter Fakten in Medien wie der New York Times ist in einem Maße aufgeweicht worden, dass das Ich mit seinen Stimmlagen und Meinungen und Eindrücken ins Scheinwerferlicht der Seite eins rücken konnte, und Rezensenten fühlen sich immer seltener verpflichtet, Bücher so objektiv wie möglich zu besprechen. Früher spielte es keine Rolle, ob einem Raskolnikoff und Lily Bart sympathisch waren, jetzt jedoch ist die Frage der «Sympathie», und damit die persönliche Ansicht des Rezensenten, ein Schlüsselelement der Kritik. Und sogar die Literatur sieht mehr und mehr wie ein Essay aus. Einige der einflussreichsten Romane der letzten Jahre, etwa von Rachel Cusk oder Karl Ove Knausgård, heben das Verfahren, mit den Mitteln der Selbstreflexion Zeugnis abzulegen, auf eine neue Stufe. Ihre extremeren Bewunderer werden Ihnen sagen, dass Phantasie und Erfindung überholte Vehikel sind; dass es einem Akt der kulturellen Aneignung, gar des Kolonialismus gleichkommt, wenn man in die Subjektivät einer Figur schlüpft, die sich nicht mit dem Autor deckt; dass die einzige authentische und politisch vertretbare Form der Erzählung die Autobiographie ist.
Derweil sieht es für den autobiographischen Essay – das formale Instrumentarium aufrichtiger Selbsterforschung und der nachhaltigen Auseinandersetzung mit Ideen, wie es von Montaigne geprägt und von Emerson, Woolf und Baldwin weiterentwickelt wurde – schlecht aus. Die meisten großen amerikanischen Zeitschriften haben es so gut wie aufgegeben, in dieser Tradition stehende Essays zu veröffentlichen. Die Form dauert vor allem in kleineren Publikationen fort, die zusammen weniger Leser haben als Margaret Atwood Follower bei Twitter. Sollten wir also das Aussterben des Essays beklagen? Oder sollten wir seinen kulturellen Siegeszug feiern?
Ein persönliches und subjektives Mikronarrativ: Das Wenige, was ich über das Essayschreiben gelernt habe, verdanke ich meinem Redakteur beim New Yorker, Henry Finder. Zum ersten Mal habe ich 1994 mit ihm zu tun gehabt, als Möchtegernjournalist, der dringend Geld brauchte. Größtenteils durch glückliche Umstände brachte ich einen druckbaren Artikel über die amerikanische Post zustande, dann, durch ureigene Inkompetenz, einen nicht druckbaren über den Sierra Club. Das war der Moment, in dem Henry andeutete, ich hätte vielleicht eine gewisse Begabung als Essayist. «Weil du offenkundig ein Scheißjournalist bist», hörte ich ihn sagen und wies eine solche Begabung weit von mir.
Da ich aus dem Mittleren Westen komme, war mir die Angst anerzogen worden, ich könnte zu viel über mich selbst reden, und außerdem war ich wegen gewisser verschrobener Vorstellungen, die ich vom Romaneschreiben hatte, der vorgefassten Meinung, es sei viel lohnenswerter, die Dinge zu zeigen, als sie zu erklären. Geld brauchte ich allerdings immer noch, also rief ich Henry weiterhin an und bat ihn um Rezensionsaufträge. Bei einem dieser Telefonate fragte er mich, ob ich mich für die Tabakindustrie interessieren würde – das Thema einer umfangreichen neuen Studie von Richard Kluger. Ich sagte schnell: «Zigaretten sind das Letzte auf der Welt, über das ich nachdenken möchte.» Worauf Henry noch schneller antwortete: «Deshalb musst du darüber schreiben.»
Das war das Erste, was ich von Henry lernte, und es bleibt das Wichtigste. Nachdem ich in meinen Zwanzigern immer geraucht hatte, war es mir gelungen, mit Anfang dreißig für zwei Jahre aufzuhören. Als ich aber mit dem Post-Artikel beauftragt wurde und es mir davor graute, auch nur den Hörer abzuheben und mich als Journalist vom New Yorker vorzustellen, fing ich wieder an. In den darauffolgenden Jahren brachte ich es fertig, mich als Nichtraucher zu verstehen, zumindest als jemanden, der so fest entschlossen war, das Rauchen wieder aufzugeben, dass ich genauso gut schon Nichtraucher hätte sein können, auch wenn ich nach wie vor rauchte. Mein Geisteszustand glich einer quantenmechanischen Wellenfunktion, in der ich gleichzeitig Raucher wie Nichtraucher sein konnte, solange ich mir über mich nur nicht im Klaren war. Und ich begriff sofort, dass über Zigaretten zu schreiben mich zwingen würde, mir über mich klar zu werden. Denn das ist es ja, was Essays tun.
Außerdem gab es da das Problem mit meiner Mutter, deren Vater an Lungenkrebs gestorben war und die zu den militanten Tabakgegnern zählte. Dass ich rauchte, hatte ich über fünfzehn Jahre lang vor ihr verborgen. Ein Grund dafür, warum ich meine unbestimmte Haltung als Raucher/Nichtraucher nicht aufgeben durfte, war der, dass ich sie nicht gerne anlog. Sobald es mir gelänge, wieder aufzuhören, und zwar auf Dauer, würde die Wellenfunktion in sich zusammenbrechen, und ich wäre zu hundert Prozent der Nichtraucher, der zu sein ich mir immer schon vorgestellt hatte – allerdings nur, wenn ich nicht zuvor, in gedruckter Form, mein Coming-out als Raucher hätte.
Henry war ein Wunderkind gewesen, als Tina Brown ihn mit Mitte zwanzig zum New Yorker holte. Er hatte eine markante, atemlose Sprechweise, eine Art hyperartikuliertes Nuscheln, wie überaus gut lektorierte, nur kaum lesbare Prosa. Seine Intelligenz und Belesenheit beeindruckten mich sehr, und ich lebte schon bald in der Furcht, ihn zu enttäuschen. Seine leidenschaftliche Emphase in «Deshalb musst du darüber schreiben» – er war der Einzige, den ich kannte, der mit einem betonten «therefore» am Satzanfang und einem imperativischen «must» davonkam – erlaubte mir zu hoffen, dass ich mich seinem Bewusstsein wenigstens ein kleines bisschen eingeprägt hatte.
Und so begann ich, an dem Essay zu arbeiten, rauchte vor dem Kastenventilator meines Wohnzimmerfensters jeden Tag ein halbes Dutzend teerreduzierte Zigaretten und gab schließlich das einzige je für Henry geschriebene Stück ab, das ohne sein Lektorat auskam. Ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter den Essay in die Finger kriegte und wie sie mir ihr tief empfundenes Gefühl, betrogen worden zu sein, mitteilte, ob per Brief oder am Telefon, aber ich weiß noch sehr genau, dass sie danach sechs Wochen lang nicht mit mir sprach – mit großem Abstand die längste Zeit, die sie sich mir gegenüber je in Schweigen hüllte. Es war genau so, wie ich befürchtet hatte. Doch als sie darüber hinweg war und wieder anfing, mir Briefe zu schreiben, fühlte ich mich von ihr auf bisher ungekannte Weise wahrgenommen: als das, was ich war. Es war nicht nur so, dass mein «wahres» Ich vor ihr verborgen gewesen wäre; es war, als wäre da gar kein wahrnehmbares Ich gewesen.
In Entweder – Oder macht sich Kierkegaard über den «geschäftigen Menschen» lustig, für den die Geschäftigkeit ein Weg ist, eine ehrliche Selbsteinschätzung zu umgehen. Nachts mag man aufwachen und begreifen, dass man in seiner Ehe einsam ist oder dass man sich darüber Gedanken machen sollte, was das eigene Konsumverhalten dem Planeten antut, aber am nächsten Tag hat man eine Million von Kleinigkeiten zu erledigen und am Tag darauf noch eine Million. Solange man mit den Kleinigkeiten an kein Ende kommt, muss man nie innehalten und sich den größeren Fragen stellen. Einen Essay zu schreiben oder zu lesen ist nicht der einzige Weg, innezuhalten und sich zu fragen, wer man eigentlich ist und was das eigene Leben bedeutet, aber es ist ein guter Weg. Und wenn man bedenkt, wie lächerlich ungeschäftig Kierkegaards Kopenhagen verglichen mit unserem Zeitalter war, dann kommen einem all diese subjektiven Tweets und hastigen Blogposts gar nicht so essayistisch vor. Eher scheinen sie ein Weg zu sein, das zu umgehen, was ein richtiger Essay uns zumuten könnte. Wir verbringen unsere Tage damit, auf dem Bildschirm Zeug zu lesen, das wir in einem Buch nie lesen würden, und schwadronieren darüber, wie geschäftig wir sind.
Zum zweiten Mal mit dem Rauchen aufgehört habe ich 1997. Und dann, 2002, zum letzten Mal. Und dann, 2003, zum allerletzten Mal – es sei denn, Sie zählen das rauchfreie Nikotin mit, das durch meinen Blutkreislauf strömt, während ich das hier schreibe. Der Versuch, einen ehrlichen Essay zu schreiben, ändert nichts an der Vielzahl meiner Ichs; ich bin immer noch gleichzeitig ein Süchtiger mit Reptiliengehirn, ein Bedenkenträger in Sachen Gesundheit, ein ewiger Teenager, ein Depressiver, der sich selbst medikamentiert. Was sich ändert, wenn ich mir die Zeit nehme, innezuhalten, um mir klar über mich zu werden, ist dies: dass meine auf einer Vielzahl von Ichs beruhende Identität Substanz gewinnt.
Es ist eines der Mysterien von Literatur, dass die persönliche Substanz, wie sie Autor und Leser gleichermaßen wahrnehmen, außerhalb ihrer beiden Körper zu finden ist, auf einem Blatt Papier. Wie kann ich mir in etwas, das ich schreibe, wirklicher vorkommen als in meinem Körper? Wie kann ich mich einem anderen Menschen näher fühlen, wenn ich seine Worte lese, als wenn ich neben ihm sitze? Die Antwort lautet zu Teilen, dass sowohl Schreiben als auch Lesen die volle Aufmerksamkeit beanspruchen. Aber sicher hat es auch mit einer bestimmten Art des Ordnens zu tun, wie sie nur auf einem Blatt Papier möglich ist.
Hier könnte ich zwei weitere Dinge nennen, die ich von Henry Finder gelernt habe. Das eine lautete: Jeder Essay, sogar ein Denkstück, erzählt eine Geschichte. Das andere lautete: Es gibt nur zwei Methoden, einen Stoff zu ordnen: «Gleiches zu Gleichem» und «Dies folgte auf jenes». Diese Grundsätze mögen selbstverständlich scheinen, aber jeder, der Highschool- oder College-Essays korrigiert, weiß, dass sie es nicht sind. Für mich war es vor allem nicht selbstverständlich, dass ein Denkstück den Regeln des Dramas folgen sollte. Andererseits: Beginnt eine gute Diskussion nicht mit der Exposition eines Problems? Und folgt darauf nicht eine kühne These, wie man es löst, werden nicht Hindernisse in Form von Einwänden und Gegenargumenten aufgebaut, bis wir schließlich, nach einer Reihe von Rückschlägen, zu einem ungeahnten und befriedigenden Ergebnis kommen?
Wenn Sie Henrys Grundsatz zustimmen, dass ein gelungenes Stück Prosa einen Stoff haben sollte, den man in Form einer Geschichte arrangiert hat, und wenn Sie meine Überzeugung teilen, dass unsere Identität aus den Geschichten gemacht ist, die wir über uns erzählen, dann ist es nur logisch, dass wir aus der Mühe des Schreibens und dem Vergnügen des Lesens eine ordentliche Ladung Substanz gewinnen. Wenn ich allein im Wald bin oder zusammen mit einem Freund zu Abend esse, werde ich von der Vielzahl zufälliger Sinneseindrücke, die auf mich einwirken, überwältigt. Der Akt des Schreibens subtrahiert beinahe alles, lässt nur das Alphabet und die Satzzeichen übrig und nähert sich der Nichtzufälligkeit. Manchmal, wenn man die Bestandteile einer bekannten Geschichte ordnet, findet man heraus, dass sie nicht das bedeutet, was man gedacht hat. Manchmal, insbesondere wenn es ums Argumentieren geht («Dies folgt aus jenem»), muss man erzählerisch neu ansetzen. Bei dem Versuch, eine überzeugende Geschichte zu gestalten, können sich Gedanken und Gefühle herauskristallisieren, von denen man nur vage wusste, dass man sie überhaupt hatte.
Falls man eine Menge Stoff vor sich hat, der sich nicht für eine Erzählung anzubieten scheint, dann, würde Henry sagen, bleibt einem nur, verschiedene Kategorien zu bilden, indem man Ähnliches zusammenfasst: Gleiches zu Gleichem. Das ist immerhin schon mal eine aufgeräumte Art zu schreiben. Aber auch Muster können sich in Geschichten verwandeln. Um Donald Trumps Sieg bei einer Wahl zu erklären, von der weithin vermutet worden war, er werde sie verlieren, liegt es nahe, eine Dies-folgte-auf-jenes-Geschichte zu erzählen: Hillary Clinton war leichtfertig im Umgang mit ihren E-Mails, das Justizministerium entschied sich gegen eine strafrechtliche Verfolgung, dann kamen Anthony Weiners E-Mails ans Licht, dann behauptete James Comey vor dem Kongress, Clinton stecke möglicherwiese noch immer in Schwierigkeiten, und dann gewann Trump die Wahl. Tatsächlich aber könnte es ergiebiger sein, Gleiches zu Gleichem zu sortieren: Trumps Sieg war wie das Brexit-Referendum und wie der auflebende fremdenfeindliche Nationalismus in Europa. Clintons anmaßend schlampiger Umgang mit ihren E-Mails war wie ihr an Botschaften armer Wahlkampf und wie ihre Entscheidung, nicht härter um Michigan und Pennsylvania zu kämpfen.
Ich war am Wahltag in Ghana, zum Vögelbeobachten mit meinem Bruder und zwei Freunden. James Comeys Bericht vor dem Kongress hatte den Wahlkampf erschüttert, bevor ich nach Afrika aufgebrochen war, aber Nate Silvers für Umfragen maßgebliche Website, Fivethirtyeight, bezifferte Trumps Siegchance nach wie vor auf nur dreißig Prozent. Ich hatte frühzeitig meine Stimme für Clinton abgegeben und fürchtete mich, als ich in Accra eintraf, nur mäßig vor dem Wahlergebnis, ja beglückwünschte mich zu meinem Entschluss, die letzte Woche des Wahlkampfs nicht damit zu verbringen, zehnmal am Tag Fivethirtyeight zu checken.
In Ghana gehorchte ich einem anderen Zwang. Zu meiner Schande bin ich, was man in der Welt des Vogelbeobachtens einen «Lister» nennt. Nicht, dass ich Vögel nicht um ihrer selbst willen lieben würde. Ich beobachte Vögel um ihrer Schönheit und Vielfalt willen, um mehr über ihr Verhalten und die Ökosysteme zu erfahren, deren Teil sie sind, und um lange, konzentrierte Wanderungen an neuen Orten zu unternehmen. Aber ich führe auch viel zu viele Listen. Ich zähle nicht nur die Vogelarten, die ich weltweit gesehen habe, sondern auch die, die mir in jedem einzelnen Land und jedem einzelnen amerikanischen Bundesstaat, in dem ich zur Vogelbeobachtung gewesen bin, begegnet sind, außerdem meine Sichtungen an verschiedenen kleineren Orten, etwa in meinem Garten, und die in jedem Kalenderjahr seit 2003. Ich könnte mein zwanghaftes Zählen zum kleinen Nebenschauplatz meiner Leidenschaft erklären. Aber ich bin wirklich zwanghaft. Vogelbeobachtern, denen es allein um die Freude geht, bin ich deshalb moralisch unterlegen.
Da traf es sich, dass sich mir mit der Reise nach Ghana die Chance auftat, meinen Vorjahresrekord von 1286 Arten zu brechen. Für das Jahr 2016 hatte ich schon mehr als 800 Arten beisammen, und durch meine Onlinerecherche wusste ich, dass Reisen, die der unseren vergleichbar waren, bis zu 500 Arten erbracht hatten, von denen nur eine Handvoll in Amerika verbreitet sind. Wenn es mir also gelingen sollte, in Afrika 460 Arten zum ersten Mal in diesem Jahr zu sehen, und ich dann meinen siebenstündigen Zwischenstopp in London nutzen würde, um in einem Park in der Nähe von Heathrow zwanzig leicht zu sichtende europäische Arten «mitzunehmen», würde 2016 mein bestes Jahr überhaupt werden.
Wir sahen Großartiges in Ghana, spektakuläre Turakos und Bienenfresser, die es nur in Westafrika gibt. Aber die wenigen erhaltenen Wälder des Landes stehen aufgrund von Jagd und Forstwirtschaft unter massivem Druck, und unsere Wanderungen darin waren eher drückend heiß als ertragreich. Bis zum Wahlabend hatten wir bereits unsere einzige Chance auf gleich mehrere meiner Zielarten verpasst. Sehr früh am nächsten Morgen, während die Wahllokale an der Westküste der Vereinigten Staaten noch geöffnet waren, schaltete ich mein Telefon an, um mich an Clintons Sieg zu freuen. Stattdessen stieß ich auf waidwunde SMS-Nachrichten von meinen Freunden in Kalifornien, ergänzt um Fotos, auf denen sie übellaunig auf einen Fernseher starrten – meine Freundin lag, eingerollt wie ein Embryo, auf dem Sofa. Die Schlagzeile der Times lautete in diesem Augenblick: «Trump siegt in North Carolina und gewinnt an Boden; Clintons Weg zum Erfolg ist schmal.»
Außer Vögel beobachten zu gehen blieb nichts zu tun. Auf der Straße in den Nsuta Forest, Holztransportern ausweichend, deren Bodengewinne mich an die von Trump denken ließen, und im festen Glauben, dass es für Clinton noch immer einen Weg zum Erfolg gebe, sah ich Hartlaub-Tokos, einen Kuckucksweih und einen Düsterspecht. Es war ein schweißtreibender, aber befriedigender Vormittag, der, sobald wir wieder Netz hatten, mit der Nachricht endete, dass der «kurzfingrige Protz» (diesen denkwürdigen Beinamen hatte ihm die Zeitschrift Spy verpasst) der neue Präsident meines Landes sei. In diesem Augenblick begriff ich, was ich im Stillen aus Nate Silvers dreißig Prozent für Trump gemacht hatte. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass diese Zahl im schlimmsten Fall bedeutete, die Welt könnte nach der Wahl um dreißig Prozent beschissener sein. Was die Zahl tatsächlich besagte, war natürlich eine dreißigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Welt um hundert Prozent beschissener sein würde.
Als wir in den trockeneren, weniger bevölkerten Norden Ghanas unterwegs waren, stießen wir auf einige Vögel, die zu sehen ich mir schon lange erträumt hatte: Krokodilwächter, Karminspinte und eine männliche Fahnennachtschwalbe, die mit ihren unglaublichen Handschwingen aussah, als würde sie von zwei Fledermäusen verfolgt. Doch wir fielen immer weiter hinter das Jahreslistentempo zurück, das ich halten musste. Zu spät dämmerte mir, dass die Listen, die ich online gesehen hatte, auch Arten aufführten, die man nur hörte, aber nicht sah, wohingegen ich einen Vogel sehen musste, um ihn zählen zu können. Wie Nate Silver hatten diese Listen meine Hoffnungen geschürt. Jetzt erhöhte jede Zielart, die ich verpasste, den Druck, jede der noch übrigen zu sehen, sogar die ganz und gar unwahrscheinlichen, wollte ich meinen Rekord noch brechen. Es war nur eine blöde Jahresliste, die am Ende sogar mir nichts bedeutete, doch die Schlagzeile vom Morgen nach der Wahl verfolgte mich. Statt 275 Wahlmänner brauchte ich 460 Arten, und mein Weg zum Erfolg wurde sehr schmal. Schließlich, vier Tage vor dem Ende der Reise, am Überlaufkanal eines Damms in der Nähe der Grenze zu Burkina Faso, wo ich auf ein halbes Dutzend neuer Savannen-Vögel gehofft hatte und keinen einzigen sah, musste ich die Niederlage akzeptieren. Auf einmal wurde mir klar, dass mein Platz zu Hause gewesen wäre, wo ich hätte versuchen sollen, meine Freundin über das Wahlergebnis hinwegzutrösten und den einen Vorteil auszuspielen, den ein depressiver Pessimist hat – die Bereitschaft, in finsteren Zeiten zu lachen.
Wie hatte es der kurzfingrige Protz ins Weiße Haus geschafft? Als Hillary Clinton wieder in der Öffentlichkeit erschien, gab sie, indem sie ein Dies-folgte-auf-jenes-Narrativ bemühte, der Gleiches-zu-Gleichem-Darstellung ihres Charakters neue Nahrung. Halb so wild, dass sie mit ihren E-Mails leichtfertig umgegangen war und von einem «Korb der Erbärmlichen» gesprochen hatte. Halb so wild, dass die Wähler womöglich einen legitimen Groll gegen die liberale Elite gehegt hatten, die Clinton repräsentierte; dass sie womöglich einfach nicht eingesehen hatten, dass Freihandel, offene Grenzen und industrielle Automatisierung vernünftig waren, wenn der allgemeine Zuwachs an globalem Reichtum doch auf Kosten der Mittelklasse ging; dass sie es womöglich übel genommen hatten, dass liberale urbane Werte konservativen ländlichen Gemeinden staatlich verordnet werden sollten. Ging es nach Clinton, war James Comey an ihrer Niederlage schuld – neben den Russen vielleicht.
Zugegeben, ich hatte mein eigenes hübsches Narrativ. Als ich aus Afrika nach Santa Cruz zurückkehrte, bemühten sich meine progressiven Freunde immer noch zu verstehen, warum Trump gewonnen hatte. Ich erinnerte mich an einen gemeinsamen Auftritt mit dem optimistischen Social-Media-Experten Clay Shirky, der dem Publikum erzählt hatte, wie «geschockt» New Yorks professionelle Restaurantkritiker gewesen seien, als Zagat, ein nutzerbasiertes Bewertungssystem, das Union Square Café zum besten Restaurant der Stadt gekürt habe. Shirky wollte darauf hinaus, dass professionelle Kritiker sich für cleverer hielten, als sie waren; dass Kritiker im Zeitalter von Big Data tatsächlich überhaupt nicht mehr gebraucht würden. Während der Veranstaltung hatte ich mich angesäuert gefragt, ob Shirky auch glaube, dass es die Dummheit von Kritikern beweise, wenn sie Alice Munro für eine bessere Schriftstellerin als James Patterson hielten, wobei ich geflissentlich ignorierte, dass das Union Square Café auch mein New Yorker Lieblingsrestaurant war (die Crowd lag also richtig!). Doch jetzt hatte auch Trumps Sieg Shirkys Expertenverhöhnung recht gegeben. Mit Hilfe der sozialen Medien hatte Trump das kritische Establishment umgangen, und in den Swing States, die eine Schlüsselrolle spielten, waren gerade genug Crowd-Mitglieder der Meinung gewesen, sein billiges Komödiantentum und seine hetzerische Sprache seien «besser» als Clintons differenzierte Argumente und ihre politische Erfahrung. Dies folgt aus jenem: ohne Twitter und Facebook kein Trump.
Nach der Wahl schien Mark Zuckerberg kurzzeitig irgendwie Verantwortung dafür zu übernehmen, die maßgebliche Plattform für Fake News über Clinton geschaffen zu haben, und er deutete an, Facebook werde beim Filtern von Nachrichten aktiver werden. (Viel Erfolg dabei.) Twitter seinerseits zog den Kopf ein. Da Trump unvermindert weitertwitterte – was konnte Twitter da schon sagen? Dass es die Welt zu einem besseren Ort mache?
Im Dezember begann mein Lieblingsradiosender in Santa Cruz, KPIG, Fake-Werbespots mit Beratungsangeboten für Menschen zu senden, die nach Anti-Trump-Tweets und Anti-Trump-Facebookposts süchtig waren. Im Monat darauf, eine Woche vor Trumps Amtseinführung, organisierte das amerikanische PEN-Zentrum im ganzen Land Veranstaltungen gegen den Angriff auf die Meinungsfreiheit, für den Trump, so wurde behauptet, stehe. Auch wenn die Reisebeschränkungen seiner Regierung es Autoren aus muslimischen Ländern später sehr wohl schwerer machten, sich in den Vereinigten Staaten Gehör zu verschaffen, war die eine schlechte Sache, die sich von Trump, in jenem Januar, nicht behaupten ließ, dass er in irgendeiner Weise die freie Rede beschnitten habe. Seine verlogenen, rüpelhaften Tweets waren freie Rede auf Steroiden. Der PEN wiederum hatte nur ein paar Jahre zuvor an Twitter einen Preis für Meinungsfreiheit verliehen, und zwar für dessen selbstpropagierte Rolle im Arabischen Frühling. Das eigentliche Ergebnis des Arabischen Frühlings war eine Konsolidierung der Autokratie, und Twitter hat sich seitdem, in Trumps Händen, als Plattform erwiesen, die für Autokraten wie geschaffen ist, doch damit enden die Ironien noch nicht. In derselben Januarwoche schlugen progressive Buchhandlungen und Autoren in Amerika vor, den Verlag Simon & Schuster zu boykottieren, weil der sich des Verbrechens schuldig gemacht hatte, ein Buch des jämmerlichen Rechtsaußen-Provokateurs Milo Yiannopoulos veröffentlichen zu wollen. Die wütendsten Buchhandlungen sprachen davon, alle Titel von S&S aus ihren Regalen zu verbannen, einschließlich, wie zu vermuten ist, die des PEN-Präsidenten Andrew Solomon. Das hörte nicht auf, bis S&S den Vertrag mit Yiannopoulos auflöste.
Trump und seine Unterstützer vom äußersten Rand der politischen Rechten machen sich ein Vergnügen daraus, bei den politisch Korrekten die richtigen Knöpfe zu drücken, aber das funktioniert auch nur, weil diese Knöpfe zum Drücken da sind – Studenten und Aktivisten nehmen für sich das Recht in Anspruch, nicht hören zu müssen, was sie ärgert, und Vorstellungen niederzubrüllen, die sie verletzen. Die Intoleranz gedeiht vor allem im Netz, wo eine maßvolle Sprache dadurch bestraft wird, dass sie keine Klicks bekommt, und unsichtbare Facebook- und Google-Algorithmen einen zu Inhalten lotsen, mit denen man übereinstimmt, und abweichende Stimmen vor lauter Angst, gebasht oder getrollt oder entfreundet zu werden, schweigen. Das Ergebnis ist ein System, in dem man, auf welcher Seite auch immer, glaubt, unbedingt richtigzuliegen, wenn man hasst, was man hasst. Und das ist ein weiterer Punkt, in dem sich der Essay von auf den ersten Blick ähnlichen Formen subjektiven Sprechens unterscheidet. Der Essay wurzelt in der Literatur, und im Idealfall – im Werk Alice Munros zum Beispiel – lädt Literatur dazu ein, sich zu fragen, ob man selbst vielleicht ein bisschen oder sogar vollkommen falschliegt, und sich vor Augen zu führen, warum jemand anders einen wohl hassen könnte.
Vor drei Jahren hat mich der Klimawandel in Rage gebracht. Die Republikanische Partei verbreitete weiterhin die Lüge, dass es in der Wissenschaft keinen Klimakonsens gebe – Floridas Umweltschutzbehörde war sogar so weit gegangen, ihren Mitarbeitern zu untersagen, im Schriftverkehr das Wort «Klimawandel» zu verwenden, nachdem der Gouverneur von Florida, ein Republikaner, darauf beharrt hatte, er sei keine «echte Tatsache» –, aber ich war nicht weniger wütend auf die Linke. Ich hatte ein neues Buch von Naomi Klein gelesen, Die Entscheidung, in dem sie dem Leser versicherte, dass, obwohl «die Zeit knapp» sei, wir noch zehn Jahre hätten, um die Weltwirtschaft radikal umzubauen und zu verhindern, dass die globale Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als zwei Grad steige. Ihre Zuversicht war rührend, hatte aber auch etwas von Leugnung an sich. Selbst vor der Wahl von Donald Trump gab es keinerlei Anzeichen, die darauf hingedeutet hätten, dass die Menschheit – politisch, psychologisch, ethisch, ökonomisch – in der Lage war, die Entscheidung zu treffen und ihre CO2-Emissionen schnell und ausreichend zu senken. Sogar die Europäische Union, die in der Klimafrage früh die Führungsrolle übernommen hatte und andere Regionen gern über deren Verantwortungslosigkeit belehrte, brauchte 2009 nur eine Rezession, um den Schwerpunkt auf das Wirtschaftswachstum zu verlagern. Ohne ein weltweites Aufbegehren gegen den Kapitalismus der freien Märkte in den nächsten zehn Jahren – das Szenario, das uns Klein zufolge noch retten könnte – wird der wahrscheinlichste Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert um die sechs Grad betragen. Wir hätten Glück, sollte es uns gelingen, einen Zwei-Grad-Anstieg vor dem Jahr 2030 zu verhindern.
In einer immer krasser gespaltenen Gesellschaft war die Wahrheit über die Erderwärmung für die Linke sogar noch unliebsamer als für die Rechte. Die Leugnungen der Rechten waren unverhohlene Lügen, aber wenigstens standen sie im Einklang mit einem gewissen kaltblütigen politischen Realismus. Die Linke, die die Rechte für ihre intellektuelle Unredlichkeit verurteilt und den Vorwurf der Klimawandelleugnung in einen politischen Schlachtruf umgemünzt hatte, war jetzt in einer unmöglichen Position. Sie hatte auf der Wahrheit der Klimaforschung zu bestehen, während sie an der Fiktion festhielt, dass eine kollektive Anstrengung der Weltgemeinschaft das Schlimmste noch abwenden könnte: dass die universelle Akzeptanz der Fakten, die 1995 tatsächlich die Entscheidung hätte bringen können, immer noch die Entscheidung bringen würde. Denn welchen Unterschied würde es sonst machen, dass die Republikaner sich mit den Wissenschaftlern weiter stritten?
Weil meine Sympathien bei der Linken lagen – CO2-Emissionen zu senken ist weitaus besser, als nichts zu tun; jedes halbe Grad hilft –, hatte ich auch höhere Ansprüche an sie. Die finstere Realität zu leugnen und so zu tun, als könnte das Pariser Abkommen die Katastrophe abwenden, war als Taktik, um die Menschen zur Senkung von Emissionen zu motivieren und die Hoffnung am Leben zu halten, verständlich. Als Strategie jedoch schadete es mehr, als es nutzte. Man gab die ethische Überlegenheit auf, beleidigte die Intelligenz nicht überzeugter Wähler («Im Ernst? Wir haben noch zehn Jahre?») und verhinderte eine offene Diskussion darüber, wie die Weltgemeinschaft sich auf die drastischen Veränderungen vorbereiten solle und wie Nationen wie Bangladesch zu entschädigen seien für das, was ihnen Nationen wie die Vereinigten Staaten angetan hatten.
Unehrlichkeit verkehrt außerdem Prioritäten. In den vergangenen zwanzig Jahren war die Umweltbewegung zur Gefangenen eines einzigen Themas geworden. Teils aus aufrichtiger Besorgnis, teils weil es politisch weniger riskant – weniger elitär – ist, menschliche Probleme in den Vordergrund zu rücken, als über die Belange der Natur zu sprechen, hatten die großen Umwelt-NGOs ihr gesamtes politisches Kapital in den Kampf gegen den Klimawandel investiert, ein Problem mit menschlichem Gesicht. Die NGO, die mich, als Vogelfreund, ganz besonders in Rage brachte, war die National Audubon Society, einst ein kompromissloser Anwalt der Vögel, jetzt eine lethargische Institution mit sehr großer PR-Abteilung. Im September 2014 hatte diese PR-Abteilung der Welt unter Fanfarenklängen mitgeteilt, dass der Klimawandel die größte Gefahr für die Vögel Nordamerikas sei. Die Erklärung war beides: unehrlich im Kleinen, weil ihre Formulierung nicht mit den Schlussfolgerungen der für Audubon tätigen Wissenschaftler übereinstimmte, und unehrlich im Großen, weil kein einziger Vogeltod unmittelbar auf menschlichen CO2-Ausstoß zurückgeführt werden konnte. Die größten Gefahren für amerikanische Vögel waren 2014 der Verlust ihres Habitats und frei herumlaufende Katzen. Weil es das Reizwort Klimawandel aufrief, bekam Audubon viel Aufmerksamkeit in den liberalen Medien; schon hatte man einen weiteren Punkt gemacht gegen die Tatsachen leugnende Rechte. Doch es war überhaupt nicht klar, inwieweit das den Vögeln half. Der einzige praktische Effekt von Audubons Erklärung, so schien es mir, bestand darin, Menschen im Kampf gegen die realen Gefahren, denen die Natur gegenwärtig ausgesetzt ist, zu entmutigen.
Ich war so wütend, dass ich beschloss, einen Essay zu schreiben. Ich begann mit einer Jeremiade gegen die National Audubon Society, weitete das aus zu einer verächtlichen Anklage der Umweltbewegung im Allgemeinen, und auf einmal fing ich an, mitten in der Nacht aufzuwachen, panisch vor Zweifel und Reue. Für einen Schriftsteller ist der Essay ein Spiegel, und mir gefiel nicht, was ich in diesem sah. Warum machte ich andere Liberale runter, wenn die Leugner doch so viel schlimmer waren? Der Klimawandel setzte mir genauso zu wie den Gruppierungen, die ich attackierte. Mit jedem zusätzlichen Grad Erderwärmung würden weitere Hunderte Millionen Menschen leiden. Lohnte es da nicht, aufs Ganze zu gehen, um wenigstens eine Verringerung von nur einem halben Grad zu erreichen? War es nicht obszön, über Vögel zu reden, wenn Kindern in Bangladesch Gefahr drohte? Ja, die Prämisse meines Essays lautete, dass wir eine moralische Verantwortung haben – sowohl für andere Arten als auch für unsere. Aber was, wenn diese Prämisse falsch war? Und, selbst wenn sie stimmte, lag mir wirklich etwas an Biodiversität? Oder war ich bloß ein privilegierter weißer Mann, der gerne Vögel beobachtete? Und nicht mal einer, der das mit reinem Herzen tat, sondern ein Lister!
Nach drei Nächten des Zweifelns – an meinem Charakter, meinen Motiven – rief ich Henry Finder an und erklärte ihm, ich könne das Stück nicht schreiben. Ich hatte unter Freunden und gleichgesinnten Umweltschützern reichlich über Klimafragen geschimpft, aber das hatte jedes Mal dem Geschimpfe im Netz geähnelt, wo einen der Stegreifcharakter des Geschriebenen, aber auch das Wissen um die freundschaftliche Verbundenheit der Leserschaft schützt. Der Versuch, etwas Ausgearbeitetes zu schreiben, einen Essay, hatte mir die Schlampigkeit meines Denkens bewusst gemacht. Auch das Schamrisiko war enorm gestiegen, zumal der Text nicht beiläufig entstanden war und die Leserschaft wahrscheinlich aus feindseligen Fremden bestand. Eingedenk Henrys Ermahnung («deshalb»), hatte ich den Essayisten zunehmend als Feuerwehrmann begriffen, dessen Aufgabe es ist, direkt in die Flammen der Schande hineinzulaufen, wenn alle anderen vor ihnen fliehen. Aber diesmal hatte ich mehr zu fürchten als die Missbilligung meiner Mutter.
Vielleicht hätte ich den Essay liegen gelassen, wenn ich nicht bereits ein Feld auf Audubons Internetseite angeklickt und damit zugestimmt hätte, dass ich, ja, beim Kampf gegen den Klimawandel mitwirken wolle. Ich hatte das nur getan, um rhetorische Munition zu sammeln, die ich gegen Audubon verwenden wollte, aber dieser Klick hatte eine Flut von Direktwerbungen nach sich gezogen. Ich bekam binnen sechs Wochen mindestens acht, die mich allesamt um Spenden baten, dazu eine vergleichbare Flut in meinem E-Mail-Postfach. Ein paar Tage nach meinem Gespräch mit Henry öffnete ich eine der E-Mails und erwischte mich beim Betrachten eines Fotos von mir selbst – zum Glück eine schmeichelhafte Aufnahme, entstanden 2010 für die Zeitschrift Vogue, die mich, durch ihr Zutun besser angezogen als sonst, mit meinem Fernglas auf einem Feld platziert hatte – wie einen Vogelbeobachter. Die Betreffzeile der E-Mail lautete in etwa: «Machen Sie es wie der Schriftsteller Jonathan Franzen und unterstützen Sie Audubon.» Es stimmte schon: Ein paar Jahre zuvor hatte ich in einem Interview mit der Zeitschrift Audubon die Organisation höflich gelobt oder doch wenigstens ihre Zeitschrift. Aber niemand hatte mich um Erlaubnis gefragt, meinen Namen und das Foto von mir zu Werbezwecken zu verwenden. Ich war mir nicht einmal sicher, ob die E-Mail rechtens war.
Ein wohlmeinenderer Impuls, mich wieder an den Essay zu setzen, kam von Henry. Soweit ich weiß, sind Vögel Henry völlig egal, aber an meiner These, dass die Beschäftigung mit den Katastrophen der Zukunft uns hindert, lösbare Umweltprobleme im Hier und Jetzt anzugehen, schien er etwas zu finden. In einer E-Mail schlug er behutsam vor, ich möge den Ton prophetischen Zorns aufgeben. «Das Stück wird ironischerweise überzeugender», schrieb er in einer weiteren, «wenn es ambivalenter, weniger polemisch ist. Du willst doch nicht auf Leute eindreschen, die unsere Aufmerksamkeit auf den Klimawandel und die Notwendigkeit geringerer Emissionen richten wollen. Sondern du sorgst dich um den Preis. Um das, was der Diskurs an den Rand drängt.» E-Mail für E-Mail, Überarbeitung für Überarbeitung, stupste mich Henry dahin, den Essay nicht als Anklage, sondern als Frage zu formulieren: Wie finden wir einen Sinn in dem, was wir tun, wenn die Welt an ein Ende zu kommen scheint? Große Teile der letzten Fassung handelten von zwei gut durchdachten Umweltschutzprojekten in Peru und Costa Rica, wo man die Welt wirklich zu einem besseren Ort macht, nicht nur für wilde Pflanzen und wilde Tiere, sondern auch für die Peruaner und Costa Ricaner, die dort leben. An diesen Projekten mitzuarbeiten ist sinnstiftend, und die Ergebnisse sind unmittelbar und konkret.
Indem ich über die beiden Projekte schrieb, hoffte ich, ein oder zwei der großen Stiftungen, die zig Millionen Dollar für die Entwicklung von Biodiesel oder Windfarmen in Eritrea ausgeben, würden das Stück vielleicht lesen und darüber nachdenken, in Arbeit zu investieren, die konkrete Erfolge zeitigt. Was ich stattdessen auslöste, war ein Raketenangriff aus dem liberalen Lager. Ich bin nicht in sozialen Netzwerken unterwegs, aber meine Freunde berichteten mir, ich würde als alles Mögliche beschimpft, etwa als «Spatzenhirn» und «Klimawandelleugner». Tweet-lange Auszüge aus meinem Essay, aus dem Kontext gerissen und retweeted, erweckten den Anschein, ich hätte vorgeschlagen, die Reduzierung von Treibhausgasen aufzugeben