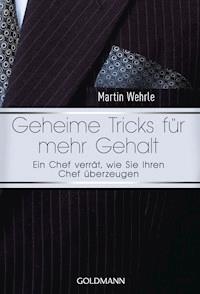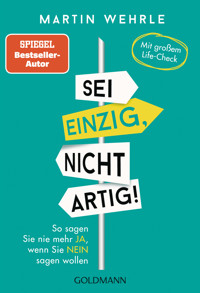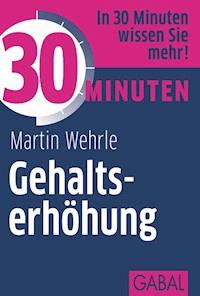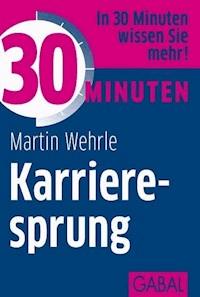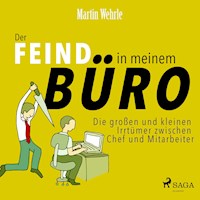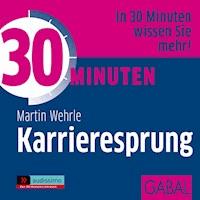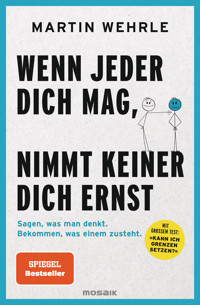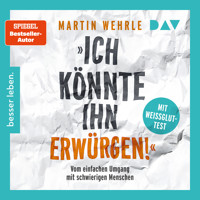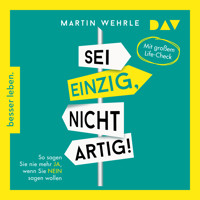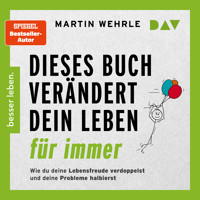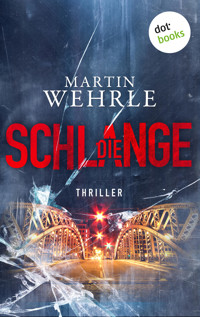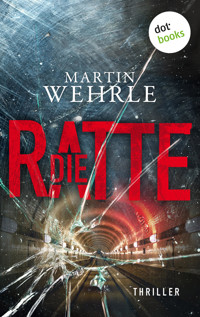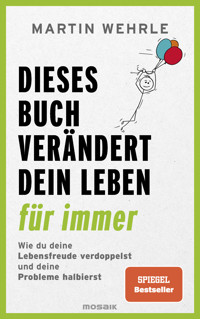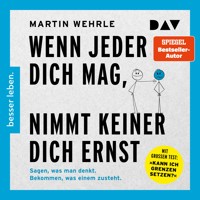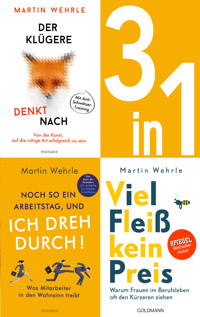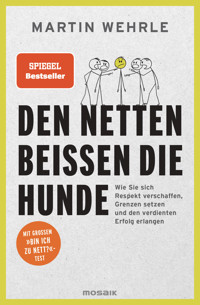Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
Hufe klappern in der Nacht, ein Bote reitet vor. Schöne Grüße vom Coach bestellt er - und übermittelt dem Klienten drei Fragen für den nächsten Coaching-Termin. Jedes Coaching kann ein unvergessliches Erlebnis sein, eine Spielwiese für Gedanken, ein Abenteuer für den Geist. Wenn es Ihnen als Coach gelingt, dass die Kognitionen Ihrer Klienten über die gängigen Ufer ihres Denkens schwappen, dann gelingen durchschlagende Coaching-Erfolge. Kreative Methoden erfordern Handwerk. Sie müssen wissen, wie Sie Rollenspiele einfädeln, Gedankenreisen anleiten und Menschen für ungewöhnliche Methoden gewinnen. Karrierecoach Martin Wehrle empfiehlt Ihnen 35 davon, außerdem stellt er Ihnen zehn ungewöhnliche Coaching-Orte vor und erläutert, wie Sie dort arbeiten. Und Sie erfahren, wie Sie sich als Coach auf kreative Weise als Experte ins Rampenlicht rücken.
Beim Coaching ist es wie in der Kunst: U (Unterhaltung) und E (Ernsthaftes) lassen sich nicht sauber trennen. Im Gegenteil, jeder Literaturfreund weiß: Große Romane sind immer auch unterhaltsame Romane. Inhaltliche Tiefe schließt unterhaltsame Form nicht aus, sondern erfordert sie geradezu. Das gilt ebenso im Coaching: Ernste Themen lassen sich am besten auf unterhaltsame Weise bearbeiten. Spielerische Mondfahrten des Geistes sind höchst seriöse Arbeit. Nur dürfen sie sich nicht wie Arbeit anfühlen. Nicht für Ihren Klienten! Aus der Kreativitätsforschung ist bekannt, dass die originellsten Gedanken nicht kommen, wenn man nach ihnen sucht; sie blitzen auf in unerwarteten Momenten: wenn man am Strand döst, durch einen Wald joggt oder nachts über eine leere Autobahn fährt. Oft gehen wir mit einem Problem ins Bett – und wachen mit einer Lösung auf. Das Gehirn will nur (unbewusst) mit den richtigen Fragen gefüttert sein – dann arbeitetet es wie von alleine. Haben Sie den Mut, Ihre Klienten ins Disneyland der Kreativität einzuladen! Schlagen Sie Methoden vor, die so ungewöhnlich sind, dass sie auch ungewöhnliche Gedanke erzeugen; Methoden, die so spielerisch sind, dass sie auch ein Spiel mit der Lösung erlauben. Je kreativer Sie ans Werk gehen, desto mehr Kreativität wird sich im Verhalten Ihrer Klienten spiegeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Du siehst Dinge und fragst ‚Warum?‘, doch ich träume von Dingen und sage ‚Warum nicht?‘“
– George Bernard Shaw –
Martin Wehrle
Die 50 kreativsten Coaching-Ideen
Das große Workbook für Einsteiger und Profis zur Entwicklung der eigenen Coaching-Fähigkeiten
managerSeminare Verlags GmbH, Edition Training aktuell
Martin Wehrle
Die 50 kreativsten Coaching-Ideen
Das große Workbook für Einsteiger und Profis zur Entwicklung der eigenen Coaching-Fähigkeiten
© 2014 managerSeminare Verlags GmbH
3. Aufl. 2023
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-97791-0, Fax: 0228-616164
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
ISBN: 978-3-98856-147-3
Lektorat: Ralf Muskatewitz
Cover: Tetastock/Fotolia
Zeichnungen: Birte Schröder
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung: „Was fällt Ihnen ein, Coach?“
Teil 1: Kreativ coachen – so geht‘s!
1. Guter Start: „Worum geht es Ihnen?“
1. Das Themen-Kartenspiel
2. Der reitende Web-Bote
3. Ernten im Bildergarten
4. Angeln im Wunschteich
5. Der abgesagte Coaching-Termin
6. Die Theaterbühne
2. Selbstklärung: „Wer sind Sie eigentlich?“
7. Der Starverteidiger vor Gericht
8. Die Kontaktanzeige
9. Der Gebärden-Dolmetscher
10. Hallo, ich bin dein Problem!
11. Der Traumdeuter
12. Hand in Hand mit Widerstand
3. Formbare Wirklichkeit: „Wie nehmen Sie wahr?“
13. Lobrede auf das Problem
14. Zwei Personaler im Gespräch
15. Der Lebens-Tacho
16. Vom Opferlamm zur Feldherrin
17. Die Zeitmaschine
18. Auf dem Stuhl des Konfliktgegners
4. Ziel im Visier: „Wohin wollen Sie?“
19. Show-Time: „Wetten, dass …?“
20. Die Zielscheibe
21. Die Lehrplan-Kommission
22. Der künftige Lebenslauf
23. Der 100-Meter-Lauf
24. Hallo, ich bin deine Lösung
25. Auf zur Fantasiereise!
5. Blick aufs Rüstzeug: „Was bringen Sie mit?“
26. Ich lade dich ein, Eigenschaft!
27. Märchen-Coaching
28. Das Kabarett-Programm
29. Anpfiff zur zweiten Halbzeit
30. Der schönste Kindheitstag
31. Die Plus-Lupe im Lebenshaus
6. Praxistransfer: „So schaffen Sie es!“
32. Das Floß im wilden Fluss
33. Das HMW-Sofortprogramm
34. Das Coaching ohne Coach
35. Der Selbst-Vertrag
Teil 2: Neue Coaching-Orte und Marketing-Ideen
1. Coaching-Orte: „Neuland wirkt Wunder!“
36. Sportlich entwickeln: Beim Joggen
37. Sehenswürdig: Die Stadtführung
38. Kurz vorm Abheben: Auf dem Flughafen
39. Natürlich erfolgreich: Beim Waldspaziergang
40. Aber bitte mit Sahne: Im Café
41. Karussell & Co.: Auf dem Jahrmarkt
42. Ein feiner Zug: Mit dem ICE zum Ziel
43. Lust auf Literatur: Spaziergang mit Goethe
44. Mit Löwenmut: Unterwegs im Zoo
45. Sandkasten frei: Auf dem Spielplatz
2. Marketing-Ideen: „Mit Fantasie im Geschäft!“
46. Experte gefragt: Wie Sie als Coach die Nummer eins werden
47. Das große Los: Der Weg auf die Titelseite
48. Aufhänger gesucht: Wie Sie als Experte ins Rampenlicht rücken
49. Pfiffiger Vortrag: Die Rede über das Coaching
50. Erfolgsautor: Die klügsten Schritte zum eigenen Buch
Weiterführende Literatur
„Was fällt Ihnen ein, Coach?“
Szene 1: Hufe klappern in der Nacht, ein Bote reitet vor. Schöne Grüße vom Coach bestellt er – und übermittelt dem Klienten drei Fragen, um den Coaching-Termin am nächsten Tag vorzubereiten. Das Pferd scharrt mit den Hufen; der Klient hat nur drei Minuten, um zu antworten. Und er kommt auf den Punkt!Szene 2: Die Eurovisions-Musik hebt an, Applaus flutet den Saal, „Wetten, dass …?“ beginnt. Auf dem Wett-Sofa sitzt ein Prominenter, der eine ungewöhnliche Wette formuliert: Er beschreibt bildhaft, was der Klient erreichen will. Und begründet, warum er an ihn glaubt und auf ihn setzt. Top, die Wette gilt!Szene 3: Die Klientin schließt die Augen, lehnt sich an einen seltsamen Apparat, und auf einmal spürt sie einen Sog, der ihre Gedanken mitreißt – von der Gegenwart in die Zukunft. Sie reist in einer Zeitmaschine, besichtigt das Land ihrer Zukunft und kommt mit einem Koffer voller Erkenntnisse zurück.Szene 4: Derselbe Klient, der gerade noch im Würgegriff seines Problems japste, springt als Kabarettist auf eine Bühne. Die bunten Pfeile seines Humors zielen auf sein eigenes Problem und die Art, wie er damit umgeht. Je näher er dem Lachen kommt, desto näher kommt er der Lösung.Szene 5: Die Klientin steht bei der letzten Sitzung vor einem reißenden Fluss, von dem sie weiß, dass sie ihn im Coaching überquert hat. Und nun sammelt sie am Ausgangsufer noch einmal ihre Ressourcen ein, baut daraus ein Floß und sonnt sich dann am Ufer der Lösung. Zugleich fasst sie Vorsätze für den Praxistransfer.Fünf Szenen, eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich um kreative Coaching-Methoden, um Gedanken- und Rollenspiele aus diesem Buch. Mag sein, diese Methoden klingen verspielt und märchenhaft – als wäre das Coaching ein Spielplatz, auf dem sich zwei Erwachsene treffen, um mit dem Sand ihrer Fantasie neue Burgen zu formen. Als wäre das Coaching keine „ernste Angelegenheit“, sondern eine lockere Begegnung, bei der nach Herzenslust gelacht und über die Stränge gedacht werden darf.
Genau so ist es! Gedanken lockern und Ideen locken, das soll ein professionelles Coaching. Das Anliegen, mit dem ein Mensch zu Ihnen kommt, ist ernst genug; Problemgedanken kleben daran wie an einem Fliegenfänger. Nun stellt sich die Gretchenfrage: Gehen Sie mit dem Klienten so an sein Anliegen heran, wie er selbst es schon getan hat: mit dem Brecheisen der Logik, verbissen und ernsthaft? Oder probieren Sie es auf andere Weise: mit dem Sesam-öffne-dich der Kreativität, fantasiereich und humorvoll?
Wer sich für den Weg der nüchternen Ernsthaftigkeit entscheidet, riskiert eine Wiederholungsschleife im Kopf des Klienten, einen Triumphzug des Problems. Wenn der Klient in gleicher Stimmung (also ernst) über die gleichen Fragen (also ernste und konventionelle) nachdenkt wie vor dem Coaching: Warum sollte er dann zu neuen Erkenntnissen kommen? Albert Einstein sagte: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Das gilt auch für das Klima, in dem gedacht wird. Wenn Sie es schaffen, eine spielerische und kreative Atmosphäre herzustellen, wird Ihr Klient neue Ideen anprobieren, als wären es Kleidungsstücke, mit denen er an Karneval experimentiert (denn er weiß, er kann sie wieder abstreifen, es ist nur ein Spiel!). Dann kapituliert sein einschränkendes Eltern-Ich, Bremssätze verstummen, und die Ziel-Einflüsterungen von außen werden durch die treffsichere Stimme der eigenen Intuition abgelöst.
Jedes Coaching kann ein unvergessliches Erlebnis sein, ein Abenteuer für den Geist. Aber noch regieren in den meisten Coachings Nüchternheit und Konvention. Denn muss ein Coaching nicht handwerklichen Ansprüchen genügen? Muss es nicht zählbare Ergebnisse bringen? Und setzt all das nicht eine Seriosität voraus, die durch kindhafte Spielerei gefährdet wird?
Diese Überlegung sieht das Coaching als Wasserlauf mit zwei Ufern, und der Coach muss sich für eines entscheiden. Entweder steht er auf der Seite der Ernsthaftigkeit, seriös und gediegen. Oder er begibt sich an das Ufer der Verspieltheit, kindlich und spontan. Aber was, wenn die Breite des Wasserlaufes es erlaubt, dass Sie gleichzeitig an jedes Ufer einen Fuß setzen? Was, wenn es Ihnen gelingt, spielerisch und ernsthaft zugleich zu sein? Spielerisch, um den Klienten aufzulockern und neue Gedanken in seinem Kopf zu wecken; und ernsthaft, um den Coaching-Prozess zu verantworten und Verbindlichkeit für den Praxistransfer herzustellen? Dann können Sie perfekt coachen!
Beim Coaching ist es wie in der Kunst: U (Unterhaltung) und E (Ernsthaftes) lassen sich nicht sauber trennen. Im Gegenteil, jeder Literaturfreund weiß: Große Romane sind immer auch unterhaltsame Romane. Inhaltliche Tiefe erfordert unterhaltsame Form, um Menschen zu erreichen. Das gilt ebenso im Coaching. Spielerische Mondfahrten des Geistes sind seriöse Arbeit. Aber sie dürfen sich nicht wie Arbeit anfühlen. Nicht für Ihren Klienten!
Nur wenn es Ihnen gelingt, dass ein Mensch sein Gehirn in den Alphazustand schaltet, dass seine Kognitionen über die gängigen Ufer seines Denkens schwappen – nur dann gelingen durchschlagende Erfolge. Die Kreativitätsforschung weiß, dass die originellsten Gedanken nicht kommen, wenn man sie sucht, sondern in unerwarteten Momenten: wenn man am Strand döst, durch einen Wald joggt oder nachts über eine leere Autobahn fährt. Oft gehen wir mit einem Problem ins Bett – und wachen mit einer Lösung auf. Das Gehirn will nur (unbewusst) mit den richtigen Fragen gefüttert sein – dann arbeitet es wie von alleine. Dagegen verschließt es sich, wenn der Druck zu hoch wird.
Kreative Methoden erfordern handwerkliches Können: Als Coach müssen Sie wissen, wie Sie Rollenspiele einfädeln, Gedankenreisen anleiten und Menschen für ungewöhnliche Methoden gewinnen. Ihr Klient darf sich nicht wie ein Versuchskaninchen vorkommen – weshalb Sie ihn auch nie zu einem „Experiment“ einladen, sondern ihm ein „Gedankenspiel“ in Aussicht stellen sollten. Vor allem muss er wissen, worauf er sich einlässt. Wenn ihm klar ist, welchen Zweck eine Methode verfolgt, wird er seinen Geist unbewusst aufs Ziel programmieren. Dann kommt der Fluss zwischen den beiden Coaching-Ufern, dann kommen seine Gedanken ins Fließen.
Je kreativer Sie ans Werk gehen, desto mehr Kreativität wird sich im Verhalten Ihrer Klienten spiegeln. Die 35 Coaching-Methoden dieses Buches, vom „Angeln im Wunschteich“ bis zum „Märchen-Coaching“, regen Sie an, das wichtigste aller Coaching-Tools zu nutzen: die Fantasie. Jede Methode beschreibe ich an einem realen Fall (mit veränderten Namen), damit Sie verfolgen können, wie man das Tool auf ein Anliegen abstimmt und mit Erfolg einsetzt. Bitte verstehen Sie meine Beschreibungen als Vorlage für Ihre Kreativität, als Einladung, die Methoden für sich selbst maßzuschneidern.
Doch nicht nur das Wie, auch das Wo entscheidet über den Erfolg: Unkonventionelle Coachings sollten nicht nur an konventionellen Orten stattfinden. Es gibt viele Alternativen zu Büros und Konferenzräumen: Wie wäre es, wenn Sie mit Ihrem Klienten mal an einen Flughafen gingen, um seine Gedanken abheben zu lassen? Wenn Sie mit ihm zum Joggen gingen, um die Kreativität auf Trab zu bringen; in einen Wald, um ihn nach seinen Wurzeln suchen zu lassen; auf den Jahrmarkt, wo er vom Riesenrad auf sein Leben blickt; oder auf einen Spielplatz, wo er Lösungen mit derselben Leichtigkeit formen kann, wie die Kinder ihre Burgen aus Sand?
Beachten Sie die systemische Wechselwirkung zwischen Ort und Mensch: Wer die Umgebung wechselt, wechselt auch die Gedanken. Niemand bringt es fertig, von einem Berggipfel in die aufgehende Sonne zu blicken und dabei genauso kleinkariert zu denken, wie er es vielleicht in seinem Büro aus schlechter Gewohnheit tut (oder liegt es an den klein karierten Tapeten dort?).
Darum stelle ich Ihnen im zweiten Teil des Buches zehn alternative Coaching-Orte vor und erkläre im Detail, wie Sie dort arbeiten, den Ort als Metapher nutzen und Ihrem Klienten reale (Impact-)Erlebnisse verschaffen können.
Den Abschluss des Buches bildet ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: Tausende von Coachs führen ein Geschäft, ohne wirklich im Geschäft zu sein. Mit verwechselbaren Angeboten gehen sie an den Markt – und wundern sich, dass die Klienten immer nur bei den Etablierten anklopfen. Von den Teilnehmern meines Ausbildungsgangs zum Karrierecoach weiß ich: Wer eine Coaching-Ausbildung absolviert, will danach mit Klienten arbeiten – so wie ein Musiker, der ein Instrument perfekt beherrscht, eines Tages vom stillen Kämmerlein auf die Bühne vors Publikum treten möchte.
Im Abschlusskapitel erfahren Sie, wie Sie sich als Coach auf kreative Weise ein Spezialthema erschließen, damit Schlagzeilen machen und zur Nummer eins in Ihrem Markt aufsteigen. Dabei werde ich Ihnen auch meine Geschichte erzählen. Denn damals, als ich antrat, sprach nichts dafür, dass ich einmal in der ersten Reihe des Marktes laufen würde – und erst recht nicht, dass mir der „Stern“ eine Titelgeschichte widmet, ich als Coach meine eigene Kolumne in der „Zeit“ bekomme und meine Bücher über Jahre hinweg in der Spiegel-Bestsellerliste mitmischen. Ich verspreche Ihnen: Die kreativen Marketing-Ansätze, auf denen mein Erfolg beruht, werden bei Ihnen ebenfalls funktionieren.
Möge die Lektüre dieses Buches eine Abenteuerreise für Sie werden, bei der Sie methodisches Neuland entdecken und für sich erschließen! Erinnern Sie sich an die Überschrift dieser Einleitung „Was fällt Ihnen ein, Coach?“? Ich hoffe, Sie können bald antworten: „Ganz viel – und immer etwas Neues!“
Allzeit kreative Coaching-Ideen
wünscht Ihnen
Ihr
Martin Wehrle
PS: Schreiben Sie mir gerne, wie Ihnen dieses Buch gefällt und welche (kreativen) Gedanken Ihnen bei der Lektüre kommen. Sie erreichen mich über meine Homepage www.karriereberater-akademie.de. Dort finden Sie unter der Rubrik „Bücher“ auch Bonusmaterial zu diesem Buch, unter anderem eine Anleitung für Rollenspiele und zusätzliche Lösungen.
Teil 1Kreativ coachen – so geht‘s!
1. Guter Start: „Worum geht es Ihnen?“
Jeder Mensch ist wie ein Haus. Ehe das erste Coaching beginnt, stehen Sie vor der verschlossenen Tür. Nur einer kann Ihnen aufmachen: der Klient. Aus welchen Räumen sein Leben besteht, welche Themen dort lagern und aus welchen Fenstern er auf die Welt schaut, das kann er Ihnen zeigen. Oder auch nicht, denn wer garantiert, dass er genug Distanz zu seinem Leben hat? Vor lauter Themen werden Kernthemen übersehen. Also brauchen Sie Methoden und Fragen, die den Blick schnell aufs Wesentliche lenken. Je kreativer Sie Ihren Klienten ansprechen, desto aufgeschlossener wird er antworten. Diese sechs Türöffner erschließen Ihnen die Anliegen eines Menschen.
Was einem Menschen auf dem Herzen liegt, finden Sie durch kreative Fragen und Übungen heraus. Fantasie lenkt die Gedanken auf neue Bahnen und kann sie ihren üblichen Problemschleifen entreißen.
1. Das Themen-Kartenspiel: Wie Sie Ihrem Klienten seine Themen als Karten auf den Tisch legen und erstaunlich schnell sortieren lassen.
2. Der reitende Web-Bote: Wie ein fiktiver Bote, den Sie am Vorabend zum Klienten reiten lassen, Ihnen die wichtigsten Infos im Galopp serviert.
3. Ernten im Bildergarten: Wie Sie mit Bildkarten erreichen, dass Ihre Klientin sich und ihr Anliegen in neuem Licht und mit schärferen Augen sieht.
4. Angeln im Wunschteich: Wie sich Wünsche, die unter der Oberfläche schwimmen, mit einer Angel-Metapher einfangen lassen.
5. Der abgesagte Coaching-Termin: Warum Sie viel Nützliches erfahren, wenn Sie nachfragen, unter welchen Umständen Ihre Klientin das Coaching abgesagt hätte.
6. Die Theaterbühne: Wie Sie Ihre Klientin zur Regisseurin machen – und die Darsteller des Anliegens übersichtlich auf die Coaching-Bühne holen.
1.Das Themen-Kartenspiel
Kartenlegen im Coaching? Warum nicht! Gemeint ist eine seriöse Methode: Lassen Sie Ihren Klienten seine Themen als Kartenspiel sortieren. Schnell und effektiv kann er zum Kern vordringen. Wetten, dass diese Methode wie ein Joker sticht!
Ziele
Der Klient sichtet und gewichtet seine Coaching-Themen.Er erkennt Schlüssel-Anliegen.Er denkt in Wünschen statt Problemen.Fallbeispiel
Guido Wrobel (38) leitet eine Produktionshalle in Hamburg. Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil seine Mitarbeiter an den Maschinen unvorsichtig sind. Oder liegt es an der Geschwindigkeit, mit der die Maschinen laufen? Weil die Geschäftsleitung Personal gekürzt hat, müssen immer weniger Mitarbeiter dieselbe Arbeit bewältigen. Außerdem sind die Maschinen alt und nicht auf dem neusten Sicherheitsstand. Wrobel überlegt, ob er das Gespräch mit seinem Chef suchen oder gleich die Firma wechseln soll. Seine Frau plädiert für einen Wechsel: Sie möchte zurück nach München, ihre Heimat. Zugleich spielt Wrobel mit dem Gedanken, eines Tages selbst ein Geschäft aufzubauen.
Die Idee
Jemand spaziert ins Coaching, nennt sein Thema, und los geht‘s – so läuft das nur in der Theorie. Die Realität ist komplexer: Einen ganzen Strauß aus Themen bringen die Menschen mit. Manches wuchert durcheinander, und wer sagt Ihnen eigentlich, dass der Strauß alles Wichtige enthält?
Dass ein Anliegen auf den ersten Blick herausragt, muss nicht heißen, dass es auch das wichtigste ist; vielleicht ist es nur das dringendste. Und wie hängen die Themen eigentlich zusammen? Gibt es Gruppen? Welche beeinflussen sich? Und welche stehen auf einem anderen Blatt?
Themen sichten und gewichten: Darauf kommt es zu Beginn an. Erst danach kann der Klient entscheiden, worum es gehen soll. Das Themen-Kartenspiel ermöglicht einen Überblick. Der Klient legt die Karten und damit seine Anliegen auf den Tisch – ein spielerischer Vorgang, der Gedanken sortiert, Zusammenhänge aufzeigt und Klarheit erzeugt. So kann er seine Energie bündeln und mit hoher Motivation ins Coaching starten.
Schritte zum Erfolg
1. Bieten Sie Ihrem Klienten ein Themen-Kartenspiel an. Dazu drücken Sie ihm einen kleinen Stapel von Karten im A6-Format in die Hand und erläutern die Methode:
„Nun höre ich schon: Da kreisen etliche Anliegen in Ihrem Kopf. Und sicher ist es Ihnen wichtig, Ihre Energie auf die wichtigsten Themen zu richten. Deshalb mein Vorschlag: Schreiben Sie Ihre Themen in Stichwörtern auf diese Karten. Jede Karte steht für ein Thema. Bitte beginnen Sie mit dem Schreiben in der Mitte des Papiers. Oben brauchen wir noch Platz, später kommen Überschriften hinzu.“
Helfen Sie dem Klienten durch Ihre Fragen, seine Themen und Anliegen zu strukturieren. Im Gespräch mit Guido Wrobel begann das etwa so:
Coach: „Ich habe herausgehört, dass Sie die Zahl der Unfälle senken wollen. Was spielt da alles rein?“
Klient: „Die Leute müssen endlich lernen, das Wort ‚Arbeitssicherheit‘ zu buchstabieren. Ich sehe da noch zu viel Leichtfertigkeit.“
Coach: „Ist das für Sie ein Thema? Wenn ja, schreiben Sie gerne ein paar Stichwörter dazu auf eine Karte.“
Der Klient greift sich eine Karte, nimmt einen Stift und schreibt auf: „Arbeitssicherheit erhöhen, Schulungen abhalten, Bewusstsein wecken, keine selbst verschuldeten Unfälle mehr!“
Coach: „Wäre für Sie denn alles in Butter, wenn die Leute vorsichtiger ans Werk gingen?“
Klient: „Nein, bestimmt nicht! Fehler sind menschlich. Ich glaube, die Zahl der Schichtdienste ist einfach zu hoch, seit diesen dämlichen Personalkürzungen.“
Coach: „Sind die Personalkürzungen und alles, was damit zusammenhängt, ein eigenes Thema?“
Klient: „Das sind sie! Denn das verdirbt mir ja die Lust an der Arbeit hier. Das ist der Grund, warum ich immer wieder an einen Wechsel denke.“
Coach: „Da klingt mir jetzt nach zwei Themen-Karten: eine für den Umgang mit Personalkürzungen und eine für den Wunsch nach einem Wechsel.“
Der Klient nickt und schreibt die jeweiligen Themen in Stichwörter auf. Im Laufe des Gespräches kommen noch fünf weitere Karten auf den Tisch. Am Ende sitzt er vor acht Themenkarten.
2. Nun laden Sie den Klienten ein, seine Karten mit Überschriften zu versehen. Geben Sie ihm die ersten drei Worte vor: „Ich wünsche mir …“ Damit ist gewährleistet, dass die Überschrift nicht das Problem manifestiert, sondern die Richtung zum Ziel weist. Auf den acht Karten stehen am Ende folgende Überschriften:
Ich wünsche mir … dass die Mitarbeiter vorsichtiger werden.Ich wünsche mir … dass mein Chef die Personalstärke realistischer plant.Ich wünsche mir … Klarheit, ob ich wechseln oder bleiben soll.Ich wünsche mir … eine Aussprache mit meiner Frau, wo wir leben wollen.Ich wünsche mir … eine Entscheidung, ob ich selbst Unternehmer werden will.Ich wünsche mir … eine überfällige Gehaltserhöhung.Ich wünsche mir … mehr persönliche Führungskompetenz.Ich wünsche mir … einen besseren Kontakt zum Betriebsrat.3. Jetzt dreht der Klient die Karten um und mischt sie. Dann soll er jeweils zwei Karten ziehen und sich für das wichtigere Thema, den Joker, entscheiden. Dieses Spiel geht so lang, bis nur noch eine Karte als Oberjoker übrig ist – offenbar das wichtigste Thema. Zur Überraschung von Guido Wrobel läuft es hinaus auf: „Ich wünsche mir … Klarheit, ob ich wechseln oder bleiben soll.“ Diese Karte darf er nun mit einem gelben Textmarker als Oberjoker kennzeichnen.
4. Laden Sie den Klienten ein, seine Karten auf dem Tisch zu gruppieren. Welche Themen hängen mit dem Oberjoker zusammen? Sofort schiebt Wrobel die Karte mit der realistischen Personalplanung durch seinen Chef neben den Wechsel. „Denn davon hängt es ab, ob ich hier auf Dauer bleibe. Ich möchte keinen Mangel verwalten.“ Ebenso rückt er die Karte „Aussprache mit meiner Frau“ neben den Oberjoker: „Ich muss jetzt endlich klären, ob sie überhaupt bereit wäre, auf Dauer mit mir in Norddeutschland zu bleiben. So richtig deutlich haben wir das noch nie besprochen.“
Die Karte zu den Mitarbeitern, die vorsichtiger sein sollen, lässt er auch in Richtung Oberjoker wandern, nur in größerem Abstand: „Ich denke, das ist ein Unterthema. Erst einmal muss ich den Leuten meine Hand reichen, indem ich eine höhere Zahl von Arbeitern durchsetze. Und dabei kann mir der Betriebsrat helfen.“ Er schiebt die Betriebsrats-Karte dicht an die realistische Personalplanung. Seine Idee, selbst ein Unternehmen zu gründen, legt er neben die Karte „Gehaltserhöhung“: „Wenn ich nach Leistung verdienen will, muss ich auf lange Sicht raus aus dem Angestelltenverhältnis.“
So entsteht auf dem Tisch eine Themenlandschaft, die dem Klienten einen schnellen Überblick verschafft, welche Anliegen er hat, wie sie zusammenhängen und worin ein Schlüsselthema bestehen könnte.
5. Der Coach bittet den Klienten, die einzelnen Themengruppen jeweils mit einer bestimmten Farbe zu markieren – so bleibt der Zusammenhang sichtbar, falls die Karten im weiteren Verlauf verschoben werden.
6. Nun darf der Klient wählen, welches Thema im Mittelpunkt des Coachings stehen soll: „Jetzt haben Sie Ihre Themen auf den Tisch gebracht. Machen Sie doch einmal einen Vorschlag, mit welchem davon wir anfangen sollen, um Sie in der entscheidenden Frage weiterzubringen. Es darf der Ober-Joker sein, muss es aber nicht.“
Der Klient schlägt vor: „Wir sollten unbedingt über mein Verhältnis zur Geschäftsführung sprechen. Denken wir noch in eine Richtung? Wie kann ich das klären? Davon hängt die ganze Zukunft ab, auch ob ich wechseln werde oder nicht.“ (Er tippt mit dem Zeigefinger auf die Wechsel-Karte.) „Falls ich wechseln würde, dann sicher in den Süden. Damit wäre auch das Umzugsthema mit meiner Frau geklärt.“ (Er tippt die Umzugskarte an.)
Diese Methode stellt sicher, dass Sie mit Ihrem Klienten alle Themen im Blick behalten – und an den wichtigsten arbeiten. Bei allen Wünschen, die sich auf andere Personen beziehen („Mein Chef soll …“), wird das Coaching den Beitrag des Klienten herausarbeiten. Bei Folgesitzungen können Sie die Karten erneut auf den Tisch legen und die Fortschritte analysieren – meist wirkt sich eine Entwicklung bei einem Thema auch positiv auf andere aus.
Weitere Fragen
Manchmal stecken Karten im Ärmel und werden übersehen: Gibt es bei Ihnen vielleicht noch ein verborgenes Thema?Schauen Sie die Karten einmal an: Fallen Ihnen vielleicht Nebenthemen ein, die da reinspielen?Angenommen, ich könnte Ihren engsten Mitarbeiter befragen: Welches Thema würde er vielleicht noch auf den Tisch legen?Angenommen, Ihre Frau säße hier und dürfte eine Karte hinzufügen: Haben Sie eine Idee, welche das sein könnte?Gibt es zwei Themen, die Sie jetzt mit Abstand auf den Tisch gelegt haben, die aber doch heimlich zusammenhängen?Schauen Sie die Überschriften Ihrer Karten einmal an: Gibt es Grundthemen, die sich durch Ihr Leben ziehen?Wie haben sich diese Themen in den letzten Jahren entwickelt?Und wie sollen sie sich in den nächsten Jahren entwickeln?Nun gibt es ja den Spruch, dass Karten neu gemischt werden. Welche von diesen Karten könnten Sie auch in der Zukunft akzeptieren?Und welche Themen hätten Sie gerne geklärt oder mit einer neuen Überschrift versehen?Varianten
Bringen Sie als Ergänzung ein Spielkarten-Set mit. Und nun darf der Klient jeweils ein Symbol zu den Karten mit seinen Anliegen legen. Welches ist das wichtigste Thema, das er vielleicht mit einem Ass versehen will? Welches ist sein Herzensthema, für das er zur Herz-Dame greift? Und welche Themen sind ihm nur eine Sieben wert? Er darf die Karten aussuchen und seine Wahl begründen. Diese Arbeit mit Bildsymbolen spricht die Kreativität an.
Profi-Tipp
Gehen Sie davon aus, dass der Klient im ersten Anlauf nicht alle Themen auf den Tisch bringt, auch wenn er das meint. Immer wieder tauchen im Verlauf neue Themen auf. Dann sollten Sie auf das Kartenspiel hinweisen und ihn fragen: „Brauchen Sie eine neue Themenkarte?“
Und geben Sie Ihrem Klienten die Karten mit nach Hause. Dann kann er im Kopf weiterarbeiten und seine Vorsätze leichter verwirklichen. Zum nächsten Termin bringt er die Karten wieder mit. Wenn viel passiert ist, sollte er sie neu sortieren. Wo liegen jetzt die Prioritäten?
Risiken
Wie gehen Sie damit um, wenn am Ende 20 Themen auf dem Tisch liegen – und das Themenchaos, das Sie beseitigen wollten, gewachsen ist?
Übung: Entwickeln Sie drei Vorschläge, bevor Sie weiterlesen:
1.)
2.)
3.)
Mein Vorschlag:
1.) Lassen Sie den Klienten eine möglichst kleine Zahl von Oberthemen bilden (farblich hervorgehoben), denen Nebenthemen zugeordnet werden.
2.) Laden Sie den Klienten ein, Themen mit augenblicklich geringer Relevanz vorerst vom Tisch zu nehmen – er darf sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder einbringen.
3.) Fragen Sie vor jedem neuen Termin, ob sich eines der Themen erledigt habe. Das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn er die Karten neu auslegt (was bei einer hohen Themenzahl sinnvoll sein kann).
Umsetzungs-Plan
Notieren Sie bitte, wann und wie Sie diese Methode einsetzen wollen:
2.Der reitende Web-Bote
Drei Auskünfte ebnen den Weg zum Coaching-Erfolg: Woher kommt der Klient? Wohin will er? Und mit welchen Kräften kann er den Weg bewältigen? Diese Methode lädt ihn ein, den Scheinwerfer seiner Aufmerksamkeit schnell aufs Wesentliche zu richten.
Ziele
Der Klient priorisiert Informationen.Er denkt an Lösungen und Ressourcen.Eine fundierte Basis für den Fortgang des Coachings entsteht.Fallbeispiel
Der Amtsrat Udo Schleier (34) langweilt sich bei seiner Arbeit als Kommunal-Beamter. Am liebsten würde er schon mittags nach Hause gehen, doch er muss seine Zeit absitzen. Diese Situation macht ihn immer griesgrämiger. Er hadert mit sich, eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen zu haben – wovon er zu Beginn des Coachings ausführlicher erzählt. Seine Gedanken bewegen sich in großen Sprüngen, mal spricht er von seinem Studium, dann wieder von einer frustrierenden Situation im Alltag. Der Coach überlegt, wie er ihn dazu bringen kann, das Anliegen knapper und strukturierter zu schildern.
Die Idee
Je mehr ein Mensch erlebt hat, desto schwerer fällt es ihm, Bedeutendes von Unbedeutendem zu unterscheiden. Jeder Klient bringt eine Geschichte mit, die über Jahre dauert, voll von Ereignissen ist und in den Tag des ersten Coachings mündet. Groß ist die Gefahr, dass er vom Hölzchen zum Stöckchen kommt – und das Coaching nicht in die Gänge. Eine Fantasieübung kann als Abkürzung zum Wesentlichen dienen: Lassen Sie den Klienten sich ausmalen, er sollte einen reitenden Boten zum Coach schicken. Nur: Dieser Bote muss in exakt drei Minuten wieder abreiten. Welche Informationen würde er ihm mitgeben?
Schritte zum Erfolg
1. Der Coach erklärt, warum er diese Übung vorschlägt. Der Klient muss sich in seiner bisherigen Ausführlichkeit gewürdigt fühlen. Dabei hilft eine anschauliche Ich-Botschaft des Coachs, die seinen Informationsbedarf hervorhebt:
„Vielen Dank, dass Sie so offen und so ausführlich aus Ihrem Leben erzählen. Alles, was Sie bisher erlebt haben, kann wichtig für Ihre nächsten Schritte sein. Diesen Bogen zur Vergangenheit werden wir noch öfter schlagen.
Wissen Sie, wie es mir bei unserem Coaching-Starttermin geht? Ich komme mir vor wie ein Fernsehzuschauer, der zum allerersten Mal in eine spannende Serie schaltet – die Serie Ihres Lebens. Sie spielt seit 34 Jahren, und jeder Tag war eine Episode. Es wird unmöglich sein, dass ich alles bisher Geschehene erfahre. Wahrscheinlich würde mich das sogar verwirren, weil es einfach zu viel ist. Aber den Kern muss ich kennen, um verstehen zu können: Wie soll es weitergehen? Und auch für Sie ist es wichtig, zu diesem Kern vorzudringen.
Eine kleine Übung kann Sie unterstützen, die wichtigsten Informationen auf den Punkt zu bringen. Ein Bote und ein Pferd spielen dabei eine wichtige Rolle. Neugierig darauf?“
2. Nun stellt der Coach die Methode vor. Er bittet den Klienten, sich abseits des Coaching-Tisches entspannt hinzusetzen, seine Gedanken treiben zu lassen und sich folgende Szene vorzustellen. Der Coach spricht dabei langsam und rhythmisch, seine Stimme klingt ruhig und tief:
„Malen Sie sich einmal aus, ich hätte mich gestern überraschend bei Ihnen gemeldet und am Telefon gesagt: ‚Herr Schleier, eines hatte ich noch vergessen: Heute Abend kommt ein reitender Bote bei Ihnen vorbei. Er wird nur drei Minuten Ihrer Zeit beanspruchen. Und er bringt drei Fragen von mir mit. Wenn Sie darauf antworten, galoppiert er mit den Antworten sofort zu mir. Das wird uns helfen, morgen schnell zum Kern des Themas vorzudringen.‘
Der gestrige Abend. Stellen Sie sich vor, wo Sie sich befinden (Pause). Natürlich warten Sie voller Neugier: Kommt tatsächlich ein Bote? Und, wenn ja: Welche Fragen wird er stellen? Haben Sie vielleicht schon eine Ahnung, wie die Fragen lauten? (Pause) Welche Fragen hätten Sie an seiner Stelle gestellt? (Pause)
Tatsächlich hören Sie eine halbe Stunde später die Hufe klappern. Ein Bote reitet bei Ihnen vor. Bitte gestatten Sie, dass ich jetzt in diese Rolle schlüpfe: Ich bin der Bote – und dieser Stuhl, auf den ich mich rücklings setze, ist mein Pferd. Und jetzt, da ich bei Ihnen vorgeritten bin, sage ich:
‚Mein Auftraggeber, der Coach, hat mir die WEB-Formel mit auf den Weg gegeben – hinter jedem dieser Buchstaben verbirgt sich eine Frage.
Was soll passieren?
E steht für:Eigenanteil – welchen Beitrag dazu leisten Sie?
B steht für:Bester Lösungsversuch, der Ihnen bisher gelungen ist?
Ich weiß, ich überfalle Sie mit meinem Besuch. Deshalb müssen Sie mir keine druckreifen Antworten geben. Sprechen Sie einfach aus dem Bauch, was Ihnen dazu einfällt – vielleicht werde ich kurz nachfragen. Nur haben wir wenig Zeit: In drei Minuten muss ich wieder aufbrechen, um rechtzeitig bei meinem Chef, dem Coach, zu sein – Sie haben pro Frage eine Minute.‘“
Bitte beachten Sie, dass der Coach nach dem ersten Absatz vom Konjunktiv auf das Präsens umschaltet. Damit wird die kleine Fantasiereise noch eindringlicher – die Handlung findet im Kopf des Klienten statt und bleibt nicht nur eine Möglichkeit.
3. Der Coach, hier reitender Bote, stellt seine W-Frage:
Reitender Bote: „Fangen wir mit dem W an: Was, Herr Schleier, soll passieren?“
Klient (braucht einige Sekunden, ehe er Worte findet): „Ich möchte raus aus dieser Langeweile. Ich habe das Gefühl, ich führe ein falsches Leben.“
Reitender Bote: „Langeweile soll nicht mehr passieren. Das notiere ich für den Coach. Aber was passiert stattdessen?“
Klient: „Ich möchte eine Aufgabe haben, an der ich wachsen kann. Ich möchte jeden Tag dazulernen. Ich möchte die Perspektive haben, mehr Verantwortung zu übernehmen – statt immer nur im Schneckentempo meiner Dienstjahre voranzukommen.“
Reitender Bote: „Darf ich dem Coach also ausrichten, dass Sie einen anderen Arbeitsplatz suchen?“
Klient: „Ja, definitiv! Ich weiß nur noch nicht, ob ich in die freie Wirtschaft will und wie das gehen soll – oder ob es für mich in der Beamtenlaufbahn noch Herausforderungen gibt.“
Reitender Bote: „Mein Pferd scharrt schon mit den Hufen, eine Frage noch: Welche möglichen Herausforderungen sehen Sie da?“
Klient: „Die freie Wirtschaft scheint mir sehr riskant. Interessanter wären zwei Beamtenkarrieren: als Bürgermeister oder Landtagsabgeordneter. Also politische Ämter.“
Die W-Frage orientiert sich an der Lösung: Der Klient soll nicht berichten, was er beseitigen will – sonst spräche er über sein Problem. Vielmehr soll er seinen Blick auf sein Ziel richten. Dorthin lenkt ihn der Coach durch seine Nachfrage („… was passiert stattdessen?“)
In dieser Rolle haben Sie es leicht: Erstens sind Sie nur der Übermittler – also kann Ihnen der Klient die enge Zeitvorgabe nicht übelnehmen. Und zweitens scharrt Ihr Pferd schon mit den Hufen: Auf spielerische Art können Sie den Klienten anregen, seine Auskünfte zu verdichten.
4. Der Coach, immer noch reitender Bote, geht zur zweiten Frage über.
Reitender Bote: „Und jetzt sind wir beim E von WEB: Wie sieht Ihr Eigenbeitrag aus? Der Coach wird mich fragen, was Sie zu tun bereit sind, um an dieses Ziel zu gelangen. Bitte wieder ganz kurz, wir haben eine Minute.“
Klient: „Ich komme schon mal ins Coaching. Auch noch auf eigene Kosten. Das ist doch ein Anfang.“
Reitender Bote: „Sie investieren Zeit und Geld – offenbar bedeutet Ihnen die Veränderung viel. Was können Sie noch dafür tun?“
Klient: „Ich werde mich informieren über die politischen Ämter. Vielleicht kann ich mal einen Bürgermeister interviewen: Wie ist er auf die Idee gekommen, für das Amt zu kandidieren? Und wie hat er seinen Wahlkampf geführt?“
Reitender Bote: „Dann richte ich dem Coach aus, dass Sie wichtige Informationen einholen. Was können Sie darüber hinaus unternehmen?“
Klient: „Ich muss endlich wissen, was ich will! Im Moment hänge ich in der Schwebe, komme vom Alten nicht los und zum Neuen nicht hin.“
Reitender Bote: „Also wären Sie bereit, im Coaching eine verbindliche Entscheidung zu fällen, sofern sie gut vorbereitet ist?“
Klient: „Ja, dazu bin ich bereit. Die Veränderung darf auch ein Risiko bedeuten – nur muss es kalkulierbar sein.“
Der Coach hört aktiv zu, fasst die Informationen des Klienten zusammen und leitet mögliche Ressourcen daraus ab. Dieses strukturierte Zuhören wirkt ansteckend und animiert zum strukturierten Erzählen – eine systemische Wechselwirkung.
5. Der Coach, nach wie vor reitender Bote, bringt die dritte und letzte Frage ins Spiel:
Reitender Bote: „Und jetzt will mein Chef, der Coach, noch die Antwort auf das B von WEB: Welches war Ihr bisher bester Lösungsversuch?“
Klient: „Ich weiß gar nicht, ob ich schon etwas zur Lösung unternommen habe.“
Reitender Bote: „Denken Sie scharf nach!“
Klient: „Na ja, ich habe mit ein paar Freunden gesprochen. Dabei bin ich auf die Idee mit dem Bürgermeisteramt gekommen. Die meinen alle, ich sei der richtige Typ dafür.“
Reitender Bote: „Das heißt, die Gespräche mit Freunden und deren Rückmeldungen bringen Sie voran?“
Klient: „Ja! Das sind die Momente, in denen ich vom Hadern zum Handeln umschalte. Beispielsweise habe ich im Internet schon geschaut, wann und wo hier in der Gegend die nächsten Bürgermeisterwahlen sind.“
Reitender Bote: „Was wurde dadurch anders?“
Klient: „Na ja, zunächst war die Idee nur eine Spinnerei. Aber durch die Rückmeldung der Freunde und die Recherche im Internet wurde es auf einmal realistischer.“
Reitender Bote: „Darf ich meinem Chef, dem Coach, also rückmelden: Sie haben mit Erfolg Ihr Netzwerk genutzt, um eine Lösungsidee zu entwickeln. Und Sie haben bei einer ersten Recherche Mut geschöpft?“
Klient: „Ja, das trifft es.“
Nach den beiden ersten Fragen hat sich der Klient ans komprimierte Antworten gewöhnt. Als ihm kein Lösungsversuch einfällt, bringt ihn der reitender Bote jovial mit einem „Denken Sie scharf nach!“ auf die Spur. Eine solche Ansprache hätte aus der Rolle des Coachs heraus nicht unbedingt funktioniert. Doch ein Bote des Chefs darf so sprechen. Seine Natürlichkeit färbt ab.
6. Als der Bote abreitet, hat sich in nur drei Minuten ein klares Bild herausgeschält. Nun erklärt der Coach das Rollenspiel für beendet und begibt sich mit dem Klienten zurück an den Tisch. Dort sagt er: „Mein reitender Bote hat mir schon von Ihnen berichtet. Ich sage Ihnen einmal, was bei mir angekommen ist …“
Oft ist der Botenbericht so präzise, dass der Klient nur noch ein paar Hintergründe erläutern muss – was die Einstiegsphase verkürzt und den Übergang zur Situationsklärung erleichtert.
Weitere Fragen
Unter uns, ich bin ja nur der Bote: Was erwarten Sie eigentlich von meinem Chef, dem Coach?Und was soll er auf keinen Fall tun?Gibt es andere Menschen, die ebenfalls erwarten, dass etwas in Ihrem Leben geschehen soll – und wenn ja, was?Wo sehen Sie die Schnittfläche zwischen Ihrer Erwartung und den Erwartungen der anderen?Und wo einen Widerspruch? Wie wollen Sie damit umgehen?Wenn Sie morgen als Superheld aufwachen würden und plötzlich ungeheuer viel Mut und Kraft hätten: Was würden Sie dann unternehmen?Was davon, natürlich in kleiner Dosis, wäre jetzt schon realistisch?Auf welche Weise haben Sie in der Vergangenheit solche Herausforderungen bewältigt?Wenn Sie sich eine Scheibe davon für die Gegenwart abschneiden dürften – wie wäre diese Scheibe beschaffen?Varianten
Lassen Sie Ihren Boten mit der Gondel vorfahren (sofern Ihre Klientin ein Venedig-Fan ist), im Oldtimer vors Haus knattern (sofern Ihr Klient alte Autos mag), mit einem Fallschirm aus allen Wolken fallen (sofern Ihr Klient diesen Sport liebt) oder gar als Engel einfliegen. Erlaubt ist alles, was Ihren Klienten gefällt und Wind unter die Flügel der Fantasie bringt.
Profi-Tipp
Tun Sie alles, um die Szenerie mit dem reitenden Boten realistisch erscheinen zu lassen.
Übung: Welche schauspielerischen Mittel, optisch und akustisch, fallen Ihnen ein, um den reitenden Boten noch realistischer darzustellen? Bitte entwickeln Sie drei Ideen.
1.)
2.)
3.)
Mein Vorschlag:
1.) Täuschen Sie mit Ihren Schuhen, die Sie rhythmisch auf den Boden klacken lassen, den Galopp eines Pferdes vor.
2.) Nehmen Sie ein Seil mit, das Sie dem Stuhl, sprich Ihrem Pferd, als Zügel umlegen.
3.) Streicheln Sie Ihrem Pferd zwischendurch den Kopf und sagen Sie: „Ruhig, Brauner!“
Je fantasievoller und spielerischer Sie an die Übung herangehen, desto mehr Fantasie und Spielfreude wird auch Ihr Klient entwickeln.
Risiken
Der Klient redet sich in Details fest, während die Uhr tickt. Helfen Sie ihm, indem Sie nach dem Kern seines Anliegens fragen. Und geben Sie ihm Orientierung, wie viel Zeit ihm bleibt. Eine Uhr in der Tischmitte, mit Sekundenanzeige, hilft weiter. Die Kombination aus beidem – lenkenden Fragen und Zeitansage – verdichtet die Antworten, auch bei assoziativen Klienten. Die letzten 20 Sekunden der Minute sind in der Regel am produktivsten.
Umsetzungs-Plan
Notieren Sie bitte, wann und wie Sie diese Methode einsetzen wollen:
3.Ernten im Bildergarten
Ehe Ihre Klientin losläuft, um eine Lösung zu finden, sollte sie prüfen: Wo stehe ich im Moment? Und was leite ich daraus ab? Bilderkarten regen dazu an, alte Zusammenhänge in neuem Licht zu sehen. Metaphern erleichtern Veränderung.
Ziele
Die Klientin verfremdet ihre Situation, was einen neuen Blickwinkel verschafft.Mit der Sichtweise verändert sich die Bewertung, was zu Lösungsideen führt.Bildkarten regen spielerische Kreativität und Metaphern-Sprache an.Fallbeispiel
Beate Dinges (62) ist als freiberufliche Grafikerin gut im Geschäft. Sie gestaltet Homepages, Flyer und Imagebroschüren. Doch in letzter Zeit verspürt sie eine immer stärkere Unlust, Aufträge anzunehmen. Manchmal täuscht sie Auslastung vor, obwohl sie noch freie Kapazitäten hätte. Zugleich sagt sie: „Ich muss noch mindestens bis zum 67. Lebensjahr arbeiten, sonst reicht meine Alterssicherung nicht.“ Ihr Wunsch ans Coaching: „Ich möchte meiner Motivation auf die Sprünge helfen. Eigentlich mache ich meinen Beruf ja gerne.“
Die Idee
Die Motive, die einen Menschen anschieben oder bremsen, schwimmen nicht an der Oberfläche seines Bewusstseins, sondern tiefer. Auf die Frage, was sie zu neuer Arbeitslust motivieren könnte, zuckt Beate Dinges mit den Schultern. Ebenso wenig kann sie sagen, was ihre Arbeitslust bremst. Solche Fragen hat sie sich selbst schon gestellt, ohne Antworten zu finden. Wer im Coaching dieselbe Fährte einschlägt, kann in die Sackgasse laufen, an den Lösungen vorbei.
Neue Gedanken erfordern neue Impulse, die nicht nur den Verstand, sondern auch die Intuition ansprechen. Bilderkarten sind ein Trumpf, um die Kreativität zu aktivieren. Jedes Bild regt im Kopf weitere Bilder, ja ganze Geschichten an. Die Karten eines Lebens werden neu gemischt. Die Klientin fängt an, ihre Situation in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Motive werden klarer, Lösungen sichtbar. Am Ende stehen ganz eigene Bilder – vom Weg zum Ziel.
Schritte zum Erfolg
1. Machen Sie Ihre Klientin auf die Arbeit mit den Bildkarten neugierig, gerne auf spielerische Weise, die im wohltuenden Kontrast zu den oft ernsten Anliegen steht – etwa so: „Wundern Sie sich nicht: Ich möchte Ihnen jetzt die Karten legen.“
Damit ist Ihnen höchste Aufmerksamkeit sicher. Nun legen Sie ein Set mit etwa 50 Bilderkarten auf den Tisch. Ich verwende ein gekauftes Bilderset. Als Hobbyfotograf können Sie auch mit 50 Abzügen eigener Bilder arbeiten. Es sollten Motive aus allen Bereichen des Lebens sein, ob ein Vogel am Himmel, ein Stau in der Stadt oder eine Schaumkrone auf dem Meer.
Blättern Sie vor den Augen der Klientin etwa zehn Motive auf den Tisch. Sie verfolgt den Vorgang mit einer kindlichen Neugier.
2. Bitten Sie die Klientin, sich für eine Karte zu entscheiden, die ihre Ausgangssituation symbolisiert. Bieten Sie ihr an, erst die Karten auf dem Tisch durchzuschauen und dann, falls sich nichts Passendes findet, die weiteren Karten durchzublättern. Beate Dinges muss nicht lange überlegen: Spontan greift sie einen alten Holzkahn, der am Ufer eines Sees liegt und mit Wasser vollgelaufen ist.
3. Der Coach bittet sie, eine Weile über dieses Motiv nachzudenken. Warum hat sie sich gerade dafür entschieden? Wo liegen die Parallelen zu ihrer Situation? Welches könnte die Geschichte dieses Bildes sein? Und welche Gemeinsamkeiten zu ihrer Situation gibt es?
Klientin: „Ich würde mal sagen: Dieses Boot ist leckgeschlagen. Wahrscheinlich lag es den ganzen Winter draußen. Und es hat schon viele Rudermeilen auf dem Buckel.“
Coach: „Finden Sie das Boot schön?“
Klientin: „Ja, so ein Holzboot hat schon was. Das ist individuell, nicht nur Kunststoff.“
Coach: „Welches Boot braucht mehr Pflege: eines aus Kunststoff oder eines aus Holz?“
Klientin: „Holz natürlich! Dieses Material arbeitet.“
Coach: „Das fertige Boot verändert sich noch?“
Klientin: „Klar, es saugt Wasser auf. Oder es kann spröde werden, wenn man es nicht streicht. Oder es platzt auf, wenn das aufgesaugte Wasser im Winter gefriert.“
Coach: „Wo liegen die Parallelen zu Ihrer Situation: Sind Sie ein Holz- oder ein Plastikboot?“
Klientin: „Ein Holzboot! Ich verändere mich ständig. In jungen Jahren gab es nur die Arbeit; heute möchte ich ein erfülltes Leben. Vielleicht bin ich ein zu schlecht gepflegtes Holzboot. Denn ich sehe mich ja ebenfalls unter Wasser.“
Coach: „Das ist spannend! Damit sagen Sie ja indirekt: Wäre das Boot besser gepflegt worden, würde es vielleicht noch majestätisch über den See gleiten.“
Klientin: „Schon möglich. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren überfordert. Zum Beispiel habe ich mehrfach den Urlaub verschoben und dann sausen lassen, nur weil neue Aufträge reinkamen.“ (…)
Die Metapher des Holzbootes ist so wirksam, weil die Klientin sich selbst dafür entschieden hat. Je länger sie auf das Bild schaut, desto klarer kann sie ihre eigene Situation in Worte fassen: In den letzten Jahren hat sie sich zu wenig um sich selbst gekümmert und zu sehr um ihre Arbeit. Der Coach arbeitet durch seine Fragen die Parallelen zu dem Boot heraus, wobei er den Fokus auf die Lösung lenkt.
4. Laden Sie die Klientin ein, das Motiv in Gedanken zu verändern: „Mal angenommen, Sie sollten dieses Boot noch einmal fotografieren – und zwar so, dass es sich von seiner schönsten Seite zeigt. Welches Motiv schwebt Ihnen dann vor? Und was müsste vorher mit dem Boot passieren?“
Klientin: „Das Boot gleitet über den See in einen Sonnenuntergang. Daneben schwimmt ein stolzer Schwan. Und an Bord sitzen zwei Menschen, natürlich ein Liebespaar.“
Coach: „Aber noch ist das Boot gar nicht seetüchtig!“
Klientin: „Man müsste es vorher in die Bootswerft bringen. Man müsste es nicht nur flicken, sondern überholen lassen. Und künftig besser pflegen.“
Coach: „Übertragen auf Ihr Lebensboot: Angenommen, Sie würden eine Werft um Rat bitten, wie Sie es wieder flottbekommen – was würde man Ihnen wohl sagen?“
Klientin: „Ich glaube, die würden sagen: Gönnen Sie dem Boot mal eine Pause! Es ist doch schon 62 Jahre im Einsatz. Da kann man leicht ermüden.“
Coach: „Also: Das Boot muss gar nicht repariert werden, sondern sich nur regenerieren?“
Klientin: „Ja, das glaube ich. Und vielleicht ist das Boot auf dem Bild ja gar nicht leckgeschlagen – vielleicht ist das Regenwasser. Also bei mir, glaube ich, ist es eher Regenwasser. Das lässt sich auch wieder abschöpfen.“
Coach: „Angenommen, Sie sollten die erste Kelle ausschöpfen – was genau würden Sie dazu tun, am besten morgen schon?“ (…)
Im weiteren Gespräch kommt der Coach immer wieder auf das Wunschbild der Klientin zurück: Was könnte der stolze Schwan sein, der ihr Leben bereichert? (Sie nennt ein paar Fernreiseziele, die sie schon lange anvisiert!) Woraus besteht der Sonnenuntergang? (Sie sagt: Aus einem frühen Feierabend, nach dem ich noch am Fluss joggen gehe.) Und welches Liebespaar sitzt in Ihrem Boot? (Sie nimmt sich vor, die leicht erstarrte Beziehung zu ihrem Lebensgefährten wieder zu beleben.)
Das muntere Springen zwischen der Bildkarte, der fantasierten Bildkarte und der eigenen Situation erhöht die Kreativität der Klientin, lässt sie mit spielerischem Vergnügen ihre Zukunft entwerfen und die Problemhypnose überwinden.
5. Die Klientin legt sich fest, welche Maßnahmen sie bis zum kommenden Coaching-Termin in zwei Wochen ergreifen wird, um ihr Lebensboot auszuschöpfen und sich dem idealen Bild anzunähern. Sie beschließt, in diesen Wochen jeweils nur drei Tage zu arbeiten und den Rest der Zeit für ihre Hobbys und ihren Partner zu nutzen.
Sie sagt unter anderem: „In den letzten Wochen saß ich oft von morgens bis abends vorm Computer, ohne wirklich etwas zu tun – ich habe nur an meinem schlechten Gewissen gearbeitet. Damit ist mein Boot immer voller gelaufen. Jetzt probiere ich es mal mit mehr Entspannung.“ Ein erster und vielversprechender Schritt, ihr Lebensboot wieder flott zu bekommen.
Weitere Fragen
Übung: Bitte denken Sie sich mindestens fünf Fragen aus, die Ihnen bei der Arbeit mit Bildkarten sinnvoll erscheinen, ehe Sie meine Vorschläge lesen.
Mein Vorschläge:
Nun haben Sie über die Parallelen zwischen dieser Bildkarte und Ihrem Leben gesprochen: Wo liegen eigentlich die gravierenden Unterschiede?Angenommen, jemand anders hätte eine Karte aussuchen können, zum Beispiel Ihr Lebenspartner: Wofür hätte er sich wohl entschieden?Angenommen, ich hätte Sie in Ihrer glücklichsten Stunde des letzten Monats getroffen: Welches Motiv hätten Sie dann gewählt?Wie bewerten Sie es, dass für dieselbe Ausgangslage je nach Zeitpunkt unterschiedliche Motive zutreffend sind?Gehen wir mal davon aus, ein Fotograf hätte Sie in den letzten Monaten begleitet: Welches wäre das schönste Bild Ihres Lebens gewesen, das er für unsere Bilderkarten-Sammlung hätte schießen können?Was haben Sie zu diesem Bild beigetragen?Woher wüsste der Fotograf, wann er eine solche Aufnahme noch mal machen kann?Wie könnten Sie ihn dabei unterstützen?Varianten
Lassen Sie die Klientin mehrere Bildkarten auswählen: eine, die ihr Problem symbolisiert – und eine für ihre Lösung. Arbeiten Sie erst mit der Metapher des Problems, um dann zur Lösung überzugehen. Zum Beispiel wählt die Klientin für ihr Problem ein Unfallauto am Straßenrand. Ihre Lösung sieht sie hingegen durch ein Flugzeug symbolisiert. Nun kann das Coaching auf die Unterschiede zwischen den Motiven eingehen und diese auf das Leben der Klientin übertragen. Woran merkt sie zum Beispiel in ihrem Alltag, ob sie gerade fliegt, nur fährt oder gar im Graben liegt? Welches ist ihr persönlicher Treibstoff, der sie in Bewegung bringt? Usw.
Profi-Tipp
Bitten Sie die Klientin, eine Stunde vor dem Termin bei Ihnen vorbeizukommen. Nun drücken Sie ihr eine Digitalkamera in die Hand und bitten sie, draußen ein paar Dutzend Fotos von Motiven zu machen, die ihr vor die Linse kommen. Die Arbeit mit solchen Bildern ist besonders wirksam. Erstens macht es der Klientin Spaß, über ihre eigenen Bilder zu sprechen. Zweitens wird ihr bewusst, dass die Fotos nicht zufällig entstanden sind, sondern zu tun haben mit ihrem Blick auf die Welt und damit auch mit ihrem Anliegen. Und drittens können Sie Ihre Klientin bei der nächsten Sitzung bitten, erneut am selben Ort zu fotografieren – und mit ihr prüfen, was sich an ihrem Blickwinkel verändert hat, eventuell auch bei dem Motiv, mit dem Sie im Coaching gearbeitet haben.
Risiken
Bei Menschen, die in Bildern denken, etwa einer Grafikerin, fällt diese Arbeit sehr leicht. Dagegen kann es bei weniger bilderaffinen Klientinnen passieren, dass sie immer wieder auf ihre Situation zurückkommen, ohne die Parallele zu der Bildkarte im Kopf zu behalten. Dann ist es notwendig, dass Sie das Motiv im wahrsten Sinn hochhalten: Nehmen Sie die Karte in die Hand, zeigen Sie sie der Klientin und schlagen Sie durch erinnernde Fragen („Jetzt vergleichen Sie ja …“) die Brücke zwischen Bildkarte und Realität. Spätestens nach zehn Minuten finden sich die meisten Klientinnen gut mit der Methode zurecht.
Umsetzungs-Plan
Notieren Sie bitte, wann und wie Sie diese Methode einsetzen wollen:
4.Angeln im Wunschteich
Wünsche sind wie Fische: Sie bewegen sich unter der Oberfläche. Wer sie einfangen will, muss erst einmal wissen, wie sie aussehen und was sie anlockt. Mit dieser Methode geben Sie Ihren Klienten ein Echolot für (verborgene) Anliegen an die Hand.
Ziele
Unterstützen Sie den Klienten dabei, seine Bedürfnisse zu erforschen.Befähigen Sie ihn, zwischen inneren Wünschen und äußeren Anforderungen zu unterscheiden.Lassen Sie ihn eine langfristige Vision entwickeln.Fallbeispiel
Der BWL-Professor Theo Petermeier (45) wird von einem diffusen Unbehagen ins Coaching getrieben: Vor drei Jahren hat er endlich eine Professur an einer Fachhochschule ergattert – wie sein Vater, der auch Hochschullehrer war. Doch seit er es erreicht hat, verliert das vermeintliche Lebensziel immer mehr an Glanz. Er kommt sich im wissenschaftlichen Betrieb „fehl am Platze“ vor. Und er meint: „Das kann nicht alles gewesen sein. Oder etwa doch?“
Die Idee
Die meisten Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie entgegen ihren Wünschen und Bedürfnissen leben. Ihre Konzentration richtet sich dann auf das Unbehagen – womit sie sich noch unwohler fühlen. Damit werden die Kräfte, die eine Lösung herbeiführen könnten, durch negatives Denken gelähmt.
Besser lenken Sie den Blick in die Gegenrichtung: Welche unerfüllten Wünsche stehen hinter einem Problem, welche Hoffnungen und Träume? Was kann der Klient tun, um sie zu erkennen und in sein Leben zu integrieren? Solche Fragen lassen sich nur schwer abstrakt besprechen, weil der Klient sich selbst schon hundert Mal gefragt hat: „Was will ich eigentlich?“ – meist ohne befriedigende Antwort.
Wenn Sie im Coaching eine neue Methode anbieten, das Angeln im Wunschteich, weckt das die Neugier Ihres Klienten. Vor allem weiß er: Wer Fische angelt, wird nicht immer etwas fangen – das ist keine Schande. So kann er im Teich seiner Wünsche ohne Erfolgsdruck angeln, mit spielerischer Freude. Gerade diese Entspannung führt ihm die nötige Kreativität während des Coachings zu.
Schritte zum Erfolg
Übung: Bitte entwickeln Sie ein Konzept für den möglichen Ablauf der Übung. In welchen Schritten gehen Sie vor? Mit welchem fantasievollen Sprechtext führen Sie die Metapher ein? Und wie arbeiten Sie mit dem Input des Klienten weiter?
Mein Vorschlag:
1. Bitten Sie Ihren Klienten, die Augen zu schließen, sich vollkommen zu entspannen und sich ein Gewässer seiner Wahl vorzustellen – zum Beispiel einen See, Fluss oder Teich, den er als Kind geliebt und zum Baden besucht hat.
2. Unterstützten Sie ihn, dass er sich diesen Teich mit allen Sinnen vorstellt, indem Sie zum Beispiel fragen: „Wie roch es an diesem Gewässer? Haben Sie noch eine Vorstellung davon? Und wie würden Sie das Gewässer einem Maler beschreiben, der es aufs Papier bringen soll? Welche Details fallen ins Auge? Und welche Geräusche waren dort zu hören?“
Achten Sie darauf, dass Sie zwischen den Fragen genug Zeit für die Antworten lassen. Einige Klienten werden laut auf Ihre Fragen antworten, andere einen Film vor ihrem inneren Auge ablaufen lassen; beides ist in Ordnung.
Meist läuft der Dialog etwas sperrig an, zum Beispiel so:
Coach: „Welche Wünsche könnten sich da unter der Oberfläche tummeln? Erzählen Sie einfach mal, was Sie dort vermuten.“
Klient: „Hmmm. Im Moment kann ich nichts sehen.“
Coach: „Sie können noch nichts sehen. Wie der Angler oft keine Fische sieht. Dennoch sind sie da. Manchmal hinterlassen sie Spuren, zum Beispiel Ringe an der Oberfläche.“
Klient: „Wünsche sind mit Sicherheit da! Fragt sich nur, wo. Und wie sie aussehen.“
Coach: „Aus welchem Bereich Ihres Lebens könnten sie herbeischwimmen?“
Klient: „Aus der Arbeit, ganz klar! Da bin ich unzufrieden. Da muss sich etwas tun.“
Coach: „Unzufriedenheit bedeutet ja: Ihnen fehlt etwas Schönes! Wie könnte dieses Schöne aussehen? Konzentrieren Sie sich wieder auf das Gewässer vor Ihnen. Welcher Wunsch könnte dort am Grund schwimmen? Beschreiben Sie mal den Umriss.“
Klient: „Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich …“
3. Versetzen Sie Ihren Klienten in die Rolle des „Wunsch-Anglers“:
„Nun stellen Sie sich bitte vor, dass Sie als Angler am Ufer dieses Gewässers sitzen. Sie haben Ihre Schnur mit Haken ausgelegt, und Sie warten darauf, dass Ihr Köder genommen wird. Aber worauf angeln Sie eigentlich? Sie sind kein Fisch-, sondern ein Wunsch-Angler! Und wie ein Angler genau weiß, dass prächtige Fische in diesem Gewässer schwimmen, er sie jedoch erst fangen muss, so wissen Sie genau: Meine geheimsten Wünsche und Sehnsüchte tummeln sich unter der Oberfläche dieses Gewässers.“
4. Bringen Sie Ihren Klienten seinen Wünschen näher, indem Sie die Metapher fortführen: „Angler nutzen eine Polarisationsbrille, mit der sie unter Wasser schauen können, denn diese Brille bricht die Spiegelung der Oberfläche. So können sie Fische unter Wasser erkennen, manchmal auch nur die Umrisse. Angenommen, Sie würden jetzt eine solche Brille aufsetzen und in das Gewässer Ihrer Wünsche blicken. Woran erkennen Sie eigentlich Ihre Wünsche? In welchen Situationen sind sie zutraulich, in welchen scheu? Welche Umrisse Ihrer Wünsche könnten sichtbar werden? Welche Sehnsüchte haben Sie früher schon in Ihrem Leben an Land gezogen? Und welche hatten Sie schon mal an der Leine, haben sie aber wieder verloren? Aus welchen Gründen?
Bitte konzentrieren Sie sich vollkommen auf diesen Blick in das Wasser Ihrer Wünsche und merken Sie sich alles, was Sie dort sehen. Welcher Wunsch schwimmt am nächsten? Welcher ist der größte? Gibt es vielleicht einen Wunsch, dessen Erfüllung sich auf Ihr ganzes Leben positiv auswirken könnte?“
5. Versetzen Sie Ihren Klienten nun in eine aktive Rolle, wieder indem Sie die Metapher fortführen: „Angler warten nicht einfach, bis ein Fisch anbeißt – sie helfen ihrem Glück auf die Sprünge, indem sie anfüttern. Sie werfen Futter ins Wasser, das die Fische an den Platz lockt. Wie könnten Sie Ihre Wünsche anfüttern? Welche Voraussetzungen müssten Sie erfüllen, um die Wünsche näher heranzulocken? Denken Sie bitte an die Vergangenheit: Was haben Sie getan, als Sie den Wünschen am nächsten waren? Was davon könnten Sie wieder tun?“
6. Bitten Sie Ihren Klienten, sich den „Fangerfolg“ vorzustellen: „Was tun Angler, wenn sie einen tollen Fisch gefangen haben? Sie machen ein Fangfoto, auf dem sie zusammen mit dem Fisch zu sehen sind. Mal angenommen, Sie hätten Ihren Wunsch an Land gezogen und müssten ein Foto Ihres Lebens machen, aus dem hervorgeht: Jetzt hat sich mein Wunsch erfüllt! Welches Foto Ihres Lebens wäre das? Was wäre auf dem Foto des erfüllten Wunsches anders als zuvor? Was haben Sie zu dieser Veränderung beigetragen? Welche Menschen außer Ihnen würden das bemerken? Wie würden sie reagieren?“
Theo Petermeier sah sich bei der Frage nach dem Foto an einem großen Chefschreibtisch sitzen. Hinter ihm hing eine Weltkarte, auf der verschiedene Länder markiert waren – offenbar war das Unternehmen international tätig. Als Wünsche hatte er vorher schon genannt, Strategien zu entwickeln, Märkte zu erobern und interkulturell zu arbeiten. Sein Resümee: „Um meine Wünsche zu erfüllen, muss ich definitiv in die Wirtschaft, als Vorstand oder Geschäftsführer. Das habe ich immer schon gespürt, mir aber nicht eingestanden. Als verbeamteter Professor versaure ich. Bei dieser Berufswahl hat mich offenbar zu sehr das Vorbild meines Vaters geleitet.“ Der entspannte Blick in den Wunschteich verhalf ihm zu einem kapitalen Erkenntnis-Fang.
Weitere Fragen
In welcher Tiefe vermuten Sie Ihre Wünsche? Direkt unter der Oberfläche? Oder weiter unten?In welchen Situationen wagen sich Ihre Wünsche aus der Deckung? Und was tragen Sie selbst zu solchen Situationen bei?Manchmal passiert es, dass zwei Fische gleichzeitig auf den Köder stürmen und sich gegenseitig am Anbeißen hindern. Welche Ihrer Wünsche stehen sich im Weg?Was könnten Sie tun, um diese Wünsche in Einklang zu bringen?Wer unterstützt Sie dabei, Ihren Wunsch einzufangen? Was können Sie dazu beitragen, diese Unterstützung noch besser zu nutzen?Wer behindert Sie dabei? Was können Sie unternehmen, um dieses Sperrfeuer abzustellen?Bei Wilhelm Busch heißt es: „Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.“ Welche Wünsche wären Ihre nächs-ten, wenn sich dieser wichtige erfüllt hat?Varianten
Nicht jeder Klient muss seine Wünsche angeln. Manchmal gibt es eine individuelle Variante, die zu den Vorlieben des Klienten passt. Wer zum Beispiel in seiner Freizeit gern Pilze sucht, kann nach seinem persönlichen „Glückspilz“ suchen. An welchen Stellen seines Lebens vermutet er ihn? Wie unterscheidet sich dieser Pilz von den alltäglichen Pilzen? Durch welche Umstände wurde dieser Pilz vielleicht schon angefressen?
In jedem Fall ist es gut, die gedankliche Handlung in der Natur spielen zu lassen, denn ihr Bild beruhigt die meisten Menschen (weshalb auch Coachings im Wald so erfolgreich sind, siehe Seite 273 ff.). Dagegen verbinden sie Städte meist mit Arbeit, Stress und Erfolgsdruck.
Profi-Tipp