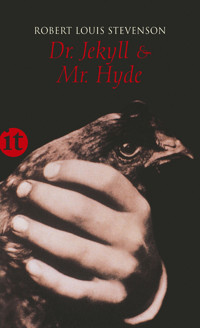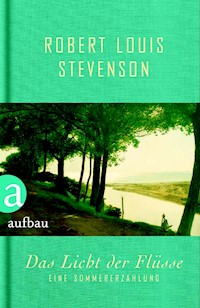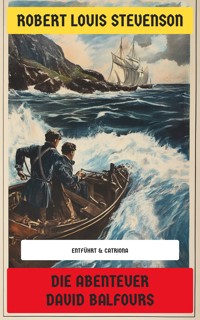
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Die Abenteuer David Balfours: Entführt & Catriona" von Robert Louis Stevenson umfasst zwei fesselnde Romane, die im Schottland des 18. Jahrhunderts spielen und durch eine spannende Handlung und tiefgründige Charaktere bestechen. Im ersten Roman, "Entführt", begleitet der Leser den jungen David Balfour, der nach dem Tod seines Vaters das Familienerbe einfordern möchte. Doch sein skrupelloser Onkel Ebenezer lockt ihn in eine Falle und lässt ihn auf ein Schiff verschleppen, das Kurs auf Amerika nimmt. David gerät in eine Welt voller Gefahren, Intrigen und Verrat. Er begegnet Alan Breck Stewart, einem mutigen jakobitischen Rebellen, mit dem ihn bald eine enge Freundschaft verbindet. Gemeinsam versuchen sie, sich zurück nach Schottland durchzuschlagen, während sie sowohl von englischen Soldaten als auch von feindlich gesinnten Clanmitgliedern verfolgt werden. Die Ereignisse spielen in einer Zeit, die stark durch politische Instabilität nach dem Aufstand der Jakobiten von 1745 geprägt ist. Die Fortsetzung "Catriona" setzt Davids Abenteuer nahtlos fort. Nachdem er zurück in Schottland ist, bemüht sich David, seine Reputation wiederherzustellen und Gerechtigkeit für sich und seinen Freund Alan zu erlangen. Dabei lernt er die mutige und willensstarke Catriona Drummond kennen, Tochter eines verfolgten jakobitischen Adligen. Während sich politische und persönliche Konflikte zuspitzen, kämpfen David und Catriona um Wahrheit, Loyalität und ihre wachsende gegenseitige Zuneigung. Stevenson greift hier erneut die Atmosphäre der Verfolgung und politischen Unruhe auf, die nach den gescheiterten Aufständen der Jakobiten herrschte und Schottland maßgeblich prägte. Die Romane schildern lebhaft die historischen Konflikte und sozialen Spannungen dieser turbulenten Periode. Stevenson verbindet meisterhaft historische Genauigkeit mit spannungsgeladenen Abenteuern und moralischen Fragen nach Freundschaft, Treue und Integrität. Dabei gelingt ihm eine eindrucksvolle Charakterzeichnung, insbesondere der Protagonisten David Balfour und Alan Breck, deren komplexe Freundschaft und individuelle Entwicklungen zentrale Themen der Bücher darstellen. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Abenteuer David Balfours
Inhaltsverzeichnis
Entführt
Kapitel I Ich mache mich auf den Weg zum Haus der Shaws
Ich fange die Geschichte meiner Abenteuer an einem bestimmten Morgen im Juni des Jahres 1751 an, als ich zum letzten Mal den Schlüssel aus der Tür meines Elternhauses nahm. Die Sonne schien gerade auf die Hügel, als ich die Straße entlangging, und als ich bei der Pfarrei ankam, zwitscherten die Amseln in den Fliederbüschen im Garten, und der Nebel, der in der Morgendämmerung über dem Tal gelegen hatte, begann sich zu lichten.
Herr Campbell, der Pfarrer von Essendean, wartete am Gartentor auf mich, ein guter Mann! Er fragte mich, ob ich gefrühstückt hätte, und als er hörte, dass es mir an nichts fehlte, nahm er meine Hand in seine beiden Hände und legte sie freundlich unter seinen Arm.
„Nun, Davie, mein Junge“, sagte er, „ich werde dich bis zur Furt begleiten, um dich auf den Weg zu bringen.“ Und wir gingen schweigend los.
„Ist es dir leid, Essendean zu verlassen?“, fragte er nach einer Weile.
„Nun, Herr“, sagte ich, „wenn ich wüsste, wohin ich gehe oder was aus mir werden soll, würde ich es Ihnen offen sagen. Essendean ist zwar ein guter Ort, und ich war dort sehr glücklich, aber ich war noch nie woanders. Da meine Eltern beide tot sind, bin ich in Essendean nicht näher bei ihnen als im Königreich Ungarn, und um ehrlich zu sein, wenn ich glauben würde, dass ich dort, wo ich hingehe, ein besseres Leben haben könnte, würde ich bereitwillig gehen.“
„Ja?“, sagte Herr Campbell. „Sehr gut, Davie. Dann ist es meine Pflicht, dir deine Zukunft vorauszusagen, soweit ich das kann. Als deine Mutter gestorben war und dein Vater (ein würdiger, christlicher Mann) sich dem Ende nahte, gab er mir einen Brief, den er mir als dein Erbe anvertraute. „Sobald ich tot bin und das Haus aufgeräumt und alles verkauft ist“ (was alles, Davie, bereits geschehen ist), „gib meinem Jungen diesen Brief und schick ihn zum Haus der Shaws, nicht weit von Cramond. Von dort stamme ich", sagte er, "und dorthin gehört mein Junge zurück. Er ist ein zuverlässiger Junge", sagte dein Vater, "und ein kluger Kerl; ich zweifle nicht, dass er sicher ankommen und dort, wo er hingeht, ein gutes Leben führen wird."
„Das Haus der Shaws!“, rief ich. „Was hatte mein armer Vater mit dem Haus der Shaws zu tun?“
„Nein“, sagte Herr Campbell, „wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Aber der Name dieser Familie, Davie, mein Junge, ist der Name, den du trägst – Balfours of Shaws: ein altes, ehrbares, angesehenes Haus, das in jüngster Zeit vielleicht etwas verfallen ist. Auch dein Vater war ein gebildeter Mann, wie es sich für seine Stellung gehörte; niemand leitete eine Schule auf plausiblere Weise; noch hatte er die Manieren oder die Worte eines gewöhnlichen Schulmeisters; aber (wie du dich selbst erinnern wirst) ich hatte immer Freude daran, ihn im Pfarrhaus zu empfangen, um den Adel zu treffen; und die aus meinem eigenen Hause, Campbell von Kilrennet, Campbell von Dunswire, Campbell von Minch und andere, allesamt angesehene Herren, hatten Freude an seiner Gesellschaft. Um dir alle Elemente dieser Angelegenheit vor Augen zu führen, hier ist der Testamentsbrief selbst, mit der Hand unseres verstorbenen Bruders überschrieben.
Er gab mir den Brief, der mit folgenden Worten adressiert war: „An Ebenezer Balfour, Esquire, Shaws, in seinem Haus in Shaws, dieser Brief wird dir von meinem Sohn David Balfour übergeben werden.“ Mein Herz schlug heftig bei dieser großartigen Aussicht, die sich nun plötzlich vor einem siebzehnjährigen Jungen, dem Sohn eines armen Landpfarrers im Wald von Ettrick, auftat.
„Herr Campbell“, stammelte ich, „wenn Sie an meiner Stelle wären, würden Sie gehen?“
„Gewiss“, sagte der Pfarrer, „das würde ich, und zwar ohne zu zögern. Ein hübscher Junge wie du sollte Cramond (das in der Nähe von Edinburgh liegt) in zwei Tagen zu Fuß erreichen können. Wenn das Schlimmste eintreten sollte und deine hohen Verwandten (von denen ich nur annehmen kann, dass sie irgendwie mit dir verwandt sind) dich vor die Tür setzen sollten, kannst du einfach die zwei Tage wieder zurücklaufen und an der Tür des Pfarrhauses anklopfen. Aber ich hoffe lieber, dass du gut aufgenommen wirst, wie dein armer Vater es für dich vorausgesagt hat, und dass du, soweit ich das beurteilen kann, mit der Zeit ein großer Mann wirst. Und hier, Davie, mein Junge“, fuhr er fort, „liegt es mir auf dem Herzen, diesen Abschied zu nutzen und dich gegen die Gefahren der Welt zu wappnen.“
Hier suchte er sich einen bequemen Platz, fand einen großen Felsbrocken unter einer Birke am Wegesrand, setzte sich mit sehr langem, ernstem Oberlippen, und die Sonne schien nun zwischen zwei Gipfeln auf uns herab, legte sein Taschentuch über seinen Dreispitz, um sich zu schützen. Dort warnte er mich mit erhobenem Zeigefinger vor einer ganzen Reihe von Irrlehren, denen ich nicht verfallen würde, und ermahnte mich, fleißig zu beten und die Bibel zu lesen. Dann zeichnete er mir das große Haus, in das ich kommen sollte, und erklärte mir, wie ich mich gegenüber den Bewohnern zu verhalten hatte.
„Sei nachgiebig, Davie, in unwichtigen Dingen“, sagte er. „Behalte dies im Gedächtnis: Obwohl du aus gutem Hause stammst, bist du auf dem Lande aufgewachsen. Bring uns nicht in Schande, Davie, bring uns nicht in Schande! Zeig dich in diesem großen, prächtigen Haus mit all diesen Bediensteten, ob oben oder unten, so nett, so umsichtig, so schnell im Begreifen und so langsam in den Worten wie alle anderen. Was den Gutsherrn angeht – denk daran, er ist der Gutsherr; mehr sage ich nicht: Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist eine Freude, einem Gutsherrn zu gehorchen; oder sollte es zumindest für junge Leute sein.“
„Nun gut, Herr“, sagte ich, „das mag sein, und ich verspreche Ihnen, dass ich mich bemühen werde, es so zu machen.“
„Sehr gut gesagt“, antwortete Herr Campbell herzlich. „Und nun zum Wesentlichen, oder (um ein Wortspiel zu machen) zum Unwesentlichen. Ich habe hier ein kleines Päckchen, das vier Dinge enthält.“ Während er sprach, zog er es mit einiger Mühe aus der Hosentasche seines Mantels. „Von diesen vier Dingen ist das erste dein rechtmäßiger Anteil: das kleine Geld für die Bücher und die Ausstattung deines Vaters, das ich (wie ich dir bereits erklärt habe) in der Absicht gekauft habe, es mit Gewinn an den neuen Lehrer weiterzuverkaufen. Die anderen drei sind Geschenke, über die Frau Campbell und ich uns freuen würden, wenn du sie annimmst. Das erste, das rund ist, wird dir wahrscheinlich auf Anhieb am besten gefallen; aber, oh Davie, mein Junge, es ist nur ein Tropfen Wasser im Meer; es wird dir nur einen Schritt weiterhelfen und dann verschwinden wie der Morgen. Das zweite, das flach und quadratisch ist und eine Inschrift trägt, wird dir ein Leben lang zur Seite stehen, wie ein guter Stab für unterwegs und ein gutes Kopfkissen in Zeiten der Krankheit. Und das letzte, das würfelförmig ist, wird dich, so ist es mein Gebet, in ein besseres Land bringen.“
Damit stand er auf, nahm seinen Hut ab und betete eine Weile laut und mit bewegenden Worten für einen jungen Mann, der in die Welt hinausgeht; dann nahm er mich plötzlich in seine Arme und umarmte mich sehr fest; dann hielt er mich auf Armeslänge von sich, sah mich mit einem Gesicht voller Trauer an; dann drehte er sich um, rief mir zum Abschied zu und machte sich rückwärts auf den Weg, den wir gekommen waren, in einer Art Trab. Für andere hätte das vielleicht lustig aussehen können, aber ich war nicht zum Lachen aufgelegt. Ich sah ihm nach, solange er zu sehen war, und er blieb nicht stehen und schaute nicht einmal zurück. Dann wurde mir klar, dass all dies seine Trauer über meine Abreise war, und mein Gewissen plagte mich, denn ich war überglücklich, aus dieser ruhigen Gegend wegzukommen und in ein großes, geschäftiges Haus zu ziehen, unter reiche und angesehene Leute meines Namens und Blutes.
„Davie, Davie“, dachte ich, „hat es je eine solche Undankbarkeit gegeben? Kannst du alte Gefälligkeiten und alte Freunde vergessen, nur weil jemand deinen Namen ruft? Schäm dich!“
Und ich setzte mich auf den Felsbrocken, den der gute Mann gerade verlassen hatte, und öffnete das Päckchen, um zu sehen, was ich geschenkt bekommen hatte. Was er als würfelförmig bezeichnet hatte, daran hatte ich nie gezweifelt; es war tatsächlich eine kleine Bibel, die man in einem Plaid-Neuk mit sich tragen konnte. Das, was er rund genannt hatte, stellte sich als ein Schilling heraus, und das dritte, das mir mein Leben lang in Gesundheit und Krankheit so wunderbar helfen sollte, war ein kleines Stück grobes gelbes Papier, auf das mit roter Tinte geschrieben stand:
„UM MAIGLÖCKCHENWASSER ZU HERSTELLEN. – Nimm die Blüten der Maiglöckchen, destilliere sie in einem Sack und trink ein oder zwei Löffel davon, wenn es nötig ist. Es gibt denen, die stumm sind, die Sprache zurück. Es hilft gegen Gicht, tröstet das Herz und stärkt das Gedächtnis. Die Blüten in ein Glas geben, gut verschließen, einen Monat lang in einen Ameisenhaufen stellen, dann herausnehmen, und du wirst eine Flüssigkeit finden, die aus den Blüten kommt. Diese in einer Flasche aufbewahren; sie ist gut, ob man krank ist oder gesund, ob Mann oder Frau.“
Und dann fügte der Pfarrer eigenhändig hinzu:
„Ebenso bei Verstauchungen einreiben; und bei Koliken eine große Löffelvoll pro Stunde.“
Ich musste darüber lachen, aber es war eher ein zittriges Lachen, und ich war froh, mein Bündel wieder auf meinen Stab zu bekommen und machte mich auf den Weg über die Furt und den Hügel auf der anderen Seite hinauf, bis ich, gerade als ich auf den breiten, durch das Heidekraut führenden Weg kam, einen letzten Blick auf Kirk Essendean warf, auf die Bäume um das Pfarrhaus und die großen Ebereschen auf dem Friedhof, wo mein Vater und meine Mutter begraben lagen.
Kapitel II Ich komme ans Ziel meiner Reise
Am Vormittag des zweiten Tages kam ich auf die Spitze eines Hügels und sah das ganze Land vor mir bis zum Meer hinabfallen; und mitten in diesem Abhang, auf einem langen Bergrücken, lag die Stadt Edinburgh und rauchte wie ein Brennofen. Auf der Burg wehte eine Flagge, und im Firth bewegten sich Schiffe oder lagen vor Anker; beides konnte ich trotz der Entfernung deutlich erkennen, und beides ließ mein Heimatgefühl in mir aufkommen.
Kurz darauf kam ich an einem Haus vorbei, in dem ein Schäfer wohnte, und bekam eine grobe Wegbeschreibung in die Nähe von Cramond; und so arbeitete ich mich von einem zum anderen nach Westen der Hauptstadt bei Colinton vor, bis ich auf die Straße nach Glasgow kam. Und dort sah ich zu meiner großen Freude und Verwunderung ein Regiment zu Pfeifen marschieren, jeder Fuß im Takt; an einem Ende ein alter rotgesichtiger General auf einem grauen Pferd und am anderen Ende die Kompanie der Grenadiere mit ihren Papamützen. Der Stolz des Lebens schien mir bei dem Anblick der roten Mäntel und beim Hören dieser fröhlichen Musik in den Kopf zu steigen.
Ein Stück weiter sagte man mir, ich sei in der Gemeinde Cramond, und ich begann, in meinen Fragen den Namen des Hauses Shaws zu nennen. Das Wort schien diejenigen, die ich nach dem Weg fragte, zu überraschen. Zuerst dachte ich, dass mein schlichtes Aussehen in meiner ländlichen Kleidung und der Staub von der Straße nicht zu der Pracht des Ortes passten, zu dem ich unterwegs war. Aber nachdem mir zwei oder vielleicht drei Leute denselben Blick zugeworfen und dieselbe Antwort gegeben hatten, begann ich zu begreifen, dass mit dem Haus Shaws etwas seltsam war.
Um diese Befürchtung zu zerstreuen, änderte ich die Form meiner Nachfragen und fragte einen ehrlichen Kerl, der auf dem Laufpass seines Karren eine Gasse entlangkam, ob er jemals von einem Haus namens Shaws gehört habe.
Er hielt seinen Karren an und sah mich an, wie die anderen auch.
„Ja“, sagte er. „Wofür?“
„Ist es ein großes Haus?“, fragte ich.
„Zweifellos“, sagte er. „Das Haus ist ein großes, mächtiges Haus.“
„Ja“, sagte ich, „aber die Leute, die darin wohnen?“
„Leute?“, rief er. „Bist du verrückt? Da ist niemand – niemand, den man Leute nennen könnte.“
„Was?“, sagte ich, „nicht Herr Ebenezer?“
„Oh ja“, sagte der Mann, „da ist der Gutsherr, wenn du ihn suchst. Was führt dich hierher, Mann?“
„Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich hier eine Stelle bekommen könnte“, sagte ich und sah so bescheiden aus, wie ich konnte.
„Was?“, schrie der Fuhrmann so laut, dass sogar sein Pferd scheute, und dann fügte er hinzu: „Nun gut, Mann, das geht mich nichts an, aber du scheinst ein anständiger Junge zu sein, und wenn du auf mich hörst, halte dich von den Shaws fern.“
Der nächste, den ich traf, war ein kleiner, gepflegter Mann mit einer schönen weißen Perücke, den ich als Friseur auf seiner Runde erkannte; und da ich wusste, dass Friseure große Schwätzer sind, fragte ich ihn ganz offen, was für ein Mann Herr Balfour von den Shaws sei.
„Schrei, Schrei, Schrei“, sagte der Friseur, „kein guter Mensch, überhaupt kein guter Mensch“, und begann mich sehr schlau zu fragen, was ich hier wolle; aber ich war ihm mehr als gewachsen, und er ging zu seinem nächsten Kunden, ohne etwas mehr zu erfahren, als er gekommen war.
Ich kann den Schlag, den das meinen Illusionen versetzte, nicht gut beschreiben. Je undeutlicher die Anschuldigungen waren, desto weniger gefielen sie mir, denn sie ließen der Fantasie viel Spielraum. Was für ein großes Haus war das, dass die ganze Gemeinde aufschreckte und starrte, wenn man nach dem Weg dorthin fragte? Oder was für ein Gentleman war das, dass sein schlechter Ruf sich so an der Straße herumreifte? Wenn mich eine Stunde Fußmarsch nach Essendean zurückgebracht hätte, hätte ich mein Abenteuer auf der Stelle abgebrochen und wäre zu Herrn Campbell zurückgekehrt. Aber da ich schon so weit gekommen war, ließ mich meine Scham nicht aufgeben, bevor ich die Sache nicht auf die Probe gestellt hatte; aus bloßer Selbstachtung war ich entschlossen, sie zu Ende zu bringen, und so wenig mir das, was ich gehört hatte, gefiel und so langsam ich auch vorankam, fragte ich weiter nach dem Weg und ging weiter.
Es ging schon auf die Abendzeit zu, als ich eine stämmige, dunkle, mürrisch aussehende Frau traf, die einen Hügel hinunterkam; und als ich ihr meine übliche Frage stellte, drehte sie sich scharf um, begleitete mich zurück zu dem Gipfel, den sie gerade verlassen hatte, und zeigte auf ein großes, sehr karges Gebäude, das auf einer Wiese im nächsten Tal stand. Die Gegend war schön, mit niedrigen Hügeln, viel Wasser und Wäldern, und die Felder sahen für mich super aus; aber das Haus selbst sah aus wie eine Ruine; es gab keinen Weg dorthin, aus den Schornsteinen kam kein Rauch, und es gab auch keinen Garten. Mir sank das Herz. „Das da!“, rief ich.
Das Gesicht der Frau hellte sich mit bösartiger Wut auf. „Das ist das Haus der Shaws!“, rief sie. „Blut hat es erbaut, Blut hat den Bau gestoppt, Blut wird es zu Fall bringen. Seht her!“, rief sie wieder – „Ich spucke auf den Boden und knacke mit dem Daumen! Schwarz soll sein Untergang sein! Wenn ihr den Gutsherrn seht, sagt ihm, was ihr gehört habt; sagt ihm, dass dies das zwölfte Mal ist, dass Jennet Clouston den Fluch über ihn und sein Haus, seine Scheune und seinen Stall, seine Männer, Gäste und Herren, seine Frau, Fräulein und Kinder gebracht hat – schwarz, schwarz soll ihr Untergang sein!“
Und die Frau, deren Stimme sich zu einer Art unheimlichem Gesang erhoben hatte, drehte sich mit einem Sprung um und war verschwunden. Ich blieb stehen, wo sie mich zurückgelassen hatte, mit zu Berge stehenden Haaren. Damals glaubten die Leute noch an Hexen und zitterten vor Flüchen; und dieser Fluch, der so passend wie ein Omen am Wegesrand kam, um mich von meinem Vorhaben abzuhalten, raubte mir den Boden unter den Füßen.
Ich setzte mich hin und starrte auf das Haus der Shaws. Je länger ich hinschaute, desto schöner erschien mir die Landschaft: überall blühende Weißdornbüsche, mit Schafen übersäte Felder, ein schöner Schwarm Krähen am Himmel und alle Anzeichen eines guten Bodens und Klimas; und doch störte mich die Baracke inmitten dieser Idylle.
Während ich dort am Rand des Grabens saß, kamen Bauern von den Feldern vorbei, aber mir fehlte die Energie, ihnen einen guten Abend zu wünschen. Endlich ging die Sonne unter, und dann sah ich direkt vor dem gelben Himmel eine Rauchwolke aufsteigen, die mir nicht viel dichter erschien als der Rauch einer Kerze; aber sie war da und bedeutete Feuer, Wärme, Essen und einen lebenden Bewohner, der sie entzündet haben musste; und das tröstete mein Herz.
Also machte ich mich auf den Weg, einem schwachen Pfad im Gras folgend, der in meine Richtung führte. Er war wirklich sehr schwach, um der einzige Weg zu einer Behausung zu sein, doch ich sah keinen anderen. Bald führte er mich zu aufrecht stehenden Steinen, neben denen eine Hütte ohne Dach stand, auf deren Spitze Wappen prangten. Es war eindeutig als Haupteingang gedacht, aber nie fertiggestellt worden; anstelle von schmiedeeisernen Toren waren zwei Hürden mit einem Strohseil zusammengebunden; und da es weder Parkmauern noch Anzeichen einer Allee gab, führte der Pfad, dem ich folgte, rechts an den Säulen vorbei und schlängelte sich weiter in Richtung des Hauses.
Je näher ich kam, desto trostloser erschien es mir. Es sah aus wie ein Flügel eines Hauses, das nie fertiggestellt worden war. Was das innere Ende hätte sein sollen, stand in den oberen Stockwerken offen und ragte mit unvollendeten Mauerwerken und Treppen gegen den Himmel. Viele der Fenster waren unverglas, und Fledermäuse flogen hinein und heraus wie Tauben aus einem Taubenschlag.
Als ich näher kam, begann es zu dämmern, und in drei der unteren Fenster, die sehr hoch und schmal und gut vergittert waren, begann das flackernde Licht eines kleinen Feuers zu schimmern. War das der Palast, zu dem ich gekommen war? Sollte ich innerhalb dieser Mauern neue Freunde finden und ein großes Vermögen machen? In meinem Vaterhaus am Essen-Ufer waren das Feuer und die hellen Lichter noch aus einer Entfernung von einer Meile zu sehen, und die Tür stand offen, wenn ein Bettler klopfte!
Ich näherte mich vorsichtig und lauschte, während ich ging, und hörte jemanden mit Geschirr klappern und einen kleinen trockenen, eifrigen Husten, der in Anfällen kam; aber es war kein Wort zu hören, und kein Hund bellte.
Die Tür, so gut ich sie im trüben Licht erkennen konnte, war ein großes Stück Holz, das mit Nägeln gespickt war; und ich hob zögernd die Hand unter meiner Jacke und klopfte einmal. Dann stand ich da und wartete. Das Haus war in eine Totenstille versunken; eine ganze Minute verging, und nichts regte sich außer den Fledermäusen über mir. Ich klopfte wieder und lauschte erneut. Inzwischen hatten sich meine Ohren so an die Stille gewöhnt, dass ich das Ticken der Uhr im Inneren hören konnte, die langsam die Sekunden zählte; aber wer auch immer in diesem Haus war, verhielt sich totenstill und musste den Atem angehalten haben.
Ich war hin- und hergerissen, ob ich weglaufen sollte, aber meine Wut gewann die Oberhand, und stattdessen begann ich, mit Füßen gegen die Tür zu treten und zu schlagen und laut nach Herrn Balfour zu rufen. Ich war in voller Fahrt, als ich direkt über mir ein Husten hörte, zurücksprang und nach oben schaute und den Kopf eines Mannes in einer hohen Nachtmütze und den Lauf einer Donnerbüchse an einem der Fenster im ersten Stock sah.
„Sie ist geladen“, sagte eine Stimme.
„Ich bin mit einem Brief hier“, sagte ich, „für Herrn Ebenezer Balfour aus Shaws. Ist er da?“
„Von wem ist er?“, fragte der Mann mit der Donnerbüchse.
„Das geht dich nichts an“, sagte ich, denn ich wurde langsam wütend.
„Na gut“, war die Antwort, „du kannst ihn auf die Türschwelle legen und dann verschwinden.“
„Das werde ich nicht tun“, rief ich. „Ich werde ihn Herrn Balfour persönlich übergeben, wie es meine Aufgabe ist. Es ist ein Empfehlungsschreiben.“
„Ein was?“, rief die Stimme scharf.
Ich wiederholte, was ich gesagt hatte.
„Wer bist du überhaupt?“, kam nach einer längeren Pause die nächste Frage.
„Ich schäme mich nicht für meinen Namen“, sagte ich. „Man nennt mich David Balfour.“
Da war ich mir sicher, dass der Mann zusammenzuckte, denn ich hörte die Donnerbüchse auf der Fensterbank klappern; und nach einer ziemlich langen Pause und mit einer merkwürdigen Veränderung in der Stimme folgte die nächste Frage:
„Ist dein Vater tot?“
Ich war so überrascht, dass ich keine Stimme fand, um zu antworten, sondern nur dastand und starrte.
„Ja“, fuhr der Mann fort, „er ist zweifellos tot, und das ist es wohl, was dich an meine Tür treibt.“ Nach einer weiteren Pause sagte er trotzig: „Na gut, Mann“, sagte er, „ich lasse dich rein“, und verschwand vom Fenster.
Kapitel III Ich lerne meinen Onkel kennen
Bald darauf kam ein lautes Klappern von Ketten und Riegeln, und die Tür wurde vorsichtig geöffnet und wieder hinter mir geschlossen, sobald ich hindurchgegangen war.
„Geh in die Küche und rühr nichts an“, sagte die Stimme, und während der Hausherr sich daran machte, die Tür wieder zu sichern, tastete ich mich vorwärts und betrat die Küche.
Das Feuer brannte ziemlich hell und zeigte mir den kargsten Raum, den ich je gesehen hatte. Ein halbes Dutzend Teller standen auf den Regalen; der Tisch war für das Abendessen gedeckt mit einer Schüssel Haferbrei, einem Hornlöffel und einem Becher mit dünnem Bier. Außer dem, was ich schon erwähnt habe, gab es in dieser großen, steinernen, leeren Kammer nichts weiter als fest verschlossene Truhen, die entlang der Wand standen, und einen Eckschrank mit einem Vorhängeschloss.
Sobald die letzte Kette hochgezogen war, kam der Mann zu mir zurück. Er war ein gemeiner, gebeugter, schmaler, lehmgesichtiger Kerl, dessen Alter zwischen fünfzig und siebzig liegen könnte. Seine Nachtmütze war aus Flanell, ebenso wie das Nachthemd, das er anstelle von Mantel und Weste über seinem zerlumpten Hemd trug. Er war lange nicht rasiert, aber was mich am meisten beunruhigte und sogar einschüchterte, war, dass er weder seinen Blick von mir abwandte noch mir direkt ins Gesicht sah. Was er war, ob von Beruf oder von Geburt, konnte ich nicht erraten, aber er sah aus wie ein alter, nutzloser Diener, der gegen Kost und Loge in diesem großen Haus zurückgelassen worden war.
„Bist du hungrig?“, fragte er und blickte auf etwa die Höhe meiner Knie. „Kannst du diesen Brei essen?“
Ich sagte, ich fürchte, das sei sein eigenes Abendessen.
„Ach“, sagte er, „ich komme schon ohne zurecht. Aber ich nehme das Bier, das befeuchtet meinen Husten.“ Er trank die Tasse etwa zur Hälfte leer, wobei er mich weiterhin im Auge behielt, und streckte dann plötzlich seine Hand aus. „Lass mich den Brief sehen“, sagte er.
Ich sagte ihm, der Brief sei für Herrn Balfour, nicht für ihn.
„Und wer glaubst du, wer ich bin?“, sagte er. „Gib mir Alexanders Brief.“
„Du kennst den Namen meines Vaters?“
„Das wäre seltsam, wenn ich ihn nicht wüsste“, antwortete er, „denn er war mein leiblicher Bruder; und so wenig du mich, mein Haus oder meinen guten Haferbrei zu mögen scheinst, bin ich doch dein leiblicher Onkel, Davie, mein Junge, und du bist mein leiblicher Neffe. Also gib mir den Brief, setz dich und füll deinen Becher.“
Wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen, hätte ich vor Scham, Müdigkeit und Enttäuschung wohl in Tränen ausgebrochen. So aber fand ich keine Worte, weder schwarz noch weiß, sondern reichte ihm den Brief und setzte mich mit so wenig Appetit auf Fleisch hin, wie es ein junger Mann nur haben kann.
Währenddessen beugte sich mein Onkel über das Feuer und drehte den Brief in seinen Händen hin und her.
„Weißt du, was darin steht?“, fragte er plötzlich.
„Sie sehen doch selbst, Herr“, sagte ich, „dass das Siegel nicht gebrochen ist.“
„Ja“, sagte er, „aber was hat dich hierher gebracht?“
„Um den Brief zu bringen“, sagte ich.
„Nein“, sagte er schlau, „aber du hattest zweifellos irgendwelche Hoffnungen?“
„Ich gestehe, Herr“, sagte ich, „als mir gesagt wurde, dass ich wohlhabende Verwandte habe, habe ich mir tatsächlich die Hoffnung gemacht, dass sie mir in meinem Leben helfen könnten. Aber ich bin kein Bettler; ich erwarte keine Gefälligkeiten von Ihnen und ich will keine, die nicht freiwillig gegeben werden. Denn so arm ich auch bin, ich habe Freunde, die mir gerne helfen werden.“
„Hü, hü!“, sagte Onkel Ebenezer, „reg dich nicht so auf. Wir werden uns schon einigen. Und, Davie, mein Mann, wenn du mit deinem Porridge fertig bist, könnte ich selbst einen Schluck davon nehmen. Ja“, fuhr er fort, sobald er mich vom Hocker und vom Löffel verdrängt hatte, „das ist gutes, gesundes Essen – Porridge ist ein großartiges Essen.“ Er murmelte ein kleines Tischgebet und begann zu essen. „Dein Vater mochte sein Essen sehr gern, ich erinnere mich; er war ein herzlicher, wenn auch kein großer Esser; aber ich selbst konnte nie mehr als ein paar Bissen hinunterbekommen.“ Er nahm einen Schluck vom schwachen Bier, das ihn wahrscheinlich an seine gastfreundlichen Pflichten erinnerte, denn seine nächsten Worte lauteten: „Wenn du Durst hast, findest du Wasser hinter der Tür.“
Darauf gab ich keine Antwort, stand steif auf meinen beiden Beinen und blickte mit mächtigem Zorn im Herzen auf meinen Onkel herab. Er seinerseits aß weiter wie jemand, der unter Zeitdruck stand, und warf mir ab und zu kurze, stechende Blicke zu, mal auf meine Schuhe, mal auf meine selbstgestrickten Strümpfe. Einmal nur, als er es wagte, etwas höher zu schauen, trafen sich unsere Blicke, und kein Dieb, der mit der Hand in der Tasche eines Mannes erwischt worden wäre, hätte lebhaftere Zeichen der Angst zeigen können. Das brachte mich zum Nachdenken, ob seine Schüchternheit vielleicht daher rührte, dass er zu lange keinen menschlichen Umgang gehabt hatte, und ob sie sich vielleicht nach einer kleinen Probe verflüchtigen könnte und mein Onkel sich dann in einen ganz anderen Menschen verwandeln würde. Aus diesen Gedanken riss mich seine scharfe Stimme.
„Ist dein Vater schon lange tot?“, fragte er.
„Seit drei Wochen, Herr“, sagte ich.
„Er war ein geheimnisvoller Mann, Alexander – ein geheimnisvoller, schweigsamer Mann“, fuhr er fort. „Er hat nie viel gesagt, als er jung war. Er hat nie viel von mir gesprochen, oder?“
„Ich wusste nicht, Herr, bis du es mir selbst gesagt hast, dass er einen Bruder hatte.“
„Meine Güte, meine Güte!“, sagte Ebenezer. „Und auch nicht von Shaws, nehme ich an?“
„Nicht einmal den Namen, Sir“, sagte ich.
„Stell dir das mal vor!“, sagte er. „Was für ein seltsamer Mensch!“ Trotzdem schien er seltsam zufrieden zu sein, aber ob mit sich selbst, mit mir oder mit dem Verhalten meines Vaters, konnte ich nicht sagen. Auf jeden Fall schien er jedoch seine anfängliche Abneigung oder Feindseligkeit mir gegenüber zu überwinden, denn kurz darauf sprang er auf, kam hinter mir durch den Raum und schlug mir freundschaftlich auf die Schulter. „Wir werden uns noch gut verstehen!“, rief er. „Ich bin froh, dass ich dich hereingelassen habe. Und jetzt geh ins Bett.“
Zu meiner Überraschung zündete er keine Lampe oder Kerze an, sondern ging in den dunklen Gang, tastete sich vorwärts, atmete tief und blieb vor einer Tür stehen, die er aufschloss. Ich war ihm dicht auf den Fersen, nachdem ich ihm so gut ich konnte gefolgt war, und dann bat er mich einzutreten, denn das sei mein Zimmer. Ich tat, wie er mir sagte, blieb aber nach ein paar Schritten stehen und bat um Licht, um ins Bett gehen zu können.
„Pst!“, sagte Onkel Ebenezer, „der Mond scheint hell.“
„Weder Mond noch Sterne, Herr, und stockfinster“, * sagte ich. „Ich kann das Bett nicht sehen.“
* Dunkel wie in einer Grube.
„Schrei-Schrei, Schrei-Schrei!“, sagte er. „Lichter im Haus sind etwas, womit ich mich nicht anfreunden kann. Ich habe große Angst vor Feuer. Gute Nacht, Davie, mein Junge.“ Und bevor ich Zeit hatte, weiter zu protestieren, zog er die Tür zu und ich hörte, wie er mich von außen einschloss.
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Der Raum war kalt wie ein Brunnen, und das Bett, als ich es gefunden hatte, feucht wie ein Torfklumpen; aber zum Glück hatte ich mein Bündel und meine Decke mitgenommen, und ich rollte mich darin ein, legte mich auf den Boden im Windschatten des großen Bettgestells und schlief schnell ein.
Bei Tagesanbruch öffnete ich die Augen und fand mich in einem großen Raum wieder, der mit geprägtem Leder behängt, mit fein bestickten Möbeln eingerichtet und von drei schönen Fenstern beleuchtet war. Vor zehn oder vielleicht zwanzig Jahren muss es ein Zimmer gewesen sein, in dem man sich so wohl fühlen konnte, wie man es sich nur wünschen konnte, aber Feuchtigkeit, Schmutz, Nichtbenutzung und Mäuse und Spinnen hatten seitdem ihr Werk getan. Außerdem waren viele Fensterscheiben zerbrochen, was in diesem Haus so üblich war, dass ich glaube, mein Onkel musste irgendwann eine Belagerung durch seine empörten Nachbarn überstanden haben – vielleicht mit Jennet Clouston an ihrer Spitze.
Inzwischen schien draußen die Sonne, und da es in diesem elenden Zimmer sehr kalt war, klopfte und schrie ich, bis mein Kerkermeister kam und mich herausließ. Er trug mich zur Rückseite des Hauses, wo sich ein Brunnen befand, und sagte mir, ich solle „mir dort das Gesicht waschen, wenn ich wolle“. Als ich das getan hatte, machte ich mich so gut es ging auf den Weg zurück in die Küche, wo er das Feuer angezündet hatte und den Brei kochte. Der Tisch war mit zwei Bowls und zwei Hornlöffeln gedeckt, aber es gab nur dieselbe kleine Menge Bier. Vielleicht fiel mir das mit einiger Überraschung auf, und vielleicht bemerkte es mein Onkel, denn er sprach, als würde er meine Gedanken erraten, und fragte mich, ob ich ein Ale trinken wolle – so nannte er es.
Ich sagte ihm, dass ich das nicht gewohnt sei, er sich aber keine Umstände machen solle.
„Nein, nein“, sagte er, „ich werde dir nichts abschlagen, was vernünftig ist.“
Er holte einen weiteren Becher vom Regal und dann, zu meiner großen Überraschung, anstatt mehr Bier einzuschenken, goss er genau die Hälfte aus einem Becher in den anderen. Das hatte etwas Nobles an sich, das mir den Atem raubte; wenn mein Onkel auch ein Geizhals war, dann gehörte er zu der Sorte, die diesem Laster fast Respekt einflößte.
Als wir mit dem Essen fertig waren, öffnete mein Onkel Ebenezer eine Schublade, holte eine Tonpfeife und einen Klumpen Tabak heraus, schnitt sich eine Prise ab und schloss die Schublade wieder. Dann setzte er sich in die Sonne an eines der Fenster und rauchte schweigend. Von Zeit zu Zeit wanderte sein Blick zu mir, und er stellte eine seiner Fragen. Einmal fragte er: „Und deine Mutter?“ Als ich ihm sagte, dass auch sie tot sei, antwortete er: „Ja, sie war ein hübsches Mädchen!“ Nach einer weiteren langen Pause fragte er: „Wer waren diese Freunde von dir?“
Ich erzählte ihm, dass es verschiedene Herren namens Campbell waren, obwohl es eigentlich nur einen gab, nämlich den Pfarrer, der mich jemals beachtet hatte; aber ich begann zu denken, dass mein Onkel meine Lage zu leicht nahm, und da ich mit ihm allein war, wollte ich nicht, dass er mich für hilflos hielt.
Er schien darüber nachzudenken und sagte dann: „Davie, mein Junge, du bist an den richtigen Mann gekommen, zu deinem Onkel Ebenezer. Ich habe eine hohe Meinung von deiner Familie und werde das Richtige für dich tun, aber während ich noch darüber nachdenke, was das Beste für dich ist – ob das Gesetz, das Priesteramt oder vielleicht die Armee, was Jungen ja am liebsten mögen –, möchte ich nicht, dass die Balfours vor einer Horde Hieland Campbells gedemütigt werden, und ich bitte dich, deine Zunge im Zaum zu halten. Keine Briefe, keine Nachrichten, kein Wort zu irgendjemandem, sonst – da ist meine Tür.“
„Onkel Ebenezer“, sagte ich, „ich habe keinen Grund anzunehmen, dass du mir etwas Böses willst. Trotzdem möchte ich, dass du weißt, dass ich meinen Stolz habe. Ich bin nicht aus freiem Willen zu dir gekommen, und wenn du mir wieder die Tür vor der Nase zuschlägst, werde ich dich beim Wort nehmen.“
Er schien zutiefst gekränkt. „Hoots-toots“, sagte er, „ca“ cannie, Mann – ca„ cannie! Bleib ein oder zwei Tage. Ich bin kein Zauberer, der dir in einer Haferflockenschüssel dein Glück vorhersagen kann, aber gib mir ein oder zwei Tage Zeit, sag niemandem etwas, und so sicher wie das Amen in der Kirche werde ich das Richtige für dich tun.“
„Na gut“, sagte ich, „genug gesagt. Wenn du mir helfen willst, werde ich mich zweifellos darüber freuen und dir von ganzem Herzen dankbar sein.“
Mir schien (vielleicht etwas voreilig), dass ich die Oberhand über meinen Onkel gewann, und ich begann damit, dass ich das Bett und die Bettwäsche gelüftet und in die Sonne zum Trocknen gelegt haben wollte, denn in diesem Dreck konnte ich unmöglich schlafen.
„Ist das mein Haus oder deins?“, sagte er mit schriller Stimme und brach dann plötzlich ab. „Nein, nein“, sagte er, „das habe ich nicht so gemeint. Was mein ist, ist dein, Davie, mein Mann, und was dein ist, ist mein. Blut ist dicker als Wasser, und außer dir und mir gibt es niemanden, der diesen Namen verdient.“ Und dann schwafelte er weiter über die Familie und ihren früheren Ruhm und seinen Vater, der mit dem Ausbau des Hauses begonnen hatte, und dass er selbst den Bau als sündhafte Verschwendung eingestellt hatte; und das brachte mich auf die Idee, ihm Jennet Cloustons Nachricht zu überbringen.
„Die Hure!“, schrie er. „Zwölfhundertfünfzehn – das ist alles, was ich seit dem Hurenstreit verdient habe! * Halt dich fest, David, ich werde sie auf rotem Torf braten lassen, bevor ich damit fertig bin! Eine Hexe – eine erklärte Hexe! Ich werde zum Gerichtsdiener gehen.“
* Verkauft.
Damit öffnete er eine Truhe, holte einen sehr alten und gut erhaltenen blauen Mantel und eine Weste sowie einen recht guten Biberhut hervor, beide ohne Spitzen. Diese warf er sich über, nahm einen Stock aus dem Schrank, schloss alles wieder ab und wollte gerade aufbrechen, als ihn ein Gedanke zurückhielt.
„Ich kann dich nicht allein im Haus lassen“, sagte er. „Ich muss dich aussperren.“
Das Blut schoss mir ins Gesicht. „Wenn du mich aussperrst“, sagte ich, „siehst du mich zum letzten Mal als Freund.“
Er wurde ganz blass und presste die Lippen aufeinander.
„So geht das nicht“, sagte er und schaute böse auf eine Ecke des Bodens. „So gewinnst du meine Gunst nicht, David.“
„Herr“, sagte ich, „bei aller Ehrerbietung für Ihr Alter und unser gemeinsames Blut, ich schätze Ihre Gunst nicht auf einen Pfennig. Ich bin mit einem gesunden Selbstwertgefühl erzogen worden, und selbst wenn Sie mein einziger Onkel und meine einzige Familie auf der Welt wären, würde ich Ihre Zuneigung nicht zu einem solchen Preis kaufen.“
Onkel Ebenezer ging zum Fenster und schaute eine Weile hinaus. Ich konnte sehen, wie er zitterte und zuckte wie ein Mann mit Parkinson. Aber als er sich umdrehte, hatte er ein Lächeln auf den Lippen.
„Na gut“, sagte er, „wir müssen es ertragen und erdulden. Ich werde nicht gehen, das ist alles, was dazu zu sagen ist.“
„Onkel Ebenezer“, sagte ich, „ich verstehe das alles nicht. Du behandelst mich wie einen Dieb; du hasst es, mich in diesem Haus zu haben; du zeigst mir das mit jedem Wort und jeder Minute: Es ist unmöglich, dass du mich magst; und ich habe mit dir gesprochen, wie ich nie gedacht hätte, mit einem Menschen zu sprechen. Warum willst du mich dann behalten? Lass mich zurückgehen – lass mich zurückgehen zu meinen Freunden, die mich mögen!“
„Nein, nein, nein“, sagte er sehr ernst. „Ich mag dich sehr; wir werden uns schon noch einigen; und um der Ehre des Hauses willen kann ich dich nicht so gehen lassen, wie du gekommen bist. Bleib hier ruhig, mein guter Junge; bleib einfach ein bisschen hier, und du wirst sehen, dass wir uns einigen werden.“
„Nun gut, Herr“, sagte ich, nachdem ich in Stille über die Sache nachgedacht hatte, „ich werde eine Weile bleiben. Es ist gerechter, dass mir mein eigenes Blut hilft als Fremde; und wenn wir uns nicht einigen können, werde ich mein Bestes tun, dass es nicht meine Schuld ist.“
Kapitel IV Ich bin im Haus der Shaws in großer Gefahr
Für einen Tag, der so schlecht angefangen hatte, verlief er recht gut. Mittags gab es wieder kalten Brei und abends heißen Brei; Brei und schwaches Bier waren die Kost meines Onkels. Er sprach nur wenig und das wie zuvor, indem er mir nach langem Schweigen eine Frage entlockte; und als ich versuchte, ihn auf meine Zukunft zu bringen, wich er wieder aus. In einem Zimmer neben der Küche, in das er mich gehen ließ, fand ich eine große Anzahl lateinischer und englischer Bücher, an denen ich den ganzen Nachmittag große Freude hatte. Tatsächlich verging die Zeit in dieser guten Gesellschaft so schnell, dass ich mich fast mit meinem Aufenthalt bei den Shaws abgefunden hatte; nur der Anblick meines Onkels und seine Augen, die mit meinen Verstecken spielten, ließen mein Misstrauen wieder aufleben.
Eine Sache entdeckte ich jedoch, die mich etwas zweifeln ließ. Es war ein Eintrag auf der Innenseite eines Taschenbuchs (eines von Patrick Walker), der eindeutig von der Hand meines Vaters stammte und wie folgt lautete: „Für meinen Bruder Ebenezer zu seinem fünften Geburtstag.“ Was mich nun verwirrte, war Folgendes: Da mein Vater natürlich der jüngere Bruder war, musste er entweder einen seltsamen Fehler gemacht haben oder aber schon vor seinem fünften Geburtstag eine ausgezeichnete, klare und männliche Handschrift gehabt haben.
Ich versuchte, diesen Gedanken abzuschalten, aber obwohl ich viele interessante Autoren, alte und neue, Geschichte, Gedichte und Geschichtenbücher las, ließ mich der Gedanke an die Handschrift meines Vaters nicht los; und als ich schließlich in die Küche zurückkehrte und mich wieder zu meinem Haferbrei und meinem kleinen Bier setzte, war das Erste, was ich Onkel Ebenezer fragte, ob mein Vater nicht sehr schnell mit dem Lesen gewesen sei.
„Alexander? Nein, nicht er!“, war die Antwort. „Ich war viel schneller als er; ich war ein schlauer Kerl, als ich jung war. Ich konnte genauso schnell lesen wie er.“
Das verwirrte mich noch mehr, und als mir ein Gedanke kam, fragte ich ihn, ob er und mein Vater Zwillinge gewesen seien.
Er sprang auf seinen Hocker, und der Hornlöffel fiel ihm aus der Hand auf den Boden. „Was fragst du da?“, sagte er, packte mich an der Jacke und sah mir diesmal direkt in die Augen: Seine eigenen Augen waren klein und hell und leuchteten wie die eines Vogels, sie blinzelten und zwinkerten seltsam.
„Was meinst du damit?“, fragte ich ganz ruhig, denn ich war viel stärker als er und ließ mich nicht so leicht einschüchtern. „Nimm deine Hand von meiner Jacke. So benimmt man sich nicht.“
Mein Onkel schien sich sehr zusammenzureißen. „Verdammt, David“, sagte er, „du solltest nicht mit mir über deinen Vater reden. Da liegt der Fehler.“ Er saß eine Weile da und zitterte, während er in seinen Teller starrte. „Er war der einzige Bruder, den ich je hatte“, fügte er hinzu, aber ohne jede Überzeugung in der Stimme. Dann griff er nach seinem Löffel und begann wieder zu essen, aber er zitterte immer noch.
Diese letzte Passage, das Auflegen der Hände auf mich und das plötzliche Bekenntnis der Liebe zu meinem verstorbenen Vater, ging so weit über mein Verständnis hinaus, dass es mich sowohl in Angst als auch in Hoffnung versetzte. Einerseits begann ich zu denken, mein Onkel sei vielleicht verrückt und könnte gefährlich sein; andererseits kam mir (ganz ungewollt und sogar gegen meinen Willen) eine Geschichte in den Sinn, die ich in einer Volksballade gehört hatte, von einem armen Jungen, der der rechtmäßige Erbe war, und einem bösen Verwandten, der ihn daran hindern wollte, sein Erbe anzutreten. Denn warum sollte mein Onkel einem Verwandten, der fast als Bettler vor seiner Tür stand, so etwas antun, wenn er nicht in seinem Herzen einen Grund hatte, ihn zu fürchten?
Mit diesem Gedanken, den ich mir nicht eingestand, der sich aber dennoch fest in meinem Kopf festsetzte, begann ich nun, seine verstohlenen Blicke nachzuahmen, sodass wir wie eine Katze und eine Maus am Tisch saßen und uns jeweils heimlich beobachteten. Er sagte kein einziges Wort mehr zu mir, aber er war damit beschäftigt, heimlich etwas in seinem Kopf zu überlegen; und je länger wir da saßen und je mehr ich ihn ansah, desto sicherer wurde ich, dass das, was er überlegte, mir nicht freundlich gesinnt war.
Als er den Teller abgeräumt hatte, holte er wie am Morgen eine einzige Pfeife Tabak heraus, drehte einen Hocker in die Kaminecke und saß eine Weile mit dem Rücken zu mir und rauchte.
„Davie“, sagte er schließlich, „ich habe nachgedacht“, dann hielt er inne und sagte es wieder. „Es gibt da ein kleines bisschen Geld, das ich dir schon versprochen habe, bevor du geboren wurdest“, fuhr er fort, „ich habe es deinem Vater versprochen. Nichts Legales, verstehst du, nur Gentlemen, die beim Wein scherzen. Nun, ich habe das Geld beiseite gelegt – es war eine große Ausgabe, aber ein Versprechen ist ein Versprechen – und inzwischen ist es auf genau – genau“ – und hier stockte er und stotterte – „auf genau vierzig Pfund angewachsen!“ Das letzte Wort schlug er mit einem Seitenblick über die Schulter heraus und fügte im nächsten Moment fast schreiend hinzu: „Schottische Pfund!“
Da ein schottisches Pfund dasselbe ist wie ein englischer Schilling, war der Unterschied durch diesen zweiten Gedanken beträchtlich; außerdem konnte ich sehen, dass die ganze Geschichte eine Lüge war, die zu einem Zweck erfunden worden war, den ich nicht erraten konnte; und ich machte keinen Versuch, den spöttischen Ton zu verbergen, in dem ich antwortete:
„Oh, denken Sie noch einmal nach, Herr! Pfund Sterling, nehme ich an!“
„Das habe ich gesagt“, erwiderte mein Onkel, „Pfund Sterling! Und wenn du kurz zur Tür hinausgehst, um zu sehen, wie die Nacht ist, hole ich es dir und rufe dich wieder herein.“
Ich tat, was er sagte, und lächelte in meinem inneren Spott darüber, dass er mich für so leicht zu täuschen hielt. Es war eine dunkle Nacht, nur wenige Sterne waren tief am Himmel zu sehen, und als ich vor der Tür stand, hörte ich in der Ferne zwischen den Hügeln ein dumpfes Heulen des Windes. Ich sagte mir, dass das Wetter gewittrig und unbeständig war, und ahnte nicht, welche enorme Bedeutung das für mich noch vor Ablauf des Abends haben würde.
Als ich wieder hereingerufen wurde, zählte mein Onkel mir siebenunddreißig Goldguineen in die Hand; den Rest hielt er in kleinerem Gold und Silber in der Hand, aber da versagte ihm das Herz, und er stopfte das Wechselgeld in seine Tasche.
„Da“, sagte er, „das soll dir eine Lehre sein! Ich bin ein seltsamer Mann und fremden Menschen gegenüber misstrauisch, aber mein Wort ist mein Ehrenwort, und hier ist der Beweis dafür.“
Nun, mein Onkel schien so geizig, dass ich von dieser plötzlichen Großzügigkeit sprachlos war und keine Worte fand, um ihm zu danken.
„Kein Wort!“, sagte er. „Kein Dank, ich will keinen Dank. Ich tue meine Pflicht. Ich sage nicht, dass jeder das getan hätte, aber für mich (obwohl ich auch ein vorsichtiger Mensch bin) ist es eine Freude, dem Sohn meines Bruders Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und es freut mich, dass wir nun als enge Freunde miteinander auskommen werden.“
Ich antwortete ihm so freundlich, wie ich konnte, aber die ganze Zeit über fragte ich mich, was als Nächstes kommen würde und warum er sich von seinen kostbaren Guineen getrennt hatte, denn den Grund, den er dafür angegeben hatte, hätte ein Kind abgelehnt.
Bald sah er mich von der Seite an.
„Und sieh mal hier“, sagte er, „wie du mir, wie ich dir.“
Ich sagte ihm, ich sei bereit, meine Dankbarkeit in jedem vernünftigen Maße zu beweisen, und wartete dann auf eine monströse Forderung. Und doch, als er endlich den Mut aufbrachte zu sprechen, sagte er mir nur (sehr richtig, wie ich fand), dass er alt und ein wenig gebrechlich werde und dass er von mir erwarte, dass ich ihm im Haus und im kleinen Garten helfe.
Ich sagte, ich würde ihm gerne zur Seite stehen.
„Gut“, sagte er, „dann fangen wir an.“ Er zog einen rostigen Schlüssel aus seiner Tasche. „Hier“, sagte er, „das ist der Schlüssel zum Treppenturm am anderen Ende des Hauses. Du kannst nur von außen hineingehen, denn dieser Teil des Hauses ist noch nicht fertig. Geh da rein, die Treppe hoch und bring mir die Truhe, die oben steht. Da sind Papiere drin“, fügte er hinzu.
„Kann ich Feuer haben, Herr?“, fragte ich.
„Nein“, sagte er ganz schlau. „In meinem Haus gibt's kein Licht.“
„Na gut, Herr“, sagte ich. „Ist die Treppe in Ordnung?“
„Sie sind großartig“, sagte er; und als ich gehen wollte, fügte er hinzu: „Bleib an der Wand, es gibt kein Geländer. Aber die Treppe ist sicher.“
Ich ging hinaus in die Nacht. Der Wind heulte immer noch in der Ferne, aber kein Hauch davon kam in die Nähe des Hauses der Shaws. Es war noch dunkler geworden, und ich war froh, mich an der Wand entlangtasten zu können, bis ich die Tür des Treppenturms am anderen Ende des unfertigen Flügels erreichte. Ich hatte den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt und gerade umgedreht, als plötzlich, ohne Wind oder Donner, der ganze Himmel von wildem Feuer erleuchtet wurde und wieder schwarz wurde. Ich musste meine Hände über die Augen halten, um mich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen, und tatsächlich war ich schon halb blind, als ich den Turm betrat.
Es war so dunkel darin, dass man kaum atmen konnte; aber ich stieß mich mit Fuß und Hand ab und stieß mit dem einen gegen die Wand und mit dem anderen gegen die unterste Stufe der Treppe. Die Wand fühlte sich an wie fein behauener Stein; auch die Stufen waren, obwohl etwas steil und schmal, aus poliertem Mauerwerk und fest und sicher unter den Füßen. Ich dachte an die Worte meines Onkels über das Geländer, blieb dicht an der Turnseite und tastete mich mit klopfendem Herzen durch die stockfinstere Dunkelheit vorwärts.
Das Haus der Shaws hatte etwa fünf Stockwerke, Dachböden nicht mitgerechnet. Nun, als ich vorwärtsging, schien mir die Treppe luftiger und etwas heller zu werden, und ich fragte mich, was die Ursache für diese Veränderung sein könnte, als ein zweiter Blitz des Sommergewitters aufleuchtete und wieder verschwand. Dass ich nicht schrie, lag daran, dass mir die Angst die Kehle zuschnürte, und dass ich nicht fiel, war eher der Gnade Gottes als meiner eigenen Kraft zu verdanken. Es war nicht nur, dass der Blitz durch die Löcher in der Wand von allen Seiten hereinscheinend, sodass ich mich fühlte, als würde ich auf einem offenen Gerüst herumklettern, sondern dasselbe vorübergehende helle Licht zeigte mir auch, dass die Stufen ungleich lang waren und dass einer meiner Füße in diesem Moment nur wenige Zentimeter über dem Brunnen stand.
Das war die große Treppe! dachte ich, und mit diesem Gedanken stieg eine Art wütender Mut in mir auf. Mein Onkel hatte mich hierher geschickt, um große Risiken einzugehen, vielleicht sogar um zu sterben. Ich schwor mir, dieses „vielleicht“ zu beseitigen, selbst wenn ich mir dabei das Genick brechen sollte; ich ging auf alle viere und kroch so langsam wie eine Schnecke weiter, tastete jeden Zentimeter vor mir ab und prüfte die Festigkeit jedes Steins, während ich die Treppe weiter hinaufstieg. Die Dunkelheit schien sich im Gegensatz zu den Blitzen verdoppelt zu haben; und nicht nur das, denn meine Ohren wurden jetzt von einem großen Geräusch von Fledermäusen im oberen Teil des Turms belästigt, und die widerlichen Tiere flogen nach unten und schlugen mir manchmal gegen Gesicht und Körper.
Der Turm war, wie ich sagen würde, quadratisch, und in jeder Ecke war die Stufe aus einem großen Stein unterschiedlicher Form gefertigt, um die Treppenläufe zu verbinden. Nun, ich war nahe an einer dieser Wendungen angelangt, als meine Hand, wie üblich vorwärts tastend, auf einer Kante abrutschte und nichts als Leere dahinter fand. Die Treppe führte nicht weiter nach oben; einen Fremden, der sie im Dunkeln betrat, hätte man direkt in den Tod schicken können; und (obwohl ich dank des Blitzes und meiner eigenen Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheit war) allein der Gedanke an die Gefahr, in der ich hätte sein können, und an die schreckliche Höhe, aus der ich hätte fallen können, ließ mir den Schweiß auf den Körper treten und meine Glieder erschlaffen.
Aber ich wusste jetzt, was ich wollte, und drehte mich um und tastete mich wieder nach unten, mit einer wunderbaren Wut im Herzen. Etwa auf halber Höhe kam der Wind mit einem Knall auf und schüttelte den Turm, dann legte er sich wieder; der Regen folgte, und bevor ich den Boden erreichte, goss es in Strömen. Ich streckte meinen Kopf in den Sturm und schaute in Richtung Küche. Die Tür, die ich hinter mir zugeschlagen hatte, stand jetzt offen und ließ ein wenig Licht herein; und ich glaubte, eine Gestalt im Regen stehen zu sehen, ganz still, wie ein Mann, der lauscht. Und dann kam ein blendender Blitz, der mir meinen Onkel deutlich zeigte, genau dort, wo ich ihn vermutet hatte; und dicht darauf folgte ein gewaltiger Donnerschlag.
Ob mein Onkel nun dachte, der Knall sei der Lärm meines Sturzes gewesen, oder ob er darin Gottes Stimme hörte, die einen Mord anklagte, überlasse ich deiner Fantasie. Sicher ist jedenfalls, dass ihn eine Art panische Angst ergriff und er ins Haus rannte und die Tür hinter sich offen ließ. Ich folgte ihm so leise ich konnte, schlich mich unbemerkt in die Küche und blieb stehen, um ihn zu beobachten.
Er hatte Zeit gehabt, den Eckschrank zu öffnen und eine große Flasche Branntwein herauszuholen, und saß nun mit dem Rücken zu mir am Tisch. Immer wieder wurde er von einem Anfall tödlichen Schauderns erfasst, stöhnte laut auf, hob die Flasche an seine Lippen und trank den rauen Schnaps in großen Schlucken.
Ich trat vor, ging dicht hinter ihn, wo er saß, und schlug ihm plötzlich beide Hände auf die Schultern – „Ah!“, schrie ich.
Mein Onkel stieß einen Art Schrei aus, der wie das Blöken eines Schafes klang, warf die Arme hoch und fiel wie tot zu Boden. Ich war etwas erschrocken, aber ich musste mich zuerst um mich selbst kümmern und zögerte nicht, ihn liegen zu lassen, wie er gefallen war. Die Schlüssel hingen im Schrank, und ich wollte mich mit Waffen versorgen, bevor mein Onkel wieder zu sich kam und mir Böses antun konnte. Im Schrank standen ein paar Flaschen, einige davon sahen aus wie Medikamente, viele Rechnungen und andere Papiere, die ich gerne durchstöbert hätte, wenn ich Zeit gehabt hätte, und ein paar Dinge, die ich nicht brauchte. Dann wandte ich mich den Truhen zu. Die erste war voll mit Mehl, die zweite mit Geldsäcken und zu Bündeln zusammengebundenen Papieren; in der dritten fand ich neben vielen anderen Sachen (die meisten davon Kleider) einen rostigen, hässlichen Hochlanddolch ohne Scheide. Diesen steckte ich in meine Weste und wandte mich meinem Onkel zu.
Er lag da, wie er gefallen war, zusammengekauert, mit einem Knie hochgezogen und einem Arm ausgestreckt; sein Gesicht hatte eine seltsame blaue Farbe, und er schien nicht mehr zu atmen. Ich bekam Angst, dass er tot sei; dann holte ich Wasser und spritzte es ihm ins Gesicht; darauf schien er ein wenig zu sich zu kommen, bewegte den Mund und flatterte mit den Augenlidern. Endlich blickte er auf und sah mich, und in seinen Augen stand ein Schrecken, der nicht von dieser Welt war.
„Komm, komm“, sagte ich, „setz dich auf.“
„Lebst du noch?“, schluchzte er. „Oh Mann, lebst du noch?“
„Das bin ich“, sagte ich. „Vielen Dank auch!“
Er hatte begonnen, mit tiefen Seufzern nach Luft zu suchen. „Die blaue Phiole“, sagte er, „im Waffenschrank – die blaue Phiole.“ Sein Atem wurde immer langsamer.
Ich rannte zum Schrank und fand dort tatsächlich eine blaue Medizinflasche mit einer auf einem Zettel notierten Dosierungsanweisung, die ich ihm so schnell ich konnte verabreichte.
„Das ist das Problem“, sagte er, als er wieder etwas zu sich kam, „ich habe ein Problem, Davie. Es ist das Herz.“
Ich setzte ihn auf einen Stuhl und sah ihn an. Ich hatte zwar Mitleid mit einem Mann, der so krank aussah, aber ich war auch voller gerechter Wut; und ich zählte ihm alle Punkte auf, die ich erklärt haben wollte: warum er mich bei jedem Wort belogen hatte, warum er Angst hatte, dass ich ihn verlassen würde, warum es ihm missfiel, wenn man andeutete, dass er und mein Vater Zwillinge waren – „Ist das, weil es wahr ist?“, fragte ich ihn. fragte ich; warum er mir Geld gegeben hatte, auf das ich meiner Überzeugung nach keinen Anspruch hatte; und schließlich, warum er versucht hatte, mich umzubringen. Er hörte mir schweigend zu und bat mich dann mit gebrochener Stimme, ihn ins Bett gehen zu lassen.
„Ich werde es dir morgen sagen“, sagte er, „so sicher wie ich sterben werde.“
Und er war so schwach, dass ich nichts anderes tun konnte, als zuzustimmen. Ich schloss ihn jedoch in sein Zimmer ein, steckte den Schlüssel ein, kehrte in die Küche zurück, machte ein Feuer, wie es dort seit vielen Jahren nicht mehr gebrannt hatte, wickelte mich in meine Decke, legte mich auf die Truhen und schlief ein.
Kapitel V Ich gehe zur Queens Ferry
In der Nacht regnete es stark, und am nächsten Morgen wehte ein bitterkalter Winterwind aus Nordwesten und trieb vereinzelte Wolken vor sich her. Trotzdem machte ich mich, noch bevor die Sonne auftauchte oder die letzten Sterne verschwunden waren, auf den Weg zum Bach und sprang in ein tiefes, wirbelndes Wasserloch. Ganz warm von meinem Bad setzte ich mich wieder ans Feuer, das ich auffüllte, und dachte ernsthaft über meine Lage nach.
Es gab jetzt keinen Zweifel mehr an der Feindseligkeit meines Onkels; es gab keinen Zweifel, dass ich mit dem Tod rechnete und dass er nichts unversucht lassen würde, um mich zu vernichten. Aber ich war jung und mutig, und wie die meisten Jungs, die auf dem Land aufgewachsen sind, hielt ich viel von meiner Schlauheit. Ich war als Bettler und kaum mehr als ein Kind an seine Tür gekommen; er hatte mich mit Verrat und Gewalt empfangen; es wäre eine schöne Genugtuung, die Oberhand zu gewinnen und ihn wie eine Herde Schafe zu vertreiben.
Ich saß da, pflegte mein Knie und lächelte ins Feuer; und ich sah mich in meiner Fantasie, wie ich eines nach dem anderen seine Geheimnisse aufdeckte und zum König und Herrscher dieses Mannes wurde. Der Zauberer von Essendean, so sagt man, hatte einen Spiegel gemacht, in dem man die Zukunft sehen konnte; er musste aus einem anderen Material als brennender Kohle sein, denn in all den Gestalten und Bildern, die ich sah, gab es kein einziges Schiff, keinen einzigen Seemann mit einer haarigen Mütze, keinen einzigen großen Knüppel für meinen dummen Kopf und nicht das geringste Anzeichen all der Schwierigkeiten, die mir bevorstanden.
Bald darauf, ganz aufgeblasen vor Selbstgefälligkeit, ging ich nach oben und gab meinem Gefangenen die Freiheit. Er grüßte mich höflich, und ich erwiderte seinen Gruß und lächelte auf ihn herab aus der Höhe meiner Selbstgefälligkeit. Bald saßen wir beim Frühstück, als könnte es der Tag zuvor gewesen sein.
„Nun, Herr“, sagte ich in spöttischem Ton, „hast du mir nichts mehr zu sagen?“ Und dann, als er keine klare Antwort gab, fuhr ich fort: „Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns gegenseitig verstehen. Du hast mich für einen naiven Landjungen gehalten, der nicht mehr Verstand und Mut hat als ein Kochlöffel. Ich habe dich für einen guten Mann gehalten, oder zumindest nicht schlechter als andere. Es scheint, wir haben uns beide geirrt. Was hast du für einen Grund, mich zu fürchten, mich zu betrügen und mir nach dem Leben zu trachten?“
Er murmelte etwas von einem Scherz und dass er Spaß möge; dann, als er mich lächeln sah, änderte er seinen Ton und versicherte mir, dass er mir nach dem Frühstück alles erklären würde. Ich sah an seinem Gesicht, dass er keine Lüge für mich parat hatte, obwohl er sich abmühte, eine zu erfinden; und ich glaube, ich wollte ihm das gerade sagen, als wir durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen wurden.
Ich bat meinen Onkel, sitzen zu bleiben, ging zur Tür und fand einen halbwüchsigen Jungen in Seemannskleidung vor der Tür stehen. Kaum hatte er mich gesehen, begann er einige Schritte der Seemannshornpipe zu tanzen (die ich noch nie zuvor gehört, geschweige denn gesehen hatte), schnippte mit den Fingern in die Luft und stampfte geschickt mit den Füßen. Trotzdem war er blau vor Kälte, und sein Gesicht hatte etwas zwischen Tränen und Lachen, das sehr mitleiderregend war und nicht zu seiner fröhlichen Art passte.
„Wie geht's, Kumpel?“, fragte er mit heiserer Stimme.
Ich bat ihn ernst, mir zu sagen, was er möchte.
„Oh, was ich gerne möchte!“, sagte er und begann zu singen:
„Denn es ist meine Freude, in einer glänzenden Nacht, In dieser Jahreszeit.“
„Nun“, sagte ich, „wenn du nichts zu tun hast, werde ich sogar so unhöflich sein, dich hinauszuwerfen.“
„Bleib, Bruder!“, rief er. „Hast du keinen Spaß mehr? Oder willst du, dass ich verprügelt werde? Ich habe einen Brief vom alten Heasyoasy für Herrn Belflower.“ Er zeigte mir einen Brief, während er sprach. „Und ich sage dir, Kumpel“, fügte er hinzu, „ich bin todhunger.“
„Na gut“, sagte ich, „komm rein, du bekommst was zu essen, auch wenn ich dafür hungrig bleiben muss.“
Damit holte ich ihn herein und setzte ihn auf meinen Platz, wo er sich gierig über die Reste des Frühstücks hermachte, mir zwischendurch zuzwinkerte und viele Grimassen schnitt, die der arme Kerl wohl für männlich hielt. In der Zwischenzeit hatte mein Onkel den Brief gelesen und saß nachdenklich da; dann sprang er plötzlich mit lebhaftem Gesichtsausdruck auf, zog mich beiseite in die hinterste Ecke des Zimmers und sagte:
„Lies das“, sagte er und drückte mir den Brief in die Hand.
Hier liegt er vor mir, während ich schreibe:
„Das Hawes Inn, Queens Ferry.
„Herr, – ich liege hier mit meiner Taue auf und ab und schicke meinen Schiffsjungen, um Ihnen Bescheid zu geben. Wenn Sie weitere Aufträge für Übersee haben, wäre heute die letzte Gelegenheit, da uns der Wind gut aus dem Firth herausstehen wird. Ich will nicht leugnen, dass ich mit Ihrem Mann, Herrn Rankeillor, Probleme hatte, die, wenn sie nicht schnell geklärt werden, zu Verlusten führen könnten. Ich habe Ihnen einen Wechsel ausgestellt, wie am Rand vermerkt, und verbleibe, Herr, Ihr ergebenster Diener, „ELIAS HOSEASON“. * Agent.