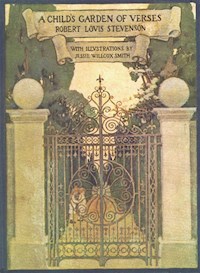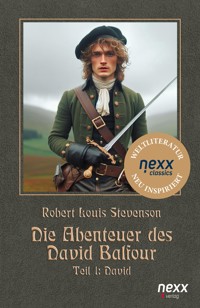
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
- Sprache: Deutsch
DER historische Abenteuerroman im Schottland des 18. Jahrhunderts
Der junge David Balfour steht nach dem Tod seines Vaters alleine in der Welt. Er reist zu seinem Onkel Ebenezer, der ihn aber, statt ihn aufzunehmen, auf ein Schiff entführen lässt, das ihn in die amerikanischen Kolonien bringen soll. Zusammen mit einem weiteren Passagier namens Alan Breck kann er fliehen, aber damit beginnen seine Abenteuer erst …
Immer auf der Flucht vor Davids skrupellosem Onkel und Alan Brecks Verfolgern führt sie ihre Reise durch die schottische Wildnis und deren beeindruckende Landschaften. Die Freundschaft der beiden wird vor viele Herausforderungen gestellt und verlangt von ihnen viel Mut und Entschlossenheit.
Diese Geschichte (Originaltitel »Kidnapped«) ist ein fesselndes Porträt von Schottland im 18. Jahrhundert, geprägt von politischen Intrigen, sozialer Ungerechtigkeit und dem Kampf um Freiheit. Es ist ein zeitloses Meisterwerk, das Leser jeden Alters in seinen Bann zieht und sie auf eine unvergessliche Reise durch eine vergangene Epoche entführt.
Der nexx verlag veröffentlicht Neu- und Wiederauflagen von besonderen Klassikern der Weltliteratur, die bezüglich Rechtschreibung und Lesegewohnheiten aufwändig »in die Gegenwart geholt« werden, ohne den Text zu verfremden. Erleben Sie das Lesen dieser besonderen Bücher neu oder entdecken Sie die wunderbaren Werke für sich!
nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Robert Louis Stevenson
Die Abenteuer desDavid Balfour
Teil 1: David
Robert Louis Stevenson
Die Abenteuer des David Balfour
Teil 1: David
ISBN/EAN: 978-3-95870-695-8
2. Auflage
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
Cover-Illustration: Madelaine Harder, Cover-Gestaltung: nexx verlag, 2024
www.nexx-verlag.de
Ich mache mich auf, um zum Haus der Shaws zu reisen
Ich will die Geschichte meiner Abenteuer mit einem bestimmten Tag beginnen. Es war ein Juni-Morgen im Jahre des Heils 1751, als ich zum letzten Mal den Schlüssel aus der Tür meines Vaterhauses zog. Die Sonne sandte ihre ersten Strahlen über die Gipfel der Hügel, während ich die Straße hinunterschritt, und als ich bis zum Pfarrhaus gekommen war, sangen die Amseln in den Holunderbüschen des Gartens, und der Nebel, der zur Zeit der Dämmerung rings im Tal zu hängen pflegte, begann sich zu heben und dahinzuschwinden.
Mr. Campbell, der Geistliche von Essendean, wartete auf mich beim Gartentor, der gute Mann! Er fragte mich, ob ich gefrühstückt hätte, und als er hörte, dass ich nichts brauche, nahm er meine Hand in seine beiden und zog sie freundschaftlich unter seinen Arm.
»Nun Davie, mein Junge,« sagte er, »ich will mit dir bis zum Fluss gehen, um dich auf den richtigen Weg zu bringen.«
Und wir begannen schweigend vorwärts zu gehen.
»Tut es dir leid, Essendean zu verlassen?« fragte er nach einer Weile.
»Ja, Herr,« sagte ich, »wenn ich wüsste, wohin ich gehe oder was aus mir werden soll, so würde ich es Euch offen sagen. Essendean ist wirklich ein schöner Ort und ich war hier sehr glücklich; aber dann wieder – ich bin noch nie anderswo gewesen. Meinem Vater und meiner Mutter werde ich, da sie nun beide tot sind, in Essendean nicht näher sein als im Königreich Ungarn; und um die Wahrheit zu sprechen, wenn ich glauben könnte, dass ich die Chance habe, es mir dort, wohin ich gehe, zu verbessern, dann ging ich wohl mit Freuden.«
»Ja?« sagte Mr. Campbell. »Das ist gut, Davie. Dann ist es wohl angebracht, dir deine Zukunft vorauszusagen, wenigstens so weit ich es kann. Als deine Mutter gestorben war und dein Vater (der ehrenwerte, gute Christ) krank wurde und sein Ende nahen fühlte, vertraute er mir einen gewissen Brief an und sagte, das wäre dein Erbe. ›Sobald ich‹, sagte er, ›gegangen sein werde und das Haus übergeben ist und über alle Habe verfügt sein wird‹ (was alles geschehen ist, Davie), ›so gebt meinem Jungen diesen Brief in die Hand und sorgt dafür, dass er sich zum Haus der Shaws aufmacht, nicht weit von Cramond. Das ist der Ort, von dem ich stamme,‹ sagte er, ›und es gehört sich, dass mein Sohn dahin zurückkehrt. Er ist ein starker Bursche‹, sagte dein Vater, ›und ein gut zu Fuß; und ich zweifle nicht, dass er dort heil ankommen und gut aufgenommen werden wird.‹«
»Das Haus der Shaws!« rief ich. »Was hatte mein armer Vater mit dem Haus der Shaws zu tun?«
»Ja,« sagte Mr.Campbell, »wer könnte das mit Gewissheit sagen? Aber der Name dieser Familie, Davie, mein Junge, ist der Name, den du trägst – Balfour of Shaws; ein altes, ehrenwertes, wohlbekanntes Haus, in letzter Zeit durch Zufall in Verfall geraten. Auch war dein Vater, wie dies seiner Stellung entsprach, ein Mann von Wissen; keiner war wie er dazu berufen eine Schule zu leiten; auch hatte er weder das Benehmen noch die Sprache eines einfachen Dorfschullehrers, sondern (wie du dich wohl selbst erinnern wirst) hatte ich viel Vergnügen daran, ihn ins Pfarrhaus zu rufen, dass er dort Leuten von Stand und Ansehen begegne; und die Angehörigen meines Hauses, Campbell von Kilrennet, Campbell von Dunswire, Campbell von Minch und andere – alles wohl angesehene Herren – fanden Vergnügen an seiner Gesellschaft. Endlich nun, um dir alle Einzelheiten dieser Angelegenheit selbst klar zu machen, hier ist der testamentarische Brief selbst, von der eigenen Hand unseres verstorbenen Bruders geschrieben.«
Er gab mir den Brief, der mit folgenden Worten überschrieben war: »Zu Händen von Ebenezer Balfour, Esquire of Shaws, im Haus der Shaws, wird dieses von meinem Sohn David Balfour übergeben.« Mein Herz begann heftig zu schlagen bei diesen großen Aussichten, die sich mir plötzlich eröffneten, einem Knaben von sechzehn Jahren, dem Sohn eines armen Dorfschullehrers in den Wäldern von Ettrick.
»Mr. Campbell,« stammelte ich, »würdet Ihr gehen an meiner Stelle?«
»Ganz sicherlich,« sagte der Geistliche, »das tät ich, und zwar ohne Zeitverlust. Ein kräftiger Bursche wie du, müsste in zwei Tagesmärschen in Cramond sein (das ist nicht weit über Edinburgh). Käme das Schlimmste zum Schlimmen, und deine hohen Angehörigen (denn ich muss wohl annehmen, dass sie irgendwie deine Blutsverwandten sind) versperrten dir ihre Tür, dann müsstest du diese beiden Tagereisen eben wieder zurückgehen und an die Tür des Pfarrhauses klopfen. Aber ich will eher hoffen, dass du gut empfangen wirst, wie dein armer Vater annahm, und soweit ich es überblicken kann, mit der Zeit ein großer Mann werden wirst. Und jetzt, Davie, mein Junge,« schloss er, »liegt es mir sehr am Herzen, diese Abschiedsstunde würdig zu nützen und dich vor allen Gefahren der Welt ernsthaft zu warnen.«
Hier sah er sich nach einer bequemen Sitzgelegenheit um, wählte dann einen großen Stein unter einer Birke am Rand der Straße, setzte sich hin, machte eine sehr lange, ernste Oberlippe und breitete, da die Sonne nun zwischen zwei Berggipfeln hell auf uns schien, ein Taschentuch über seinen krämpenlosen Hut, um sich zu schützen. So begann er nun mich mit erhobenem Zeigefinger erst vor einer beträchtlichen Anzahl von Irrlehren zu warnen, zu denen ich keinerlei Neigungen hatte, und beschwor mich, beständig zu bleiben in meinen Gebeten und im Lesen der Bibel. Dies getan, entwarf er ein Bild des großen Hauses, in das ich kommen werde und wie ich mich gegenüber den Bewohnern benehmen sollte.
»Sei nachgiebig, Davie, in gleichgültigen Dingen«, sagte er. »Halte es dir stets vor Augen, dass du, obgleich edel geboren, nur auf dem Lande erzogen wurdest. Beschäm' uns nicht, Davie, beschäm' uns nicht. In jenem großen Haus mit all den Bedienten oben und unten, zeig' dich so höflich, so umsichtig, so schnell im Begreifen und so langsam im Sprechen wie irgendeiner. Und was den Gutsherrn betrifft – vergiss nicht, er ist der Gutsherr; ich sage nicht mehr. Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist für junge Menschen ein Vergnügen, seinem Gutsherrn zu gehorchen.«
»Gut, Herr,« sagte ich, »es mag so sein, und ich versprech' Euch, mich zu bemühen, es so zu machen.«
»Sehr gut gesagt«, antwortete Mr. Campbell herzlich. »Und nun, um zur Sache zu kommen oder (um ein Wortspiel zu machen) zur Nebensache. Ich habe hier ein kleines Päckchen, das vier Dinge enthält.« Er zog es bei diesen Worten nicht ohne Schwierigkeiten aus der Brusttasche seines Mantels hervor. »Von diesen vier Dingen ist das erste dein gesetzliches Erbteil: das bisschen Geld für deines Vaters Bücher und Einrichtungsgegenstände, die ich gekauft habe (wie ich von Anfang an erklärte), um sie mit Gewinn dem zukünftigen Schullehrer wieder zu verkaufen. Die anderen drei Gaben sind von Mrs. Campbell und mir und wir würden uns freuen, wenn du sie annehmen würdest. Das erste ist rund und wird dir wohl fürs erste am besten gefallen; aber, oh Davie, mein Junge, es ist nur wie ein Tropfen Wasser im Meer; es wird dir nur einen Schritt weit helfen und dahinschwinden wie der Morgen. Das zweite ist flach und viereckig und beschrieben; es wird dir dein ganzes Leben lang beistehen wie ein guter Stock auf der Landstraße oder ein gutes Kissen unterm Kopf auf dem Krankenlager. Und was das letzte betrifft, das kubisch ist, das wird dich hoffentlich – ich will Gott darum in meinen Gebeten bitten – in ein besseres Land begleiten.«
Mit diesen Worten stand er auf, nahm seinen Hut ab und betete ein Weilchen laut und in rührenden Worten für einen jungen Mann, der im Begriff stand in die weite Welt zu ziehen. Dann schloss er mich plötzlich in seine Arme und küsste mich sehr fest; dann hielt er mich mit ausgestreckten Armen vor sich und sah mich mit schmerzlich zuckendem Gesicht an, dann drehte er sich schnell um und rief mir ein Lebewohl zu und lief in einer Art Trab den Weg zurück, den wir gekommen waren. Einem anderen hätte es lächerlich vorkommen mögen, aber mir war nicht zum Lachen zumute. Ich blickte ihm nach, solange er noch zu sehen war; er blieb auch nicht einen Augenblick stehen und sah sich nicht ein einziges Mal um. Da wurde es mir mit einem Mal klar, dass all dies nur sein Schmerz über meine Abreise war und ich empfand heftige Gewissensbisse, weil ich für mein Teil nur allzu glücklich war, fortzukommen aus diesem stillen Dorf und in ein großes, bewegtes Haus unter reiche und angesehene, vornehme Leute meines eigenen Namens und Blutes zu gehen.
»Davie, Davie,« dachte ich, »hat man schon je solch Undank gesehen? Kannst du beim bloßen Klang eines Namens gleich alte Wohltaten und alte Freunde vergessen? Pfui, pfui! Welche Schande!«
Und ich setzte mich an eben der Stelle nieder, von wo der gute Mann gerade aufgestanden war und öffnete das Päckchen, um meine Gaben zu besehen. Das, was er kubisch genannt hatte, war natürlich – ich war darüber keinen Augenblick im Zweifel gewesen – eine kleine Taschenbibel. Das, was er rund genannt hatte, war, wie sich herausstellte, ein Schillingstück und das dritte, das mir so wunderbar, ob gesund, ob krank, all mein Lebtag helfen sollte, war ein kleines, gewöhnliches, gelbes Stückchen Papier, auf dem mit roter Tinte folgendes geschrieben stand:
Bereitung von Maiglöckchen-Wasser
Man nehme die Blüten von Maiglöckchen, destilliere sie in Säckchen und trinke ein oder zwei Löffel davon, je nach Bedarf. Es gibt den Stummen die Sprache wieder. Es ist gut gegen die Gicht. Es stärkt das Herz und schärft das Gedächtnis. Die Blüten gebe man in ein fest verschlossenes Glas und setze dieses für einen Monat in einen beliebigen Ameisenhaufen, dann nehme man es wieder heraus und man wird einen Saft finden, der von den Blüten stammt und den man in einem Fläschchen aufbewahren muss. Er ist gut für Mann und Weib, ob gesund, ob krank.
Und dann von des Geistlichen eigener Hand:
Ebenso für Verstauchungen, damit einzureiben; und für Koliken, ein großer Löffel stündlich.
Darüber nun habe ich natürlich gelacht. Aber es war mehr ein zitterndes Lachen und ich war froh, mein Bündel an das Ende meines Stockes zu hängen; so setzte ich über den Fluss und dann, auf der anderen Seite, den Hügel hinauf. Bis ich, gerade als ich zur großen Herdenstraße kam, die breit durch die Heide lief, den Blick auf Kirk Essendean warf, auf die Bäume, die um das Pfarrhaus standen und auf den Friedhof, wo mein Vater und meine Mutter lagen.
Ich gelange an das Endziel meiner Reise
Am Vormittag des zweiten Tages sah ich, als ich auf die Spitze eines Hügels kam, das Land rings vor mir zum Meer hin abfallen; und inmitten dieses Abhanges, auf einem langen Grat rauchte die Stadt Edinburgh wie ein Riesenofen. Eine Flagge wehte auf dem Schloss, und Schiffe bewegten sich auf dem Meer oder lagen in der Bucht verankert. Ich konnte beides genau sehen, so weit entfernt ich auch stand, und beides bewog mich, mein Landratten-Maul weit aufzusperren.
Kurz nachher kam ich an einem Haus vorbei, in dem ein Hirte wohnte und der gab mir ungefähr die Richtung an, wie ich in die Gegend von Cramond käme; und so arbeitete ich mich von einem zum anderen durch, bis ich über Colinton westlich von der Hauptstadt auf der Straße von Glasgow herauskam. Dort erblickte ich zu meiner großen Freude und Verwunderung ein Regiment Soldaten, die im Takt zum Klang der Pfeifen marschierten, ein alter rotwangiger General auf einem grauen Pferd an einem Ende und eine Kompagnie Grenadiere mit ihren Bischofsmützen am anderen. Aller Lebensmut schien mir beim Anblick der Rotröcke und beim Klang der fröhlichen Musik zu Kopf zu steigen.
Ein Stückchen weiter sagte man mir, dass ich im Gemeindebezirk von Cramond wäre, und ich fing nun an, mich in meinen Fragen nach dem Haus der Shaws zu erkundigen. Das schien jene, von denen ich meinen Weg zu erfragen suchte, in Erstaunen zu setzen. Zuerst glaubte ich, dass die Einfachheit meiner Erscheinung – in meinem Bauernanzug, der noch dazu von der Landstraße ganz staubig war – schlecht zu der Größe des Ortes passte, zu dem ich gelangen wollte. Aber nachdem ich von zweien oder auch dreien denselben Blick und dieselbe Antwort erhalten hatte, da ging es mir langsam auf, dass da etwas Sonderbares um die Shaws sein müsse.
Um diese Furcht schneller zu verscheuchen, änderte ich die Art meiner Fragen. Als ich einen ehrlichen Burschen erspäht hatte, der in seinem Karren über eine Wiese herankam, fragte ich ihn, ob er jemals etwas von einem Haus der Shaws, wie sie es nannten, gehört habe.
Er hielt seinen Wagen an und sah mich genau so wie die übrigen an.
»Ja,« sagte er, »warum?«
»Ist es ein großes Haus?« fragte ich.
»Sicherlich«, sagte er. »das Haus ist ein großes, geräumiges Haus.«
»Ja,« sagte ich, »und die Leute, die darin wohnen?«
»Leute?« rief er, »seid Ihr verrückt? Dort gibt's keine Leute – was man so Leute nennt.«
»Was?« sagte ich, »nicht Mr. Ebenezer?«
»Oh ja,« sagte der Mann, »der Gutsherr dort, natürlich wenn Ihr den sucht. Was habt Ihr denn dort zu tun, Herrchen?«
»Ich hab' geglaubt, dass ich dort eine Stelle bekommen könnte«, sagte ich und sah so bescheiden drein, wie ich nur konnte.
»Was?« ruft der Mann so laut, dass sogar sein Pferd scheute. Und dann: »Na, mein Herrchen,« fügte er hinzu »es geht mich ja nichts an, aber Ihr scheint ein ordentlicher Bursche zu sein und wenn Ihr von mir einen Rat annehmen wollt, so haltet Euch fern von den Shaws.«
Der Nächste, dem ich begegnete, war ein gewandtes, kleines Männchen mit einer schönen, weißen Perücke, das ich sofort als einen Barbier erkannte, der seine Runde machte. Da ich wohl wusste, dass Barbiere große Schwätzer sind, fragte ich ihn geradeheraus, was Mr. Balfour of Shaws für ein Mann sei.
»Hu, hu, hu,« sagte der Barbier, »das ist so eine Art von einem Mann, gar keine Art von einem Mann eigentlich«, und er fing ganz schlau an, mich darüber auszufragen, was ich eigentlich vorhätte. Aber darin war ich ihm wohl gründlich gewachsen und er musste zu seinem nächsten Kunden abziehen, um Nichts klüger als zuvor.
Ich kann nicht gut beschreiben, was das für ein Schlag für all meine Illusionen war. Je unbestimmter die Anschuldigungen waren, umso weniger gefielen sie mir, denn sie ließen meiner Phantasie umso größeren Spielraum. Was für ein seltsames Haus musste das sein, dass die ganze Gemeinde erstaunte und erstarrte, wenn einer nach dem Weg dahin fragte? Oder was für ein merkwürdiger Herr, dass sein übler Ruf auf der offenen Straße so wohlbekannt war? Hätte mich eine Stunde Weges nach Essendean zurückgebracht, wie gerne hätte ich meine Abenteuer im Stich gelassen und wäre zurückgekehrt zum Haus des Mr. Campbell. Aber da ich schon einen so weiten Weg gemacht hatte, schämte ich mich, von meinem Vorhaben abzusehen, ehe ich die Sache genau geprüft hatte. Ich fühlte mich aus bloßer Selbstachtung gezwungen, durchzuhalten. Und so wenig mir auch das, was ich hörte, gefiel und so langsam ich auch weiterging, so fragte ich mich doch durch und kam vorwärts.
Es war schon um die Dämmerung, als mir ein kräftiges, dunkles, finster blickendes Weib begegnete, das langsam einen Hügel herunter kam. Als ich meine gewohnte Frage an sie stellte, wandte sie sich schnell um, begleitete mich bis zur Spitze des Hügels, den sie eben heruntergekommen war, zurück und deutete auf einen großen Gebäudekomplex, der auffallend kahl inmitten einer Rasenfläche stand, unten in dem vor uns liegenden Tal. Die Gegend rings umher war gar lieblich; sanfte Hügel, Bäche, Wälder und Felder, deren Getreide mir ganz besonders hoch und schön zu stehen schien. Aber das Haus selbst glich einer Ruine, keine Straße führte hinzu, kein Rauch stieg von den Kaminen empor, auch gab es Nichts, was einem Garten glich. Mein Mut sank. »Das?« rief ich.
Das Antlitz des Weibes leuchtete auf in boshaftem Hass. »Das ist das Haus der Shaws!« rief sie. »Mit Blut wurde es gebaut; Blut brachte den Bau zum Stillstand; durch Blut soll es fallen. Da sieh!« rief sie wieder, »ich speie auf den Boden und knicke meinen Daumen davor! Dunkel sei sein Fall! Wenn du den Gutsherrn siehst, sag' ihm, was du hörst. Sag' ihm, dies ist das zwölfhundertneunzehnte Mal, dass Jennet Clouston den Fluch gesprochen hat über ihn und sein Haus, über Speicher und Stall, Männer und Gäste und Herr, Frau, Mädchen und Kind – schwarz und schwer sei ihr Fall!«
Und das Weib, deren Stimme sich zu einer Art beschwörendem Sing-Sang erhoben hatte, wandte sich mit einem Ruck um und war verschwunden. Ich stand, wo sie mich verlassen hatte und die Haare standen mir zu Berge. In jenen Tagen glaubten die Leute noch an Hexen und zitterten vor einem Fluch. Und dieser, der so unerwartet niedergedonnert war, ein zufälliges Omen, mich warnend, an meinem Vorhaben festzuhalten, ließ mir das Mark in den Knochen erstarren.
Ich setzte mich hin und starrte auf das Haus der Shaws. Je länger ich hinsah, umso lieblicher erschien mir die ganze Gegend. Rings umher die Hagedornbüsche in voller Blüte, die Wiesen gesprenkelt mit weidenden Schafen, ein Zug Krähen hoch oben in der Luft, alle Anzeichen eines fruchtbaren Bodens und freundlichen Klimas. Doch diese Baracke inmitten all dieses Friedens wollte zu meinen Erwartungen so gar nicht passen.
Es gingen wohl Bauersleute vorbei, als ich da so am Rand des Grabens saß, aber es fiel mir nicht ein, ihnen einen guten Abend zu wünschen. Endlich ging die Sonne unter und dann sah ich, sich scharf gegen den gelben Himmel abhebend, eine Rauchsäule aufsteigen, nicht viel dicker schien es mir als der Rauch einer Kerze. Aber immerhin sie war doch da und bedeutete Feuer und Wärme und Essen und irgendeinen lebendigen Bewohner, der es angezündet haben musste. Und das tröstete mein Herz ungemein – mehr, sicherlich, als eine ganze Flasche voll von jenem Maiglöckchen-Wasser, von dem Mr. Campbell so viel Aufhebens machte.
Und so setzte ich mich in Bewegung und folgte einer schwachen Spur im Gras, die in meiner Richtung führte. Sie war wirklich sehr schwach, als einziger Weg zu einem bewohnten Ort, aber ich sah keine andere. Endlich brachte sie mich zu einigen aufgeschichteten Steinen mit einer ungedeckten Hütte daneben und einer Menge dürrer Äste darauf. Zweifellos hätte das wohl einmal ein Haupteingang werden sollen, war aber nie vollendet worden. Statt eines Gittertores aus getriebenem Eisen waren einige mit Stroh umwickelte Zaunpfähle im Boden befestigt, und da es keine Gartenmauer gab und kein Anzeichen einer Allee, folgte ich einem Pfad, der rechts an den Pfählen vorbei auf das Haus zu führte.
Je näher ich kam, umso trostloser sah es aus. Es erschien wie der eine Flügel eines Hauses, das niemals beendet worden war. Was im Innern hätte sein sollen, stand frei sichtbar im oberen Stockwerk und hob sich mit Stufen und Stiegen eines unvollendeten Baues vom Himmel ab. Viele der Fenster waren ohne Scheiben und die Fledermäuse flogen ein und aus wie Tauben in einen Taubenschlag.
Als ich nahe gekommen war, begann es langsam Nacht zu werden. In dreien der unteren Fenster, die ziemlich hoch oben waren und klein und fest vergittert, fing das flackernde Licht eines kleinen Feuers zu leuchten an.
War dies das Schloss, zu dem ich gewandert war? Waren es diese Mauern, hinter denen ich neue Freunde und ein großes Vermögen suchen sollte? Nein, in meines Vaters Haus in Essendean pflegte das Feuer und die hellen Lichter eine Meile weit zu leuchten und die Tür sich beim ersten Pochen eines jeden Bettlers zu öffnen.
Ich ging vorsichtig weiter und scharf hinhorchend, hörte ich jemand mit Schlüsseln klappern und ein schwaches trocknes Husten, das stoßweise kam; aber es war kein Ton einer menschlichen Stimme zu hören und kein Hund bellte.
Die Tür war, so gut ich es im Finstern sehen konnte, aus starkem Holz, ganz mit Nägeln beschlagen und ich zog schwachen Mutes meine Hand unterm Rock hervor, um zu klopfen. Dann stand ich und wartete. Im Haus war es totenstill geworden. Eine ganze Minute verging und nichts regte sich, nur die Fledermäuse oben. Ich klopfte wieder und horchte wieder. Jetzt waren meine Ohren schon so sehr an die Stille gewöhnt, dass ich das Ticken der Uhr drinnen vernahm, wie sie langsam die Sekunden zählte. Aber wer auch immer in diesem Haus sein mochte, er verhielt sich totenstill und musste sogar seinen Atem anhalten.
Ich war im Zweifel, ob ich davonlaufen sollte; aber der Zorn behielt die Oberhand und ich fing stattdessen an, mit Fäusten und Füßen gegen die Tür zu schlagen und laut nach Mr. Balfour zu schreien. Ich war mittendrin, als ich das Husten gerade über meinem Kopf vernahm. Ich fuhr zurück, sah hinauf und erblickte den Kopf eines Mannes in einer großen Nachtmütze und die Mündung eines Gewehres in einem der Fenster des ersten Stockwerkes.
»S' ist geladen«, sagte die Stimme.
»Ich bin mit einem Brief hergekommen«, sagte ich, »für Mr. Ebenezer Balfour of Shaws. Ist er hier?«
»Von wem ist er?« fragte der Mann mit der Flinte.
»Von irgendjemandem«, sagte ich, denn ich wurde ganz wütend.
»Gut,« war die Antwort, »du kannst ihn auf die Türschwelle legen und dich fortscheren.«
»Das werde ich nicht tun«, rief ich. »Ich werde ihn Mr. Balfour selbst übergeben, so wie es mir aufgetragen worden war. Es ist ein Empfehlungsbrief.«
»Was ist es?« rief die Stimme scharf.
Ich wiederholte, was ich gesagt hatte.
»Wer bist denn du selbst?« war die nächste Frage nach einer beträchtlichen Pause.
»Ich schäme mich meines Namens nicht,« sagte ich, »man nennt mich David Balfour.«
Daraufhin musste der Mann wohl zurückgefahren sein, denn ich hörte das Gewehr am Fensterbrett rasseln; und erst nach einer ziemlich langen Pause und mit merkwürdig veränderter Stimme folgte die nächste Frage:
»Ist dein Vater tot?«
Ich war so überrascht, dass mir die Stimme versagte. Ich stand still und starrte ihn an.
»Ja,« fing der Mann wieder an, »er wird wohl tot sein, zweifellos, und das führt dich auch her und darum klopfst du an meine Tür.« Wieder Pause und dann verächtlich: »Na gut, junger Mann,« sagte er, »ich will dich herein lassen.« Und er verschwand vom Fenster.
Ich mache die Bekanntschaft meines Onkels
Gleich darauf hörte man ein schreckliches Rasseln von Ketten und Riegeln, die Tür wurde vorsichtig geöffnet und, sobald ich hinein gegangen war, gleich wieder hinter mir geschlossen.
»Geh in die Küche, aber rühr' dort nichts an«, sagte die Stimme, und während der Hausbewohner daran ging, die Verschanzung der Tür wieder in Ordnung zu bringen, tastete ich meinen Weg vorwärts und trat in die Küche.
Das Feuer brannte nun hübsch hoch und zeigte mir den kahlsten Raum, den ich nur jemals in meinem Leben gesehen hatte, glaub' ich. Ein halbes Dutzend Schüsseln standen auf dem Sims; der Tisch war für das Abendessen gedeckt: ein Teller Suppe, ein Holzlöffel und ein Becher dünnen Bieres. Außer den Dingen, die ich aufgezählt habe, war auch nicht ein einziger Gegenstand in diesem großen, steinüberdeckten, leeren Raum, nur fest versperrte Kasten längs der Wände und ein Eckschrank mit einem großen Vorhängeschloss.
Endlich, als die letzte Kette wieder vorgehängt war, kam mir der Mann nach. Er war ein schmächtiger, gebückter, schmalschultriger Kerl von fahler Gesichtsfarbe, und sein Alter mochte so zwischen fünfzig und sechzig liegen. Seine Nachtmütze war aus Flanell und ebenso sein Schlafrock, den er statt eines Rockes und einer Weste über seinem zerrissenen Hemd trug. Er war schon lange nicht rasiert, aber was mich am meisten abschreckte, ja sogar entsetzte, war, dass er die Augen weder von mir abwandte, noch mir gerade ins Gesicht sah. Was er nach Geburt und Stand sein mochte, war mehr als ich ergründen konnte; am ehesten glich er noch einem alten, unbrauchbaren Diener, dem man gegen ein Kostgeld die Aufsicht über dieses weitläufige Gebäude übergeben hatte.
»Bist du müde gelaufen«, fragte er bis etwa zur Höhe meiner Knie schielend. »Kannst den Tropfen Suppen da essen.« Ich sagte, ich fürchtete, es wäre sein eigenes Essen.
»Oh,« sagte er, »ich kann es leicht entbehren. Nur das Bier will ich nehmen, es lindert meinen Husten.« Er trank den Becher halb aus, wobei er mich während des Trinkens stets im Auge behielt und plötzlich streckte er die Hand aus und sagte: »Zeig' mir den Brief.«
Ich sagte ihm, dass der Brief für Mr. Balfour wäre und nicht für ihn.
»Und wer glaubst du, bin ich?« sagte er, »gib mir Alexanders Brief.«
»Ihr kennt den Namen meines Vaters?«
»'s wär' merkwürdig, wenn ich ihn nicht kennen sollte,« antwortete er, »er war doch mein leiblicher Bruder. Und so wenig dir meine Person, mein Haus und meine gute Suppe zu gefallen scheinen, so bin ich doch dein leiblicher Onkel, Davie, mein Junge, und du mein leiblicher Neffe. Also gib uns den Brief und setz' dich nieder und füll' dir den Magen.«
Wäre ich einige Jahre jünger gewesen, so wäre ich zweifellos vor Scham, Müdigkeit und Enttäuschung in Tränen ausgebrochen. Aber so wie es war, konnte ich keine Worte finden, weder gut noch böse, sondern händigte ihm den Brief aus und setzte mich zur Suppe nieder, mit so geringer Lust zu essen, wie nur je ein junger Mann empfunden haben mag.
Inzwischen drehte mein Onkel, über das Feuer gebeugt, den Brief in seinen Händen hin und her.
»Weißt du, was drin steht?«, fragte er mich plötzlich.
»Ihr könnt ja selbst sehen, Herr, dass das Siegel nicht aufgebrochen ist«, sagte ich.
»Ja,« sagte er, »aber was hat dich hergeführt?«
»Den Brief abzugeben«, sagte ich.
»Nein,« sagte er schlau, »du hast doch sicherlich irgendwelche Hoffnungen gehabt?«
»Ich gestehe, Herr,« sagte ich, »als ich hörte, dass ich wohlhabende Verwandte hätte, wiegte ich mich wohl in der Hoffnung, dass sie mir auf meinem Lebensweg behilflich sein könnten. Aber ich bin kein Bettler. Ich schiele nicht nach Gnaden von Eurer Hand und will keine Geschenke, die nicht freiwillig gegeben werden. Denn, so arm ich auch scheinen mag, so hab' ich doch eigene Freunde, die mir gerne helfen werden.«
»Ta – ta – ta!« sagte Onkel Ebenezer, »musst mich nicht gleich anschnauzen und beleidigt sein. Wir werden uns schon ganz gut vertragen. Und dann, Davie, mein Junge, wenn du die Suppe nicht mehr essen willst, kann ich ebenso gut selbst einen Löffel voll davon nehmen. Ja,« fuhr er fort, nachdem er mir Stuhl und Löffel abgenommen hatte, »'s ist ein gutes, nahrhaftes Essen, Suppe.« Er murmelte leise irgendein Tischgebet und fiel darüber her. »Dein Vater war ein guter, um nicht zu sagen starker Esser; während ich von den Speisen immer nur kaum naschen konnte.« Er nahm einen Schluck Dünnbier und sein nächster Ausspruch lautete: »Wenn deine Kehle vielleicht trocken ist, hinter der Tür findest du Wasser.«
Darauf gab ich keine Antwort, sondern stand steif auf meinen zwei Beinen und sah zornerfüllt auf meinen Onkel nieder. Er, für sein Teil, fuhr fort zu essen, wie einer, der es eilig hat und warf kleine flüchtige Blicke bald auf meine Schuhe, bald auf meine handgestrickten Socken. Einmal nur, als er zufällig wagte, ein wenig höher zu schielen, begegneten sich unsere Blicke, und kein Dieb, auf frischer Tat ertappt, hätte lebhaftere Zeichen von Verlegenheit zeigen können. Dies erweckte in mir den Gedanken, ob sein scheues Wesen nicht vielleicht daher stammte, dass er jeder menschlichen Gesellschaft so lange entwöhnt war, und ob es nicht auf einen kleinen Versuch ankäme dies zu ändern und mein Onkel vielleicht ein ganz anderer Mensch werden könnte. Seine schrille Stimme weckte mich aus diesen Betrachtungen.
»Dein Vater ist schon lange tot?« fragte er.
»Drei Wochen, Herr«, sagte ich.
»Er war ein verschlossener Mann, Alexander – ein verschlossener, schweigsamer Mann«, fuhr er fort. »Er sprach nie viel, so lange er jung war. Er wird wohl nicht viel von mir erzählt haben?«
»Ich wusste nicht einmal, Herr, dass er überhaupt einen Bruder hatte, ehe Ihr es mir jetzt selbst gesagt habt.«
»Nein, du meine Güte!« sagte Ebenezer. »Auch wohl von den Shaws nicht, wie?«
»Nicht einmal den Namen, Herr«, sagte ich.
»Denk einer nur mal!« sagte er. »Ein sonderbarer Mensch!«
Trotz alledem schien er merkwürdig zufrieden, aber ob mit sich selbst oder mit mir oder mit dem Benehmen meines Vaters war mehr, als ich enträtseln konnte. Sicherlich aber schienen dieser Abscheu und das Übelwollen, die er anfangs gegen meine Person gezeigt hatte, zu schwinden. Denn plötzlich sprang er auf, schritt durch das Zimmer auf mich zu und schlug mir freundschaftlich auf die Schulter. »Wir werden uns noch ganz gut vertragen!« rief er. »Ich bin eigentlich froh, dass ich dich hereingelassen habe. Und jetzt komm ins Bett.«
Zu meiner Verwunderung zündete er weder eine Lampe noch eine Kerze an, sondern ging in den finsteren Vorraum hinaus, tastete, schwer atmend, seinen Weg ein Stockwerk höher die Stiege hinauf und blieb vor einer Tür stehen, die er aufsperrte. Ich war ihm, so gut ich konnte, nachgestolpert und folgte ihm dicht auf den Fersen. Er ließ mich eintreten, denn dies wäre mein Zimmer. Ich tat, wie er mich hieß und bat ihn zum Schlafengehen um ein Licht.
»Ta–ta–ta,« sagte Onkel Ebenezer, »der Mond scheint hell genug.«
»Weder Mond noch Sterne, Herr. Es ist stockfinster«, sagte ich. »Ich kann das Bett nicht sehen.«
»Ta–ta–ta!« sagte er, »Lichter im Haus, das ist so eine Sache, mit der ich nun einmal nicht einverstanden bin. Ich fürchte mich vorm Feuer. Gute Nacht, Davie, mein Junge!« Und ehe ich noch Zeit hatte, weitere Einsprüche zu erheben, schlug er die Tür zu und ich hörte, wie er mich von außen einsperrte.
Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Das Zimmer war so kalt wie ein Brunnen und das Bett, als ich meinen Weg dahin gefunden hatte, so feucht und dumpf wie eine Torfgrube. Aber zum Glück hatte ich mein Bündel und meine Decke mit heraufgebracht, und so wickelte ich mich gut ein, legte mich auf den Boden, windgeschützt durch das große Bettgestell, und schlief augenblicklich ein.
Beim ersten Morgengrauen öffnete ich die Augen. Ich befand mich in einem großen Zimmer; die Wände waren mit gepresstem Leder tapeziert, schöne, gestickte Möbel standen darin und das Licht fiel durch drei große, helle Fenster herein. Vor zehn oder zwanzig Jahren musste es eines der schönsten Zimmer gewesen sein, in dem man zu schlafen oder aufzuwachen nur wünschen konnte. Aber Feuchtigkeit, Schmutz, Unbenütztheit, Mäuse und Spinnen hatten seither alles getan, was in ihrer Macht gestanden hatte. Außerdem waren viele Fensterscheiben zerbrochen; aber das war tatsächlich ein so gewohnter Anblick an der Fassade dieses Hauses, dass ich annehme, mein Onkel musste einmal von Seiten seiner entrüsteten Nachbarn eine Belagerung ausgestanden haben – vielleicht mit Jennet Clouston an der Spitze.
Inzwischen schien draußen hell die Sonne. Da mir in diesem elenden Zimmer sehr kalt war, klopfte und schrie ich solange, bis mein Kerkermeister kam und mich herausließ. Er führte mich an die Hinterseite des Hauses, wo ein Ziehbrunnen war und hieß mich, mir dort Gesicht und Hände waschen, wenn ich wollte. Nachdem dies geschehen war, fand ich, so gut ich konnte, allein den Weg in die Küche zurück, wo er das Feuer bereits angezündet hatte und die Suppe bereitete. Der Tisch war gedeckt mit zwei Schüsseln und zwei Löffeln, aber nur ein Maß Dünnbier wie gestern. Vielleicht ruhte mein Auge mit einigem Erstaunen auf dieser Einzelheit und vielleicht hatte mein Onkel dies bemerkt. Denn er fing an, wie in Beantwortung meines Gedankens, und fragte mich, ob ich gerne Bier tränke.
Ich sagte ihm, dass dies wohl eine Gewohnheit sei, bat ihn aber, sich deswegen nicht stören zu lassen.
»Na, na,« sagte er, »ich will dir nichts abschlagen, was recht und billig ist.«
Er holte einen zweiten Becher vom Sims herunter, und dann goss er, zu meiner größten Verwunderung, anstatt mehr Bier zu holen, genau die Hälfte von seinem Becher in den anderen. Es lag eine Art Vornehmheit darin, die mir den Atem raubte. Wenn mein Onkel auch sicherlich ein Geizhals war, so war er doch wenigstens ein so wohlerzogener, dass sein Laster dadurch beinahe geadelt wurde.
Als wir unsere Mahlzeit beendet hatten, sperrte mein Onkel Ebenezer einen Kasten auf, nahm eine Tonpfeife und einen Tabaksbeutel heraus, stopfte die Pfeife und sperrte den Tabak wieder ein. Dann setzte er sich an eines der Fenster in die Sonne und rauchte schweigend. Von Zeit zu Zeit schweiften seine Blicke zu mir herüber und er stieß eine seiner Fragen hervor. Einmal war es: »Und deine Mutter?« Und als ich ihm gesagt hatte, dass auch sie bereits tot sei, »Ja, sie war ein liebes, gutes Mädchen!« Dann wieder nach einer langen Pause: »Wer sind denn deine Freunde, die du hast?«
Ich erzählte ihm, es wären einige Herren aus der Familie der Campbells. Eigentlich war es ja nur einer und das war der Geistliche, der sich, genau genommen, nie um mich gekümmert hatte. Aber ich fing an zu glauben, dass mein Onkel meine Stellung zu gering einschätzte und da ich mich mit ihm allein befand, wollte ich nicht, dass er mich für ganz hilflos hielt.
Er schien dies wohl zu überlegen und dann, »Davie, mein Junge,« sagte er, »du hast das Richtige getan, als du zu deinem Onkel Ebenezer kamst. Ich habe viel Sinn für die Familie und will dir Gutes tun. Aber ich will mir's noch ein wenig überlegen, wozu du wohl am besten taugst – ob zu Gericht oder zum Prediger oder vielleicht ins Heer – Buben wollen immer raufen; ich möchte nicht, dass die Balfours von einem gewöhnlichen Highlander Campbell beschämt werden und bitte dich, vorläufig den Mund zu halten. Keine Briefe, keine Botschaften, kein Wort zu irgendjemand, oder sonst – dort ist die Tür!«
»Onkel Ebenezer,« sagte ich, »ich habe keinen Grund anzunehmen, dass du mir anderes als Gutes willst. Trotz alledem möchte ich, dass du weißt, auch ich habe meinen Stolz. Ich bin nicht aus freiem Willen hergekommen um dich aufzusuchen, und wenn du mir noch einmal die Tür weist, so werde ich dich beim Wort nehmen.«
Er geriet anscheinend ganz außer sich. »Ta-ta-ta,« sagte er, »nimm dich in Acht, Mensch! – Nimm dich in Acht! Bleib ein oder zwei Tage hier. Ich bin kein Zauberer, dass ich dein Glück im Suppenteller finden kann! Lass mir doch ein oder zwei Tage Zeit und sag' niemandem was; ich werde schon, so sicher wie nur etwas, das Richtige für dich finden.«
»Also gut,« sagte ich, »dann wollen wir nicht mehr davon sprechen. Wenn du mir helfen willst, dann werde ich sicherlich sehr froh sein und dir gewiss allen Dank wissen.«
Es schien mir (zu früh, muss ich wohl sagen), dass ich die Oberhand über meinen Onkel gewann und ich sagte gleich, dass mein Bettzeug gelüftet werden müsse; denn nichts könnte mich dazu bringen, in einem solchen Kellerloch zu schlafen.
»Ist das mein Haus oder deins?« sagte er mit seiner schrillen Stimme und dann brach er plötzlich ab. »Na, na,« sagte er, »ich hab's nicht so gemeint. Was mein ist, ist dein, Davie, mein Junge, und was dein ist, ist mein. Blut ist stärker als Wasser und es ist keiner außer dir und mir, der den Namen trägt.« Und dann faselte er weiter über die Familie und ihre einstige Größe und seinen Vater, der das Haus vergrößern wollte, und sich selbst, der den Bau als sündhafte Verschwendung angesehen habe, und das brachte mich auf den Gedanken, ihm Jennet Cloustons Botschaft auszurichten.
»Die Vettel!« rief er, »zwölfhundertneunzehn – das ist ebenso viel wie Tage verstrichen sind, seitdem ich sie ausgepfändet habe. Gott, David, ich muss sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen, früher werde ich keine Ruhe haben von ihr! Eine Hexe – eine ausgesprochene Hexe! Ich geh' sofort zu Gericht.«
Und mit diesen Worten öffnete er einen Schrank, nahm einen alten, gut erhaltenen blauen Rock samt Weste heraus und einen leidlich guten Biberhut, beides ohne Borten. Er zog schnell alles irgendwie an, nahm einen Stock aus dem Kasten, sperrte alles wieder zu und wollte eben hinausgehen, als ihn ein Gedanke zurückhielt.
»Ich kann dich nicht allein im Haus lassen,« sagte er, »ich muss dich aussperren.«
Das Blut stieg mir zu Kopf. »Wenn du mich aussperrst, hast du mich zum letzten Mal im Guten gesehen.«
Er wurde sehr blass und begann an seiner Oberlippe zu saugen. »Das ist nicht die Art,« sagte er und sah boshaft in eine Ecke auf den Boden, »... das ist nicht die Art, um meine Gunst zu gewinnen, David.«
»Herr,« sagte ich, »mit aller schuldigen Achtung vor Eurem Alter und unserem gemeinsamen Blut ist mir Eure Gunst keinen Pfennig wert. Ich wurde mit einiger Selbstachtung erzogen; und wärt ihr auch zehnmal mehr als alle Onkels und die ganze Familie, die ich auf der Welt besitze, möcht ich Eure Liebe nicht um solchen Preis erwerben.«
Onkel Ebenezer ging und sah zum Fenster hinaus. Ich sah, wie er zitterte und zuckte, wie in Krämpfen. Aber als er sich umwandte, lag ein Lächeln auf seinem Gesicht.
»Gut, gut,« sagte er, »wir müssen dulden und verzeihen. Ich werde nicht gehen, das ist alles, was darüber noch zu sagen ist.«
»Onkel Ebenezer,« sagte ich, »ich verstehe das Ganze nicht. Du behandelst mich wie einen Dieb; du willst mich nicht im Haus haben; du zeigst es mir jeden Augenblick und mit jedem Wort; es ist unmöglich, dass du mich gern hast; und was mich anbelangt, so hab' ich zu dir gesprochen, wie ich niemals zu irgendjemand sprechen wollte. Warum versuchst du es dann, mich hier zu behalten? Lass mich zurückkehren – lass mich zu meinen Freunden zurückkehren, die mich lieben!«
»Na, na, na, na,« sagte er sehr ernst. »Ich habe dich sehr gern, wir werden uns noch sehr gut vertragen. Und um der Ehre unseres Hauses willen, könnte ich dich nicht dahin zurückkehren lassen, woher du gekommen bist. Bleib ruhig hier, sei ein guter Junge, bleib schön ruhig hier, ich bitte dich, und du wirst sehen, wir werden uns vertragen.«
»Nun gut, Herr,« sagte ich, nachdem ich mir die Sache im Stillen überlegt hatte, »ich will noch eine Weile bleiben. Es ist natürlicher, dass ich von meinem eigenen Blut unterstützt werde, als von Fremden; und sollten wir uns nicht vertragen, ich will mich bemühen, dass es nicht durch meine Schuld geschehe.«
Ich laufe große Gefahr im Haus meines Onkels
Für einen so übel begonnenen Tag verlief der Tag ganz leidlich. Wir hatten mittags wieder kalte Suppe und abends warme Suppe. Suppe und Dünnbier waren meines Onkels Diät. Er sprach wenig und das Wenige in derselben Art wie vorher. Er warf mir nach langem Stillschweigen eine Frage hin, und wenn ich versuchte, ihn in ein Gespräch über meine Zukunft zu ziehen, entschlüpfte er mir. Ich fand in einem Zimmer neben der Küche – das er mir zu betreten erlaubte – eine große Anzahl Bücher, sowohl englische als auch lateinische, mit denen ich mich den ganzen Nachmittag mit viel Vergnügen beschäftigte. Die Zeit verging in dieser angenehmen Gesellschaft tatsächlich so schnell, dass ich schon anfing, mich mit meinem Aufenthalt in Shaws wieder auszusöhnen und nur der Anblick meines Onkels, dessen Blicke mit den meinen immer Verstecken spielten, erweckte immer wieder mein stärkstes Misstrauen.
Eines fiel mir auf, worüber ich mir Gedanken machte. Ich fand auf dem Vorsatzblatt eines Buches eine Widmung von der Hand meines Vaters geschrieben: »Meinem Bruder Ebenezer, an seinem fünften Geburtstag.« Was mich daran nun so sehr in Erstaunen setzte, war, dass mein Vater, da er natürlich der jüngere Bruder war, entweder einen sonderbaren Irrtum begangen haben musste oder, noch ehe er das fünfte Lebensjahr erreicht hatte, eine ausgezeichnete, leserliche, männliche Handschrift besessen hatte.
Das wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Obwohl ich eine Menge interessanter Autoren herunternahm, alte und neue, Geschichte, Poesie, Erzählungen, immer wieder kam mir der Gedanke an meines Vaters Handschrift. Und als ich endlich in die Küche zurückging und mich wieder zu Suppe und Dünnbier setzte, war das erste, was ich meinen Onkel Ebenezer fragte, ob mein Vater nicht schon im frühesten Alter gut lesen und schreiben konnte.
»Alexander? Nein, er nicht!« war seine Antwort. »Ich lernte es viel früher. Ich war ein kluges Kerlchen, als ich noch jung war. Ja, ich konnte schon zur selben Zeit lesen wie er.«
Das versetzte mich in noch größere Verwunderung. Da ging mir ein Gedanke durch den Kopf und ich fragte ihn, ob sie vielleicht Zwillinge gewesen seien.