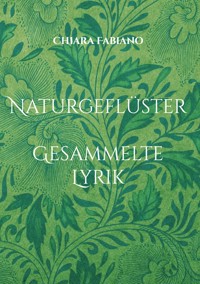Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ägypten Anfang des 20. Jahrhunderts Die junge Waise Josephine wächst bei ihrem Großvater, einem Archäologen, in der Wüste von Gizeh auf Forschungsreise auf, weit weg von den Konventionen der westlichen Welt. Als sie eines Tages eines sensationellen Fund macht, ändert sich ihr Leben schlagartig. Eines Tages tritt Erich, ein junger Arzt aus Österreich in ihr Leben und schließt sich der Mission an. Schnell verlieben sich die beiden unsterblich ineinander, doch bald schon wird Josephines Leben von zahlreichen Schicksalsschlägen erschüttert und auch Erich muss sie verlassen. Als sie eines Tages den Entschluss fasst die Wüste zu verlassen, wird ihr die Reise durch das trockene Gebiet fast zum Verhängnis. Bereits ohnmächtig wird sie von der jungen Engländerin Jane gefunden, die sie daraufhin mit zu sich nach England nimmt. Josephine kann ihr Glück kaum fassen, als sie von Jane und ihrer Familie aufgenommen wird, denn nun scheint auch Erich zum Greifen nahe zu sein. Doch die strengen Konventionen der englischen Gesellschaft und die vielen Dinge, die es zu lernen gilt sind nicht einfach für Josephine, genauso wenig wie die emotionale Entscheidung, die es zu fällen gilt, als auch noch der junge Lord William Bayswater in ihr Leben tritt. Eine junge Frau zwischen Konvention und Gefühlen, eine spannende Reise durch das antike Ägypten und die Spannungen Europas vor dem Ersten Weltkrieg. Die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer jungen Frau auf dem Weg zu ihrer inneren Bestimmung. Band 1 der Josephine Wennington Reihe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Mama und für meinen Mann, der sich jedes Kapitel eine Sekunde nach dem Abtippen freudig angehört hat und jede Sekunde mitgefiebert. Ich würde dich jederzeit zum Helden in meinen Geschichten machen.
Und auch für Jane Austen
„If adventures will not befall a young lady in her own village, she must seek them abroad”
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kairo: Um 1900
EINS
ZWEI
DREI
FÜNF
Irgendwo in Ägypten
SECHS
SIEBEN
ACHT
London
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREIßIG
EINUNDDREIßIG
ZWEIUNDDREIßIG
DREIUNDDREIßIG
VIERUNDDREIßIG
FÜNFUNDDREIßIG
SIEBENUNDDREIßIG
ACHTUNDDREIßIG
NEUNUNDDREIßIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
Hinweise
Weitere Informationen
NACHWORT
Über die Autorin
PROLOG
Es war Ende August und der Spätsommer legte seine Hitze wie eine Wolldecke über die Stadt. Am Abend erwachte sie und ließ die Lichter kilometerweit bis in den Horizont erstrahlen. Wo es morgens nach frischen Croissants und gerade aufgebrühtem Kaffee roch, wo Automobile und vereinzelt sogar noch Droschken durch die Straßen polterten und die Glöckchen über den Türen der Pâtisserien ununterbrochen Kunden ankündigten, wo die Bäcker in ihrer weißen Kleidung seit den Morgenstunden schufteten, damit sie, nun die silbernen Tablets über den Köpfen balancierend, ihre köstlichen Kostbarkeiten an die Kundschaft feinen Charakters verkaufen konnten und arme Straßenkinder die bettelnden Nasen an den Fensterscheiben plattdrückten ohne auch nur die leiseste Hoffnung darauf zu haben sich eine dieser Köstlichkeiten warm auf der Zunge zergehen zu lassen, dort roch man jetzt den leckeren Duft aus der Küche der Closerie des Lilas und genau dort schwebte nun der blau-lila glitzernde Himmel über der Stadt und kündigte eine erneute, magische Nacht an. Und doch, so muss ich an dieser Stelle gestehen, war mein Blick über das geschäftige Treiben durch die durchaus große Krempe meines nicht minder erwähnenswert großen Hutes sichtbar eingeschränkt. Betonen möchte ich, dass ich dennoch genauso viel sah, wie ich sehen musste. Ein gewisses Interesse daran, was sich vor einem abspielte war nämlich nicht nur von gesellschaftlichem Interesse, es lag letztlich auch in meinem eigenen, ja, nicht ferner meiner simplen Neugier, alles mitzubekommen, was sich unmittelbar vor meiner Hutkrempe abspielte. Der verehrte Leser mag dies befremdlich, wenn nicht sogar abschätzig, bewerten, doch soll er sich an dieser Stelle einmal fragen, über was er sich eigentlich in letzter Zeit mit seinen Gesprächspartnern bei einer Tasse eines Getränkes seiner Wahl unterhalten hat, wenn nicht über den neuesten Tratsch. Ein Kellner in schwarzer Livree kam und stellte ein Glas prickelnden Champagners genau vor meiner Nase auf der Perlmuttweißen Tischdecke ab, da hielt ein galantes Automobil in dunkelblauem Lack vor dem Efeutorbogen und hinaus stieg ein lila Hut auf schwarzem Bubikopf, dazu ein Gazellenartiger Körper in violettem Kleid und die Tür des Automobils schlossen letztlich zwei, zum selben Körper gehörende, Arme in weißen Handschuhen, die perlenartig bis zum Ellbogen hochgezogen waren. Ich senkte den Kopf und lächelte hinter meiner Krempe. Gebracht hatte das nichts, denn kaum hatte die Gazellendame den Efeutorbogen durchschritten, da hörte ich einen spitzen Aufschrei.
„Mon Dieu, Madame La Croiquette“. Ja, jetzt kennt der werte Leser auch endlich den Namen seiner Erzählerin.
„Nie im Leben hätte ich erwartet Sie hier zu treffen“. Und da erst hob ich meinen Kopf und sah der Gazellenfrau in die Augen. „In der Closerie des Lilas?“, fragte ich nach.
„In Paris!“, stieß sie aus, gedämpft von meiner eher mäßigen Begrüßung. „Das letzte Mal sah ich Sie ganz in Braun mit Weste und Ballonhose in London. Und jetzt in dieser Stadt, ganz damenhaft. Wie kommen Sie denn bloß hierher? Sie gehören doch nicht zu diesem neuen Fräuleinwunder im Bananenröckchen?“. Ich lächelte nüchtern und drehte unauffällig an meinem Diamantring. “Mitnichten!“, antwortete ich und erntete dafür einen erleichterten Seufzer, setzte dann aber betont hinterher: „aber bloß, weil ich gar kein Fräulein bin, sondern eine hervorragend verheiratete Frau. Gehörte ich dann zum Eheweibwunder, Verehrteste?“
Als ich sah, dass diese nicht verstand und auch Sie, verehrter Leser doch bestimmt äußerst interessiert daran sind zu erfahren, warum ich an diesem Sommerabend in der Closerie des Lilas den besten Champagner von Paris trank, und vor allem warum die Gazellenfrau darüber so verwundert war, beginne ich an diesem Punkt meine Geschichte zu erzählen.
Nun, werter Leser, kennen Sie wahrscheinlich die Schwierigkeit, die mit dem Erzählen einer Geschichte einhergeht, nur zu gut. Eine davon, die wohl Offensichtlichste, ist einen geeigneten Anfang zu finden. Und das ist auch gleich das richtige Stichwort. Anfang. Über meinen Anfang ist mir leider nur sehr wenig bekannt. Damals jedoch war ich natürlich nicht Madame La Croiquette. Ich war noch nicht einmal Madame. Damals war ich lediglich Josephine. Jo, Josie, ich erinnere mich sehr genau an den Klang der verschiedenen Stimmen, die alle meinen Namen riefen, aus verschiedenen Anlässen versteht sich. Denke ich heute daran zurück, so realisiere ich, dass mein Name ungewöhnlich häufig erzürnt gerufen wurde. Der geschätzte Leser soll jetzt kein Mitleid mit mir empfinden, oder mir gar eine schwere Kindheit zuschreiben, ich war einzig und allein ein zutiefst unerzogenes Kind, das mehr Flausen im Kopf hatte als die Stofffüllung ihres Kuscheltiers. So ist es nun einmal häufig, wenn man ohne Eltern aufwächst. Auch über diesen Anfang weiß ich bedauernswert wenig. Meine Mutter starb im Kindbett, mein junger Vater an der Schwindsucht. Außerdem hatten beide sehr rostige Hare, was ich daher wusste, dass die meinen einen Ton von so rostigem Rot besaßen, dass die Eltern zwei bemerkenswerte Rotschöpfe gewesen sein mussten. Auch meine haselnussfarbenen Augen kamen nicht von irgendwoher. Ich war mir also immer selbst der beste Anhaltspunkt gewesen, wenn es um das Aussehen meiner Eltern ging. Sicher, ich hätte auch meinen Großvater fragen können, bei dem ich schließlich aufwuchs. Der aber hatte meine Mutter gar nicht gekannt, denn mein Vater war nach nur drei Tagen gegen den Willen seiner Eltern mit ihr durchgebrannt. Das Erste, was mein Großvater von uns hören sollte, war also das aufgeweckte Quäken eines winzigen Säuglings, das schon früh Kundschaft über den ungebändigten Charakter dieses kleinen Menschen gab. Das hatte jedenfalls mein Großvater beteuert. Und sagen Sie, werter Leser, sieht man nicht letztlich am Laufe der Geschichtsschreibung, dass es immer die alten, weißhaarigen Männer mit Backenbart sind, die die Weisheit dieser Welt mit ihren feinsten Silberlöffeln geschlürft haben? Mein Großvater hatte einen prächtigen Backenbart und auch Suppe schlürfte er liebend gerne. Aber nicht nur das, auch in der Säuglingsversorgung verstand er sich im besonders hohen Maße männlicher Kompetenz! Er gab mir immer nur den besten Kräuterlikör zum Einschlafen und rauchte bloß den hochwertigsten Tabak in unserem Schlafzimmer. Was mein Opa aber richtig gemacht hat? Er war Archäologe. Ich war also die stolze, stürmische Enkeltochter, die bei ihrem berühmten Ausgräberopa und seiner Horde geballter, mit triefender Männlichkeit versehener Gruppe von Archäologen die Pinsel aus den Ausgrabungsstätten hielt und dabei auch bloß vier Zigaretten selbst pro Tag rauchte. Mehr sei auf keinen Fall vertretbar für ein Mädchen von so zarter Verfassung, schimpfte mein Großvater, wenn ich mir dann doch in der Mittagspause eine fünfte genehmigt hatte. Nun, lieber Leser, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass bei einem Mädchen, welches in Staub und Sand bei einem weißhaarigen, sonderbaren Großvater von zarten sechzig Jahren und rund zehn anderen männlichen Personen verschiedener Altersklassen aufgewachsen ist, keine vornehme kleine Lady mit einem Spitzentaschentuch in den sanften Händen herauskommt. Aber da muss ich Sie leider eines Besseren belehren, und genau deshalb beginnt meine Geschichte in der trockenen, stickigen Sandwüste von Kairo.
Kairo
Um 1900
EINS
Wenn ich sagte meine Geschichte beginne in Kairo, dann meine ich nicht die große Hauptstadt am Nil, wo sich das orientalische Leben tummelt, Händler ihre Waren vertreiben, Gewürzdüfte durch die Nasenflügel ziehen und Hungergefühl verursachen. Ich meine damit nicht die überlaufenen Marktplätze, wo Klänge orientalischer Musik die Beine zum Tanzen bringen und wunderschöne Kleidungsstücke mit Goldbordüre in kleinen Geschäften vertrieben werden. Ich meine damit die sich ewig erstreckende, trockene Wüste von Gizeh, in der die Sonne auf die Köpfe prallt, so stark, dass jeder Archäologe irgendwann glaubt noch ungefähr hundert neue Gräber entdeckt zu haben, und einen Moment später von einem Hitzeschlag mitten in seiner dehydrierten Wahnvorstellung umgehauen wird. Dann war es das mit seiner Entdeckung, denn sein Körper wird eins mit dem Sand und garantiert von niemandem gefunden. Dort, wo Hitze einen um den Verstand bringt und jeder irgendwann glaubt völlig verloren zu sein, habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Mein Großvater war damals für eine Stiftung des British Museum unterwegs, die einzelne Grabstücke aus den weltberühmten Pyramiden von Gizeh bergen und nach England verschiffen sollten. Er hatte keine andere Wahl gehabt, als mich mit sich zu nehmen, denn meine Großmutter war unmittelbar nach meiner Geburt gestorben, was uns beide zu den gegenseitig letzten Verbliebenen machte. Dennoch zählte ich das Team meines Großvaters mit zu meiner Familie. Ein Kleinkind bei Ausgrabungen, dazu noch ein Mädchen, das war eine Seltenheit und dennoch zogen sie mich auf, als seien alle elf meine Väter. Da war beispielsweise der ältere Herr Droog. Von ihm lernte ich mit fünf Jahren einen Pinsel zu halten und zu benutzen. Ich kann mich an dieses Gefühl so lebendig erinnern, als kniete ich wieder dort im Sand. Ich ließ die sanften Haare des Pinsels über meine Hände gleiten, fühlte, wie weich sie waren und lernte, von welcher Wichtigkeit es war, dass man sehr präzise mit ihnen arbeitet. „Wir alle“, erzählte mir Herr Droog, „sind bloß ein Produkt anderer Zivilisationen, ein Ergebnis der Geschichte. Wollen wir uns selbst verstehen, müssen wir sie verstehen. Mit jedem Gegenstand aus dem Sand erfahren wir ein Stückchen mehr, wer sie waren. Und auch wer wir sind.“ Damals war ich zu klein, um es zu verstehen, für mich waren diese Gegenstände eben nur das: Material, an dem der staubtrockene Sand klebte. Dass er Recht hatte, wurde mir erst bewusst, als ich mit zwölf Jahren meinen ersten Ohrring ausgrub.
Es war ein Tag von besonderer Trockenheit, wir hatten seit Wochen im nirgendwo der Wüste gegraben. Weiter rauszugehen, trauten wir uns nicht, da wir noch immer mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden mussten. Zu viele waren bereits weiter raus in die Tiefen der Wüste hineingegangen, aber nie mehr wiedergekommen. Die Laune meines Großvaters wurde von Tag zu Tag grimmiger, nicht am Ende in Ermangelung eines ordentlichen Stück Fleischs. Ich war ein solch zartes, zerbrechliches Wesen, denn man durfte nicht vergessen, ich hatte den Großteil meines Lebens in der ägyptischen Wüste verbracht. Ich kannte nur das, was ich von der Gruppe mitbekam. Und das war sogar eine ganze Menge. Der verehrte Leser soll sich nicht darin täuschen, wie klug und gebildet ich als Kind einer wissenschaftlichen Mission war. Herr Droog lehrte mich die alte Geschichte und alles, was davon bisher bekannt war, sodass ich wusste, weshalb wir hier waren. Mein Großvater grub und grub, noch heute sehe ich ihn vor mir mit seiner ganz vertrockneten, ledrigen Haut, die schon beinahe einer Kakaobohne glich und dem vollständig ergrauten, ernsten Backenbart. Auf der Nase trug er eine winzige Brille, die mit einem Band am Hinterkopf befestigt war, sodass sie beim Graben nicht verloren ging. Wenn er einen schlechten Tag hatte, kletterte ich oft hinunter in seine Grube und handelte mir einen Tadel ein. „Ein so kleines Wesen gehört nicht in eine vom Einsturz gefährdete Grube! Ein so kleines Wesen gehört nach oben ins Zelt mit etwas zu trinken.“ Ich steckte daraufhin ihm und mir eine Zigarette an. Da warf er die Arme in die Luft und jauchzte. „Eine Dame soll ich aus dir machen und jetzt sieh dich an: zehn Jahre alt, ganz magere Glieder, in kurzen Leinenhosen und Zigarette im Mund.“ Doch schließlich nahm er sich die seine, schob sie zwischen die Lippen und zwinkerte mir zu. Ich zwinkerte zurück, umarmte ihn, atmete den trockenen Sandgeruch ein, der sich mit seinem Schweiß paarte und holte den Pinsel aus meiner Hosentasche hervor. „Ich pinsele doch so gerne Großvater, also hopp, grab mir mal etwas Schönes aus.“ Da lachte er und legte mir einen Sonnenhut auf den Kopf, den ich selbst immer wieder vergaß. „Nicht, dass dich der Hitzetod holt“, mahnte er dann und grub weiter. So ging es einige Jahre, ich lernte alte Geschichte bei Herrn Droog, lernte lesen bei unserem jungen Studenten Werter und die Gesetze der Biologie bei Herrn von Soost. In meinen beigen Leinenhosen saß ich herum, den Sonnenhut auf den rostigen Haaren, die sich wie wild darunter kräuselten und mein Hemd in die Hose gesteckt. Man hätte mich schon beinahe gebildet nennen können, aber etwas ganz Entscheidendes fehlte mir: ich hatte absolut keine Ahnung von Kultur oder von weiblichem Benehmen. Je älter ich wurde, desto seltsamer erschien es mir als einziges Mädchen unter all den Männern zu sein und desto mehr fragte ich mich, ob es überhaupt irgendetwas gab, was uns voneinander unterschied. Und dann, eines Tages, stieg ich wieder hinab in die Grube, holte mir wieder einen Tadel ein und sah dann etwas in der sandigen Schicht glitzern. Instinktiv schob ich meine Hand in den Sand, fühlte, wie er mir durch die Hände rann, griff mit der anderen Hand nach meinem Pinsel, den ich mir in die Hosentasche gesteckt hatte und befreite das winzige Stückchen fein säuberlich von dem ganzen Sand. Perlmutt schimmerte es in meiner Hand, ein solches Material hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Türkis, schon fast wie vom Wasser eingefärbt, blitzte es in der trockenen Sonne und bildete einen unvergesslichen Kontrast zum monotonen Gold des unendlichen Sandes. „Was hast du da?“, fragte mein Großvater. Als ich es ihm gab, weiteten sich seine Augen und er rief die gesamte Mannschaft zusammen. Ein unfassbarer Fund, ein Ohrring! Ein Ohrring aus einem seltenen Material. Er drückte mich, gab mir einen Kuss auf die Wange und warf mich nach oben. Alle feierten mich, die Entdeckerin dieses spannenden Zeugnisses antiker Geschichte. Und ich sah an diesem Tag das aller erste Mal ein Stück Schmuck. Da wusste ich, was Herr Droog gemeint hatte. Ich begann mir vorzustellen, wer dieses Schmuckstück getragen hatte.
ZWEI
Natürlich konnte der Ohrring nicht in unserem verstaubten Zelt in Gizeh bleiben, sondern mussten gut versorgt, gereinigt und dementsprechend verpackt nach Großbritannien gebracht werden. Dafür mussten wir, mein Großvater, Herr Droog und ich nach Kairo rein, denn dort war unsere nächstgrößere Anlaufstelle. Ich wusste natürlich rein gar nichts über die Stadt. Ich konnte an meinen Fingern abzählen, wie oft ich irgendwo anders gewesen war, als in der unendlichen Weite von Gizeh und da stellt sich nicht nur Ihnen werter Leser, sondern auch mir die Frage, inwieweit diese Erinnerungen noch den Tatsachen entsprechen, und ob sie nicht doch nun mehr das Produkt meiner lebhaften Fantasie als kleines Mädchen sind. Nun ja, wir fuhren also zu dritt richtig in die Stadt von Kairo hinein. Die Sonne prallte geradezu auf unsere Köpfe, es war ein unbeschreiblich heißer Tag. Und doch war ich völlig überfordert von der Fülle von Eindrücken. Kamele liefen auf dem brennend heißen Asphalt, der ganz fein mit weißen Sandkörnern übersät war und von den zarten Luftzügen in der Luft wirbelte. Ich schaute nach links nach rechts, nach oben auf die Dächer, von denen Teppiche mit Goldbordüren herunterflatterten und unter mir auf den Boden, dessen Pflaster von der Hitze förmlich dampfte. Ich hörte aufgeregte Stimmen schreien. Von oben bis unten verschleierte Männer in weiß trugen riesige Hüte auf ihren Köpfen und standen hinter Ständen mit jeder Menge kleiner Päckchen, die einen unerträglichen Duft ausstrahlten.
„Großvater!“, ich zog ihm an seinem Leinenhemd. Er folgte meinem Blick und lachte. „Das sind Gewürze“, erklärte er mir, „Damit schmeckt das Essen anders. Besser.“ Aber ich verstand es nicht wirklich. Mein Essen befand ich als gut, so wie es war und dennoch… Diese bunten, farbig strahlenden Gewürze sahen aus wie Wundermittel. Mein Großvater hielt mich an der Hand, eine Fürsorge, die ich nicht gewohnt war von einem Mann, dem ich regelmäßig die Zigaretten anzündete, damit er besser gelaunt war, und der mich manchmal einfach so mit Erde abwarf, lachte und „SANDSTURM!“, rief. Und nein, lieber Leser, das war nicht pädagogisch verwerflich, das war einzig und allein totlustig. Ich liebte die Streiche meines Großvaters und fühlte mich von oben bis unten wie ein von Glück erfülltes Kind. Bis zu diesem Tag. Bis zu dem Tag, als ich den Ohrring fand und in der Stadt eine Entdeckung machte. Diese Entdeckung spielte sich zufällig genau vor unserem Ziel ab: dem Ägyptischen Museum. Diese Entdeckung war in ein Gewand aus genau der gleichen Perlmuttschimmernden Farbe gekleidet, wie der Ohrring, der sich in dem Behälter meines Großvaters befand. Bei jedem Schritt, den sie machte, flog der federleichte Stoff ihres Gewandes um sie umher. An ihrem Oberkörper war es mit winzigen, goldenen Fäden versehen, ihr schwarzes Haar wallte ihr bis zur Brust hinunter und die tief dunklen Augen waren bläulich umrandet. Wenn man als Kind jahrelang unter Männern aufwächst und an einer Hand abzählen konnte, wie oft man ein weibliches Wesen zu Gesicht bekommen hatte, dann wusste man nicht recht, wie man mit einer Schönheit dieses Ausmaßes umgehen sollte. Eines aber wusste ich schlagartig: ich wollte sein, wie sie. Wollte den Stoff dieses Kleides um meine Beine fühlen, wollte, dass er meine Taille umschmeichelte. Noch nie zuvor in meinem ganzen Leben hatte ich etwas Vergleichbares gefühlt. Aber sie erschien so unnahbar, so unerreichbar, als wüsste sie ganz genau um die Wirkung, die sie auf alle hatte. Und es dauerte Jahre, bis ich mir darüber bewusstwurde, dass es nicht ihre Kleider waren, die mich so für das begeisterte, was sich vor meinem Auge abspielte. Es war der Blick in ihren dunklen Augen, nicht das, was sie trug, sondern das, was durch sie nach außen getragen wurde. Diese wunderschöne mysteriöse Frau umgab eine Aura der Sinnlichkeit. Unfassbar reizend und doch so verletzlich. Ja, ihre Verletzlichkeit lag in ihrem Stolz. Und doch ging alles so unfassbar schnell. Noch bevor ich mir noch näher die Stickereien auf ihrem Kleid ansehen konnte, war sie auch schon verschwunden. Sagen nicht die Leute in den Büchern immer es gäbe eine Art Schlüsselmoment im Leben? Wenn ja, lieber Leser, dann war dies mein Schlüsselmoment, denn etwas in mir hatte sich ganz entschieden verändert. Ich hatte die Schönheit nie gekannt, Sinnlichkeit war mir fremd. Aber dieses kleine Stückchen Perlmutt, dieser kleine Glanz im gelben Sand, zeigte mir, dass wenn man nur lange genug grub, die Schönheit im Verborgenen wartete.
Nicht nur in meinem Welt- und Selbstbild hatte der Fund des Ohrringes alles durcheinandergebracht, auch mein Großvater fiel völlig aus den Socken. Denn kaum waren wir im Museum angekommen, breitete sich die Aufregung auch unter den anderen aus. Endlich wurde etwas gefunden, endlich, nach all den Jahren der Buddelei. Und auf einmal meinte man, dass die Mann, die wir waren, nicht ausreichten, man brauche noch zig mehr! Das Museum rekrutierte mehr Männer aus sämtlichen Ländern, aus England, aus Frankreich, sogar aus dem Deutschen Kaiserreich. Und all das war noch nicht genug: uns sollte ein ägyptischer Experte zur Seite gestellt werden, der sich in der Umgebung rund um Gizeh auskannte. Denn schließlich hatten wir ja jetzt lange genug dort rumgebuddelt, wir sollten unseren Umkreis vergrößern. Und bei jedem Wort, das der Museumsdirektor vorschwärmte, zuckte mein Großvater einmal mehr zusammen. Ich wusste damals ganz genau, wie er sich fühlte. Jahre um Jahre hatte er in den Löchern gesessen und abends versucht die Erde unter seinen Fingernägeln hervorzukratzen und nun stand da ein großer Herr in einem schwarzen Anzug und hielt den Ohrring in seinen Händen. Er wollte Profit. Mein Großvater hatte Tränen in den Augen. Also änderte sich auch in unserer Truppe so ziemlich alles. Als wir aus dem Museum hinausgingen, atmete mein Großvater schwer aus und sah sich um. Ich griff nach seiner Hand und drückte sie. Als ich noch jünger gewesen war, hatte ich mir immer einen Spaß daraus gemacht meinen Großvater damit zu ärgern den Altersflecken auf seiner Hand zu zählen. Just in diesem Moment bemerkte ich, dass sie so viele geworden waren, dass es für mich viel zu lange gedauert hätte sie jetzt noch zu zählen. Ich lächelte zu ihm herauf. Mit einem gepressten Lächeln zwinkerte er mir zu und drückte mich.
„Na Josie, wie gefällt dir die Stadt?“. Wie gefiel sie mir? Ich war ehrlich zu mir selbst, mir war sie völlig egal, das Einzige, was in meinem Kopf Platz hatte, war die Schönheit. Also zuckte ich mit den Schultern.
„Mitnichten so familiär, wie unsere Station“. Mein Großvater fiel in hallendes Gelächter aus.
„Wer hat dir denn diese Worte beigebracht?“ Ich wollte antworten, da hatte er sich aber schon zu mir heruntergebeugt und hielt mich an den Schultern. „Josie“, sagte er eindringlich, „Das ist heute dein großer Tag!“ Ich fragte mich damals sofort, warum er das dachte. „Egal, was dieser Anzugheini da redet, das ist DEIN großer Tag. Heute bist du eine waschechte Archäologin. Und lass dir ja von niemandem etwas anderes einreden.“ Ich legte den Kopf schief.
„Aber Großvater, das bin ich doch schon seit ich geboren wurde. Ich habe mehr Sand in meinem Leben gegessen als so mancher Mensch Kekse zum Tee.“ Er lachte und schüttelte den Kopf. „Jedenfalls, möchte ich, dass du dir von hier aus der Stadt etwas aussuchst. Etwas, dass du dir wünschst und was ich dir kaufen werde.“
Es kam mir damals so unfassbar banal vor. Etwas kaufen? Warum sollte er mir etwas kaufen, wo ich doch alles hatte, was mich glücklich machte und niemals bekommen konnte, was mich erfüllen würde? Und dann fielen mir die Händler und ihre Stoffe wieder ein. „Das ist äußerst gütig von dir, Großvater“, sagte ich lächelnd.
„Hör auf zu sprechen, als kämst du ausm Buckingham Palace, sonst muss ich nochmal ein ernstes Wort mit Herrn Droog sprechen!“, scherzte er. Und das war die zweite Sache, die ich an diesem Tag realisierte. Ich genoss es plötzlich gewähltere Worte zu verwenden. Wie sie klangen, wenn ich sprach, wie sie aus meinem Mund purzelten, wie edel sie waren. Und dann war da noch diese große neue Aufgabe. Ich sollte mir etwas aussuchen, was ich mir wünschte. Aber es war doch noch alles so neu für mich, wie sollte ich das alles kennenlernen und direkt entscheiden, wonach ich mich sehnte? Als wir dann auf den Markt gingen, wurde es mir schlagartig bewusst. Ich sah sie erst nur aus dem Augenwinkel. Stoffe, in den buntesten Farben und den verschiedensten Ausführungen. Schnurstracks deutete ich auf den Händler, mein Großvater folgte mir. Ich sah sie auf einmal so deutlich vor mir, als stünde sie direkt neben dem Händler. Die Schönheit, mit all ihrer Sinnlichkeit, all ihrer Ausstrahlung. Der Händler beäugte die Fremdartigkeit meiner weißen Haut, die trotz all der Jahre in der ägyptischen Sonne nie an Bräune gewonnen hatte, meine zarten Glieder, die durch all die körperliche Betätigung nie an Fleisch zugenommen hatten und dann fiel sein Blick auf meine rostroten Haare. Instinktiv griff ich mir in den wilden Haarschopf, aber er wirkte in keiner Weise verstört, er wirkte geradezu fasziniert. Und dann drehte er sich um und holte ein grün leuchtendes Tuch hervor. An den Seiten hatte es feine Stickereien und wundervolle Fransen. Er breitete das Tuch aus, deutete auf meine Haare und lächelte. Ich verstand instinktiv und beugte mich zu ihm vor. Kunstvoll drapierte er mir das Tuch um den Kopf, sodass das Grün wellenartig in das Kupfer der Locken überging, die sich noch wild darunter hervorstahlen. Zufrieden hielt er mir einen Spiegel hin, und ich erschrak. Die bleiche Haut zum Leben erweckt, der wunderschöne Kontrast von Rot und Grün. Als mein Großvater bezahlte, war das Tuch mein größtes Heiligtum, mein ganzer Stolz, alles, was ich besaß. Ich spürte eine innige Liebe, vielleicht nicht zu dem Tuch selbst, aber zu dem, was es aus mir machte. Als wir aus der Stadt zurückkamen, bestaunte jeder das Tuch um meinen Kopf. Herr Droog kam und stellte sich verträumt vor mich. „Oh, werte Dame, welch Freude Ihre Aufwartung zu machen.“ Mein Großvater schnaubte.
„Hören Sie auf meiner Enkeltochter so geschmalztes Gelaber beizubringen, Droog“. Ich zwinkerte und flüsterte.
„Bitte nicht, ich finde es so schön“.
Und auch die anderen aus der Mannschaft spaßten herum, nannten mich jetzt eine feine Lady. Abends jedoch, als die meisten schliefen und auch ich bereits schlafen sollte, sah ich meinen Großvater noch in die Ferne starren. Oh je, dachte ich direkt, das war ein Zigarettenmoment. Also zündete ich zwei an und reichte ihm die eine.
„Du sollst doch nicht rauchen!“, presste er hervor, die Zigarette schon zwischen den Lippen.
„Und außerdem sollst du schlafen.“ Ich blies den Rauch aus und fragte mich urplötzlich etwas ganz anderes: Nämlich, ob das etwas ist, was Schönheiten tun. Würde die Frau vor dem Museum so ungeschickt Rauch ausblasen? Noch nie zuvor hatte ich mir diese Frage gestellt.
„Du siehst ja so traurig aus“, stellte ich fest,
„dabei war heute doch ein so schöner Tag.“ Mein Großvater schmunzelte und seufzte, während er sich das Tuch ansah, dass ich nun als Schärpe trug.
„Da hast du völlig Recht, meine Josie. Und doch war er auch so traurig. Mir ist nämlich klargeworden, dass passiert ist, was passieren muss und worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.“ Ich hustete.
„Die Arbeit?“, fragte ich naiv.
„Nein“, lachte mein Großvater, „aber es ist spät, und du sollst ins Bett. Du bist doch jetzt unsere berühmte Ausgräberin.“ Und da wurde ich auf einmal furchtbar müde. Ich sollte außerdem auch erst viel später erfahren, was er denn damit gemeint hatte.
DREI
Verlief mein Leben bis dahin auch noch so eintönig, so sollte sich ab diesem Tage alles mehr oder weniger ändern. Ich hatte das Leben geschnuppert, die neuen Eindrücke hatten bei mir etwas bewirkt und wie es irgendwie immer ist, wenn sich ein Gedanke in unseren Köpfen eingenistet hat, wird er uns nie wieder verlassen. Sind Gedanken einmal vorhanden, können wir sie nicht ungedacht machen, so sehr wir es uns auch wünschen. Wir können einzig und allein entscheiden, wie wir mit diesem gedachten Gedankengut umgehen und was wir daraus machen. Als ich eines Morgens aufwachte, hatte sich alles verändert. Sie würden sich wundern, verehrter Leser, wie schnell weiße britische Männer handeln können, wenn sie ein seltenes Stück wertvollen Fundes in den Händen halten. In meiner langatmigen, langlebigen Welt kamen mir alle diese Veränderungen vor, wie eine Welle, oder noch ein besseres Wortbild: Wie ein Sandsturm, der über unseren Alltag flog und alles, was bisher dagewesen war mit einer dicken Schicht seines Sandes belagerte. Ich stand auf, wickelte mir den Schal um, den ich die ganze Nacht in meinen Händen gehalten hatte und verließ das stickige Zelt. Als ich hinauskam, war es nicht nur die mir so vertraute ägyptische Sonne, die mich blendete. Innerhalb weniger Wochen hatte sich unsere Mannschaft verdreifacht. Nicht nur hatten wir auf einmal mehrere ägyptische Führer, die sich in den Tiefen der Wüste auskannten, auch aus Europa waren zahlreiche weitere Männer angereist. Ich hörte auf einmal Sprachen, die ich noch nie zuvor gehört hatte, sah Dinge, die mir noch exotischer vorkamen als die bunten Gewürze auf dem Markt in Kairo. Wo wir noch vor wenigen Wochen unsere vertraute Truppe langjähriger Freunde gewesen waren, fühlte ich mich nun, wie in einer Kolonie von Fremden. Es war, als wären sie aus Europa gekommen, um uns mit ihrer europäischen, zivilisierten Art zu zeigen, wie man die Dinge richtig machte, die wir in ihren Augen Jahre lang falsch gemacht hatten. Und mich als junges Mädchen von gerade einmal vierzehn Jahren, betrachteten sie, wie einen gefährlichen Skarabäus. Doch so sehr ich mir auch wünschte, dass ich es bereute den Ohrring gefunden zu haben und wieder dahin zurückzukehren, wo wir all die Jahre gewesen waren, ich konnte es nicht. Dieses Schmuckstück hatte mir eine Welt eröffnet, mir bewusst gemacht, was es für schöne Dinge da draußen gab, und nun wollte ich diese Gewissheit nicht mehr hergeben, für nichts in dieser Welt. Ich klammerte mich an meinen Schal, als wäre es eine Verdinglichung meiner Erinnerung, als befürchtete ich, dass sie mir abhandenkäme. Ich musste nur jeden Morgen das Grün betrachten, um wieder diese Regung in meiner Brust zu verspüren, die ich gespürt hatte, als ich die Schönheit sah. Hätte ich mir also gewünscht dies ungeschehen zu machen, wäre auch eben diese Erinnerung mit verschwunden. Jede Veränderung tut erst einmal weh, und wenn ich glaubte, dass sie mir schon wehtat, dann würde ich keine Worte finden, um zu beschreiben, wie mein Großvater unter der Last des Neuen zusammenzuckte. Sogar Herr Droog hielt den Blick nun immer öfter gesenkt und buddelte ganz für sich allein, allerhöchstens einmal mit mir. Wie früher würde es aber nie wieder werden, das wussten wir alle. Während ich mit Herrn Droog dasaß und meinen Pinsel über den Sand malen ließ, erzählte er mir Dinge über die Geschichte aus dem Land, aus dem er kam: dem Deutschen Kaiserreich. Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war das Kaiserreich aufgeteilt in ganz viele Fürstentümer. Fürsten waren furchtbar reich, aber nicht einmal annähernd so reich, wie Könige. Auch wir in England, dem Land, aus dem mein Opa stammte, hatten eine Königin gehabt, die war aber vor ein paar Jahren gestorben und nun regierte ihr Sohn zu Hause das Land. Deutschland hatte einen Kaiser, erzählte mir Herr Droog, der hatte einen ziemlich lustigen Schnurrbart und war noch recht jung gewesen, als er Kaiser wurde. Während wir da also buddelten, gruben, pinselten, hörte ich Herrn Droog zu und konnte mich gar nicht entscheiden, was ich am spannendsten fand. Wie er die Landschaften beschrieb, voller Wälder und Lichtungen in denen Vögel zwitscherten. Selbstverständlich kannte ich keine Wälder und erst recht keine Vögel, weshalb die Schilderungen von Herrn Droog alsbald zu wunderbar fantastischen Gebilden meiner Vorstellungskraft wurden. Aber ich war so fasziniert von diesen Geschichten, dass sich bald ein ganz interessanter Gedanke in meinem Kopf festsetzte und wir wissen ja, was dann geschehen würde, wenn er erst einmal da war: er wurde real.
„Ich muss unbedingt einmal dorthin!“, rief ich aufgeregt, „Ins Kaiserreich, da muss ich einmal hin“.
Auf einmal fegte mir jemand einen heftigen Stoß Sand über den Kopf und ich erschrak so sehr, dass ich in die Grube fiel und mein Tuch mit Erde beschmutzte. Von oben sah ich einen Mann, der mit verzogenem Mund auf mich herabsah und „Pute allemande!“, ausstieß. Herr Droog verpasste ihm einen heftigen Schlag und erwiderte etwas auf der gleichen Sprache, das so beängstigend gewesen sein musste, dass sich der Fremde mit einem Knurren abwandte und uns fortan mied. Herr Droog kam zu mir, nahm mein Tuch und blies den Sand weg. „Komm mein Kind“, sagte er und wickelte mir das saubergemachte Tuch wieder um die Haare.
„Warum hat er das getan? Ich habe nicht verstanden, was er zu mir gesagt hat.“ Seufzend half mir Herr Droog auf die Beine und klopfte den Sand von meiner weißen Bluse.
„Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Deutschland gegen Frankreich in einem furchtbaren Krieg gekämpft. Viele sind ums Leben gekommen, und man weiß nicht so recht, was diese Männer alles gesehen haben, dass sie zu solchen hasserfüllten Kreaturen wurden. Als du ausgesprochen hast, was du eben ausgesprochen hast, hat das diesen Mann wahrscheinlich einfach an etwas erinnert. Und das hatte rein gar nichts mit dir zu tun.“ Ich hustete einen Schwall Sand aus und trotz, dass der Mann mich so herb behandelt hatte, empfand ich auf einmal tiefstes Mitleid. „Das tut mir schrecklich leid“, sagte ich zu Herrn Droog, aber dieser winkte ab.
„Es sind nicht Länder oder Nationalitäten, die diese Kriege führen. Es sind Menschen, völlig unabhängig davon, wo sie herkommen. Nationalität kann keinen Charakter haben, es ist also völlig egal, ob du Franzose, oder Deutscher oder Italiener bist: Du kannst auch alles gleichzeitig sein, zählen tut nur, dass du menschlich bist und was du daraus machst. Viele wissen gar nicht erst woher sie kommen, so wie du meine Kleine. Zählen tut nur dein Weg, nicht wo er begonnen hat und nicht wo er endet, sondern nur wie du ihn gehst.“ Ich sah dem Mann noch eine Weile nach.
„Ich hoffe ich werde niemals einen so furchtbaren Krieg miterleben müssen“, erwiderte ich. Herr Droog besah mich mit einem mitleidigen Lächeln. Danach machten wir uns wieder an die Arbeit.
Wissen Sie, verehrter Leser, warum Sie die Geschichte ihres Lebens so erzählen, wie sie sie erzählen? Warum Sie genau die Ereignisse erwähnen, welche Momente bei Ihnen alles verändert haben? Ich habe mich schon so oft gefragt, warum manche meiner Erinnerungen so lebhaft so wichtig sind, und andere nicht, wo doch jedes Fragment, jeder Moment dieselbe Bedeutung und dieselbe Wichtigkeit innehat. Wie Bindeglieder liegen sie zwischen unseren großen Erinnerungen, halten die Kette unserer Lebensgeschichte aufrecht. Und manchmal vergessen wir Dinge, die in den Momenten ihrer Aktualität noch so groß und bedeutungsvoll erschienen. Hätte ich an diesem Tag gewusst, dass es meine letzte Unterhaltung, der letzte Abend beim Essen mit Herrn Droog sein würde, ich hätte ihm gedankt. Ich hätte ihn gedrückt und ihm gedankt dafür, was er mir alles beigebracht hatte. Aber natürlich hatte ich es vorher nicht gewusst und als Herr Droog in dieser Nacht starb war es, als wäre ein bedeutender Teil unseres Alltages auch gestorben. Mein Großvater ging in sein Zelt, ich begleitete ihn. Er sah aus, als würde er schlafen, die kleine silberne Brille mit den kreisrunden Gläsern auf der Nase, sogar seinen hellen Strohhut, hatte er sich auf den Kopf gelegt. Mein Großvater schnäuzte und nickte.
„Lebwohl mein alter Freund.“ sagte er und verließ das Zelt. Mir kullerten lautlos die Tränen, es war, als wäre mein bester Freund gestorben. Denn das war er für mich gewesen, mein bester Freund, der mir Dinge über die Welt erzählte, die ich so noch nie hatte kennenlernen dürfen. Ich wischte mir die Träne von der Wange und nahm das kleine gerahmte Bild von seiner Frau vom Boden, um es ihm behutsam unter die Hand mit seinem Ehering zu legen. Er hatte mir vor langer Zeit einmal erzählt, dass seine Frau die Schönheit einer blühenden Magnolie und den Charakter eines Engels auf Erden besessen hatte und es erinnerte mich an die vielen Abende, die er dort in der ägyptischen Wüste unterm Sternenhimmel gesessen hatte, nach oben sah und ihr lächelnd in den Himmel zuzwinkerte. Als ich ihn da so liegen sah, das Bild in seiner Hand und den friedlichen Ausdruck auf seinem Gesicht, da spürte ich diese todtraurige Freude. Todtraurig über diesen ersten riesigen Verlust in meinem Leben und Freude darüber, dass dieser wunderbare, ehrbare Freund nun endlich wieder mit seiner Frau tanzen konnte.
FÜNF
Als Herr Droog nicht mehr bei uns war, trauerte unsere ganze Mannschaft um ihren alten Freund. Mit ihm war auch das letzte bisschen Bekanntes gestorben und wir mussten uns alle nun diesem unleugbar Neuem stellen. Auch mein Großvater war nicht mehr der Alte. Eine Woche lang rührte er keine Zigarette an, trank nichts und wenn ich abends mit ihm am Lagerfeuer saß, umarmte er mich einfach still, bis wir dann alle ins Bett gingen. Er arbeitete nicht mehr gerne. Früher hatten wir den ganzen Tag alle zusammen gegraben, haben gelacht und Scherze gemacht. Nun war es nicht mehr so, denn Großvater wurde von früh bis spät von den englischen Männern zur Rechenschaft dafür gezogen, was so viele Jahre ihrer Meinung nach schiefgelaufen war. Wo ich ihn am Anfang noch still zuhören gesehen habe, starrte er jetzt mit ganz glasigen Augen in die Ferne und schien gar nicht mehr wirklich anwesend zu sein. Ich schluckte und konzentrierte mich zunehmend auf die Bücher in meinem Zelt als auf das Buddeln in der Sonne. Herr Droog hatte mir alle seine Bücher hinterlassen, sogar schriftlich und ich war nun stolze Eigentümerin von Büchern. Geschichtswerke, Sprachbücher, sogar Romane. Immer mehr Zeit verbrachte ich auf einmal zwischen den Zeilen, bis ich irgendwann vollständig in diesen fremden Welten versank. Die Wüste wurde mir zu klein, mein Leben engte mich ein. Und dann eines Tages, kam jemand an. Ich saß gerade im Sand, da sah ich drei Kamele auf uns zukommen, zwei ägyptische Männer in ihren typischen Gewändern und eine dritte Person. Als er abstieg, musterte ich ihn aufmerksam. Ich hatte mein ganzes Leben lang mit männlichen Personen zusammengelebt, ich bin unter Männern aufgewachsen. Aber diesmal war es anders. Er hatte kurzes, blondes Haar, war groß, so viel größter als ich. Seine Augen waren beinahe so grün, wie mein Tuch, das ich noch immer tagein, tagaus um den Kopf trug. Mit großen Schritten kam er uns entgegen. Einer der fremden Arbeiter, der erst vor wenigen Tagen angekommen war, sprach mit ihm und deutete dann in die Richtung meines Großvaters. Der saß gerade schweißgebadet auf einem Stuhl und trank etwas aus seiner grünen Wasserflasche, als sich der blonde Herr vorstellte. Ich merkte sofort, wie sich die Augen meines Großvaters verengten und er dem Herrn andeutete kein Wort von dem zu verstehen, was er versuchte zu sagen. Ich ging ein wenig näher an die beiden heran und hörte, dass der junge Mann Deutsch sprach. Mein Großvater verstand ihn nicht, denn er sprach nur Englisch, ich aber hatte von Herrn Droog Deutsch gelernt. Mit pochendem Herzen und ganz nervös auf den Beinen ging ich auf die beiden zu. „Entschuldigung“, sagte ich und sofort drehte sich der junge Mann zu mir um. Seine Augen musterten mich erstaunt und ich glaube ich fragte mich das erste Mal in meinem ganzen Leben, ob ein männliches Wesen mich hübsch fand. Ich lächelte ihm unsicher zu.
„Mein Großvater spricht kein Deutsch“, erklärte ich mit matter Stimme. Der junge Mann stieß einen Schwall Luft aus. „Ich kann es ihm übersetzen“, bot ich an.
„Ich bin der neue Arzt, man sagte mir man habe mich bereits angekündigt.“ Noch nie hatte ich eine solche Stimme gehört. Sie war von einer Sanftheit, dass ich mich in ihrem Klang hätte baden wollen, von einer Ruhe, dass ich mich von ihr hätte in den Schlaf reden lassen, so beschützend, so warm, wie der perlige feine Sand unter meinen Füßen. Ich nickte gebannt und erklärte meinem Großvater auf Englisch, wer dieser Mann war. Im ersten Moment musterte ihn mein Großvater mit einem Blick, der so viel Zweifel ausspie und gleichzeitig sagen wollte: bist du nicht gerade erst geboren wurden? Aber dann schien er sich daran zu erinnern, dass ein junger Arzt wohl besser war, als gar keiner und lächelte müde. War bisher einer von uns krank geworden, musste man ihn nach Kairo zu einem Arzt bringen. Nun waren wir aber so viel Mann geworden und unsere Expedition so groß, dass man es wohl als nötig befand uns mit einem eigenen Expeditionsarzt auszustatten. Für meinen Großvater war die Sache wohl gegessen, denn er wandte sich lustlos ab. Hilflos stand der junge Mann da und ich erkannte, dass er wohl genauso fremd in dieser Welt war, wie ich in seiner sein würde.
„Kommen Sie“, sagte ich höflich, „Ich zeige Ihnen Ihr Zelt.“ Dankbar folgte er mir. Ihm wurde das Zelt von Herrn Droog zugeteilt, da dieses leer stand und es sich sehr gut als Ärztezelt eignete. Es war ausreichend geräumig und hatte zwei Pritschen. Doch als ich mit der Hand aufs Zelt deutete, fühlte es sich an, als hätte mir jemand ein Messer ins Herz gerammt. Er ging hinein und ich folgte ihm. Begeistert und zugleich beängstigt sah er sich um, legte dann seine Ledertasche ab und packte die Hände in die Taschen seiner hellen Leinenhose. Er sah so vornehm aus, dass es mir schwerfiel zu glauben, er habe in seinem ganzen Leben das Haus öfter verlassen, als für eine vornehme Kutschfahrt. Ich hatte noch nie so saubere Kleidung gesehen und kam mir gleichzeitig seltsam schmutzig vor. „Wie kommt es, dass Sie Deutsch sprechen?“, fragte er mich. Ich erklärte ihm, dass ein guter Freund es mir beigebracht habe, ein alter Gelehrter aus dem Kaiserreich. „Ich komme aus Österreich“, sagte er freudig. „Aus Wien genauer gesagt.“ Ich versuchte zu verstecken, dass ich keine Ahnung hatte, wo das war und was Wien eigentlich genau war. „Ich komme aus Ägypten“, erwiderte ich automatisch und als ich sah, dass er stutzte, erläuterte ich: „Ich bin hier groß geworden bei meinem Großvater.“ Wir lächelten uns an und ohne zu wissen, wie wir hießen, waren wir Vertraute. „Ich bin Erich“, stellte er sich mir vor. Ich schüttelte seine Hand und wunderte mich über die Zögerlichkeit seines Händedrucks. „Josephine“. Und so kam es, dass mich in kürzester Zeit eine der wichtigsten Personen in meinem Leben verließ und gleichzeitig eine andere in mein Leben trat.
Erich, der geheimnisvolle Fremde mit dem blonden Haar und den grünen Augen. Ich erinnere mich daran, wie es sich anfühlte neben ihm zu sitzen, seine Stimme zu hören, sein Lachen, wie seine Augenlider zuckten, wie sanft und weich sich die Haut über seinen Händen anfühlte. Alle anderen Hände, die ich je gesehen, oder berührt hatte, waren rau gewesen, wie kratziger Stein, braun wie Leder, porös. Nicht aber die Seinen. Seine Haut war so makellos hell. Sein Haar lag jeden Tag in einer sanften Welle von der Stirn nach hinten weg. Er trug helle Kleidung, weiße Hemden, goldene Hemdnadeln, Weste und Leinenhosen. Seine glänzenden Lederstiefel sahen aus, als hätte er sie erst einmal getragen, und zwar auf seiner Reise hierher. Wenn ich neben ihm saß, roch ich den fremden Geruch, der so süßlich und herb zugleich war. Und schon bald wurde dieser Duft für mich zu dem wohl Schönsten, was mein Herz je gespürt hatte. Von da an und für jeden Tag meines Lebens, der folgte, sollte es Erichs Duft sein. Süß und herb, sanft und beschützend. Wir sprachen über Bücher, er erzählte mir von Wien, von einer Speise, die sich Apfelstrudel nannte und beschrieb mir den Geruch eines Kaffeehauses. Ich lachte bei der Vorstellung, dass sich feine Leute in eleganten Roben trafen, um dort etwas zu trinken. Aber Erich erklärte mir, dass es in Österreich eine Tradition sei, etwas unfassbar Wichtiges im Alltag. Man traf sich und man trank Kaffee und dabei redete man über alles Mögliche, über Politik, über Tratsch. Ich hörte mit so glänzenden Augen zu, dass er dieses Schmunzeln hatte, dieses ganz besondere stille lachen, was er immer hatte, wenn er sich innerlich freute, wenn ihn eine Vorstellung so begeisterte, dass er sich in diesem Gefühl von Freude badete und sich doch nicht ganz traute diese Freude nach außen zu tragen. Sein distanziert galanter Charakter prallte auf meine wenig damenhafte Art mich auszudrücken, meine Wildheit, meine rasche Begeisterung für alles Fremde und Unbekannte. Oft saßen wir dort unter den Sternen, als alle anderen schon schliefen und ich erzählte ihm von meiner Kindheit in Ägypten. Wie ich unter Männern aufwuchs und letztlich auch von dem Ohrring. Oder besser gesagt, was dieser Fund mit mir gemacht hatte. Als ich mit der Erzählung fertig war, sah mich Erich mit einer sanften Faszination an, so dass das Feuer vor uns in seinen grünen Augen flackerte. Sein Duft strömte in meine Nase und ich merkte, dass nichts und niemand, nicht einmal die Schönheit aus Kairo es geschafft hatte, mein Herz in so ein wohliges Gefühl rasender Freude zu bringen, wie dieses leise Schmunzeln auf Erichs Lippen.
„Das Tuch ist wirklich wunderschön“, sagte er dann, nein er hauchte es eher. Ich fasste an den seidigen Stoff.
„Nein, wirklich“, stieß er hervor, „Als wir uns am ersten Tag kennenlernen, hast du ausgesehen, wie die einzig schöne bunte Blume in dieser ewig monotonen Wüste aus goldenem Sand. Ich glaube ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen“, flüsterte er. Ich legte meine Hand auf seine. Die erste Geste der Zärtlichkeit und der innigen Verbundenheit. Habe ich bis dahin auch nie gewusst, was Verliebtheit war, nun wusste ich es. Und dann erzählte mir Erich aus seinem Leben. Er wuchs bei wohlhabenden Eltern in Wien auf, in der Nähe eines Ortes, der sich Prater nannte. Seine Mutter starb, als er noch ein kleiner Junge war, der Vater hatte ihn auf ein Internat geschickt. Dort lernte er allerhand totes Zeug, wie Griechisch und Latein, las längst verweste Autoren, wie Socrates und beschäftigte sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Was er wohl am allerbesten mit seinem reichen Erbe anstellen würde und welche wohlerzogene junge Lady aus einem ebenso vornehmen Kreis ihn dabei wohl unterstützen würde. Aber dann verschluckte sich eines Abends ein Junge aus seiner Klasse an einem Stück Gebäck und Erich merkte das erste Mal, dass er Arzt werden würde. „Es war eine Eingebung“, erzählte er mir, „Eine Berufung. Ich muss Arzt werden!“. Und dabei hatte er ein schon fast verrücktes Glänzen in den Augen, das mich aber niemals einschüchtern hätte können, weil ich mich in seiner Erzählung stets selbst fand. Auch ich hatte eine Art Berufungsmoment erlebt, ich wusste damals nur noch nicht welcher Art er gewesen war. Erichs Vater fand die Vorstellung jedoch weniger amüsant, er war geradezu erzürnt. Sein Sohn solle nicht seine Lebensjahre an der Universität verschwenden und sich dann an verseuchten Menschen gar selbst anstecken und dahinraffen. Es war dann mehr oder minder ironisch, dass sein Vater, der nur sehr wenig liebevoll zu seinem Sohn gewesen war, einige Jahre später selbst an einer Krankheit starb, die sich die französische Krankheit nannte. Als ich Erich bat mir zu erklären, was denn die französische Krankheit sei, wurde er kurz rot, sah sich um, ob auch niemand uns belauschte und lehnte sich dann zu mir herunter. Was er mir da erklärte, versetzte mich in eine Ekstase des Staunens. Ich hatte bisher noch nicht einmal gewusst, was da zwischen Mann und Frau entstehen konnte, aber so etwas! Erich sah mich skeptisch an und ich zuckte mit den Schultern. „Was ist denn los?“, fragte ich ihn. „Du bist ja überhaupt nicht geschockt.“ Ich lachte.
„Aber nein, warum sollte ich denn geschockt sein?“ Er schüttelte den Kopf und hob die Augenbrauen.
„Du bist das außergewöhnlichste Mädchen, was mir je begegnet ist.“ Ich verstand es erst später, als ich mit dem Konzept von Konventionen konfrontiert wurde. Aber Erich verstand in diesem Moment nicht, dass ich nicht hätte geschockt sein können, denn Konventionen wurden rein gesellschaftlich anerzogen, und da ich hier unter einer Horde Männer aufgewachsen war, mit denen ich gerne noch eine letzte Abendzigarette rauchte, kannte ich die anerzogene Scham nicht. Genauso wenig, wie ich junge Männer um mich