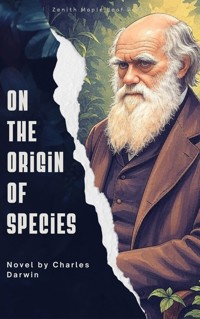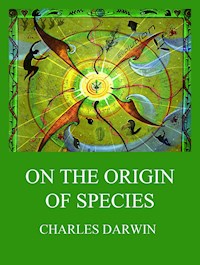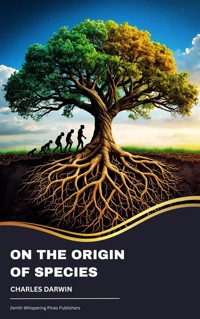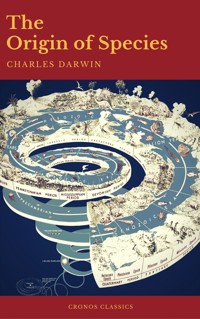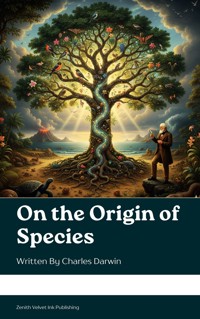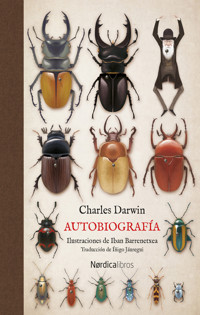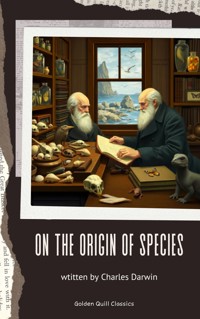3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenportät aus dem Metzler Philosophen Lexikon. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Als eine der großen Kränkungen der Menschheit bezeichnete Sigmund Freud Darwins Evolutionstheorie, die unser Bild von der Welt radikal verändert hat: Darwin konnte als Erster wissenschaftlich nachweisen, dass der Mensch dem Tierreich entstammt, also keine von Gott geschaffene Krone der Schöpfung darstellt. Und dass in der Welt nicht immer nur die Muskelpakete, sondern oft auch die Paradiesvögel und elegantesten Männchen erfolgreich sind, hat Darwin lange vor der heutigen Schönheitsindustrie gewusst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Charles Darwin
Die Abstammung des Menschen
Aus dem Englischen von Heinrich Schmidt
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenportät aus dem Metzler Philosophen Lexikon.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Einleitung
Viele Jahre hindurch habe ich Notizen über den Ursprung oder die Abstammung des Menschen gesammelt, ohne die Absicht, etwas darüber zu veröffentlichen; ich war im Gegenteil entschlossen, nichts davon in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich fürchtete, damit nur die Vorurteile gegen meine Ansichten zu vermehren. In der ersten Ausgabe meiner »Entstehung der Arten« ließ ich es bei der Andeutung bewenden, daß durch dieses Werk Licht verbreitet würde auch über den Ursprung des Menschen und seine Geschichte. Darin lag eingeschlossen, daß der Mensch hinsichtlich seines Erscheinens auf der Erde denselben allgemeinen Schlußfolgerungen unterworfen sei wie jedes andere Lebewesen.
Jetzt liegen die Dinge wesentlich anders. Wenn ein Naturforscher von der Bedeutung Karl Vogts als Präsident des Nationalinstituts von Genf (1869) erklären darf: »Niemand, wenigstens in Europa, wagt mehr, die Erschaffung der Arten, unabhängig voneinander, zu verteidigen«, so muß jetzt offenbar eine große Zahl von Naturforschern geneigt sein, die Arten als veränderte Nachkommen anderer Arten zu betrachten. Dies gilt besonders für die jüngeren und aufstrebenden Naturforscher. Die Mehrzahl derselben anerkennt die natürliche Zuchtwahl, wenn auch einige meinen, ich hätte ihre Bedeutung sehr überschätzt. Ob sie recht haben, muß die Zukunft entscheiden. Unter den älteren und angeseheneren Naturforschern gibt es leider auch noch solche, die von einer Entwickelung überhaupt nichts wissen wollen.
Den gegenwärtig von den meisten Naturforschern angenommenen Anschauungen werden schließlich auch die Laien folgen; und so habe ich mich denn entschlossen, meine Notizen zusammenzustellen, um zu sehen, inwieweit sich die allgemeinen Schlußfolgerungen meiner früheren Werke auch auf den Menschen anwenden lassen. Dies zu tun, erschien mir um so notwendiger, als ich meine Betrachtungsweise bisher noch nicht auf eine einzelne Art angewendet habe. Wenn wir unser Augenmerk auf eine einzige Form beschränken, so verzichten wir auf die wichtigen Beweismittel, die uns die verwandtschaftlichen Beziehungen ganzer Organismengruppen, ihre geographische Verbreitung in Gegenwart und Vergangenheit und ihre geologische Aufeinanderfolge liefern. Übrig bleiben für die Betrachtung die gleichartigen Bildungen (homologe Strukturen), die rudimentären Organe und die embryonale Entwickelung einer Art, sei es nun des Menschen oder irgend eines anderen Tieres, worauf sich unser Augenmerk richtet. Aber gerade diese großen Gruppen von Tatsachen erheben, wie mir scheint, das Prinzip der allmählichen Entwickelung zur höchsten Wahrscheinlichkeit. Indessen wird es gut sein, auch die Beweiskraft der anderen Tatsachen im Auge zu behalten.
In diesem Werke soll nun untersucht werden: erstens, ob der Mensch – wie jede andere Art – von einer früher existierenden Form abstammt; zweitens die Art und Weise seiner Entwickelung; drittens der Wert der Unterschiede zwischen den sogenannten Menschenrassen. Diese Unterschiede im einzelnen aufzuzählen, ist unnötig; diese umfassende Arbeit ist bereits in wertvollen Werken in vollem Umfang ausgeführt worden. Von einer Reihe hervorragender Männer, zuerst von Boucher de Perthes, ist das hohe Alter des Menschen nachgewiesen worden, und dies ist die unentbehrliche Grundlage für das Verständnis seines Ursprungs, deren Richtigkeit im folgenden vorausgesetzt wird. Ich verweise hier meine Leser auf die vortrefflichen Abhandlungen von Charles Lyell, John Lubbock u.a. Auch die Unterschiede zwischen dem Menschen und dem Menschenaffen werde ich nur flüchtig berühren; denn nach der Meinung der berufensten Beurteiler hat Professor Huxley überzeugend nachgewiesen, daß der Mensch in jedem einzelnen seiner erkennbaren Merkmale weniger von den höheren Affen abweicht, als diese von den niederen Vertretern derselben Ordnung (der Primaten oder Herrentiere) verschieden sind.
Mein Werk enthält kaum neue Tatsachen; die Schlüsse jedoch, zu denen mich eine flüchtige Übersicht führte, schienen mir interessant genug, um sie auch anderen mitzuteilen. Es ist oft mit größter Entschiedenheit behauptet worden, der Ursprung des Menschen werde immer in Dunkel gehüllt bleiben. Allein, Entschiedenheit wurzelt häufiger in Unwissenheit als im Wissen. Es sind immer nur diejenigen, die wenig wissen, und nicht diejenigen, die viel wissen, welche positiv behaupten, daß dieses oder jenes Problem von der Wissenschaft niemals gelöst werden könne.
Die Folgerung, daß der Mensch ebenso wie andere Arten von einer alten, tiefstehenden, ausgestorbenen Form abstamme, ist keineswegs neu. Sie wurde schon vor langer Zeit von Lamarck gezogen, ebenso wie später von mehreren hervorragenden Naturforschern und Philosophen, von Wallace, Lyell, Huxley, Vogt, Lubbock, Büchner, Rolle u.a., besonders aber von Ernst Haeckel. Außer in seiner großen »Generellen Morphologie der Organismen« (1866) hat der zuletzt genannte Naturforscher die Genealogie des Menschen auch in seiner »Natürlichen Schöpfungsgeschichte« eingehend erörtert (1868). Wäre dieses Buch schon vor der Niederschrift meiner Arbeit erschienen, so wäre diese wahrscheinlich nie beendet worden. Fast alle Schlüsse, zu denen ich gekommen bin, finde ich durch diesen Naturforscher bestätigt, dessen Kenntnisse in vielen Punkten viel vollkommener sind als die meinigen.
Erstes Kapitel Beweise für die Abstammung des Menschen von einer tiefer stehenden Form
Wer zu erkennen wünscht, ob der Mensch der veränderte Nachkomme einer früheren Form ist, wird wahrscheinlich zunächst untersuchen, ob der Mensch in seinem Körperbau und in seinen geistigen Fähigkeiten irgendwie von der Norm abweicht (variiert), und, wenn dem so ist, ob die Abweichungen gemäß den in der Tierreihe geltenden Gesetzen auch bei seinen Nachkommen auftreten. Er wird weiterhin fragen, ob die Abweichungen – soweit uns unsere Unwissenheit ein Urteil darüber erlaubt – auf dieselben allgemeinen Ursachen zurückzuführen sind und von denselben allgemeinen Gesetzen beherrscht werden wie bei anderen Lebewesen, z.B. von den Gesetzen der Korrelation, der vererbten Wirkungen des Gebrauchs und Nichtgebrauchs usw. Ferner, ob der Mensch ähnlichen Mißbildungen unterworfen ist, Entwickelungshemmungen, Verdoppelung von Teilen usw., und ob sich die eine oder andere seiner nichtnormalen Bildungen als ein Rückschlag auf einen früheren und älteren Typus deuten läßt. Ebenso muß untersucht werden, ob auch der Mensch, wie so viele andere Tiere, Varietäten und Unterrassen erzeugt, die voneinander nur wenig verschieden sind; oder Rassen, die so sehr voneinander abweichen, daß sie als zweifelhafte Arten bezeichnet werden müßten. Endlich, wie es sich mit der geographischen Verbreitung derartiger Rassen verhält und wie das Produkt einer Kreuzung in der ersten wie in den folgenden Generationen beschaffen ist. Und was dergleichen Fragen mehr sind.
Sodann wäre als ein sehr wichtiger Punkt zu erforschen, ob sich der Mensch in einem so raschen Verhältnis vermehrt, daß gelegentlich ein harter Kampf um die Existenz daraus entspringt, infolge dessen nützliche Abänderungen, körperliche oder geistige, erhalten bleiben, schädliche dagegen ausgemerzt werden. Endlich, ob die Rassen oder Arten – gleichgültig, wie man sie bezeichnen will – einander verdrängen und ersetzen, so daß manche schließlich vernichtet werden.
Wir werden sehen, daß alle diese Fragen für den Menschen offenbar ebenso bejaht werden müssen wie für die anderen Tiere; sie mögen jedoch für jetzt noch zurückgestellt werden. Zunächst wollen wir die mehr oder weniger deutlichen Spuren seiner Abstammung in seiner körperlichen Struktur aufsuchen. In späteren Kapiteln sollen dann auch die geistigen Fähigkeiten des Menschen mit denen der tiefer stehenden Tiere verglichen werden.
Der Körperbau des Menschen. Der Mensch ist ganz augenscheinlich nach demselben Typus gebaut wie die anderen Säugetiere. Alle Knochen seines Skelettes können verglichen werden mit den entsprechenden Knochen eines Affen, einer Fledermaus oder eines Seehundes. Ebenso ist es mit seinen Muskeln, Nerven, Blutgefäßen und Eingeweiden. Mit dem Gehirn, dem wichtigsten aller Organe, verhält es sich genau ebenso, wie Huxley und andere Autoren gezeigt haben. Bischoff[1], ein Zeuge aus dem gegnerischen Lager, räumt ein, daß jede Hauptfurche und -windung im Gehirn des Menschen ihr Analogon im Gehirn des Orang hat. Er fügt hinzu, daß auf keiner Stufe der Entwickelung ihr Gehirn völlig übereinstimme; aber völlige Übereinstimmung kann ja auch gar nicht erwartet werden, sonst müßten auch ihre geistigen Kräfte dieselben sein. Vulpian[2]bemerkt: »Die tatsächlichen Unterschiede zwischen dem Gehirn des Menschen und dem der höheren Affen sind sehr gering. Man gebe sich in dieser Hinsicht keiner Illusion hin. In den anatomischen Verhältnissen des Gehirns steht der Mensch den Anthropomorphen (Menschenaffen) viel näher als diese den anderen Säugetieren, selbst die geschwänzten Affen und Makaken nicht ausgenommen.« Weitere Einzelheiten über die Ähnlichkeit des Menschen mit den höheren Säugetieren, wie sie sich im Bau des Gehirns und aller anderen Teile des Körpers offenbart, sind hier überflüssig.
Indessen wird es gut sein, wenn ich als Zeugnisse für diese Übereinstimmung oder Verwandtschaft ein paar spezielle Tatsachen anführe, die nicht direkt oder nicht augenfällig mit dem Körperbau zusammenhängen.
Gewisse Krankheiten können vom Menschen auf andere Tiere übertragen werden und umgekehrt, so z.B. die Wasserscheu, Pocken, Rotz, Syphilis, Cholera, Flechten usw.[3], und diese Tatsache erweist die große Ähnlichkeit ihrer Gewebe und ihres Blutes, sowohl in ihrem feineren Bau wie in ihrer Zusammensetzung, viel deutlicher als ihre Vergleichung unter dem besten Mikroskop, oder die sorgfältigste chemische Analyse[4]. Die Affen sind vielen der gleichen nicht ansteckenden Krankheiten ausgesetzt wie wir. So fand Rengger[5], der den Cebus Azarae in seiner Heimat lange und mit Sorgfalt beobachtete, daß diese Affen Katarrhe mit den gewöhnlichen Symptomen bekommen, die bei häufigeren Rückfällen auch zur Schwindsucht führen. Auch Schlagfluß, Bauchfellentzündung und grauer Star traten bei diesen Affen auf. Die Jungen sterben oft am Fieber während des Zahnwechsels. Arzeneien hatten dieselben Wirkungen wie bei uns. Viele Arten von Affen haben eine starke Vorliebe für Tee, Kaffee und Spirituosen. Wie ich selbst gesehen habe, rauchen sie auch mit Vergnügen Tabak[6]. Brehm behauptet, daß die Eingeborenen Nordost-Afrikas Affen dadurch einfangen, daß sie Gefäße mit starkem Bier ausstellen, an dem sich die Affen berauschen. Er sah ein paar dieser Tiere, die er in Gefangenschaft hielt, in diesem Zustand, und er gibt einen sehr humorvollen Bericht über ihr Benehmen und ihre seltsamen Grimassen. Am folgenden Morgen waren sie sehr schlecht gelaunt und elend; sie hielten ihr schmerzendes Haupt mit beiden Händen und sahen ganz erbärmlich aus; wurde ihnen Bier oder Wein angeboten, so wandten sie sich mit Abscheu ab, labten sich dagegen an Zitronensaft[7]. Weiser als viele Menschen, rührte ein amerikanischer Affe, ein Ateles, nach einem Branntweinrausch das infame Getränk nie mehr an. Diese an sich unbedeutenden Tatsachen beweisen, wie ähnlich die Geschmacksnerven bei Menschen und Affen sein müssen und in wie ähnlicher Weise ihr ganzes Nervensystem erregt wird.
Der Mensch wird von inneren Parasiten geplagt, die zuweilen verhängnisvoll werden, ebenso von äußeren, die sämtlich zu denselben Gattungen oder Familien gehören, die auch andere Säugetiere befallen, bei der Krätzmilbe sogar zu derselben Art[8]. Wie andere Säugetiere, Vögel und selbst Insekten[9] ist auch der Mensch jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen, nach dem gewisse normale Vorgänge, die Trächtigkeit, die Reife, die Dauer mancher Krankheiten, den Mondperioden folgen. Seine Wunden machen denselben Heilungsprozeß durch, und die Stümpfe, die nach einer Amputation seiner Glieder besonders in frühen Embryonalperioden übrig bleiben, besitzen zuweilen die Fähigkeit der Regeneration wie bei den niedersten Tieren[10].
Der ganze Verlauf der Fortpflanzung, jener höchst wichtigen Funktion, ist bei allen Säugetieren auffallend gleich, angefangen von der Werbung des Männchens[11] bis zur Geburt und Aufzucht der Jungen. Die Affen sind bei der Geburt fast ebenso hilflos wie unsere Kinder; und bei gewissen Gattungen unterscheiden sich die Jungen von den Erwachsenen im Aussehen genau so wie unsere Kinder von ihren Eltern[12]. Als einen wichtigen Unterschied haben einige Schriftsteller angegeben, beim Menschen würden die Jungen viel später reif als bei jedem anderen Tier; wenn wir aber unseren Blick auf die Menschenrassen werfen, die tropische Gegenden bewohnen, so ist der Unterschied nicht eben groß; denn der Orang soll nicht vor dem 10. bis 15. Jahre reif werden[13]. Der Mann unterscheidet sich vom Weib in der Größe, der Körperkraft, der Behaarung usw., ebenso in geistiger Beziehung, in derselben Weise wie die beiden Geschlechter bei vielen Säugetieren. Im allgemeinen Bau wie in der feineren Struktur der Gewebe, in der chemischen Zusammensetzung und in der Konstitution ist somit die Übereinstimmung zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, speziell den anthropomorphen Affen, eine überaus weitgehende.
Embryonale Entwickelung. Der Mensch entwickelt sich aus einem Ei von etwa 1/5 mm Durchmesser, das sich in keiner Hinsicht von den Eiern anderer Tiere unterscheidet. Der Embryo selbst kann auf einer gewissen Entwickelungsstufe kaum von den Embryonen anderer Wirbeltiere unterschieden werden. Auf dieser Stufe verlaufen die Halsarterien in bogenförmigen Ästen, als ob das Blut zu Kiemen geführt werden sollte, die doch bei den höheren Wirbeltieren nicht vorhanden sind. Daß sie früher vorhanden waren, zeigen die Kiemenfurchen an der Seite des Halses. Etwas später entstehen die Gliedmaßen und zwar, wie der berühmte Carl Ernst von Baer bemerkt, aus derselben Grundform wie die Füße der Eidechsen und Säugetiere, ebenso wie die Flügel und Füße der Vögel. »Erst in den letzten Stadien der Entwickelung«, sagt Professor Huxley[14], »zeigt das Menschenjunge deutliche Verschiedenheiten von dem jungen Affen, der in seiner Entwickelung ebenso weit vom Hunde abweicht, wie der Mensch. So erstaunlich diese Behauptung auch erscheinen mag, sie ist doch nachweisbar richtig.«
Da manche meiner Leser vielleicht noch niemals die Abbildung eines Embryo gesehen haben, habe ich nebenstehend eine solche von einem Menschen und eine andere vom Hunde von ungefähr derselben Entwickelungsstufe gegeben, beides Kopien nach zwei Werken von zweifelloser Genauigkeit[15].
Nach den mitgeteilten Feststellungen so bedeutender Autoritäten würde es überflüssig sein, noch mehr Einzelheiten aufzuführen, welche die große Ähnlichkeit des menschlichen Embryos mit den Embryonen anderer Säugetiere bezeugen. Es mag jedoch noch hinzugefügt werden, daß der menschliche Embryo verschiedene Struktureigentümlichkeiten aufweist, die bei gewissen niederen Formen dauernd vorhanden sind. Das Herz zum Beispiel ist zuerst nichts als ein pulsierendes Gefäß; die Exkremente werden durch eine Kloake entleert; und das Schwanzbein (os coccygis) ragt wie ein wirklicher Schwanz über die Anlagen der Beine beträchtlich hinaus[16]. Bei den Embryonen aller luftatmenden Tiere entsprechen gewisse Drüsen, die Wolffschen Körper, den Nieren erwachsener Fische und funktionieren auch wie diese[17]. Auch noch in einer späteren Entwickelungsperiode lassen sich auffallende Ähnlichkeiten zwi
Fig. 1. Die obere Figur ist ein menschlicher Embryo nach Ecker, die untere der eines Hundes nach Bischoff. a) Vorderhirn, Großhirnhemisphären usw. b) Mittelhirn, Vierhügel. c) Hinterhirn, Kleinhirn, verlängertes Mark. d) Auge. e) Ohr. f) Erster Visceralbogen. g) Zweiter Visceralbogen. H) Wirbelsäule und Muskelmasse. i) Vordere Gliedmaßen. K) Hintere Gliedmaßen. L) Schwanz oder Coccyx.
schen den Menschen und den tiefer stehenden Tieren beobachten. So gibt Bischoff an, daß die Windungen des Gehirns bei einem menschlichen Embryo aus dem siebenten Monat ungefähr so weit entwickelt seien wie bei einem erwachsenen Pavian[18]. Wie Professor Owen bemerkt, ist die große Zehe, welche beim Gehen und Stehen den Stützpunkt bildet, vielleicht die charakteristischste Eigenheit des menschlichen Körpers[19]; aber bei einem Embryo von etwa einem Zoll Länge fand Professor Wyman, »daß die große Zehe kürzer als die anderen war und, anstatt den anderen parallel zu laufen, in einem Winkel nach seitwärts stand, wie es bei den Vierhändern dauernd der Fall ist«[20]. Ich will schließen mit einem Wort von Huxley; auf die Frage, ob der Mensch in einer anderen Weise entstehe als ein Hund, ein Vogel, ein Frosch oder Fisch, antwortet er: »Die Antwort ist keinen Augenblick zweifelhaft; die Art des Ursprungs und die ersten Stadien der Entwickelung des Menschen sind mit denen der unmittelbar unter ihm stehenden Tiere identisch. Ohne Zweifel steht er in dieser Hinsicht den Affen näher, als diese dem Hunde stehen«[21].
Rudimente. Obgleich dieser Punkt keine größere Bedeutung besitzt als die beiden vorhergehenden, soll er doch aus mehreren Gründen ausführlicher behandelt werden[22]. Es läßt sich kein höheres Tier angeben, bei dem nicht irgend ein Teil rudimentär wäre, und der Mensch bildet keine Ausnahme von dieser Regel. Rudimentäre Organe müssen unterschieden werden von eben entstehenden, obgleich in manchen Fällen die Unterscheidung nicht leicht ist. Die ersteren sind entweder durchaus nutzlos – wie z.B. die Brustdrüsen der männlichen Vierfüßer, und die oberen Schneidezähne der Wiederkäuer, die niemals zum Durchbruch kommen –, oder sie sind ihren gegenwärtigen Besitzern von so geringem Nutzen, daß wir schwerlich annehmen können, ihre Entwickelung habe unter den gegenwärtigen Bedingungen stattgefunden. Streng genommen sind Organe in diesem letzteren Zustand nicht rudimentär, aber sie entwickeln sich dahin. Entstehende Organe hingegen sind, wenn auch noch nicht voll entwickelt, von großer Bedeutung für ihren Besitzer und fähig, sich weiter zu entwickeln. Rudimentäre Organe sind außerordentlich variabel; und das ist teilweise verständlich, da sie nutzlos und infolgedessen nicht mehr der natürlichen Zuchtwahl unterworfen sind. Sie werden oft ganz unterdrückt. In diesem Falle können sie aber gelegentlich wieder auftauchen, und diese Fälle von Rückschlag sind sehr der Beachtung wert.
Die hauptsächlichsten Ursachen der Verkümmerung eines Organs scheinen zu sein: Nichtgebrauch während derjenigen Lebensperiode, in welcher das Organ sonst hauptsächlich gebraucht wird – und das ist gewöhnlich während der Reifezeit – verbunden mit Vererbung in entsprechendem Lebensalter (»inheritance at a corresponding period of life«). Der Ausdruck »Nichtgebrauch« bezieht sich nicht bloß auf verringerte Tätigkeit der Muskeln, sondern auch auf verminderten Blutzufluß zu einem Teil oder Organ, sei es, daß es nur geringen Druckänderungen ausgesetzt ist, oder sei es, daß es weniger gewohnheitsmäßig tätig ist. Teile, die in dem einen Geschlecht normal ausgebildet sind, können in einem anderen Geschlecht rudimentär sein, und solche Rudimente haben oft, wie wir in einem anderen Zusammenhang darlegen werden, einen andersartigen Ursprung als die bisher besprochenen. In einigen Fällen sind gewisse Organe durch die natürliche Zuchtwahl reduziert worden, weil sie unter veränderten Lebensbedingungen für den Bestand der Art gefährlich wurden. Der Vorgang der Rückbildung wird wahrscheinlich oft unterstützt durch die beiden Prinzipien der Kompensation und der Ökonomie des Wachstums; aber die letzten Stadien der Verkümmerung, wenn der Nichtgebrauch alles bewirkt hat, was ihm etwa zugeschrieben werden kann, und die durch die Ökonomie des Wachstums erzielte Ersparnis sehr gering sein würde[23]), sind schwer zu verstehen. Die letzte und vollständige Unterdrückung eines Teiles, der bereits nutzlos und sehr reduziert ist, in welchem Falle weder Kompensation noch Ökonomie in Frage kommen kann, ist vielleicht verständlich mit Hilfe der Hypothese der Pangenesis. Da indessen das Kapitel der rudimentären Organe schon in meinen früheren Werken erörtert worden ist[24], brauche ich hier nichts mehr darüber zu sagen.
Rudimentäre Muskeln sind aus vielen Teilen des menschlichen Körpers bekannt[25], und nicht wenige Muskeln, die in der Regel bei einigen der tiefer stehenden Tiere vorhanden sind, finden sich gelegentlich beim Menschen in einer sehr reduzierten Form. Jedermann weiß, mit welcher Kraft manche Tiere, besonders Pferde, ihre Haut bewegen oder erzittern lassen; das wird bewirkt durch den Panniculus carnosus. Überreste dieses Muskels in wirkungsfähigem Zustand finden sich in verschiedenen Teilen unseres Körpers; ein solcher ist z.B. der Muskel an der Stirn, durch welchen die Augenbrauen in die Höhe gezogen werden. Das Platysma myoides, welches am Nacken sehr entwickelt ist, gehört ebenfalls zu diesem System. Wie mir Prof. Turner in Edinburgh mitteilt, hat er gelegentlich Muskelfasern an fünf verschiedenen Stellen entdeckt, in der Achselhöhle, nahe dem Schulterblatt usw., die alle zu dem System des Panniculus gerechnet werden müssen. Er hat auch gezeigt[26], daß der Musculus sternalis oder sternalis brutorum, der nicht dem Rectus abdominalis zuzurechnen, sondern dem Panniculus nahe verwandt ist, unter 600 Menschen im Verhältnis von etwa 3 % vorkommt. Er fügt hinzu, daß dieser Muskel eine ausgezeichnete Illustration für den Satz abgebe, daß gelegentliche und rudimentäre Bildungen der Abänderung in der Anordnung ganz besonders ausgesetzt sind.
Manche Menschen können noch die oberflächlichen Muskeln ihrer Kopfhaut zusammenziehen, und diese Muskeln sind variabel und zum Teil rudimentär. A. de Candolle hat mir ein merkwürdiges Beispiel von langer Dauer oder Vererbung und ungewöhnlicher Ausbildung dieser Fähigkeit mitgeteilt. Er kennt eine Familie, in welcher ein Glied, das gegenwärtige Haupt der Familie, in seiner Jugend mehrere schwere Bücher durch bloße Bewegung seiner Kopfhaut von seinem Kopf schleudern konnte. Er gewann Wetten durch die Vorführung dieses Kunststückes. Sein Vater, Onkel, Großvater und seine drei Kinder besitzen dieselbe Fähigkeit in demselben ungewöhnlichen Maße. Diese Familie teilte sich in der achten Generation in zwei Zweige, so daß das Haupt des oben erwähnten Zweiges der Vetter im siebenten Grad von dem Haupt des anderen Zweiges ist. Dieser entfernte Verwandte wohnt in einem anderen Teil Frankreichs; als er gefragt wurde, ob er dieselbe Fähigkeit besäße, gab er augenblicklich eine Probe seiner Kraft. Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie dauerhaft manche Erbstücke von absoluter Nutzlosigkeit sind, vielleicht ererbt von unseren weit zurückliegenden halbmenschlichen Vorfahren: viele Affen können ihre Kopfhaut in großer Ausdehnung auf und nieder bewegen, und sie tun es oft[27].
Die äußeren Muskeln, die das äußere Ohr bewegen, und die inneren Muskeln, welche die verschiedenen Teile bewegen, sind beim Menschen rudimentär; sie gehören zum System des Panniculus. Sie sind auch variabel in ihrer Entwickelung oder doch wenigstens in ihrer Funktion. Ich habe einen Mann gesehen, der das ganze Ohr vorwärts bewegen konnte; andere können es nach oben, wieder andere nach rückwärts bewegen[28]; und nach dem, was mir eine dieser Personen sagte, ist es wahrscheinlich, daß die meisten von uns diese Bewegungsfähigkeit wieder erlangen können, wenn wir unsere Ohren öfter berühren und dabei unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Die Fähigkeit, die Ohren zu spitzen und sie dabei nach den verschiedenen Richtungen hinwenden zu können, ist ohne Zweifel von der höchsten Bedeutung für viele Tiere, weil sie so die Richtung einer herannahenden Gefahr erkennen; ich habe aber nie gehört – wenigstens nicht mit genügender Beweiskraft –, daß ein Mensch diese Fähigkeit, die doch nützlich für ihn wäre, besessen habe. Die ganze äußere Ohrmuschel kann als ein Rudiment betrachtet werden, mitsamt den verschiedenen Falten und Hervorragungen (Helix und Antihelix, Tragus und Antitragus usw.), die bei niederen Tieren das Ohr spannen und stützen, ohne sein Gewicht sehr zu vermehren. Einige Autoren indessen vermuten, daß der Knorpel der Ohrmuschel dazu diene, dem Hörnerven Schallschwingungen zu übermitteln; aber Toynbee[29] kommt nach einer Prüfung der vorliegenden Zeugnisse zu dem Schluß, daß die äußere Ohrmuschel keinen besonderen Nutzen habe. Die Ohren von Schimpanse und Orang sind denen des Menschen außerordentlich ähnlich, die Ohrmuscheln sind ebenfalls nur sehr schwach entwickelt[30], und die Wärter in den zoologischen Gärten haben mir versichert, daß diese Tiere ihre Ohren niemals bewegen oder aufrichten; sie sind somit, was die Funktion betrifft, in demselben rudimentären Zustand wie die des Menschen. Warum diese Tiere, ebenso wie die Voreltern des Menschen, die Fähigkeit, ihre Ohren aufzurichten, verloren haben, wissen wir nicht. Es mag sein – aber diese Erklärung befriedigt mich nicht –, daß sie infolge ihres Aufenthalts auf Bäumen und ihrer großen Kraft nur wenig Gefahren ausgesetzt waren, deshalb ihre Ohren eine lange Zeit hindurch nur wenig bewegten und dabei nach und nach die Fähigkeit, sie zu bewegen, einbüßten. In einem parallelen Fall haben große und schwere Vögel auf ozeanischen Inseln die Fähigkeit verloren, ihre Flügel zum Fliegen zu gebrauchen, wahrscheinlich weil sie Angriffen von Raubtieren nicht ausgesetzt waren. Die Unfähigkeit des Menschen und mancher Affen, die Ohren zu bewegen, wird übrigens teilweise kompensiert dadurch, daß sie ihr Haupt frei in einer horizontalen Ebene bewegen und Geräusche aus allen Richtungen auffangen können. Es ist behauptet worden, das Ohr des Menschen allein besitze ein Läppchen; aber »ein Rudiment davon ist beim Gorilla zu finden«[31], und wie ich von Prof. Preyer höre, fehlt es nicht selten beim Neger.
Der berühmte Bildhauer Woolner machte mich auf eine Eigentümlichkeit am äußeren Ohr aufmerksam, die er bei Männern sowohl als Frauen oft bemerkt und deren Bedeutung er richtig erkannt hat. Seine Aufmerksamkeit wurde zuerst darauf gelenkt, als er an seinem »Puck« arbeitete, dem er spitze Ohren gab. Das veranlaßte ihn, die Ohren verschiedener Affen zu untersuchen, und noch sorgfältiger die des Menschen. Die von ihm beobachtete Eigentümlichkeit besteht in einem kleinen stumpfen Höcker an dem einwärts gefalteten Rand, dem Helix. Wenn er vorhanden ist, ist er schon bei der Geburt entwickelt; nach Prof. Ludwig Meyer ist er häufiger beim Manne als bei der Frau. Woolner hat von einem solchen Fall ein genaues Modell hergestellt und mir die beistehende Zeichnung übersandt (Fig. 2).
Fig. 2. Menschliches Ohr, modelliert und gezeichnet von Mr. Woolner. a) Der vorspringende Punkt.
Dieser Höcker ragt nicht immer einwärts nach dem Mittelpunkt des Ohres, sondern etwas nach außen über die Ebene des Ohres, so daß er sichtbar ist, wenn man den Kopf direkt von vorn oder hinten sieht. Seine Größe und Stellung sind variabel; er steht bald höher, bald tiefer, zuweilen ist er an dem einen Ohr vorhanden, am anderen nicht. Er kommt auch nicht nur beim Menschen vor; ich selbst beobachtete ihn bei einem Ateles beelzebuth im Zoologischen Garten, und E. Ray Lankester, wie er mir mitteilt, bei einem Schimpansen im Hamburger Zoologischen Garten. Der Helix besteht offenbar aus dem nach innen gefalteten äußeren Rande des Ohres, und diese Faltung scheint in irgend einer Weise damit zusammenzuhängen, daß das ganze äußere Ohr beständig nach rückwärts gedrückt wird. Bei manchen nicht sehr hochstehenden Affen, wie bei den Pavianen und manchen Makakus-Arten[32], ist der obere Teil des Ohres leicht zugespitzt und der Rand ist nicht einwärts gefaltet. Wäre er’s, so würde dabei eine kleine Spitze nach dem Inneren des Ohres zu vorspringen, wahrscheinlich ein wenig nach auswärts von der Ebene des Ohres. Und so, glaube ich, ist auch der erwähnte Höcker in vielen Fällen entstanden. Anderseits behauptet Prof. L. Meyer in einem beachtenswerten Aufsatz[33], daß das Ganze nur ein Fall bloßer Variabilität sei; daß die Höcker nicht wirkliche Hervorragungen seien, sondern dadurch erzeugt würden, daß der innere Knorpel auf jeder Seite der Spitze nicht vollständig entwickelt sei. Ich gebe bereitwillig zu, daß für manche Fälle dies die richtige Erklärung ist, so für die von Prof. Meyer abgebildeten, wo mehrere sehr kleine Spitzen zu sehen sind, oder der ganze Rand buchtig ist. Ich selbst habe das Ohr eines mikrozephalen Idioten gesehen, bei dem sich ein Vorsprung an der Außenseite des Helix befand, nicht an der nach innen gefalteten, so daß diese Spitze nicht auf eine frühere Ohrenspitze bezogen werden kann. Dennoch scheint mir meine ursprüngliche Ansicht, daß der Höcker ein Überrest der Spitze von einem früher aufgerichteten und zugespitzten Ohr sei, in einigen Fällen zu Recht zu bestehen. Ich glaube das, weil er so häufig vorkommt und in seiner Stellung im allgemeinen mit der Spitze eines zugespitzten Ohres übereinstimmt. In einem Falle, von dem mir eine Photographie zugesandt wurde, ist der Vorsprung so groß, daß er ein Drittel des ganzen Ohres einnehmen würde, wenn man sich in Übereinstimmung mit Prof. Meyers Ansicht das Ohr durch gleichmäßige Entwickelung des Knorpels über die ganze Ausdehnung des Randes hin vervollständigt denkt. Aus Nordamerika und England sind mir zwei Fälle mitgeteilt worden, bei denen der obere Rand überhaupt nicht einwärts gefaltet, jedoch zugespitzt ist, so daß es im Umriß dem spitzen Ohr eines Vierfüßlers sehr ähnlich sieht. In dem einen dieser Fälle, dem eines kleinen Kindes, vergleicht der Vater das Ohr mit der Zeichnung, die ich von dem Ohr eines Affen, des Cynopithecus niger, gegeben habe[34], und sagt, daß die Umrisse sehr ähnlich seien. Wenn in diesen beiden Fällen der Rand in der gewöhnlichen Weise nach einwärts gefaltet worden wäre, würde ein Vorsprung nach innen zustande gekommen sein. Ich will hinzufügen, daß in zwei anderen Fällen der Umriß etwas zugespitzt ist, trotzdem der Rand der oberen Partie des Ohres in normaler Weise nach einwärts gefaltet ist, in dem einen Falle freilich nur eine schmale Partie. Der umstehende Holzschnitt (Fig. 3) ist eine genaue Kopie von der Photographie eines Orang-Fötus (die mir freundlichst von Dr. Nitsche übersandt wurde), an der zu sehen ist, wie verschieden der zugespitzte Umriß des Ohres in dieser Periode von seiner ausgebildeten Form ist, die im allgemeinen
Fig. 3. Fötus eines Orangs. Genaue Kopie einer Photographie, um die Form des Ohres in diesem frühen Alter zu zeigen.[35]
der beim Menschen sehr ähnlich ist. Es ist klar, daß ein nach innen vorspringender Höcker entsteht, wenn sich die Spitze eines solchen Ohres herunterfaltet, und das Ohr sich während seiner Weiterentwickelung nicht sehr verändert. Im ganzen genommen scheint es mir also immer noch wahrscheinlich zu sein, daß die fragliche Spitze in manchen Fällen, sowohl beim Menschen wie beim Affen, als Andeutung eines früheren Zustandes aufzufassen ist.
Die Nickhaut, oder das dritte Augenlid, ist mitsamt ihren akzessorischen Muskeln und anderen Strukturen besonders gut bei den Vögeln ausgebildet und für diese von großer funktioneller Bedeutung, da sie sehr schnell über den ganzen Augapfel gezogen werden kann. Sie findet sich auch bei manchen Reptilien und Amphibien und bei gewissen Fischen, wie z.B. bei Haifischen. Sie ist ziemlich gut entwickelt in den beiden untersten Abteilungen der Säugetiere, nämlich bei den Monotremen (Kloakentieren) und Marsupialiern (Beuteltieren), sowie bei einigen höheren Säugetieren, z.B. beim Walroß. Beim Menschen, den Affen und den meisten anderen Säugetieren existiert sie als ein bloßes Rudiment, als die sogenannte halbmondförmige Falte[36].
Der Geruchssinn ist von der größten Bedeutung für die Mehrzahl der Säugetiere; für die einen, wie die Wiederkäuer, dadurch, daß er sie Gefahren bemerken läßt; für die anderen, wie die Fleischfresser, beim Aufsuchen ihrer Beute; für wieder andere, wie den wilden Eber, in dieser zweifachen Hinsicht. Von äußerst geringem Nutzen ist er hingegen, wenn überhaupt, selbst für die dunkelfarbigen Menschenrassen, bei denen er doch viel höher entwickelt ist als bei den weißen und zivilisierten Rassen[37]; er warnt sie weder vor Gefahr, noch führt er sie zu ihrer Nahrung; er verhindert die Eskimos nicht am Schlafen in einer stinkenden Atmosphäre, noch schreckt er viele Wilde vor dem Genuß halbfaulen Fleisches zurück. Bei Europäern ist das Geruchsvermögen bei verschiedenen Individuen sehr verschieden, wie mir ein hervorragender Naturforscher versichert hat, bei dem dieser Sinn sehr hoch entwickelt ist, und der diesem Gegenstand seine Aufmerksamkeit gewidmet hat. Wer an das Prinzip allmählicher Entwickelung glaubt, wird nicht leicht annehmen, daß der Geruchssinn in seinem gegenwärtigen Zustand vom Menschen, so wie dieser jetzt existiert, ursprünglich erworben worden ist. Er erbte die Fähigkeit in einem abgeschwächten und somit rudimentären Zustand von irgend einem früheren Vorfahren, dem sie äußerst nützlich war, und von dem sie unausgesetzt gebraucht wurde. Bei den Tieren, bei denen dieser Sinn hoch entwickelt ist, wie bei Hunden und Pferden, ist die Erinnerung an Personen und Örtlichkeiten fest verbunden mit ihrem Geruch. Wir können im Zusammenhange damit vielleicht verstehen, daß, wie Dr. Maudsley richtig bemerkt hat[38], der Geruchssinn beim Menschen ganz merkwürdig mithilft, Ideen und Bilder vergessener Szenen und Gegenden wieder ins Gedächtnis zurückzurufen.
Der Mensch weicht von allen anderen Primaten auffällig darin ab, daß er fast nackt ist. Doch finden sich wenige kurze, straffe Haare verstreut über den größten Teil des Körpers beim Mann, feine dunenartige beim Weib. Die verschiedenen Rassen weichen in der Behaarung sehr voneinander ab, und bei den Individuen derselben Rasse sind die Haare sehr variabel, nicht nur in der Menge, sondern auch im Auftreten; so sind bei manchen Europäern die Schultern ganz nackt, während sie bei anderen dicke Haarbüschel tragen[39]. Es ist kaum zu bezweifeln, daß diese über den Körper zerstreuten Haare die Überbleibsel des gleichmäßigen Haarkleids tiefer stehender Tiere sind. Diese Ansicht wird noch wahrscheinlicher durch die bekannte Tatsache, daß feine, kurze und hellgefärbte Haare an den Gliedmaßen und anderen Teilen des Körpers sich gelegentlich zu dichtstehenden, langen und ziemlich groben dunklen Haaren entwickeln, wenn sie abnorm ernährt werden, wie z.B. in der Nähe alter entzündeter Stellen[40].
James Paget teilte mir mit, daß oftmals verschiedene Glieder einer Familie einige Haare in ihren Augenbrauen haben, die viel länger als die übrigen sind; es scheint also selbst diese unbedeutende Eigentümlichkeit vererbt zu werden. Auch diese Haare scheinen ihre Repräsentanten zu haben; denn bei einem Schimpansen und bei gewissen Makakus-Arten finden sich auf der nackten Haut oberhalb der Augen zerstreute Haare von beträchtlicher Länge, die unseren Augenbrauen entsprechen. Ähnliche lange Haare ragen aus der Haardecke der Augenbrauenleisten mancher Paviane hervor.
Noch merkwürdiger ist das feine, wollähnliche Haar, der sogenannte Lanugo, womit der menschliche Embryo im sechsten Monat dicht bedeckt ist. Es entwickelt sich im fünften Monat zuerst an den Augenbrauen und am Gesicht und besonders um den Mund, wo es viel länger ist als auf dem Kopfe. Ein Schnurrbart dieser Art wurde von Eschricht bei einem weiblichen Embryo beobachtet[41]. Doch ist dieser Umstand nicht so auffallend, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag; denn die beiden Geschlechter sind während einer gewissen Periode ihrer Entwickelung in allen äußeren Eigenschaften im großen und ganzen ähnlich. Die Richtung und Anordnung der Haare ist in allen Teilen dieselbe wie beim Erwachsenen, unterliegt jedoch großer Variabilität. Die ganze Oberfläche mit Einschluß selbst der Stirn und der Ohren ist dicht bekleidet; aber es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß Handflächen und Fußsohlen ganz nackt sind, wie die unteren Flächen aller vier Extremitäten bei den meisten tiefer stehenden Tieren. Da dies schwerlich eine zufällige Übereinstimmung sein kann, so repräsentiert wahrscheinlich die wollige Bedeckung des Embryos das erste bleibende Haarkleid derjenigen Säugetiere, welche behaart geboren werden. Drei oder vier Fälle sind bekannt, wo Personen geboren wurden, deren Körper und Gesicht dicht bedeckt war mit feinen langen Haaren; und dieser merkwürdige Zustand wird streng vererbt und steht in Korrelation mit einem abnormen Zustand der Zähne[42]. Prof. Alexander Brandt teilt mir mit, daß er das Gesichtshaar eines derart ausgezeichneten 35jährigen Mannes mit dem Lanugo eines Embryo verglichen und beides in der Textur ganz ähnlich gefunden habe. Es mag daher dieser Fall, wie er bemerkt, betrachtet werden als eine Hemmung in der Entwickelung des Haares, verbunden mit fortgesetztem Wachstum. Wie mir ein Arzt an einem Kinderhospital versichert, ist der Rücken vieler zarter Kinder mit ziemlich langen seidenartigen Haaren bedeckt, und diese Fälle gehören wahrscheinlich in dieselbe Kategorie.
Der hinterste Backenzahn oder Weisheitszahn scheint bei den zivilisierten Menschenrassen der Verkümmerung entgegenzugehen. Dieser Zahn ist meistens kleiner als die anderen Backenzähne, ebenso wie beim Schimpansen und Orang; auch hat er nur zwei getrennte Wurzeln. Er durchbricht das Zahnfleisch nicht eher als etwa im siebenten Jahre, und man hat mir versichert, daß er der Zerstörung viel mehr ausgesetzt sei und früher verloren gehe als die anderen Zähne; doch wird dies von einigen hervorragenden Zahnärzten bestritten. Mehr als die anderen Zähne unterliegt er der Variation sowohl hinsichtlich der Struktur als auch der Zeit seiner Entwickelung[43]. Bei den melanesischen Rassen dagegen sind die Weisheitszähne gewöhnlich mit drei Wurzeln versehen und meist gesund; sie sind auch in der Größe von den anderen Molaren weniger verschieden als bei den Kaukasischen Rassen[44]. Prof. Schaaffhausen führt diese Verschiedenheit zwischen den Rassen darauf zurück, daß der hintere zahntragende Abschnitt des Kiefers bei den zivilisierten Rassen immer verkürzt sei[45], und diese Verkürzung mag, wie ich vermute, dadurch verursacht sein, daß die zivilisierten Menschen sich gewöhnlich von weichen, gekochten Speisen ernähren und so ihre Kiefer weniger brauchen. Mr. Brace teilt mir mit, daß es in den Vereinigten Staaten allgemein gebräuchlich werde, einige Backenzähne der Kinder entfernen zu lassen, weil der Kiefer nicht groß genug wird für die völlige Entwickelung der normalen Zahl[46].
Am Verdauungskanal ist mir nur ein einziges Rudiment aufgestoßen, nämlich der wurmförmige Anhang des Blinddarms. Der Blinddarm ist eine blind endigende Abzweigung oder ein Divertikel des Darmes, der bei vielen pflanzenfressenden Säugetieren außerordentlich lang ist. Bei dem Koala, einem Beuteltier, ist er tatsächlich mehr als dreimal so lang als der ganze Körper[47]. Zuweilen ist er in eine lange, allmählich abnehmende Spitze ausgezogen, zuweilen ist er in einzelne Abteilungen zerschnürt. Es scheint, als wenn der Blinddarm infolge veränderter Ernährung oder Lebensweise bei verschiedenen Tieren sehr verkürzt worden sei, wobei der Wurmfortsatz als Rudiment des verkürzten Teiles übrig geblieben ist. Daß dieser Fortsatz ein Rudiment darstellt, läßt sich aus seiner geringen Größe und aus seiner Variabilität beim Menschen schließen, für die Prof. Canstrini Beweise gesammelt hat[48]. Gelegentlich fehlt er ganz, oder er ist andererseits sehr entwickelt. Sein Lumen ist bisweilen auf die Hälfte oder ein Drittel seiner Länge vollständig verschlossen, so daß der Endteil eine flache, solide Ausbreitung darstellt. Beim Orang ist dieser Fortsatz lang und gewunden; beim Menschen entspringt er vom Ende des kurzen Blinddarms und ist gewöhnlich vier bis fünf Zoll lang, mit einem Durchmesser von etwa ein Drittel Zoll. Es ist nicht bloß nutzlos, sondern verursacht zuweilen den Tod, wovon mir kürzlich zwei Fälle bekannt geworden sind, wenn nämlich kleine harte Körper, wie z.B. Samenkörner, in den Kanal eindringen und eine Entzündung verursachen[49].
Bei einigen niederen Affen, bei den Lemuriden und Carnivoren, ebenso bei vielen Beuteltieren, findet sich nahe dem unteren Ende des Oberarmbeins ein Loch, das suprakondyloide Foramen, durch welches der große Nerv der vorderen Extremitäten und oft auch die große Arterie hindurchtreten. Nun findet sich im Oberarmbein des Menschen gewöhnlich eine Spur dieses Kanals, welche zuweilen ziemlich gut entwickelt ist, gebildet von einem hakenähnlichen Knochenfortsatz und einem Ligament. Dr. Struthers, der diesen Gegenstand sorgfältig studiert hat, hat jetzt gezeigt, daß diese Eigentümlichkeit zuweilen vererbt wird; sie trat auf bei einem Vater und bei vieren seiner sieben Kinder[50]. Wenn das Loch vorhanden ist, so tritt der große Armnerv unveränderlich durch ihn hindurch; und das weist deutlich darauf hin, daß es das Homologon und Rudiment des suprakondyloiden Foramen der Säugetiere ist. Prof. Turner hat berechnet, wie er mir mitteilt, daß es bei etwa einem Prozent der rezenten Skelette auftritt. Wenn aber die gelegentliche Entwickelung dieser Struktur beim Menschen, wie es wahrscheinlich ist, ein Rückschlag ist, so ist sie ein Rückschlag auf einen sehr alten Zustand, da sie bei den höheren Affen fehlt.
Im Oberarmbein ist eine andere Durchbohrung oder ein Foramen, welches gelegentlich beim Menschen zu finden ist, und welches das inter-kondyloide genannt werden kann. Es findet sich, jedoch nicht immer, bei verschiedenen Anthropoiden und anderen Affen[51] und ebenso bei manchen tiefer stehenden Tieren. Es ist merkwürdig, daß dieses Loch in alten Zeiten viel häufiger gewesen zu sein scheint als gegenwärtig. Mr. Busk hat über diesen Gegenstand die folgenden Tatsachen gesammelt[52]: »Prof. Broca notierte die Durchbohrung bei viereinhalb Prozent der von ihm auf der Cimetière du Sud in Paris gesammelten Armknochen; und in der Höhle von Orrony, deren Inhalt der Bronzeperiode zugerechnet wird, waren von 32 Oberarmknochen acht durchbohrt. Dieser außerordentlich hohe Prozentsatz könnte jedoch, wie er meint, darauf zurückzuführen sein, daß die Höhle eine Art Familiengrab gewesen sei. Dupont fand 30 % durchbohrter Armknochen in den Höhlen des Lesse-Tales, welche der Renntierperiode angehören, während Leguay in einer Art von Dolmen bei Argenteuil 25 % beobachtete; und Pruner-Bey fand 26 % in demselben Zustand unter den Knochen von Vauréal. Zu beachten ist ferner die Konstatierung Pruner-Beys, daß dieser Zustand bei Guanchen-Skeletten der gewöhnliche ist.« Es ist eine interessante Tatsache, daß sich häufiger bei alten als bei modernen Rassen Strukturen vorfinden, welche den Strukturen tiefer stehender Tiere ähnlich sind. Eine Hauptursache davon scheint mir zu sein, daß die alten Rassen ihren entfernten, tierähnlichen Vorfahren auf der langen Linie der Abstammung etwas näher stehen.
Das Schwanzbein, zusammen mit gewissen anderen, später zu beschreibenden Wirbeln, ist, obgleich es beim Menschen als Schwanz funktionslos ist, doch offenbar der Repräsentant dieses Teiles bei anderen Wirbeltieren. In einer frühen Embryonalperiode ist es frei und ragt über die unteren Extremitäten hinaus. Selbst nach der Geburt bildet es in einigen seltenen und anomalen Fällen[53] ein kleines äußeres Schwanzrudiment. Das Schwanzbein ist kurz und enthält gewöhnlich nur vier verwachsene rudimentäre Wirbel, die, mit Ausnahme des ersten, nur aus dem Wirbelkörper bestehen[54]. Sie sind mit ein paar kleinen Muskeln versehen; einer davon ist, wie mir Prof. Turner mitteilt, von Theile ausdrücklich beschrieben worden als ein rudimentärer Repräsentant des Schwanzstreckers, der bei vielen Säugetieren so kräftig entwickelt ist.
Das Rückenmark erstreckt sich beim Menschen nur bis zum letzten Rücken- oder ersten Lendenwirbel nach abwärts; ein fadenförmiges Gebilde (das Filum terminale) verläuft jedoch durch den Kreuzteil des Rückenmarks, ja sogar den Rücken der Schwanzwirbel entlang. Die obere Partie dieses Filaments ist, wie mir Prof. Turner mitteilt, unzweifelhaft dem Rückenmark homolog; der untere Teil besteht jedoch augenscheinlich nur aus der Pia mater, der gefäßführenden Hüllmembran. Auch in diesem Fall läßt sich also sagen, daß das Schwanzbein die Spur eines so wichtigen Gebildes, als das Rückenmark ist, besitzt, obgleich es nicht mehr in einen knöchernen Kanal eingeschlossen ist. Eine andere Tatsache, die ich ebenfalls Prof. Turner verdanke, zeigt, wie genau das Schwanzbein dem wirklichen Schwanz der niederen Tiere entspricht. Luschka hat nämlich neuerdings am Ende der Schwanzknochen einen sehr eigentümlich gewundenen Körper entdeckt, der mit der mittleren Kreuzbeinarterie im Zusammenhang steht; diese Entdeckung veranlaßte Krause und Meyer, den Schwanz eines Affen (Makakus) und einer Katze zu untersuchen, und sie fanden bei beiden einen ähnlich gewundenen Körper, wenn auch nicht am Ende.
Das Fortpflanzungssystem zeigt verschiedene rudimentäre Strukturen; sie weichen jedoch in einer bedeutungsvollen Hinsicht von den vorhergehenden Fällen ab. Wir haben es hier nicht zu tun mit dem Überrest eines Teiles, welcher der Art überhaupt in einem funktionsfähigen Zustand fehlt, sondern mit einem Teil, der in einem Geschlecht funktioniert, im anderen als bloßes Rudiment vorhanden ist. Bei dem Glauben an eine separate Schöpfung jeder Art ist das Vorkommen solcher Rudimente ebenso unerklärbar, wie in den vorhergehenden Fällen. Ich werde später auf diese Rudimente zurückkommen und zeigen, daß ihr Vorkommen allgemein auf Vererbung zurückzuführen ist; Teile, die von einem Geschlecht erworben wurden, sind teilweise auch auf das andere übertragen worden. Hier will ich nur ein paar Beispiele von solchen Rudimenten anführen. Es ist bekannt, daß die Männchen aller Säugetiere, mit Einschluß des Menschen, rudimentäre Milchdrüsen besitzen. In verschiedenen Fällen haben sich diese gut entwickelt und eine reichliche Menge von Milch gegeben. Ihre wesentliche Identität in beiden Geschlechtern wird auch bewiesen durch ihre sympathische Vergrößerung bei beiden während der Masern. Die Prostatadrüse, die bei vielen männlichen Säugetieren gefunden worden ist, wird jetzt allgemein als das Homologon des weiblichen Uterus einschließlich des damit verbundenen Kanals betrachtet. Es ist unmöglich, Leuckarts treffliche Darstellung dieses Organs und seine Betrachtungen darüber zu lesen, ohne die Richtigkeit seiner Schlußfolgerung zuzugeben. Das ist besonders deutlich bei denjenigen Säugetieren, bei denen der weibliche Uterus sich gabelförmig teilt: bei den Männchen derselben ist diese Drüse ebenfalls gegabelt[55]. Es könnten hier noch viele andere rudimentäre Strukturen der Fortpflanzungsorgane aufgeführt werden[56].
Die Tragweite der drei großen Klassen von Tatsachen, die hier mitgeteilt sind, ist nicht zu verkennen. Aber es würde überflüssig sein, hier die sämtlichen Argumente, die ich in meiner »Entstehung der Arten« gegeben habe, zu rekapitulieren. Die homologe Bildung des ganzen Körpers bei den Gliedern ein und derselben Klasse wird verständlich, wenn wir annehmen, daß sie von einer gemeinschaftlichen Stammform abstammen und sich in der Folge an verschiedene Bedingungen angepaßt haben. Nach jeder anderen Ansicht ist die Ähnlichkeit der Hand eines Menschen oder Affen mit dem Fuße eines Pferdes, der Flosse einer Robbe, dem Flügel einer Fledermaus usw. völlig unerklärlich[57]. Zu sagen, daß sie alle nach demselben ideellen Plane gebaut seien, ist keine wissenschaftliche Erklärung. Was die Entwickelung betrifft, so können wir nach dem Prinzip, daß Variationen in einer ziemlich späten embryonalen Periode auftreten und in einem korrespondierenden Lebensalter vererbt werden, deutlich einsehen, warum die Embryonen von höchst verschiedenen Formen mehr oder weniger den Bau ihres gemeinschaftlichen Stammvaters beibehalten. Keine andere Erklärung ist jemals gegeben worden von der wunderbaren Tatsache, daß die Embryonen eines Menschen, eines Hundes, einer Robbe, einer Fledermaus, eines Reptils usw. anfangs kaum unterschieden werden können. Um die rudimentären Organe zu verstehen, brauchen wir bloß anzunehmen, daß ein Vorfahr die fraglichen Teile in einem vollkommenen Zustand besessen habe, und daß sie unter veränderter Lebensweise sehr reduziert wurden, entweder durch bloßen Nichtgebrauch, oder durch natürliche Zuchtwahl solcher Individuen, die am wenigsten durch überflüssige Teile belastet waren, unterstützt durch andere, schon früher erörterte Mittel.
So läßt sich verstehen, warum der Mensch und alle anderen Wirbeltiere nach demselben allgemeinen Modell gebaut sind, warum sie alle dieselben Stadien der Entwickelung durchlaufen, und warum sie allgemein gewisse Rudimente beibehalten haben. Wir sollten darum ihre gemeinsame Abstammung ohne Rückhalt zugeben. Irgend eine andere Ansicht bilden, hieße einräumen, daß unsere eigene Bildung und diejenige aller Tiere um uns her eine bloße Falle für unser Urteil sei. Unsere Folgerung wird noch bedeutend verstärkt, wenn wir die Glieder der ganzen Tierreihe ins Auge fassen und die Beweise, die uns ihre Verwandtschaft, ihre Klassifikation, ihre geographische Verteilung und geologische Aufeinanderfolge liefern. Es ist nur unser natürliches Vorurteil und die Arroganz, womit unsere Vorväter von Halbgöttern abzustammen erklärten, die uns verleiten, diese Folgerung abzuweisen. Aber die Zeit wird bald kommen, in der es verwunderlich erscheinen wird, daß Naturforscher, die mit der vergleichenden Anatomie und mit der Entwickelung des Menschen und anderer Säugetiere vertraut sind, haben glauben können, daß jedes derselben das Produkt eines besonderen Schöpfungsaktes sei.
Zweites Kapitel Über die Art der Entwickelung des Menschen aus einer tiefer stehenden Form
Es steht fest, daß der Mensch gegenwärtig einer bedeutenden Variabilität unterliegt. Nicht zwei Individuen derselben Rasse sind völlig gleich. Wir mögen Millionen von Gesichtern vergleichen, und jedes wird verschieden sein. Ebenso groß ist die Verschiedenheit in den Proportionen und Dimensionen der verschiedenen Körperteile. Die Länge der Beine ist einer der variabelsten Punkte[58]. Obgleich in einigen Teilen der Erde ein langer Schädel, in anderen ein kurzer Schädel vorherrscht, so besteht doch eine große Verschiedenheit in der Form selbst innerhalb der Grenzen derselben Rasse, wie bei den Ureinwohnern von Amerika und Süd-Australien – die letzteren eine Rasse »wahrscheinlich so rein und homogen in Blut, Sitten und Sprache wie nur irgendeine« – und selbst bei den Einwohnern eines so beschränkten Gebietes wie die Sandwich-Inseln[59]. Ein hervorragender Zahnarzt versichert mir, daß in den Zähnen beinahe ebenso große Verschiedenheit herrsche wie in den Gesichtern. Die Hauptschlagadern haben so oft einen abnormen Verlauf, daß man es zu chirurgischen Zwecken für nützlich befunden hat, aus 1040 Leichen zu berechnen, wie oft jede Verlaufsart vorkommt[60]. Die Muskeln sind außerordentlich variabel; so fand Prof. Turner, daß die Muskeln des Fußes auch nicht bei zweien unter fünfzig Leichen völlig gleich waren, und bei einigen war die Abweichung beträchtlich[61]. Er fügt hinzu, daß die Fähigkeit, die geeigneten Bewegungen auszuführen, in Übereinstimmung mit den verschiedenen Abweichungen modifiziert worden sein müsse. Mr. Wood hat 295 Muskelvariationen bei 36 Personen beschrieben[62] und bei einer anderen Reihe derselben Zahl nicht weniger als 558 Variationen gefunden, die an beiden Seiten des Körpers vorkommenden als eine gerechnet. In der letzteren Reihe fand sich nicht ein Körper unter sechsunddreißig, der völlig mit den stehenden Beschreibungen des Muskelsystems in den anatomischen Textbüchern übereingestimmt hätte. Ein einziger Leichnam wies die außerordentliche Zahl von 25 verschiedenen Abnormitäten auf. Derselbe Muskel variiert zuweilen in verschiedener Weise; so beschreibt Prof. Macalister[63] nicht weniger als zwanzig verschiedene Variationen des Palmaris accessorius.
Der alte berühmte Anatom Wolff[64] behauptet, daß die inneren Eingeweide variabler seien als die äußeren Teile: »Es gibt keinen einzigen Teil, der sich nicht in verschiedenen Menschen verschieden verhält«. Er hat selbst eine Abhandlung über die Auswahl typischer Beispiele für die Darstellung der Eingeweide geschrieben. Eine Erörterung über das ideal Schöne der Leber, Lungen, Nieren usw. in eben der Weise wie über das göttlich Schöne des menschlichen Antlitzes klingt unseren Ohren seltsam.
Die Variabilität oder Verschiedenartigkeit der geistigen Fähigkeiten bei den Angehörigen derselben Rasse, ganz zu schweigen von den größeren Differenzen zwischen den Menschen verschiedener Rassen, ist so notorisch, daß kein Wort darüber gesagt zu werden braucht. Ebenso ist es mit den Tieren; den Leitern von Menagerien ist diese Tatsache bekannt, und wir sehen sie bestätigt bei unseren Hunden und anderen domestizierten Tieren. Brehm besonders behauptet, daß jedes Affen-Individuum von denen, die er in Afrika in Gefangenschaft hielt, seine eigene besondere Veranlagung und Laune gehabt habe; er erwähnt einen durch seine hohe Intelligenz bemerkenswerten Pavian; und die Wärter im Zoologischen Garten zeigten mir einen neuweltlichen Affen, der gleichfalls wegen seiner Intelligenz bemerkenswert war. Auch Rengger betont die Verschiedenheit der geistigen Eigenschaften bei den Affen derselben Spezies, die er in Parguay hielt; und diese Verschiedenheit ist, wie er hinzufügt, zum Teil angeboren, zum Teil das Resultat der Behandlung oder Erziehung[65].
Ich habe an anderer Stelle[66] die Vererbung so ausführlich erörtert, daß ich hier kaum etwas hinzuzufügen brauche. Hinsichtlich der Vererbung der unbedeutendsten sowohl wie der bedeutungsvollsten Eigenschaften sind noch weit mehr Tatsachen in bezug auf den Menschen als auf die Tiere gesammelt worden. Doch sind die Tatsachen in bezug auf die letzteren reichlich genug. So ist z.B. die erbliche Überlieferung von geistigen Eigenschaften bei unseren Hunden, Pferden und anderen Haustieren unbestreitbar. Außer speziellen Neigungen und Gewohnheiten werden sicher auch allgemeine Intelligenz, Mut, bösartiges und gutes Temperament usw. vererbt. Beim Menschen beobachten wir ähnliches in fast jeder Familie, und wir wissen jetzt durch die bewunderungswürdigen Arbeiten von Galton[67], daß das Genie, welches eine wunderbar komplexe Kombination hoher Fähigkeiten umfaßt, zur Erblichkeit neigt. Andererseits ist es ebenso gewiß, daß Wahnsinn und Geisteskrankheiten gleicherweise durch ganze Familien laufen.
In betreff der Ursachen der Variabilität sind wir in allen Fällen sehr unwissend; aber wir können sehen, daß sie sowohl beim Menschen wie bei den Tieren in Beziehung zu den Bedingungen stehen, welchen jede Art während mehrerer Generationen ausgesetzt gewesen ist. Gezähmte Tiere variieren mehr als Tiere im Naturzustand, und dies augenscheinlich infolge der verschiedenen und wechselnden Natur der Bedingungen, denen sie unterworfen worden sind. In dieser Hinsicht gleichen die verschiedenen Menschenrassen den domestizierten Tieren, und dasselbe gilt für die Individuen derselben Rasse, wenn sie ein sehr ausgedehntes Areal, wie etwa Amerika, bewohnen. Wir sehen den Einfluß verschiedener Bedingungen bei den zivilisierten Nationen; die Glieder derselben, verschiedenen Ständen und Berufen angehörend, weisen mehr Abstufungen im Charakter auf als die Glieder barbarischer Nationen. Aber die Gleichförmigkeit der Wilden ist oft übertrieben worden, und in einigen Fällen läßt sie sich kaum behaupten[68]. Trotzdem ist es ein Irrtum, den Menschen für »weit mehr domestiziert« anzusprechen als irgend ein anderes Tier[69], selbst wenn wir nur auf die Bedingungen sehen, denen er ausgesetzt gewesen ist. Gewisse wilde Rassen, wie die Australier, sind nicht verschiedeneren Bedingungen ausgesetzt als viele Arten mit weitem Verbreitungsgebiet. In einer sehr bedeutungsvollen Hinsicht weicht der Mensch von jedem domestizierten Tiere ab: seine Nachkommenschaft ist niemals lange kontrolliert worden, weder durch methodische, noch durch unbewußte Selektion. Keine Rasse oder menschliche Gruppe ist von anderen Menschen so völlig unterjocht worden, daß gewisse Individuen, die ihren Herren irgendwie hervorragend von Nutzen gewesen sind, erhalten und so unbewußt ausgewählt worden wären. [Man denke aber an die jahrhundertelange klerikale Züchtung, die ein frommes, zum Denken wenig befähigtes Geschlecht, und die politische Züchtung, die den Typus des »Untertanen« gezüchtet hat. H. S.] Ebensowenig sind gewisse männliche und weibliche Individuen absichtlich ausgelesen und miteinander gepaart worden, ausgenommen in dem bekannten Fall der preußischen Grenadiere; und in diesem Falle folgte man dem Gesetz der methodischen Zuchtwahl; denn es wird behauptet, daß in den Dörfern, welche die Grenadiere mit ihren großen Weibern bewohnten, viele große Menschen gezüchtet worden seien. Auch in Sparta wurde eine Art Selektion ausgeübt, denn es war vorgeschrieben, daß alle Kinder kurz nach der Geburt untersucht werden sollten; die wohlgebauten und kräftigen wurden erhalten, die anderen dem Untergang geweiht[70].
Wenn wir annehmen, daß alle Rassen des Menschen eine einzige Art bilden, so ist ihr Verbreitungsgebiet enorm; aber schon gewisse besondere Rassen, wie die Amerikaner und Polynesier, haben sehr ausgedehnte Verbreitungsgebiete. Es ist ein bekanntes Gesetz, daß weitverbreitete Arten variabler sind als Arten mit beschränktem Verbreitungsgebiet; und die Variabilität des Menschen kann zutreffender mit derjenigen weitverbreiteter Arten als mit jener der domestizierten Tiere verglichen werden.
Beim Menschen wie bei den Tieren scheint die Variabilität nicht nur durch dieselben allgemeinen Ursachen bewirkt zu werden; hier wie dort werden auch dieselben Körperteile in einer durchaus analogen Weise affiziert. Godron und Quatrefages haben das mit so ausführlichem Detail erwiesen, daß ich hier nur auf ihre Werke zu verweisen brauche[71]. Monstrositäten, die allmählich in geringe Variationen übergehen, sind ebenfalls beim Menschen und den niederen Tieren so ähnlich, daß bei beiden dieselbe Klassifikation und Terminologie angewendet werden kann, wie Isidore Geoffroy S. Hilaire gezeigt hat[72]. In dem Buche über Vererbung und Variabilität habe ich die Gesetze der Abänderung in einer flüchtigen Skizze unter folgende Gesichtspunkte gebracht: Die direkte und bestimmte Wirkung veränderter Bedingungen, wie sie sämtliche oder fast alle Individuen einer Art darbieten, die unter denselben Umständen in derselben Weise abändern; die Wirkungen lange fortgesetzten Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile; der Zusammenhang homologer Teile; die Variabilität mehrfach vorhandener Teile; Kompensation des Wachstums (von diesem Gesetz habe ich jedoch beim Menschen kein gutes Beispiel gefunden); die Wirkungen des gegenseitigen mechanischen Druckes der Teile (wie z.B. der Druck des Beckens auf den Schädel des Kindes im Mutterleib); Entwickelungshemmungen, die zur Verkleinerung oder Unterdrückung von Teilen führen; das Wiedererscheinen längst verlorener Charaktere durch Rückschlag, und schließlich korrelative Abänderung. All diese sogenannten Gesetze gelten ebenso für den Menschen wie für die Tiere; die meisten sogar für die Pflanzen. Es wäre überflüssig, sie hier alle zu erörtern[73]; einige sind jedoch so bedeutungsvoll, daß sie ziemlich ausführlich behandelt werden müssen.
Die direkte und bestimmte Wirkung veränderter Bedingungen. – Dies ist ein äußerst verwickeltes Thema. Es ist nicht zu leugnen, daß veränderte Bedingungen alle Organismen beeinflussen, manchmal sogar recht beträchtlich. Und es scheint auf den ersten Blick wahrscheinlich, daß dies unabänderlich eintritt, wenn genügende Zeit zur Verfügung steht. Aber ich habe vergebens versucht, evidente Beweise dafür zu bekommen, und starke Gründe lassen sich für das Gegenteil beibringen, mindestens soweit die zahllosen Strukturen in Betracht kommen, die speziellen Zwecken angepaßt sind. Indessen ist es nicht zweifelhaft, daß veränderte Bedingungen fluktuierende Variabilität in fast unbegrenzter Ausdehnung hervorrufen, wodurch die ganze Organisation in gewissem Grade plastisch gemacht wird.
In den Vereinigten Staaten wurden über eine Million Soldaten, die während des letzten Krieges dienten, gemessen und die Staaten, in denen sie geboren und erzogen waren, notiert[74]. Diese erstaunliche Zahl von Beobachtungen hat erwiesen, daß gewisse lokale Einflüsse direkt die Größe beeinflussen; und wir lernen ferner daraus, »daß der Staat, wo das physische Wachstum zum größten Teil erfolgt ist, sowie der Staat der Geburt einen deutlichen Einfluß auf die Größe auszuüben scheinen«. Zum Beispiel wurde festgestellt, »daß der Aufenthalt in den westlichen Staaten während der Jahre des Wachstums eine Zunahme der Größe zur Folge hat«. Anderseits ist es sicher, daß die Lebensweise der Matrosen das Wachstum hemmt, wie »die große Differenz in der Größe von Soldaten und Matrosen im Alter von 17 und 18 Jahren« zeigt. Mr. B. A. Gould bemühte sich, die Natur dieser Einflüsse auf die Größe festzustellen; aber er kam zu bloß negativen Ergebnissen, nämlich, daß sie nicht in Beziehung stehen, weder zum Klima, noch zur Meereshöhe des Landes, weder zum Boden, noch »in irgend einem kontrollierbaren Grad« zu dem Überfluß oder dem Mangel an Lebensannehmlichkeiten. Diese letzte Folgerung ist direkt entgegengesetzt derjenigen von Villermé, die aus der Statistik der Körpergröße der in verschiedenen Teilen Frankreichs Konskribierten gewonnen wurde. Wenn wir die Unterschiede in der Größe zwischen den polynesischen Häuptlingen und den niederen Klassen derselben Inseln vergleichen, oder zwischen den Einwohnern der fruchtbaren vulkanischen und der niedrigen unfruchtbaren Koralleninseln desselben Ozeans[75], oder wiederum zwischen den Feuerländern an der östlichen und westlichen Küste ihres Landes, wo die Existenzmittel sehr verschieden sind, so läßt sich die Schlußfolgerung kaum vermeiden, daß bessere Nahrung und größerer Komfort die Körpergröße beeinflussen. Die vorstehenden Angaben zeigen jedoch, wie schwer es ist, zu einem entschiedenen Resultat zu kommen. Dr. Beddoe hat kürzlich nachgewiesen, daß bei den Einwohnern Englands der Aufenthalt in den Städten und gewisse Beschäftigungen einen die Größe vermindernden Einfluß haben; und er schließt ferner, daß das Resultat bis zu einem gewissen Grad vererbt wird, wie es auch in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Dr. Beddoe glaubt ferner, »daß, wo nur immer eine Rasse ihr Maximum von physischer Entwickelung erreicht, sie auch an Energie und moralischer Kraft ihr Höchstes erreicht[76].
Ob äußere Bedingungen irgend eine andere Wirkung auf den Menschen hervorbringen, ist unbekannt. Es könnte erwartet werden, daß Unterschiede im Klima einen deutlichen Einfluß hätten, insofern als Lungen und Nieren bei einer niederen, Leber und Haut bei einer höheren Temperatur zu lebhafterer Tätigkeit angeregt würden[77]. Früher glaubte man, daß die Hautfarbe und die Beschaffenheit des Haares durch Luft oder Wärme bestimmt würden; aber obgleich kaum geleugnet werden kann, daß dadurch eine gewisse Wirkung hervorgebracht wird, so stimmen doch jetzt beinahe sämtliche Beobachter darin überein, daß die Wirkung selbst nach viele Generationen hindurch andauernder Einwirkung nur sehr gering gewesen ist. Genauer soll das erörtert werden, wenn wir die verschiedenen Menschenrassen behandeln. In bezug auf unsere Haustiere haben wir Gründe zu der Annahme, daß Kälte und Feuchtigkeit das Wachstum der Haare direkt beeinflussen; aber in bezug auf den Menschen ist mir kein gut beglaubigter Beweis hierfür begegnet.
Wirkungen des vermehrten Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Teile. – Es ist bekannt, daß der Gebrauch die Muskeln des Individuums stärkt und völliger Nichtgebrauch oder die Zerstörung des zugehörigen Nervs sie schwächt. Wird das Auge zerstört, so atrophiert der Sehnerv häufig. Wenn eine Arterie unterbunden wird, so werden die seitlichen Gefäße nicht nur weiter, sondern ihre Wandung wird auch dicker und kräftiger. Wenn eine Niere infolge Krankheit aufhört zu funktionieren, so wird die andere größer und übernimmt die doppelte Arbeit. Knochen werden nicht nur dicker, sondern auch länger, wenn sie ein größeres Gewicht zu tragen haben[78]. Verschiedene Beschäftigungen, gewohnheitsmäßig ausgeübt, verändern die Proportionen in verschiedenen Teilen des Körpers. So wurde durch die Kommission der Vereinigten Staaten festgestellt, daß die Beine der im letzten Kriege verwendeten Matrosen 0,217 Zoll länger waren als die Beine der Soldaten, obgleich die Matrosen im Durchschnitt kleiner waren; ihre Arme dagegen waren 1,09 Zoll kürzer, also unverhältnismäßig kurz selbst mit Rücksicht auf ihre geringe Körpergröße[79]. Diese Kürze der Arme ist augenscheinlich Folge ihres stärkeren Gebrauchs und ist ein unerwartetes Resultat; aber Matrosen verwenden ihre Arme hauptsächlich zum Ziehen und nicht zum Tragen von Lasten. Bei Matrosen ist der Umfang des Nackens größer und ist der Spann höher als bei Soldaten, der Umfang der Brust, der Taille und der Hüften kleiner.
Ob diese verschiedenen Modifikationen erblich würden, wenn dieselben Lebensgewohnheiten viele Generationen hindurch eingehalten würden, ist nicht bekannt; aber es ist wahrscheinlich. Rengger[80] führt die dünnen Beine und starken Arme der Payaguas-Indianer darauf zurück, daß sie Generationen hindurch nahezu ihr ganzes Leben in Kanus zugebracht und ihre Beine nicht bewegt haben. Andere Autoren sind zu ähnlichen Folgerungen in analogen Fällen gekommen. Nach Cranz[81], der lange bei den Eskimos lebte, »glauben die Eingeborenen, daß Scharfsinn und Geschick im Robbenfang (ihrer höchsten Kunst und Tugend) erblich sei; und es ist wirklich etwas daran, denn der Sohn eines berühmten Robbenfängers wird sich auszeichnen, auch wenn er seinen Vater in der Kindheit verloren hat«. Aber in diesem Falle ist es die geistige Geschicklichkeit, die ebensogut vererbt wird als die körperliche Bildung. Es wird behauptet, daß die Hände der englischen Arbeiter schon bei der Geburt größer seien als die Hände der besitzenden Klassen[82]. Nach der Korrelation, die wenigstens in einigen Fällen[83]