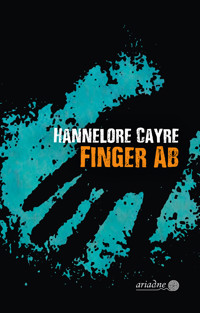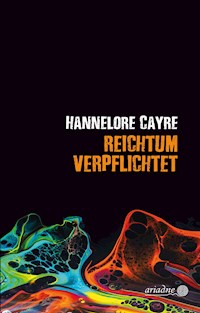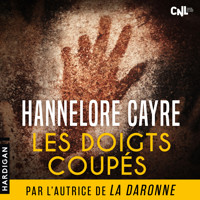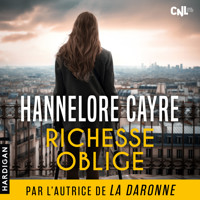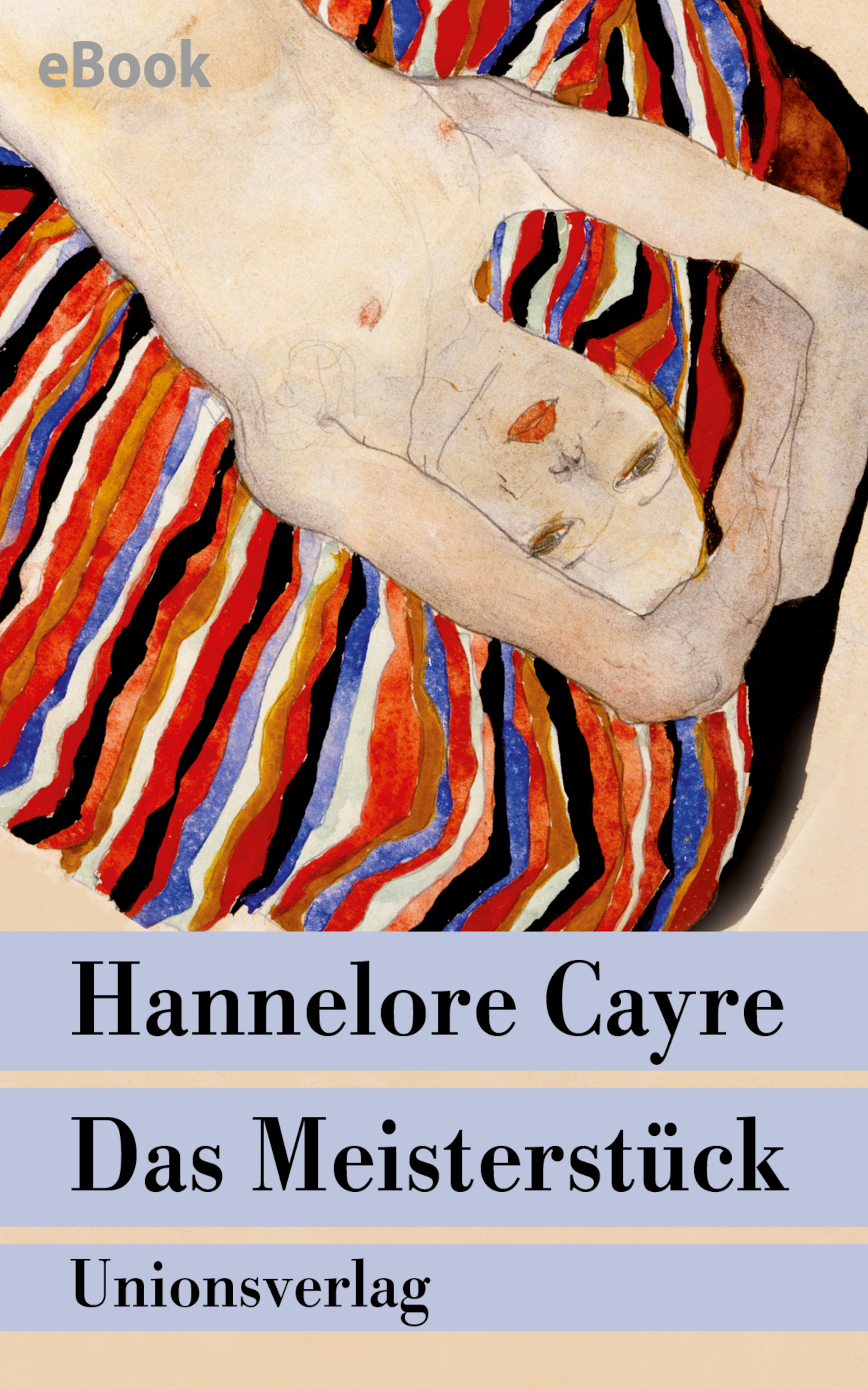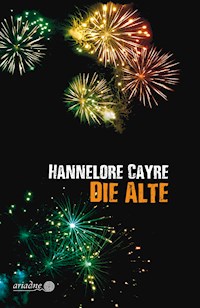
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ariadne
- Sprache: Deutsch
Madame Portefeux, die Arabischübersetzerin mit den Patience-blauen Augen, führt ein Scheißleben. Die Kohle ist knapp, die alte Mutter liegt im Sterben, die Welt biegt sich vor Ungerechtigkeit. Dann tut sich unverhofft eine Chance auf, die einfach ergriffen werden muss. Und alles wird anders. Was passiert, wenn eine von Verantwortung und Geldsorgen zermürbte französische Mittfünfzigerin beschließt, dem Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen zu begegnen? Eine scharfe Bestandsaufnahme und ein Feuerwerk aus bösem Witz mit schamlosen Ausfällen gegen ein selbstherrliches, durch und durch verlogenes System.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Cayre
Die Alte
Deutsch von Iris Konopik
Ariadne 1240
Argument Verlag
Ariadne
Herausgegeben von Else Laudan
Titel der französischen Originalausgabe: La daronne
© Éditions Métailié, Paris 2017
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 2019
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Lektorat: Else Laudan
Umschlag: Martin Grundmann
Fotomotiv: © IrisImages, Fotolia.com
ISBN (Buch) 978-3-86754-240-1
ISBN (Epub) 978-3-86754-838-0
ISBN (Mobi) 978-3-86754-839-7
Erste Auflage 2019
Über dieses Buch
Eine Frau strampelt sich ab, richtet sich in Überforderung ein, trennt sich von den Illusionen der Kindheit, zieht irgendwie zwei Töchter groß, arbeitet bis zum Umfallen als Dolmetscherin für die Kripo, hört tagtäglich endlose Telefonate ab. Kann das Altenheim für ihre Mutter nicht mehr zahlen …
Patience Portefeux ist eine schwer geknechtete Mittelstandsfrau, aber sie ist keine Theres (in Anne Goldmanns Das größere Verbrechen), in der ein vereinsamendes Trauma gärt und schwärt, auch keine Lady Bag (von Liza Cody), die an der Flasche hängt und die Wohlstandsgesellschaft von ganz unten sieht, und keine Anna McDonald (in Klare Sache von Denise Mina), die sich auf der Flucht umdreht und gegen die Raubtiere antritt. Der Ausstieg von Patience Portefeux ist unauffälliger, egoistischer und skrupelloser.
Ihre Lebensodyssee entfaltet sich in Rückblicken als lässig-beißender Kommentar zur Vergangenheit und Gegenwart französischer Verhältnisse samt Kolonialgeschichte und Terrorangst. Über Jahre hegt sie das Gefühl, das viele Frauen kennen: dass sich etwas ändern muss, dass es so nicht mehr geht. Dann nutzt sie einen Glückstreffer und wird von heute auf morgen Die Alte, eine Frau ohne Moral, aber mit Witz und Wut und genug Wissen, um Klischee und Wirklichkeit auseinanderzuhalten.
Das macht als Lektüre gewaltigen Spaß – zumal ihre Schöpferin, die Strafverteidigerin Hannelore Cayre, keine Gelegenheit auslässt, mit leichter Hand und doch deutlich die ganze Absurdität dessen zu zeigen, was gemeinhin als normal akzeptiert wird. Schließlich ist das Genre genau dafür da.
Also her mit dem Vorstoß der Bürgerin ins kriminelle Milieu, her mit dem Feuerwerk am Nachthimmel: Vorhang auf für Patience Portefeux, die Alte!
Else Laudan
Hinweis des Verlags
Warnung: Dieser Roman enthält diverse politisch unkorrekte Ausdrücke. Um den Sarkasmus der Autorin nicht zu entstellen, wurden sie präzise ins Deutsche übernommen. Alles andere wäre erst recht unkorrekt.
Danksagung
Ich danke meinen treuen Korrektoren Jean und Antony. Dank auch an die Übersetzerinnen und Übersetzer vom Palais de Justice von Paris, die mir geholfen haben und deren Namen ich mit Absicht verschweige, damit sie weiterhin arbeiten können.
Für meine Kinder
1
Geld ist alles
Meine Betrüger von Eltern liebten das Geld instinktiv. Nicht wie ein lebloses Etwas, das man in einem Safe versteckt oder als Guthaben auf einem Konto besitzt. Nein. Wie ein lebendiges intelligentes Wesen, das erschaffen und töten kann, ausgestattet mit der Fähigkeit zur Reproduktion. Wie etwas Gewaltiges, das Schicksale prägt. Das das Schöne vom Hässlichen unterscheidet, den Loser vom Erfolgreichen. Geld ist alles; das Kondensat von allem, was sich kaufen lässt in einer Welt, in der alles zum Verkauf steht. Es ist die Antwort auf alle Fragen. Es ist die Sprache vor Babel, die alle Menschen verbindet.
Man muss dazusagen, dass sie alles verloren hatten, einschließlich ihrer Heimat. Es war nichts übrig vom französischen Tunesien meines Vaters, vom jüdischen Wien meiner Mutter. Niemand, mit dem man Pataouète1 oder Jiddisch sprechen konnte. Nicht einmal Tote auf einem Friedhof. Nichts. Von der Karte radiert wie Atlantis. So hatten sie ihre Einsamkeiten zusammengelegt und auf einer Lücke zwischen einer Autobahn und einem Wald Wurzeln geschlagen, um dort das Haus zu errichten, in dem ich aufgewachsen bin, hochtrabend die Besitzung genannt. Ein Name, der diesem trostlosen Stück Erde den unantastbaren und heiligen Charakter eines Rechtstitels verlieh; eine Art verfassungsrechtliche Rückversicherung, dass man sie nie wieder vertreiben würde. Ihr Israel.
Meine Eltern waren Kanaken, halbseidene Exoten, Fremde. Raus. Die Blöße vorn und hinten mit den Händen bedeckt. Wie alle von ihrer Art hatten sie nicht groß die Wahl. Sich auf das nächstbeste Geld stürzen, jede beliebige Arbeitsbedingung akzeptieren, oder aber mauscheln bis zum Exzess, gestützt auf eine Gemeinschaft von ihresgleichen – sie hatten nicht lange überlegt.
Mein Vater war Generaldirektor einer Speditionsfirma, der Mondiale, deren Motto Alles, überalllautete. »Generaldirektor«, ein Wort, das heute nicht mehr verwendet wird, um eine Arbeit zu bezeichnen wie in Was ist dein Vater von Beruf ? – Er ist Generaldirektor, aber in den Siebzigern sagte man so. Es passte zu Ente in Orangensauce, gelben Nylon-Rollkragenpullovern über Hosenröcken und bortenverzierten Telefonhauben.
Er war damit reich geworden, seine Laster in sogenannte Drecksländer zu schicken, deren Namen auf -an enden wie Pakistan, Usbekistan, Aserbaidschan, Iran usw. Um bei der Mondiale als Fahrer anzuheuern, musste man unmittelbar einem Gefängnisbus entsteigen, meinem Vater zufolge ließ sich nur ein Typ, der mindestens fünfzehn Jahre gesessen hatte, darauf ein, tausende Kilometer in der Kabine seines Lasters eingesperrt zu sein und seine Ladung zu verteidigen, als ginge es um sein Leben.
Ich sehe mich noch, als wäre es gestern, in marineblauem Samtkleidchen und Lackschuhen unterm Weihnachtsbaum, umringt von Kerlen mit Schmissen, die in ihren derben Würgehänden hübsche bunte Päckchen hielten. Das Verwaltungspersonal der Mondiale war dementsprechend. Es bestand ausschließlich aus Pied-noir-Landsleuten meines Vaters, Männer so unredlich wie hässlich. Nur Jacqueline, seine persönliche Sekretärin, hübschte das Gesamtbild auf. Mit ihrer toupierten Hochfrisur, in die sie kokett ein Diadem spießte, strahlte die Tochter eines während der »Säuberungen«2 zum Tode Verurteilten Klasse aus, ein Erbe aus ihrer Jugend in Vichy.
Dieser fröhliche Haufen Geächteter, über den mein Vater mit romantischem Paternalismus herrschte, erlaubte ihm in aller Verborgenheit, seine Konvois mit sogenannten Beiladungen zu versehen. So war der Transport von Morphinbase in Kooperation mit seinen Korsen- und Pied-noir-Freunden3 und dann von Waffen und Munition bis Anfang der Achtzigerjahre ein einträgliches Geschäft für die Mondiale und ihre fürstlich entlohnten Angestellten. Pakistan, Iran, Afghanistan, ich schäme mich nicht zu sagen: Mein Papa war der Marco Polo der Trente Glorieuses, der dreißig glorreichen Nachkriegsjahre, indem er die Handelswege zwischen Europa und dem Mittleren Orient wiedereröffnete.
Jede Kritik an der Lage der Besitzung wurde von meinen Eltern als symbolischer Angriff empfunden, so dass wir unter uns nie auch nur den geringsten negativen Aspekt des Ortes erwähnten: den ohrenbetäubenden Lärm der Autobahn, der uns zu brüllen zwang, um uns zu verständigen, den schwarzen klebrigen Staub, der überall eindrang, die Erschütterungen, die das Haus wackeln ließen, oder die extreme Gefährlichkeit dieser sechsspurigen Straße, wo etwas so Schlichtes wie nach Hause zu gehen, ohne von hinten angefahren zu werden, einem Wunder gleichkam.
Meine Mutter bremste dreihundert Meter vor dem Tor, um mit eingeschalteten Warnblinkern und unter stürmischem Hupen im ersten Gang in die Einfahrt einzubiegen. Die seltenen Male, die er da war, praktizierte mein Vater mit seinem Porsche eine Art Motorbremsen-Terrorismus, er ließ seinen V8 aufheulen, wenn er binnen weniger Meter von 200 auf 10 Stundenkilometer abbremste, was den, der das Pech hatte, hinter ihm zu fahren, zu furchterregenden Ausweichmanövern zwang. Was mich betrifft, bekam ich natürlich nicht ein einziges Mal Besuch. Wenn eine Freundin mich fragte, wo ich wohnte, schwindelte ich über meine Adresse. Ohnehin hätte mir niemand geglaubt.
Meine kindliche Phantasie machte uns zu einem eigenen Menschenschlag: das Volk der Straße.
Fünf Ereignisse, verteilt über dreißig Jahre, bestätigten diese Eigentümlichkeit: 1978 metzelte in Hausnummer 27 ein dreizehnjähriger Bengel seine Eltern und vier Geschwister im Schlaf mit einem Gartenwerkzeug nieder. Als man ihn fragte, warum, antwortete er, er brauchte eine Veränderung. In der 47 kam es in den Achtzigern zu einem besonders fiesen Fall von Freiheitsberaubung, wobei ein alter Mann von seiner Familie gequält wurde. Zehn Jahre später eröffnete in Hausnummer 12 ein Heiratsinstitut, de facto ein Prostitutionsnetzwerk mit osteuropäischen Frauen. In der 18 fand man ein mumifiziertes Ehepaar. Und kürzlich in der 5 ein djihadistisches Waffendepot. Es stand alles in der Zeitung, ich habe das nicht erfunden.
Warum haben all diese Leute beschlossen, dort zu leben?
Für einen Teil von ihnen, darunter meine Eltern, fällt die Antwort leicht: weil Geld den Schatten liebt und es am Rand einer Autobahn Schatten im Überfluss gibt. Die anderen hat die Straße in den Wahnsinn getrieben.
Ein eigener Menschenschlag also, denn bei Tisch verstummten wir mit erhobenen Gabeln, wenn wir das Kreischen von Reifen hörten. Es folgten ein absonderliches Geräusch von zermalmtem Schrott, dann eine merkwürdige Stille, eine eigene Disziplin des Totengeläuts, der sich die Autofahrer unterwarfen, während sie im Schritttempo am Gemisch aus Fleisch und Karosserie vorüberfuhren, zu dem jene geworden waren, die wie sie irgendwohin unterwegs waren.
Wenn derlei bei uns vor der Tür passierte, im Umkreis von Hausnummer 54, rief meine Mutter die Feuerwehr, dann ließen wir unser Essen stehen, um die Unfallvorstellung zu besuchen, wie sie es nannte. Wir holten unsere Klappstühle und trafen dort unsere Nachbarn. Das Stück lief in der Regel am Wochenende auf Höhe von Nummer 60, wo der angesagteste Nachtclub der Gegend mit seinen sieben unterschiedlichen Ambientes logierte. Und Club bedeutet unweigerlich unfassbare Unfälle. Es ist Wahnsinn, wie viele sturzbetrunkene Leute es schaffen, sich in einen Wagen zu quetschen und darin zu sterben und im gleichen Schwung fröhliche Familien mit sich zu reißen, die des Nachts in die Ferien aufbrechen, um mit Meerblick zu erwachen.
So hat das Volk der Straße eine beachtliche Anzahl Dramen aus nächster Nähe miterlebt, mit Jungen, Alten, Hunden, Fetzen von Hirn und Gedärm … wobei mich immer erstaunt hat, dass ich von all diesen Opfern nie den kleinsten Schrei vernahm. Allenfalls ein oh là là, ganz leise geäußert von denen, die es taumelnd bis zu uns schafften.
Das Jahr über verkrochen sich meine Eltern wie Ratten hinter ihren vier Wänden und widmeten sich ebenso verschlungenen wie avantgardistischen Berechnungen zur Steueroptimierung, während sie noch das kleinste äußere Zeichen von Reichtum aus ihrer Lebensweise verbannten, um so die Bestie zu täuschen, die von fetteren Beutetieren angezogen wird.
Aber in den Ferien, kaum hatten wir französisches Territorium verlassen, lebten wir wie Milliardäre in schweizerischen oder italienischen Hotels in Bürgenstock, Zermatt oder Ascona, Seite an Seite mit amerikanischen Filmstars. Unsere Weihnachten verbrachten wir im Winter Palace in Luxor oder im Danieli in Venedig … und meine Mutter blühte auf.
Sobald wir ankamen, stürmte sie in die Luxusboutiquen, um Kleider, Schmuck und Parfums zu kaufen, während mein Vater seine Ernte an prall gefüllten Pappumschlägen mit Barem einbrachte. Am Abend fuhr er vor dem Hotelportal mit dem weißen Thunderbird-Cabrio vor, das uns auf mir schleierhaften Wegen auf unseren Offshore-Reisen folgte. Das Gleiche gilt für Riva, die wie durch Zauberei auf den Wassern des Vierwaldstättersees oder des Canal Grande in Venedig auftauchte.
Es gibt noch viele Fotos von diesen fitzgeraldesken Ferien, aber ich finde, in zweien sind sie alle enthalten.
Das erste zeigt meine Mutter in einem Kleid mit rosa Rosen, wie sie in der Nähe einer Palme posiert, die sich wie ein grüner Zisch vom Sommerhimmel abhebt. Sie hält die Hand schützend über ihre Augen, die bereits krank sind vom Sonnenlicht.
Das andere ist ein Foto von mir an der Seite von Audrey Hepburn. Es wurde an einem 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, im Belvédère aufgenommen. Ich esse einen großen Becher Erdbeer-Melba, ertränkt in Schlagsahne und Sirup, und während meine Eltern auf der Tanzfläche zu einem Song von Shirley Bassey tanzen, wird ein prächtiges Feuerwerk abgebrannt, das sich im Vierwaldstättersee spiegelt. Ich bin sonnengebräunt und trage ein gesmoktes blaues Liberty-Kleid, das das Patience-Blau meiner Augen unterstreicht, wie mein Vater ihre Farbe getauft hat.
Es ist ein perfekter Moment. Ich strahle vor Wohlbefinden wie ein Atomreaktor.
Die Schauspielerin muss diese unermessliche Glückseligkeit gespürt haben, denn sie setzte sich spontan zu mir und fragte, was ich mal werden wolle, wenn ich groß bin.
»Feuerwerksammlerin.«
»Feuerwerksammlerin! Wie willst du so was denn sammeln?«
»In meinem Kopf. Ich werde durch die Welt reisen, um sie alle zu sehen.«
»Du bist die erste Feuerwerksammlerin, die ich kennenlerne! Sehr erfreut.«
Dann winkte sie einen befreundeten Fotografen herbei, damit er diesen Premierenmoment verewigte. Sie ließ zwei Abzüge machen. Einen für mich und einen für sich. Ich habe meinen verloren und sogar seine Existenz vergessen, aber ihren habe ich zufällig in einem Auktionskatalog wiedergesehen, mit der Bildunterschrift: Die kleine Feuerwerksammlerin, 1972.
Dieses Foto fing ein, was mein früheres Leben versprochen hatte: eine sehr viel strahlendere Zukunft als all diese Zeit, die seit jenem 1. August vergangen ist.
Nachdem wir die ganzen Ferien kreuz und quer durch die Schweiz gefahren waren, um ein Kostüm oder eine Handtasche mit nach Hause zu bringen, schnitt meine Mutter am Tag vor der Abreise alle Etiketten aus den neuen Kleidern, die sie gehamstert hatte, und füllte den Inhalt ihrer Parfumflacons in Shampooflaschen um, nur für den Fall, dass die Zollinquisition uns fragte, von welchem Geld wir all diese Neuheiten gekauft hatten.
Und warum gab man mir den Namen Patience – Geduld?
Na, weil du nach zehn Monaten geboren wurdest. Dein Vater hat uns immer erzählt, der Schnee hätte ihn daran gehindert, den Wagen aus der Garage zu holen und dich nach der Geburt zu besuchen, aber in Wahrheit war er nach der langen Warterei einfach superenttäuscht, eine Tochter zu bekommen. Und du warst riesig … fünf Kilo … ein Monstrum … und so was von hässlich … dein halber Kopf von der Geburtszange zerquetscht … Als man es endlich schaffte, dich meinem Körper zu entreißen, war um mich herum so viel Blut, als wäre ich auf eine Mine getreten. Ein wahres Gemetzel! Und wofür das alles? Für ein Mädchen! Das ist so ungerecht!
Ich bin dreiundfünfzig. Meine Haare sind lang und vollkommen weiß. Sie wurden weiß, als ich sehr jung war, so wie bei meinem Vater. Ich habe sie lange gefärbt, weil ich mich schämte, aber eines Tages hatte ich es satt, meinen Haaransatz zu belauern, und schor mir den Kopf, um sie nachwachsen zu lassen. Angeblich ist das heute in; jedenfalls passt es sehr gut zu meinen Patience-blauen Augen und beißt sich immer weniger mit meinen Falten.
Ich spreche mit leicht schiefem Mund, weshalb meine rechte Gesichtshälfte etwas weniger faltig ist als die linke. Verantwortlich dafür ist eine kaum merkliche halbseitige Lähmung, die von der geburtlichen Quetschung herrührt. Das gibt mir die Ausstrahlung einer Faubourienne, einer Pariserin alten Schlages, was im Verbund mit meinem eigenartigen Haar nicht uninteressant wirkt. Ich habe einen kräftigen Körperbau mit fünf Kilo zu viel, weil ich bei meinen zwei Schwangerschaften jeweils dreißig Kilo zulegte, indem ich meiner Leidenschaft für üppige bunte Torten, Fruchtgelee und Eiscreme freien Lauf ließ. Bei der Arbeit trage ich monochrome Kleidung in Grau, Schwarz oder Anthrazit und von ungekünstelter Eleganz.
Ich achte darauf, immer so zurechtgemacht zu sein, dass ich mit meinen weißen Haaren nicht wie eine alte Hippiefrau wirke. Das heißt nicht, dass ich eitel bin; in meinem Alter finde ich derlei Koketterien eher trostlos … Nein, ich will nur, dass man bei meinem Anblick ausruft: Herr im Himmel, ist die Frau gut in Schuss … Friseur, Maniküre, Kosmetikerin, Hyaluronsäurespritzen, IPL-Haarentfernung, gut geschnittene Klamotten, Tages- und Nachtcreme, Mittagsschlaf … ich hatte immer eine marxistische Schönheitsauffassung. Lange Zeit hatte ich nicht die finanziellen Mittel, mich schön und fit zu machen; heute, wo ich sie habe, hole ich das nach. Würden Sie mich jetzt sehen, hier auf dem Balkon meines hübschen Hotels, man könnte meinen: Heidi in ihren Bergen.
Man sagt mir nach, ich hätte einen schlechten Charakter, aber ich halte diese Analyse für voreilig. Es ist wahr, dass mich die Leute schnell nerven, weil ich sie als schwer von Kapee und oft uninteressant empfinde. Versuchen sie beispielsweise, mir umständlich irgendwelches Zeug zu erzählen, das mir in der Regel schnurzegal ist, neige ich dazu, sie mit kaum verhohlener Ungeduld anzuschauen, und das kränkt sie. Deshalb finden sie mich unsympathisch. Ich habe folglich keine Freunde, nur Bekannte.
Ansonsten leide ich an einer kleinen neurologischen Absonderlichkeit; mein Gehirn verbindet mehrere Sinne, so dass ich eine andere Realität erlebe als andere Leute. Bei mir sind Farben und Formen mit Geschmack oder mit Empfindungen wie Behagen oder Sattheit gekoppelt. Eine sensorische Erfahrung, die ziemlich seltsam und schwer zu erklären ist. Das passende Wort ist unaussprechlich.
Manche sehen Farben, wenn sie Töne hören, andere assoziieren Zahlen mit Formen. Wieder andere nehmen das Vergehen der Zeit körperlich wahr. Ich schmecke und fühle die Farben. Ich weiß sehr wohl, dass sie nicht mehr sind als eine Quantentuschelei zwischen Materie und Licht, trotzdem sagt mir mein spontanes Gefühl, dass sie im Körper der Dinge selbst wohnen. Wo die Leute zum Beispiel ein rosa Kleid sehen, sehe ich es aus rosa Material, zusammengesetzt aus kleinen rosa Atomen, und schaue ich länger hin, verliert sich mein Blick in rosiger Unendlichkeit. Das löst in mir ein Gefühl von Wohlbehagen und Wärme aus, aber auch eine unbezwingliche Lust, das besagte Kleid an meine Lippen zu führen, denn für mich ist Rosa auch ein Geschmack. Wie »das kleine gelbe Mauerstück« in Prousts Die Gefangene, das den Betrachter von Vermeers Ansicht von Delft so besessen macht. Ich bin sicher, der Autor hat den Mann, der ihn zur Figur des Bergotte inspirierte, eines Tages dabei überrascht, wie er das Gemälde ableckte. Weil er das zu verrückt und eine Spur obszön fand, hat er es in seinem Roman nicht erwähnt.
Als Kind schluckte ich ständig Wandfarbe und monochromes Plastikspielzeug und wäre mehrfach um ein Haar gestorben, bis ein etwas kreativerer Arzt über die banale Diagnose von Autismus hinausging und eine bimodale Synästhesie feststellte. Diese neurologische Eigenart erklärte endlich, warum ich, wenn ich vor einem Teller mit einem Farbgemisch saß, die Mahlzeit damit verbrachte, den Inhalt zu sortieren, während mein Gesicht von nervösen Tics heimgesucht wurde.
Er schlug meinen Eltern vor, sie sollten mich essen lassen, was ich wollte, solange die Kost, die man mir vorsetzte, meinen Augen angenehm war und mich nicht vergiftete: pastellfarbene Bonbons, sizilianische Cassata, Windbeutel mit rosa und weißer Sahnefüllung, mit kleinen bunten kandierten Früchten gespicktes Plombir-Eis4. Er war es auch, der ihnen den Trick mit den Farbmusterpaletten zum Blättern und den Ringen mit großen farbigen Schmucksteinen verriet, die ich stundenlang betrachten konnte, während ich geistlos auf meiner Zunge kaute.
Das bringt mich zum Feuerwerk: Wenn diese glühenden Chrysanthemenbouquets am Himmel erscheinen, empfinde ich eine so ungemein heftige farbenfrohe Erregung, dass sie mich mit Freude sättigt und mir ein Gefühl der Erfüllung schenkt. Wie ein Orgasmus.
Feuerwerke zu sammeln, tja, das wäre demnach, wie im Zentrum einer gigantischen Gruppensexorgie mit dem ganzen Universum zu sein.
Und Portefeux … das ist der Name meines Ehemanns. Des Mannes, der mich eine Zeitlang vor der Grausamkeit der Welt beschützte und mir eine Existenz voller Freuden und erfüllter Wünsche schenkte. Die paar wunderbaren Jahre, die wir verheiratet waren, liebte er mich so, wie ich war, mit meiner farbintensiven Sexualität, meiner Leidenschaft für Rothko, meinen bonbonrosa Kleidern und meiner Unfähigkeit, irgendetwas Nützliches zu tun, die der meiner Mutter ebenbürtig war.
Wir starteten unser gemeinsames Leben in luxuriösen Appartements, gemietet von den Früchten seiner Arbeit. Ich sage ausdrücklich gemietet – im Sinne von unpfändbar, denn wie mein Vater machte mein Mann Geschäfte, über die niemand das Geringste wusste, außer dass sie uns einen ungeheuren materiellen Komfort erlaubten, und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, genauer nachzufragen, dermaßen großzügig, seriös und wohlerzogen war er.
Auch er verdankte seinen Reichtum den sogenannten Drecks ländern, wo er als Berater bei der Entwicklung nationaler Strukturen für Wettgeschäfte tätig war. Kurz gesagt, er verkaufte seine Expertise in Sachen Lotteriespiele und Pferdewetten an politische Führer in Ländern Afrikas und des Fernen Ostens wie Aserbaidschan oder Usbekistan. Das Ambiente kann man sich vorstellen. Ich jedenfalls kenne sie gut, diese Am-Arsch-der-Welt-Atmosphäre, denn ich habe mit ihm wie mit meiner Familie des Öfteren in unglaublichen internationalen Hotels gewohnt. Die einzigen Orte, wo die Klimaanlage funktioniert und es passablen Alkohol gibt. Wo Söldner mit Journalisten verkehren, mit Geschäftsleuten und Betrügern auf der Flucht. Wo in der Bar gelangweilte Ruhe herrscht, wie gemacht für träge Plaudereien. Für die, die es kennen: ganz ähnlich dem wattigen Flair im Gemeinschaftsraum psychiatrischer Kliniken. Oder dem in den Spionageromanen von Gérard de Villiers5.
Wir lernten uns in Maskat im Sultanat Oman kennen, und am selben Ort starb er auch, als wir dort unseren siebten Hochzeitstag feierten.
Beim Frühstück nach unserer ersten gemeinsamen Nacht schmierte er mir, ohne es zu wissen, einen Toast nach dem Bild meines Lieblingsgemäldes: ein Brotrechteck, zur Hälfte gleichmäßig bedeckt mit leuchtender Himbeermarmelade, auf einem Streifen der verbliebenen Fläche Butter ohne alles und dann Orangenkonfitüre bis zum Rand: White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) von Rothko. Unglaublich, oder?
Indem ich ihn heiratete, so dachte ich, würde ich für immer in Liebe und Unbeschwertheit baden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich im Leben etwas so Grässliches ereignen könnte wie eine Aneurysmaruptur mitten in einem Lachkrampf. So starb er mit vierunddreißig Jahren, während er mir im Hyatt von Maskat gegenübersaß.
Was ich empfand, als ich ihn mit dem Kopf in seinen Salatteller kippen sah, war unbeschreiblicher Schmerz. Als hätte man mir einen Apfelausstecher in den Leib gerammt, um meine Seele im Ganzen herauszureißen. Ich wäre am liebsten geflüchtet oder im Dämmer einer barmherzigen Ohnmacht versunken, aber nein, ich saß wie festgenagelt auf meinem Stuhl, die Gabel in der Luft, umgeben von Leuten, die in aller Ruhe weiteraßen.
In diesem Moment … nicht eine Sekunde früher, nein, genau in diesem Moment verwandelte sich mein Leben in eine einzige große Scheiße.
Es ging gleich rasant los mit stundenlangem Warten in einem unfassbaren Kommissariat, umgeben von Koffern und mit zwei kleinen Mädchen, die vor Hitze durchdrehten, unter den durchdringenden und überheblichen Blicken der Polizisten des Sultanats. Noch heute habe ich nachts Albträume davon: Ich klammere mich an meinen Reisepass, beruhige so gut ich kann meine verdurstenden Töchter und reagiere nur mit einem schwachen Lächeln auf die demütigenden Bemerkungen, die ich eigentlich nicht verstehen soll, wo ich doch fließend Arabisch spreche.
Da die Überführung des Leichnams zu kompliziert war, erteilte mir ein herablassender Beamter schließlich die Erlaubnis, ihn auf dem Petroleum Cemetery zu bestatten, dem einzigen Friedhof der Region, der Kuffar – Ungläubige – akzeptiert, wofür er unsere EC-Karte mit einer exorbitanten Summe belastete.
So passiert es, dass man im Alter von siebenundzwanzig Jahren mit einem Neugeborenen und einem zweijährigen Mädchen dasteht, allein, ohne Einkommen, ohne Dach über dem Kopf, denn es verging kaum ein Monat, da flogen wir aus unserer schönen Wohnung mit Seine-Blick in der Rue Raynouard und unsere hübschen Möbel wurden verkauft. Was unseren Mercedes mit Lederausstattung angeht … tja, der bucklige alte mehrfach verurteilte Erotomane, den mein Mann als Chauffeur beschäftigte, zischte einfach damit ab und ließ meine Töchter und mich vor dem Notariat stehen.
Bei diesem Tempo gab mein Verstand bald den Geist auf. Ich hatte ohnehin schon die Neigung, Selbstgespräche zu führen und Blumen zu essen, aber eines Nachmittags verließ ich, von Kopf bis Fuß in neue Klamotten gekleidet, wie eine Schlafwandlerin die Céline-Filiale in der Rue François Ier und quakte in die Runde Auf Wiedersehen, ich zahle später!, als zwei arme schwarze Wachmänner mit Knopf im Ohr sich auf der Türschwelle auf mich stürzten. Ich schlug auf sie ein und biss sie bis aufs Blut und man verfrachtete mich schnurstracks in die Klapse.
Meine acht Monate bei den Irren verbrachte ich damit, auf mein vorheriges Leben zurückzublicken wie eine Schiffbrüchige, die unablässig aufs Meer schaut, während sie auf Rettung wartet. Man verlangte von mir, dass ich mir meine Trauer aus dem Kopf schlug, als handelte es sich um eine Krankheit, von der ich um jeden Preis genesen musste, aber ich schaffte es nicht.
Meine zwei kleinen Töchter, zu jung, um die geringste Erinnerung an ihren wundervollen Vater zu haben, zwangen mich, mich meiner neuen Existenz zu stellen. Blieb mir überhaupt eine Wahl? Ich zählte die Tage, dann die Monate, die mich vom Tod meines Mannes trennten, und eines Tages hörte ich, ohne es zu merken, mit Zählen auf.
Ich war zu einer neuen Frau geworden, reif, traurig und streitlustig. Ein unpaariges Wesen, eine Socke ohne Gegenstück: die Witwe Portefeux.
Ich trennte mich von dem, was mir von meiner Vergangenheit geblieben war … meinem riesigen Paraíba-Turbalin-Cabochon, meinem rosenfarbenen Padparadscha-Saphir, meinem kleinen Du-und-ich-Ring in peppigem Blau und Pink und von meinem Feueropal … all diesen Farben, die mich seit Kindesbeinen begleitet hatten … Ich veräußerte alles, um eine trostlose kleine Drei-Zimmer-Wohnung in Paris-Belleville zu kaufen, mit Blick in einen Hof, der zu einem weiteren Hof führt. Ein Loch, in dem tagsüber Nacht herrscht und wo es keine Farben gibt. Das ganze Gebäude passte dazu: ein alter Sozialwohnungsbau aus den Zwanzigern, roter Backstein und schlechte Ausstattung, zunehmend von Chinesen bevölkert, die sich den lieben langen Tag von einem Stockwerk zum anderen anbrüllten.
Und dann suchte ich mir Arbeit. Ach ja, die Arbeit … ich persönlich hatte keine Vorstellung, was das sein soll, bis mich ein bösartiges Geschick aus dem Cast von Die 26 vertrieb … Und da ich nichts anzubieten hatte außer einer Expertise in Betrug aller Art und einem Doktortitel in arabischen Sprachen, wurde ich Übersetzerin und Dolmetscherin bei Gericht.
Nach einer solchen materiellen Talfahrt konnte ich nicht anders als meine Töchter in hysterischer Angst vor dem sozialen Abstieg großziehen. Ich zahlte überteuerte Schulen, schrie sie an, wenn sie eine schlechte Note hatten, ein Loch in ihrer Jeans oder fettige Haare. Ich gebe es ungeniert zu, ich war eine verhärmte und absolut nicht nette Mutter.
Nach ihren brillanten Uniabschlüssen sind meine beiden gelehrten Töchter derzeit Arbeiterinnen im Dienstleistungssektor. Ich habe nicht richtig begriffen, worin ihre Tätigkeiten bestehen; sie haben einige Versuche unternommen, es mir zu erklären, aber ich muss gestehen, dass ich abgeschaltet habe, ehe ich es kapierte. Sagen wir, es handelt sich um diese Scheißjobs, bei denen man vor einem Computerbildschirm dahinvegetiert, um Dinge herzustellen, die nicht wirklich existieren und der Welt keinerlei Mehrwert bringen. Ihre berufliche Karriere entspricht dem Rap von Orelsan: Keine feste Arbeit, egal wer du bist, nicht mal mit Abi und Doktorhut, mein Pizzabote ist Satellitenspezialist!
Wie auch immer, ich bin stolz auf sie, und wenn sie Hunger leiden müssten, würde ich mir beide Arme ausreißen, um ihnen etwas zu essen zu geben. Aber seien wir ehrlich, ansonsten haben wir uns nicht viel zu sagen. Ich werde also nicht weiter darüber reden, höchstens um zu verkünden, dass ich sie liebe, meine Töchter. Dass sie wundervoll sind, anständig, und ihr Schicksal stets ohne Aufmucken akzeptiert haben. Da das auf mich nie zutraf, wird die Abenteurerlinie unserer Familie mit mir aussterben.
Der Auktionator, zu dem es meine sämtlichen Ringe verschlagen hatte, als ich von den Irren zurückkam – Verkauf der Schmuckschatulle von Mme P., einer anspruchsvollen Sammlerin