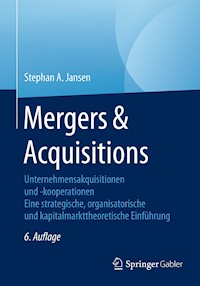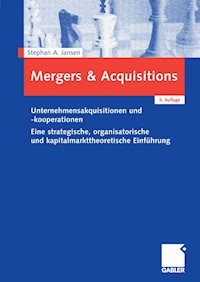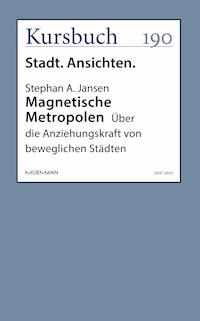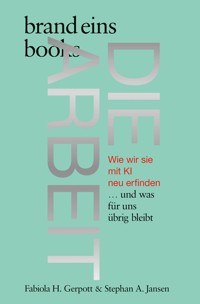
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie wird sich die Arbeitswelt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz verändern? Wer arbeitet was warum, wie und wie lange mit wem? Wie bilden wir uns – um, weiter, weiter? Wie führt man in der neuen Arbeitsteilung? Werden wie Cyborgs, Zentauren oder doch humanistische Künstler? Das Buch bietet profunde wie provokative Sichtweisen auf das Verhältnis zwischen dem Menschen und seinen neuen Maschinen – für andere Arbeit, andere Arbeitsteilungen, andere Führung und andere Bildung. Neben Studien aus der Wissenschaft bietet das Buch konkrete Handlungsempfehlungen für ein neues «Human Machine Resource Management», das nicht nur das Personalmanagement, sondern jeder von uns zu einer anregenderen und sinnstiftenderen Arbeit nutzen kann. Und es lädt dazu ein, an der Zukunft der Arbeit aktiv mitzuarbeiten. Zentrale Themen sind unter anderem die ethischen Implikationen, wenn Entscheidungen an Maschinen delegiert werden, die Auswirkungen auf die Diversität und Leistungsfähigkeit der Belegschaft sowie die Neugestaltung von Arbeitsräumen und HR-Prozessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fabiola H. Gerpott • Stephan A. Jansen
Die Arbeit
Wie wir sie mit KI neu erfinden … und was für uns übrig bleibt
Über dieses Buch
Wie wird sich die Arbeitswelt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz verändern? Wer arbeitet was warum, wie und wie lange mit wem? Wie bilden wir uns – um, weiter, weiter? Wie führt man in der neuen Arbeitsteilung? Werden wir Cyborgs, Zentauren oder doch humanistische Künstler?
Das Buch bietet profunde wie provokative Sichtweisen auf das Verhältnis zwischen dem Menschen und seinen neuen Maschinen – für andere Arbeit, andere Arbeitsteilungen, andere Führung und andere Bildung. Neben Studien aus der Wissenschaft bietet das Buch konkrete Handlungsempfehlungen für ein neues «Human Machine Resource Management», das nicht nur das Personalmanagement, sondern jeder von uns zu einer anregenderen und sinnstiftenderen Arbeit nutzen kann. Und es lädt dazu ein, an der Zukunft der Arbeit aktiv mitzuarbeiten.
Zentrale Themen sind unter anderem die ethischen Implikationen, wenn Entscheidungen an Maschinen delegiert werden, die Auswirkungen auf die Diversität und Leistungsfähigkeit der Belegschaft sowie die Neugestaltung von Arbeitsräumen und HR-Prozessen.
Vita
Fabiola H. Gerpott ist Professorin für Personalführung an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf und gehört zum Redaktionsausschuss der international renommierten Zeitschrift für Führungsforschung The Leadership Quarterly. Sie äußert sich regelmäßig zu aktuellen Führungsthemen in Podcasts und Personalmagazinen und wurde für diese Arbeit als einer der 40 führenden HR-Köpfe ausgezeichnet.
Stephan A. Jansen ist Professor für Management, Innovation & Finanzen sowie Direktor des Center for Philanthropy & Civil Society | PhiCS an der Karlshochschule/Karlsruhe, ist Gründungskoordinator des Digital Urban Center for Health & Aging (DUCAH) und wurde für die Stiftungsprofessur für Urbane Innovation an die UdK in Berlin berufen. Seit 2008 betreut er die Kolumne «Fragen an Stephan A. Jansen» beim Magazin brand eins. Er ist Autor von über 20 Büchern.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2025
Copyright © 2024 by brand eins Verlag Verwaltungs GmbH, Hamburg
Lektorat Gabriele Fischer, Holger Volland
Faktencheck Katja Ploch
Projektmanagement Hendrik Hellige
Covergestaltung Mike Meiré/Meiré und Meiré
ISBN 978-3-644-02379-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Computer sind absolut nutzlos. Sie können nur Antworten geben.»
Pablo Picasso (1946)
EinleitungWarum ist bei künstlicher Intelligenz immer alles 1 oder 0, schwarz oder weiß?
Das wissen wir auch nicht, aber vielleicht ist gerade deshalb dieses Buch wie das Leben: bunter – also differenzierender, sortierender, fragender, mit schwarzem Humor und Wissenschaft. Die Themen werden noch schwer genug, warum nicht launig-leicht einsteigen?
Mr. Vain und Mr. Vinge
1993: Dieses Internet hat gerade mit den ersten Webbrowsern die Tür für alle aufgemacht. Bescheidenheit ist nun wirklich fehl am Platz. In deutschen Radios läuft der Song «Mr. Vain» von der deutschen Eurodance-Formation Culture Beat rauf und runter. Ein Ohrwurm über einen egozentrischen Selbstdarsteller, der davon überzeugt ist, dass alle auf einen Mann wie ihn hoffen. Der Ton ist gesetzt.
Zur gleichen Zeit – im Land der unbegrenzten Möglichkeiten – tritt ein Mr. Vinge auf. Nicht an das DJ-, sondern an das Redner-Pult bei einem Symposion der NASA zur Zukunftsforschung: Es hatte wohl keiner auf ihn gewartet, zu bescheiden, zu zahlenlastig. Aber auch er war von etwas sehr überzeugt: Wir haben nicht mehr zu viel zu hoffen – und brauchen genau deshalb Hoffnung. Der Ton sitzt.
Vernor Vinge, Mathematiker und Informatikprofessor, ist nicht nur ein begabter Zahlenjongleur, sondern auch ein beherzter Zukunftsprophet im Eldorado der Technikoptimisten – Woodstock-Feeling im World Wide Web. In seinem Vortrag malte er 1993 ein Bild von einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz (KI) so weit fortgeschritten ist, dass sie menschliche Intelligenz übertrifft und unsere Welt in einer Weise transformiert, wie wir es uns kaum vorstellen können. Er erinnerte an die Hypothese der Singularität, nach der eine kleine Ursache eine große Wirkung hervorruft, und er prophezeite: «Within thirty years, we will have the technological means to create superhuman intelligence. Shortly after, the human era will be ended.» [1]
Gekommen, um zu bleiben
Schnellvorlauf zum heutigen Tag: Wir Menschen sind noch immer da – und schreiben noch immer darüber, dass es wild und gefährlich wird …
Der Zickzackkurs zwischen Utopien und Dystopien, zwischen Hypes und Hysterie ist menschlich – wir spüren uns so besser. Zudem leben Medien davon, und Wissenschaft hat was zum Wundern. Aber ist nach dem ChatGPT-Moment wirklich etwas anders? Warnen die Entwickler ernsthaft, oder ist das Marketing? Geht uns jetzt doch die Arbeit aus, wie bei jeder neuen Technik prognostiziert wird? Bleibt noch was übrig für uns Homo sapiens nach all den Kränkungen des Verlierens gegen Maschinen? Die neuen Maschinen – von Bots bis KI – befeuern alte Debatten zwischen Wissenschaft und Science-Fiction der 50er-Jahre.
Was bleibt nun übrig von der Arbeit?
Es wäre – algorithmisch berechnet – vermutlich ökonomischer, wir legten Ihnen hier eine Warnschrift über die nun noch sinnentleertere Arbeit in einer kafkaesken 4.0-Welt vor oder zeigten gleich die menschenentleerten Büros nach den menschenentleerten Fabriken des vergangenen Jahrhunderts. Oder wir liefern in einer bald KI-optimierten Buchmarktmaschine ein Erleuchtungsbuch über die Rettung der Welt durch KI-Lösungen für Gesundheit, Bildung und Klimaschutz. Beide Perspektiven sind allerdings bereits gut bearbeitet.
Noch besser wäre es natürlich, wenn wir – wie unsere Freunde und Kolleginnen echt witzig vorschlugen – das Buch gleich von einem Chatbot schreiben ließen. Wäre weniger Arbeit. Aber sie merken schon, nichts für uns.
KI von A bis Z – von Alarmismus bis Zuversicht
Unser bescheidener Anspruch ist es, einen leicht verständlichen und wissenschaftlich belegten Raum zwischen Wissen und Noch-nicht-Wissen aufzumachen und daraus ein «Humanistisches Manifest der Arbeit an der Arbeit» zu entwickeln. Wir nennen das als Arbeitstitel «Human Machine Resource Management (HMRM)». Damit Personaler, ITler und alle dazwischen und außerhalb wissen – es geht nur noch zusammen.
Unsere Zuversicht speist sich unter anderem aus der Arbeit des österreichisch-amerikanischen KI-Pioniers, Kybernetikers und Maschinendenkers Heinz von Foerster zur Entscheidungstheorie [2]: «Nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, können wir entscheiden.» Das ist eine Basis.
Bei der Gelegenheit danke für Ihre Entscheidung, dieses Buch zu beginnen. Denn KI und Personalarbeit – das klingt nicht unbedingt nach Nervenkitzel. In einer Forsa-Umfrage aus dem Herbst 2024 sind sich Deutsche über alle Einkommensklassen hinweg einig: 9 Prozent der Befragten befürworten den Einsatz von KI in der Personalauswahl. 80 Prozent nicht. [3] In Uni-Seminaren sagen wir dazu: aufrichtiges Desinteresse.
Allerdings: Die KI kommt nicht zur Arbeit, sie ist schon da. Wo Unternehmen mit Blick auf Datenschutzbedenken und Datenerhebungsprobleme noch berechtigt abwarten, sind Mitarbeitende schon im «BYOAI-Modus» (Bring your own AI). Im Frühjahr 2024 befragten Microsoft und LinkedIn 31000 Beschäftigte der Wissensindustrie in 31 Ländern und werteten dazu die Produktivitätsdaten aus Microsoft 365 sowie Forschungsdaten von Fortune-500-Unternehmen aus. Das Ergebnis: 78 Prozent der Wissensarbeiter nutzten KI im Arbeitsalltag – und zwar in Eigenregie. [4]
Sie bekommen mit diesem Buch in alter DJ-Manier hoffentlich ein gutes Set, von Schlager bis Breakbeat und Drum ’n’ Bass, aber immer mit der Einladung zum Tanz – auch gern Tango, geht nur zusammen. Und in dieser Hybrid-Logik finden Sie zum Buchabschluss außerdem für den Quellen-Review (QR) den einschlägigen QR-Code, mit dem Sie auf unser lebendiges Literaturverzeichnis und weitere Inhalte zugreifen können.
Machen wir uns an die Arbeit!
«Don’t believe the hype.»
Song von Public Enemy
But: «Don’t believe the catastrophe.»
Fabiola H. Gerpott & Stephan A. Jansen
1.Maschinen des Menschen
Magie, Macht, Mysterium
«Was also sollten wir unseren Enkeln raten? (…) Wir können sie entweder dazu drängen, nach technischen Lösungen für die vielfältigen, lebensbedrohlichen Risiken zu suchen, die ihnen die gegenwärtigen Technologien hinterlassen werden, oder sie dazu ermahnen, ihre Abhängigkeit von Maschinen zu verringern.» [5]
Robert Skidelsky, Polit-Ökonom
Revolutionen der Arbeit haben kein Startdatum
Faulheit und Findigkeit sind gute Geschwister. Seitdem der Mensch über Arbeit nachdenkt, arbeitet er an deren Vermeidung.
Er denkt dabei eigentlich weniger nach als vor – und diese Arbeit heißt Fortschritt, also Erfindungen, Werkzeuge und Maschinen zur Arbeitsentlastung. Produktivität ist nicht definiert als mehr Produkte aus der Arbeit, sondern auch durch Arbeitsvermeidung.
Die großen Anfänge entstanden immer durch Erfindungen, nicht durch Erfinder, wie einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jürgen Kaube in seinem Buch Die Anfänge von allem feststellt. [6] Denn wer hat die Nähnadel nochmals genau erfunden, das Rad oder den Agrarflug?
Wohl vor ein paar Millionen Jahren, als sich aus der Australopithecus-Gruppe die Gattung Homo bildete, entwickelten wir uns in 3G-Geschwindigkeit: Gesichtsschädel, Gebiss und Gehirngröße. Genau in diesem Übergang kann die Entstehung der Arbeit – also der körperlichen wie psychischen Anstrengung – als Lernen, Optimieren und Erfinden evolutionär vermutet werden. Die Nähnadel, das Rad, die Sprache wie auch Musik, Kunst, Religion, das Zählen, das Geld wie auch die heutige Landwirtschaft und Produktion, inklusive der menschengemachten Maschinen dafür – dies alles waren Revolutionen der Arbeit durch Arbeit, ohne den einen Erfinder und den einen Startzeitpunkt.
Kurze Zeitreise in die Maschinenzeitalter: Von Webstühlen zu Webshops
1829 hatte der Historiker Thomas Carlyle in seinem Text «Signs of the Times» [7] im Edinburgh Review das Maschinenzeitalter ausgerufen, das die «Grundfesten der Gesellschaft durch die Verinnerlichung mechanistischer Axiome» veränderte. Er definierte vier Elementen der «Zukunft der Arbeit»: 1. mechanisches Weltbild (von Gott aufgezogenes Uhrwerk), 2. neue Praxen der Künste wie des Gewerbes, 3. Arbeitsteilung und 4. Bürokratie.
1956 dachte man das zweite Maschinenzeitalter vor. Auf der Dartmouth Conference – bezahlt von der Rockefeller Foundation, die sich aus Gewinnen der Ölindustrie finanzierte – ahnten die Vorreiter: Daten sind das neue Öl der nächsten Maschinen, für Roboter wie Bots. Die sogenannte künstliche Intelligenz (KI) stolperte nun zwischen Frühlingsfreuden und winterlichen Abkühlungen. In den 2010er-Jahren wurde die sogenannte vierte industrielle Revolution ausgerufen, bevor sie eintrat. Und bevor sie tatsächlich revolutionäre Produktivitätsvorteile erzielen konnte; was sie bis heute nicht leistet. [8] Insbesondere in Europa fehlen dazu ernsthafte digitale Geschäftsmodelle, noch immer und immer mehr: In Europa halbierte sich der Anteil der weltweiten Plattformökonomie von vier Prozent im Jahr 2017 auf zwei Prozent im Jahr 2023. [9]
Der Übergang von den Webstühlen der Textilindustrie zu den Webshops des Online-Handels ging flott. Dann kam noch mehr Geschwindigkeit in die Revolution, und zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung gab es ein Startdatum:
30. November 2022. Wir hatten an dem Tag Seminar, besprachen gerade die Prüfungsleistung und erlebten das Gleiche wie beim ersten Internetbrowser und bei der Nutzung des iPhone von Apple: Es wird nun anders. Auch die Prüfung.
OpenAI hatte den Chatbot ChatGPT über eine einfache Web-App für alle zugänglich gemacht. Die sogenannte schwache KI kam nun mit stärkster Wucht in alle Maschinen. Seitdem arbeitet es in der Arbeitswelt mächtig. Personalabteilungen von privaten Wirtschaftsorganisationen bis zu öffentlichen Verwaltungen machen Überstunden und Weiterbildungen, suchen neue Fachkräfte, planen Entlassungen und Umschulungen für die nächste Arbeit. Für die Arbeit, die nach der KI und empathischer Robotik übrig bleiben könnte.
Und manche denken weiter über die nächsten Hoffnungen und Hypes der Technologieoptimisten nach – vom industriellen Metaverse über Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen des Web 3.0 bis hin zu sogenannten Brain-Machine-Interface-Technologien. Und hoffen, dass mentale Gesundheit, Zeitwohlstand, Achtsamkeit und Feelgood-Management irgendwann doch Realität werden.
Welche Arbeit bleibt übrig, und welche Arbeit ist für diese Transformation jetzt notwendig?
Zu viel Arbeit für zu wenige Menschen und Maschinen?
Die Geschichte der Zukunft arbeitet, wie wir durch den Bielefelder Geschichtswissenschaftler Joachim Radkau wissen, mit geistesgegenwärtigem Ruhepuls: Zukunft haben wir uns schon immer schlimmer und schöner vorgestellt, als sie dann war. Sie verhinderte sich durch Apokalypse- und Realismus-Checks selbst. So wohl auch hier.
Konkret: Arbeit ist – wie in allen Revolutionen zuvor – weiterhin da. Mal verändert, mal ganz anders, mal weiterbildungsintensiv. Und dies vor allem in Deutschland und allen wirtschaftlich entwickelten und alternden Nationen.
Warum? Wir sind zukünftig zu wenig und arbeiten bereits heute zu wenig für das Wohlstands- und Wohlfahrtsniveau, das wir gewohnt sind. Aktuell hat die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland mit rund 47 Millionen ihren absoluten Höhepunkt erreicht. 2060 wird die Zahl – ohne Zuwanderung – auf rund 30 Millionen schrumpfen. Das ist eine einfache Rechnung, wenn der Gesundheitsfortschritt bleibt, ebenso wie das Renteneintrittsalter.