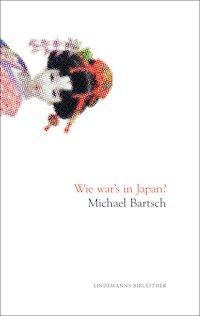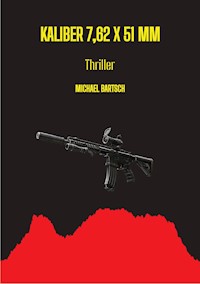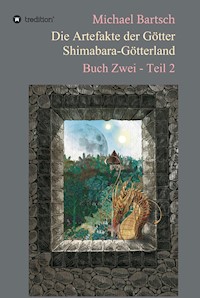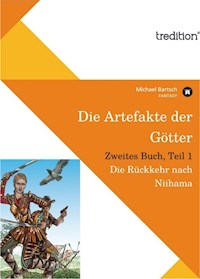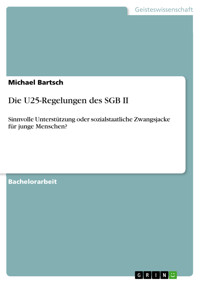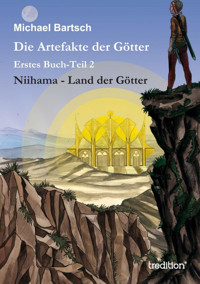
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf dem Weg zur Heimstätte des Gottes Svanson müssen Reneé Förster und ihre Gefährten viele Gefahren überstehen. Bei Kämpfen gegen die Alte Rasse, die Tohopka, bei Reneés Gefangennahme durch die Landsknechte, beim Überfall durch gedungene Meuchelmörder und bei einer weiteren Begegnung und Kampf gegen die Akatsukis, gelingt es ihnen immer wieder dem Tode zu entkommen, wenn auch manchmal nur knapp. Sie finden neue Kampfgefährten, eine Ninja, die Tochter eines Gottes und ein Rittmeister schließen sich ihnen auf ihrer Reise an. Die Begegnung mit taoistischen Mönchen und Tai-Chi helfen Reneé, ihre körperlichen und seelischen Verletzungen zu überstehen. Sie treffen auf Gott Svansons Beobachter, nämlich die Raben Hugin, Munin, Frigga und Gritha. Ein erneuter Kampf gegen die Harpyien von Königin Antiope bringt sie an den Rand des Todes. Selbst die Gefahren durch den übernatürlichen Schutz, der von Gott Svanson erschaffen wurde, können die Gefährten von ihrem Ziel, die Heimstätte Svansons zu erreichen, nicht abbringen. Kann Reneé dort ihren Vater endlich in die Arme schließen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Niihama - Land der Götter
Meiner Familie und allen Freunden danke ich für die aufmunternde Unterstützung. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle meinen Lektor und Freund Karl-Heinz Hemmersbach, der sich mit der 2. Auflage sehr viel ‚Mühe‘ bei der Überarbeitung meiner Zeilen gab. Ich danke ihm und natürlich seiner Frau, die Mithalf;
Michael Bartsch
Die Artefakte der Götter
Erstes Buch Teil 2
„Niihama - Land der Götter“
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 2. Auflage Autor: Michael Bartsch Verlag: tredition GmbHwww.tredition.de ISBN: 978-3-8495-3857-6
Lektor: Karl-Heinz Hemmersbach Covergestaltung und
Inhaltsverzeichnis
Was bisher geschah
I. Folter und Tod
II. Teezeremonie und Samurai
III. Böses Erwachen und Tai Chi
IV. Mythische Monster
V. Das Ziel
VI. Epilog
VII. Anmerkungen
Niihama - Land der Götter
Was bisher geschah…
Das Findelkind Reneé wird von Rosie und Harald Förster liebevoll aufgezogen. Nach dem Tode der Zieheltern wohnt sie in Garmisch-Partenkirchen. Sie ist finanziell unabhängig und sportlich sehr aktiv. Seit frühester Jugend ist sie fasziniert von den fernöstlichen Kampfsportarten und hat unter anderem auch die Schwertkampftechnik mit zwei Schwertern im klassischen Niten ichi ryu-Stil erlernt.
Eines Tages erhält Reneé einen Brief aus Neuseeland. Der Absender, das Notariat Huber & Costner, ist ihr nicht bekannt. Ihr wird mitgeteilt, dass ihr leiblicher Vater, David Copeland, sie in seinem Testament als Erbin eingesetzt hat.
Sie fliegt nach Auckland und lernt dort die VersicherungsDetektivin Lucy Rowland kennen, die auf der Suche nach gestohlenen Antiquitäten ist. Unter anderem sucht sie zwei kostbare Langschwerter, das Aku Ryou Taisan und das Ryouko maru. Reneés Vater und sein langjähriger Vertrauter Marc Dacasyi werden verdächtigt, in diese Diebstähle verwickelt zu sein. Marc Dacasyi wurde ebenfalls in dem Testament bedacht. Nach der Testamentseröffnung weist Reneé die Avancen des Notars Hal Costner zurück. Sie lernt Marc Dacasyi näher kennen. Als er ihr von ihrem Vater und ihrer Mutter erzählt, beschließt sie ihm zu vertrauen.
Bei einem Überfall vor ihrem Hotel, kommt ihr Lucy Rowland zu Hilfe. Unter den Verbrechern erkennt Reneé den Notar Hal Costner. Bei der Schießerei wird einer der Gangster von seinen eigenen Leuten erschossen. Lucy schafft es die Verbrecher zu verjagen. Von einem verletzten Gangster erfährt Reneé, dass ihr Vater im Besitz eines antiken Artefaktes, einem Gargoyl sein soll.
Lucy und Reneé flüchten zu Marc Dacasyi in das AntiquitätenLager. Dort findet Lucy die gestohlenen Schwerter. Bevor Marc ihr das erklären kann, werden sie von Karl Urbansky und seiner Gangsterbande überfallen.
Beim Kampf erschießt Lucy den Banditen und Notar Hal Costner, wird selber aber auch verwundet. Bevor sie von den Gangstern überwältigt werden, öffnet Marc mit Hilfe des Artefaktes ein Portal zu einem fremden Planeten. Ehe Urbansky und seine Männer ihnen folgen können, schließt sich das Tor.
So entkommen sie auf die Ebene und Lucy erholt sich dort von ihrer Schusswunde. Marc erklärt ihnen, dass sie sich auf einer künstlich geschaffenen Welt befinden, die Niihama heißt. Reneés Vater hat diese Ebene erschaffen. Er wird von den Bewohnern ihrer Zuflucht ‚Gott Svanson‘ genannt.
Marc Dacasyi’s richtiger Name ist Yagyu Kissaki Kenshi. Er war ein Schüler des Schwertkampflehrers Miamoto Mushashi. Kenshi wurde im Alter von 25 Jahren, mit anderen Menschen aus der Gegend von Shimosuwa am Suwa-See, im Jahre 1638 von Gott Svanson auf die Ebene Niihama gebracht. Marc berichtet, dass Reneés leibliche Mutter Alexandra Copeland sich auf Niihama versteckt hält.
Sie lebt beim Indianerstamm der Choctaw, der sie als die „Frau unseres Gottes“ verehrt. Gott Annas, Svanson’s Schwester, leistet ihr Gesellschaft.
Auf der Ankunftsstelle entdecken sie, dass die Wächter getötete wurden. Marc stellt fest, dass Akatsuki, die Todfeinde aller Götter und Menschen, auf der Ebene eingefallen sind. Zusammen machen sie sich auf den Weg zu Gott Svanson’s Heimstätte, die sich auf dem Berg Chochokpi befindet. Denn nur von dort aus können Reneé und Lucy wieder zur Erde zurückkehren.
Auf dem Weg zum Dorf der Choctaw’s tötet Reneé eine Riesenschlange. Danach treffen sie auf eine Gruppe Choctaw-Indianer; die Anführer wollen sie auf ihre Reise ein Stück begleiten. Sie überleben ein schweres Unwetter und geraten danach in einen Kampf mit der Harpyien-Königin Antiope.
Auf der Weiterreise erfahren sie, dass das Choctaw-Dorf von Cherokee-Indianern überfallen wurde. Dabei wurden Reneés Mutter Alexandra und ihre Tante Annas, zusammen mit der Häuptlingstochter Nadowessiu verschleppt. Unter Marcs Führung wollen sie und einige Choctawkrieger die Entführten befreien. Auf dem Weg dahin werden sie von Zentauren überfallen. Die Freunde, aber nur zwei der Choctawkrieger, überleben mit Mühe und Not den Kampf.
Als sie die Cherokee-Ansiedlung erreichen, in der Häuptling Towo’di die Gefangen festhält, müssen sie mit ansehen, wie die Akatsuki das Dorf mit der Strahlenkanone ihres Flugbootes vernichten. Lucy schießt mit ihrem Langbogen auf das Flugboot und bringt es zum Absturz. In letzter Sekunde, bevor sie in den Flammen umkommen, befreien sie Annas, Alexandra und die Häuptlingstochter Nadowessiu.
Nach der Befreiung suchen sie in einer Höhle Schutz vor dem nächsten Unwetter. Sie erholen sich von den Strapazen und Reneé lernt endlich ihre Mutter kennen. Danach machen sie sich auf den Weg zur Heimstätte. Die Häuptlingstochter begleitet sie.
Unterwegs wird Reneés Mutter bei einem erneuten Kampf gegen die Harpyien getötet. Auch Reneé wird dabei schwer verletzt. Nach ihrer Genesung reiten sie zur Burg des Ordensritters Albrecht von Brandenburg. Dort lernen sie die Tochter des Gottes Lookken kennen. Kristanna, genannt Göndül, die Wölfin, ist eine der wenigen Vertrauten von Reneés Vater.
Während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes in der Burg verliebt sich Reneé unsterblich in den Hausherren. Der Hausherr Albrecht von Brandenburg gibt sich als Vertrauter ihres Vaters zu erkennen. Er ist schon lange in Reneé verliebt und bittet sie um ihre Hand. Sie nimmt den Heiratsantrag an, aber vorher will sie noch ihren Vater finden. Reneé muss einen Tjost auf Leben und Tod ausfechten, den sie gewinnt.
Lucy und Reneé machen einen Ausritt und können dabei eine Karawane vor einer Horde Zentauren retten. In der Burg überstehen Reneé, Albrecht und Marc mit viel Glück den Überfall eines Meuchelmörders, eines Shinobi.
Tage später werden Albrecht und Reneé, als sie zur Besichtigung der Burg Krähenhorst reiten, von Akatsuki angehalten. Sie fordern von Albrecht seine Gefolgschaft ein; zum Schein geht er auf ihre Forderung ein. Daraufhin wird er von ihnen mit einer Tätowierung am Arm gekennzeichnet.
Nach drei Wochen verlassen die Freunde wieder Albrechts Burg um zum Suwa-See zu reiten.
***
Gevatter Tod
In Gedanken spuken bleiche Gespenster, ob’s mich fürchtet? Sie schreien und jammern, pochen ans Fenster. Ich öffne das Tor einen Spalt, mich schaudert’s, im Hintergrund ein grausliches Gefunkel,
I. Folter und Tod
Bevor wir aufbrachen, hatte uns Marc den Weg zum Suwa-See beschrieben. Anschließend sagte er optimistisch: „Wenn wir Glück haben, kommen wir so ungesehen an den deutsch-schwedischen Landsknechten des Capitain Grothusen vorbei. Denn ich bin nicht erpicht darauf, mit diesem unberechenbaren Zeitgenossen zusammenzutreffen. Vor allem dann nicht, wenn die Brieftaube, die der Landsknecht vor seiner Ergreifung noch losschicken konnte, für ihn bestimmt war!“ Sein Blick sprach Bände, als er mich dabei anschaute.
Zögernd, wegen der unausgesprochenen Konsequenzen, musterte ich ihn mit schmalen Augen. Dann schürzte ich bewusst abschätzig die Lippen und entgegnete leger: „Der wird uns auch nicht aufhalten können!“ Und irgendwie war ich von meinen Worten im Unterbewusstsein auch fest überzeugt.
Ergeben nickte Marc und stimmte mir zu. Während Lucy mir zustimmend auf die Schulter klopfte, blickte Annas dagegen ziemlich skeptisch drein. In der Hoffnung diesmal ohne Schwierigkeiten unser Ziel zu erreichen, verließen wir zuversichtlich die Burg. Die Hufe unserer Pferde klapperten auf dem Kopfsteinpflaster des Burghofes. Wir waren auf dem Weg zum nächsten Etappenziel, zu Marcs Onkel und Tante.
In den drei Wochen auf der Burg hatte ich meine ‚Wunden‘ geleckt, seien sie seelischer oder körperlicher Art gewesen. Die Trauer um meine Mutter hatte ich tief in mein Innerstes verbannt. Albrecht hatte mir dabei mit seiner Liebe dabei geholfen. Die Bilder vom gestrigen Abend gingen mir noch einmal durch den Kopf. Wir hatten uns in dieser letzten Nacht bis zur Erschöpfung geliebt. Ich sah sein enttäuschtes Gesicht wieder vor mir, als ich ihm sagte, dass ich erst meinen Vater suchen wolle. Aber er sagte mir trotzdem, dass er mein Handeln verstehe.
Ich spürte noch immer seine liebkosenden Hände, als sie forschend meinen erhitzten Körper erkundeten. Wie er mich mit ihnen von einem Höhepunkt zum nächsten leitete. So eine ekstatische Liebe hatte ich noch nie zuvor erfahren. Bei diesen Erinnerungen hätte ich meinen Entschluss, meinen Vater zu suchen, fast wieder revidiert. Es kostete mich meine ganze Willenskraft, die Reise fortzusetzen anstatt sofort umzudrehen um bei ihm zu bleiben.
Dumpf polterten die Hufe über die hölzerne Zugbrücke, die den Burggraben überspannte. Ich drehte mich nochmals um und sah Albrecht mit wehenden schwarzen Haaren auf dem Bergfried stehen. Er hob nur kurz grüßend seine Hand, dann verschwand er im Turm.
Von meinen Zweifeln ahnte keiner meiner Gefährten etwas. Ich blickte seufzend auf Lucys Rücken, die vor mir ritt. Dabei murmelte ich: „Wer weiß, für was das alles gut sein wird.“ Ich folgte meinen Gefährten und zog unser Packpferd hinter mir her.
Im großen Bogen ritten wir in das ‚Freie Land‘ zurück. Später bogen wir auf die Karawanenstraße ab, die zum Suwa-See führte. Anfangs leitete sie uns durch eine grüne Hügellandschaft mit sanften Rundungen. Die Grasebenen, die Heidegewächse, die größeren Findlinge die überall lagen, die vereinzelt stehende Ebereschen und Eichen, all das erinnerte mich stark an die Highlands.
Immer wieder ließ ich meine Augen suchend umherschweifen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass uns jemand verfolgte. Diese Befürchtung teilte ich meinen Gefährten mit. Aber auch mit unserer gemeinsamen Aufmerksamkeit konnten wir keinen Verfolger ausmachen.
Wir ritten eine der vielen leichten Anhöhen empor, als plötzlich über der Hügelkuppe Rauchwolken hochstiegen und Brandgeruch uns um die Nasen wehte. Wir zogen unsere Katanas. Lucy nahm den Langbogen aus der Hülle und zerrte einen Pfeil aus dem Köcher. Vorsichtig ritten wir weiter hoch zum Gipfel; oben am Kamm zügelten wir die Pferde. Auf der abschüssigen Hangseite, in etwa zweihundert Meter Entfernung entdeckten wir eine Wagenburg.
Drei Planwagen waren umgestürzt und qualmten. Keine Menschenseele war zu sehen, selbst die obligatorischen Aasfresser ließen sich nicht blicken. Der wolkenlose, blaue Himmel über uns war wie leergefegt. Eine unheimliche Stille lastete über der Senke.
Mit mulmigem Gefühl schloss ich mich Marc an, der langsam den Hügel hinunter ritt. Annas folgte uns in einem etwas größeren Abstand. Währenddessen sicherte Lucy mit ihrem Bogen von der Hügelkuppe aus unseren Abstieg zur Unglücksstelle. Vorsichtig tasteten wir uns näher und behielten dabei ständig die Umgehung im Auge. Endlich erreichten wir die Wagen. Marc ritt wachsam durch eine Lücke zwischen zwei Wagen in den Verteidigungsring hinein.
Ich folgte ihm langsam; meinen Mustang lenkte ich nur mit den Schenkeln. Mein Katana hielt ich kampfbereit in der rechten Hand und meine Linke umklammerte den Griff der Saigabel. Annas zügelte außerhalb der Wagenburg ihren Mustang und beobachtete angespannt die Umgebung. Wir fanden weder Menschen noch Tiere. Selbst die Wagen waren leer, bis auf ein paar Scherben und mehrere zerfetzte Planen.
Ich führte mein Katana in die Saya zurück. Marc bedeutete Lucy, sie solle weiter auf ihrem Posten zu bleiben. Dann stieg er vom Pferd. Mit einem knappen Befehl trieb Annas ihren Mustang an und folgte uns vorsichtig durch die Lücke in die Wagenburg. Mit einem unbehaglichen Gefühl im Magen, ritt ich an Marc vorbei, bis zur Platzmitte, wo ich einen Ring aus schwarzen Steinen bemerkt hatte. In der Mitte des Kreises lag eine Steinplatte, deren Oberfläche mit rötlichen Flecken gesprenkelt war.
Ich stieg vom Mustang, um mir die Sache etwas genauer anzusehen. Marc folgte mir langsam zu Fuß und zog seinen Mustang am Zügel hinter sich her. Er schaute sich immer wieder argwöhnisch um.
Bestürzt rief er plötzlich: „Bleib stehen!“ Er packte mich an der Schulter, und zerrte mich ein Stück zurück. Erstaunt schüttelte ich seine Hand ab und schaute ihn fragend an. Mit finsterer Miene erklärte er: „Das sieht aus wie ein Hitomi gokū“. Noch bevor ich ihn fragen konnte was das denn sei, murmelte er mit angespannt vibrierender Stimme: „Ein Stein für Menschenopfer.“
Entsetzt riss ich die Augen auf und deutete auf die Steinplatte: „Menschenopfer?“ Mein Magen verhärtete sich wie ein Mühlstein; die Knie begannen zu zittern. Ich stöhnte geschockt: „Willst du damit sagen, dass die Leute des Wagenzuges darauf geopfert wurden?“
„Ich weiß es nicht, aber wir sollten schnellstens von hier verschwinden. Die Luft ist wahrscheinlich noch mit dem Gift versetzt, das der Karawane zum Verhängnis wurde.“ Er drehte sich um und rief Annas zu: „Hitomi gokū!“
Hastig riss Annas ihr Pferd herum und floh in wildem Galopp aus der Wagenburg. Sie stob den Hang hinauf und hielt erst neben Lucy wieder an.
Immer noch starrte ich fassungslos auf den Opferstein. Urplötzlich kroch mir eine Gänsehaut über’s Kreuz. Ich roch zwar nichts, wollte aber Marcs Bemerkung nicht in Frage stellen. Beim Umdrehen fielen mir Ornamente auf, die jemand mit weißer Farbe auf einen Stein gepinselt hatte. Ich bückte mich, um sie genauer zu betrachten.
Marc hatte die Ornamente ebenfalls entdeckt und schüttelte wütend den Kopf: „Los komm!“ Er zog mich hoch und ich sträubte mich nicht dagegen. Wir sprangen auf unsere Pferde. Die scharrten schon unruhig mit den Hufen, so als würden sie etwas Unheimliches wittern. Ziemlich eilig verließen wir die Wagenburg. Erst als wir bei Lucy und Annas ankamen, zügelten wir die Pferde wieder.
Lucy überfiel uns mit einem erregten Wortschwall. Mit hochgezogenen Augenbrauen fragte sie: „Was ist los? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den Leibhaftigen gesehen! Und vor allem, wer oder was ist Hitomi gokü?“
Marc gab ihr die geforderte Erklärung; dabei beobachtete er unentwegt die Umgebung. Zum Schluss fügte er bitter hinzu: „Und die Ornamente, da auf dem Stein, sind dem Hitomi gokū-Clan des Ninja Sarutobi Sasuke zuzuordnen. Das ist ein ehemaliger Samurai, ein Mörder der mit Gift und ‘Schwarzer Magie’ auf Niihama sein Unwesen treibt. Außer vielen anderen Untaten, hält sein Clan auch Zeremonien mit Menschenopfern ab. Einige seiner Gefolgsleute nennen sich Shārénrúmá, was wortwörtlich ‚Menschen abschlachten‘ bedeutet.“
Zornig brach es aus Annas hinaus: „Bis jetzt konnte man ihm nicht beikommen! Selbst mein Bruder schaffte es bisher nicht, ihn aufzuspüren. Er zieht sich immer wieder in eine Bergregion am Öigawa-Fluß zurück. Dort kann er sich in vielen Höhlen verstecken.“
Lucy packte ihren Langbogen weg und presste angewidert zwischen den Lippen hervor: „Da wir den Unglücklichen da unten doch nicht mehr helfen können, sollten wir schnellstens von hier verschwinden.“
Ich nickte zustimmend. Froh, diesen gruseligen Ort zu verlassen, zog ich meinen Mustang herum und ritt los. Mit einem Blick über die Schulter überzeugte ich mich davon, dass meine Gefährten mir ohne lange zu zögern folgten. In den nächsten Stunden ritten wir angespannt und prüften immer wieder misstrauisch unsere Umgebung.
Erst gegen Nachmittag rasteten wir in einem kleinen Tal, in dessen Mitte, auf einer angeschütteten Anhöhe, dreizehn riesige Felsblöcke kreisförmig aufgestellt waren. Zwei mächtige Monolithen, auf deren Spitzen eine gewaltige Steinplatte lag, bildeten den Eingang.
Erstaunt betrachtete ich die Anlage. Sie erinnerte mich an das ehrfurchtgebietende Stonehenge in der Gegend um Salisbury. Egal, welche anderen Erklärungen es sonst noch für die fünftausend Jahre alte Kultstätte gab, diese prähistorische Anlage blieb für mich stets der Platz der Druiden und ihrer geheimnisvollen Rituale. Ein leichter Schauer lief mir den Rücken herab.
Die Lücken zwischen den Steinsäulen wurden von einer Art Ilexstrauch geschlossen, dessen rote Blüten in der Nachmittagssonne wie große Blutstropfen leuchteten. Die gezackten, sehr harten dunkelgrünen Blätter dieser Stechpalmenart, bildeten mit ihren langen Dornen einen schier undurchdringlichen Schutzwall. Die Zweige rankten sogar an den Steinsäulen empor. Die etwa drei Meter hohen Felsblöcke wachten wie riesige Wächter über der Landschaft. In der Mitte des Steinkreises waren kleinere Felsquader um einen von Menschenhand behauenen Granitblock gruppiert, der vermutlich einen überdimensionalen Thron darstellte.
Wir waren froh, dass wir ohne weitere Vorkommnisse, diesen anscheinend sicheren Lagerplatz endlich erreicht hatten. An den kleinen Büschen, die in der Anlage wuchsen, banden wir unsere Pferde an. Die rotgelbfarbigen Blütenkelche verströmten einen zarten Geruch, der leicht nach frischen Trauben duftete. Im Gegensatz zu unserer letzten Station, verbreitete dieser Ort eine friedliche Atmosphäre.
Während meine Gefährten sich auf den Steinquadern ausruhten, kletterte ich auf den riesigen Thron. Von dort aus bot sich mir, zwischen den Steinwächtern hindurch, ein herrlicher Ausblick auf die sich vor uns ausbreitende Landschaft. Linker Hand entdeckte ich, von hohem Buschwerk halb verdeckt, eine kleine Burg.
Bevor ich danach fragen konnte, erzählte Marc: „Diese Altarstätte hier wurde in der Zeit etwa so um 1307 bis 1311, von dem französischen Tempelherrn Jakob Molay errichtet. Der hatte in der realen Welt ziemlich großen Ärger mit dem französischen König Philipp IV. Irgendwann verschwanden er und seine vierundfünfzig Ordensritter. Sie wurden nie mehr gesehen. Nicht weit von hier besaß er eine kleine Burg. Reneé, von deinem Platz aus kannst du sie vielleicht sehen.“
Während ich wieder vom Sitz herunter stieg, erzählte Marc weiter: „Seitdem steht das Anwesen leer. Die abergläubischen Einwohner hier glauben, dass er mit seinen Getreuen in der Burg herumspukt. Manche behaupten sogar, sie sahen ihn hier auf diesem Felsenthron sitzen.“
Annas und Lucy stellten aus den Vorräten, die Albrecht uns mitgegeben hatte, eine Vesper zusammen. Es gab getrockneten Fisch, einen herrlich duftenden rohen Schinken, Ziegenkäse, ein knuspriges Landbrot und dazu ein Pinot Noir aus Albrechts Weinkeller. Es schmeckte vorzüglich. Zum Abschluss der Brotzeit wurde die silberne Feldflasche mit dem Rest des köstlichen Weines herumgereicht. Langsam baute sich unsere Anspannung ab und selbst Annas machte jetzt wieder ein zufriedenes Gesicht. Sie hatte mittlerweile den Vorfall bei der Wagenburg aus ihren Gedanken verbannt.
Ich bewunderte die feine Gravur auf dem Gefäß, trank einen Schluck, und gab die Trinkflasche weiter an Annas. Meine Tante prostete uns zu und urteilte nach dem ersten Schluck: „Da hat Albrecht mir doch einen ausgezeichneten Muskateller aus dem Weinkeller des Johanniters Martin von Hohenstein mitgegeben. Dieses herrliche Getränk baut der Ritter auf den Terrassen um seine Burg herum an. Der fruchtbare Löß der Steillagen verleiht diesem edlen Tropfen einen wunderbaren Geschmack. Ich durfte ihn in seiner Burg schon einmal probieren. Ich fand ihn ausgezeichnet.“
Nach einem stillen Augenblick sinnierte sie: „Schon die alten Griechen und Römer fanden diese wohl älteste Kulturtraube der Welt sehr wohlschmeckend.“
Marc wechselte das Thema und fragte in die Runde: „Wer hat jetzt noch Lust weiter zu reiten?“ Lucy und Annas schüttelten verneinend den Kopf. Ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr. Deshalb antwortete ich: „So wie es aussieht niemand. Der Platz hier ist zum Übernachten doch einfach optimal; jedenfalls kann man uns hier nicht so ohne weiteres überraschen. Und da wir alle keine Angst vor den Geistern der Templer oder sonstigen bösen Gesellen haben, können wir uns einigermaßen beruhigt zwischen den Steinsäulen zum Schlafen niederlegen.“ Marc war einverstanden und so errichteten wir das Nachtlager.
Lucy lief den Hang hinunter zu einem umgestürzten Baum, dessen abgestorbene vertrocknete Äste gutes Feuerholz versprachen. Annas und Marc standen derweil neben einem Felsenwächter. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass ich sie nicht stören wollte. Ich schlenderte zum Eingang, blieb zwischen zwei mächtigen Monolithen stehen und betrachtete die Umgebung. Dabei warf ich ein Auge auf Lucy, die sich, mit einem Bündel Holz im Arm, auf den Rückweg machte.
Plötzlich hörte ich helles Glockengebimmel. Eine Herde Ziegen trottete hinter Lucy über die Hügelkuppe. Zwei Hirten, in langen braunen Kapuzenmänteln, trieben sie ins Tal hinunter. Die Viehtreiber benutzten dazu einen langen Stab, der oben in einer langen Metallspitze endete.
Ich bedeutet Lucy mit Gesten, dass sie etwas schneller machen sollte. Unbewusst tastete ich nach meinem Katana auf dem Rücken und nach der Saigabel an meiner Hüfte. Mit langen Schritten hastete Lucy den Hang hinauf. Schnaufend lief sie an mir vorbei und schmiss das Feuerholz in die Mitte des Lagerplatzes. Dort begrenzten Steine eine schon oftmals benutzte Feuerstelle. Danach rief sie zu Marc und Annas hinüber: „Wir kriegen Besuch, da kommt eine ganze Horde!“
Als Marc und Annas erschrocken ihre Katanas packten, beruhigte Lucy sie lachend: „Eine Herde Ziegen, meinte ich“ und zwinkerte ihnen schmunzelnd zu. Marc drohte ihr kopfschüttelnd mit der Faust. Danach kamen die Beiden heran und stellten sich zu uns in den Durchlass. Gemeinsam beobachteten wir die Herde, die immer näher kam. Die Tiere wurden stetig größer; wie alles auf Niihama, dachte ich im Stillen.
Interessiert beobachtete ich die beiden seltsam gekleideten Hirten. In ihren braunen Kutten sahen sie aus wie Mönche. An der Seite ihres Gürtels baumelte ein langes Messer, das schon mehr wie ein Kurzschwert aussah. Lucy kniff die Augen zusammen, als sie die Messer und die Stäbe der Ziegenhüter genauer studierte.
„Das gefällt mir überhaupt nicht“, murmelte sie. Sie schlenderte zu ihrem Gepäck, holte den Japanischen Kurzbogen heraus und kam mit ihm und dem Köcher voller Pfeile zurück. So ausgerüstet stellte sie sich im Eingang halblinks vor die gewaltige Steinsäule. Wir blieben bei den Steinen stehen, aber so, dass die Büsche uns etwas verdeckten. So konnten die Ankommenden uns nicht sofort entdecken. Wir warteten auf die Reaktion der Hirten, die Lucy in diesem Moment vor der Templeranlage bemerkten.
Abrupt blieben sie stehen und starrten sie überrascht an. Die Gesichter konnte man unter den Kapuzen nicht so deutlich erkennen. Für einen Moment drängte sich mir der Eindruck auf, als würden sie auf geistiger Ebene miteinander kommunizieren. Sekunden später trennten sie sich mit gleitenden Schritten voneinander. Der rechte Kuttenmann nahm ein kleines, silbernes Horn von seinem Rücken und blies hinein. Zwei klagende Hornstöße tönten für einen Augenblick durch die klare Luft über der Hügellandschaft. Erstaunt beobachteten wir, dass die Ziegen sich sammelten und wie von unsichtbarer Hand geleitet, an der Templeranlage vorbei, das Tal verließen.
Lucy, die an exponierter Stelle im Eingang stand, gab einen erschreckten Laut von sich und deutete erregt nach vorn: „Da, seht nur!“. Sofort nahm sie ihren Bogen und den Köcher vom Boden auf. Heftig deutete sie mit einem Pfeil auf den Hügel vor uns. Dort kam ein weiterer Hirte in brauner Kutte über die Hügelkuppe. An seiner Seite führte er an einer Kette vier große gelbe Wölfe. Von diesem Anblick erschüttert, fasste Annas nach Marcs Hand; der reagierte angespannt und stieß zischend seinen Atem aus. Als ich diese irreale Szene sah, umkrampfte ich unwillkürlich mit der rechten Hand die Saigabel an meiner Hüfte.
Noch einmal ertönte der klagende Ton und der Viehtreiber mit dem Horn deutete mit ausgestrecktem Arm auf Lucy. Bestätigend deutete der Wolfsführer ebenfalls auf die Bogenschützin. Uns Drei hatten sie augenscheinlich noch nicht bemerkt. Lucy hatte mittlerweile einen Pfeil auf die Bogensehne gelegt. Der Hirte starrte sie bösartig an und löste die Kresch von der Kette. Mit kurzem trockenem Bellen stürzten sich die vier gelben Blitze den Hügel hinab. Wir griffen zu unseren Waffen.
Plötzlich ließ ein hoher schriller Schrei mir fast das Blut in den Adern gefrieren. Das ganze Szenario kam augenblicklich zum Stillstand. Lucy setzte den schussbereiten Bogen ab und verzog ihr Gesicht zur Grimasse. Schützend presste sie ihre Hände auf die Ohren. Genau wie wir, versuchte sie das schmerzhafte Nachklingen des Schreies aus dem Kopf zu vertreiben. Die Kresch wuselten orientierungslos jaulend und winselnd durcheinander. Hilflos warteten sie auf weitere Anweisungen ihres Führers.
Suchend schauten wir uns nach dem Verursacher dieses grauenhaften Schreies um. Auf dem Hügel, schräg hinter uns, erhob sich schattenhaft aus dem Gras eine hochgewachsene Gestalt. Sie war in einen langen, bis zum Boden reichenden Umhang gehüllt und trug einen zylinderähnlichen Hut. Das Gesicht wurde weitgehend von der Krempe verdeckt. Die Kleidung war tiefdunkel schwarz, was den unheimlichen Eindruck noch verstärkte. Falls das, nach diesem Schrei, überhaupt noch möglich war.
Marc schnaubte, verzog sein Gesicht als hätte er Zahnschmerzen und flüsterte leise: „Das wird jetzt aber sehr interessant. Da ist unser Verfolger! Das ist ein Tohopka! Haltet eure Waffen bereit, denn ich weiß nicht, ob er uns auch noch angreift, wenn er mit denen da unten fertig ist.“
Wir schauten ihn erstaunt an und Lucy, die ihren Bogen wieder schussbereit machte, fragte ganz ungläubig: „Was heißt hier, uns noch angreifen? Ich denke, der hat gegen die drei Hirten und die Wölfe nicht die geringste Chance.“
„Wir werden es ja sehen“, antwortete Marc und umschloss mit der rechten Hand fester den Griff seines Katanas.
Ich hatte den Tohopka nicht aus den Augen gelassen und sah, wie er sich langsam in Bewegung setzte. Er wurde schneller und immer schneller. Während er mit langen eleganten Sprüngen den Hügel herunter lief, schlug er seinen wehenden Umhang zurück. Ich war geschockt, das hatte ich wirklich nicht erwartet: Der hatte an jeder Seite zwei Arme! Sekunden später schwang er in jeder seiner vier Fäuste einen gebogenen Säbel. Die Schneiden blitzten in der späten Mittagssonne.
Ein letzter gewaltiger Sprung trug den Unirdischen mitten unter die unentschlossenen Wölfe. Die warteten noch immer vergeblich auf die Anweisungen ihres Hirten. Nach einem Wirbel aufblitzender Klingen heulten die Tiere panisch auf. Ihr Blut spritzte in Fontänen über den Kampfplatz. Ich hatte vielleicht drei- bis viermal mit den Augenlidern geblinzelt, da lagen drei der großen, gelben Bestien mit abgetrennten Köpfen auf dem Boden. Das Blut der Kresch färbte um sie herum das Gras rot.
Nach einem weiteren Säbelhieb humpelte auch der vierte Wolf; trotzdem versuchte er den Tohopka anzugreifen. Aber das ‘Wilde Biest’ sprang im hohen Satz über das Tier hinweg und besiegelte mit zwei seitlich geführten Hieben sein Schicksal. Jaulend sank der Wolf in sich zusammen und blieb im Gras liegen. Sein Bezwinger blieb nur kurz bei dem zuckenden Wolfskörper stehen und trennte mit lässiger, ja fast überheblicher Bewegung, den Kopf vom Rumpf. Die Viehtreiber verfolgten das blutige Schauspiel fassungslos.
Jetzt stolzierte der Unheimliche mit seinen langen dünnen Beinen fast gemächlich den drei Hirten entgegen. Dabei ließ er kein Auge von ihnen. Die kreisten ihn langsam ein und streckten ihm dabei die Kampfstäbe halb drohend, halb abwehrend entgegen. Regungslos blieb der Tohopka stehen und erwartete ihren Angriff. Die folgende gespenstische Szenerie blieb mir noch lange wie ein Alptraum im Gedächtnis haften.
Fast lautlos prallten die Gegner aufeinander. Für einen kurzen Augenblick sah es so aus, als könnten die Mönche den Tohopka in die Enge treiben. Aber durch den Wirbel seiner Säbel, seine wendigen Sprüngen und Drehungen, konnten sie ihn letztendlich doch nicht stellen. Keine der Parteien schaffte es, sich einen entscheidenden Vorteil zu erkämpfen; so entstand eine Pattsituation. Vorsichtig umkreisten die Hirten den Tohopka und versuchten ihn zu einer unvorsichtigen Aktion zu verleiten. Immer wieder stachen sie mit den Stäben nach ihrem Gegner. Der ließ sich aber nicht provozieren und stand stoisch auf seinem Platz. Er beobachtete seine Gegner und lauerte auf einen entscheidenden Fehler.
Bei genauer Betrachtung des Tohopka bemerkte ich, dass er den Kopf, wie eine Eule, um 360 Grad drehen konnte. Dabei sah ich zum ersten Mal seine riesigen roten Augen; die lagen wie glühende Kohlen tief in seinem Gesicht. Jetzt verstand ich, warum die Einheimischen von Niihama ihm diesen Namen verpasst hatten. Er machte seinem Namen ‚Wildes Biest‘ wirklich alle Ehre.
Dann war es plötzlich so weit. Unvorsichtig verließ einer der Hirten, mit einem Schritt nach vorne, die gemeinsame Kampflinie. Darauf hatte der Tohopka nur gewartet. Mit einem markerschütternden Schrei sprang er blitzschnell dem Mönch entgegen. Mit zwei seiner Schwerter blockierte er die Kampflanze des Hirten. Ein Rundschlag der beiden anderen Säbel trennte den Leib des Unglücklichen in zwei Hälften. Wieder spritzten Blutfontänen hoch in die Luft.
Mit einer grotesk aussehenden Bewegung nutzte der Unheimliche sofort die entstandene Lücke in der gegnerischen Front. Er sprang vor und metzelte mit einem Wirbel von Schlägen den zweiten Hirten nieder. Übergangslos wandte er sich seinem letzten Gegner zu. Der konnte sich noch einige Augenblicke lang der rotierenden Säbel erwehren. Mit seinem Kampfstab trennte er dem Tohopka sogar den oberen der beiden rechten Arme ab. Doch selbst diese schwere Verwundung konnte das Wüten des ‘Wilden Biestes’ nicht stoppen.
Mit einer wilden Serie von Hieben prellte es dem Hirten die Kampflanze aus der Hand. Mit wahnsinnigem Geheule, das aus sämtlichen Poren seiner Gestalt zu dringen schien, hackte es dann den letzten Viehtreiber in Stücke.
Danach herrschte erst einmal Ruhe. Die aus einem Alptraum entsprungene Kreatur setzte sich auf einen kleineren Felsbrocken und betrachtete ihre Verwundung. Anschließend starrte sie stumm zu uns herauf. Die unnatürliche Stille war beklemmend; das stumme Anstarren zerrte an meinen Nerven.
Blass um die Nase murmelte Lucy: „Nun verschwinde schon, du Monster, leg dich bloß nicht mit uns an!“ Um ihre Furcht zu verbergen, bleckte sie die Zähne. Mir erging es nicht viel anders. Nervös nestelte ich am Griff meines Katanas herum.
Als der Tohopka dann aufstand und langsam in unsere Richtung kam, sprach Marc im ruhigen Tonfall: „Lucy, bleibe hier bei Annas am Eingang stehen. Decke ihn mit deinen Pfeilen so richtig ein und versuche vor allem seine Schwertarme zu treffen. Reneé und ich werden ihn dann aufhalten.“
Mit einem ernsten Gesicht fasste er mich an der Hand und sagte eindringlich: „Du hast gesehen, zu was alles diese Kreatur fähig ist. Also sei vorsichtig! Aber wenn sich uns eine Chance bietet, müssen wir ihn sofort attackieren. Er muss erst einmal zu uns hoch kommen. Dies, und Lucy mit ihren Pfeilen, das sind unsere Vorteile.“
Mein Blut raste in meinem Körper und ein Adrenalinschub ließ mich vor Anspannung erzittern. Wir bewegten uns etwa fünfzehn Schritte vom Eingang weg. Voll konzentriert nahm ich die Grundstellung ein, die Füße parallel nebeneinander. Dann entschied ich mich für die Seigan no Kamae-Stellung. Ich schob den rechten Fuß einen halben Schritt vor und hob die linke Ferse leicht an. Die Spitze meines Schwertes deutete etwa in Brusthöhe auf den Tohopka. Zugleich hielt ich mit der linken Hand, etwa in der Körpermitte, die Saigabel in der Honte-Stellung bereit.
Diese Haltung ermöglichte mir mehrere Variationen, entweder für einen Angriff oder zur Verteidigung. So erwartete ich das ‘Wilde Biest’. Dabei versuchte ich, alle Gedanken an den bevorstehenden Kampf und meinen möglichen Tod, zu verdrängen.
Marc kniete mit dem linken Knie im Gras und stützte seine Schwerthand leicht am Griff des Katanas ab, die Klingenspitze in den Grasboden gesteckt. Sein Kurzschwert ‚ruhte‘ noch in der Saya.
Der Tohopka hatte inzwischen, in einer Art Wiegeschritt, die Hälfte der Strecke über-wunden. Sein kräftiger Oberkörper wippte dabei vor und zurück, wie bei einem Hahn. Dann blieb er stehen und starrte uns mit rot glühenden Augen an. Ich hatte das Gefühl, als würden diese Augen sich tief in meine Seele einbrennen. Wieder stapfte der Unheimliche einige Schritte vorwärts, blieb dann aber erneut stehen.
Er drehte sich ein wenig in Marcs Richtung, dabei ließ er mich aber keineswegs außer Acht. Marc erhob sich und bezog mit leicht erhobenem Katana Position. Mit seiner linken Hand zog er das Wakizashi blank, dann blickte er furchtlos unserem Gegner entgegen. Diese Haltung war keineswegs nur Fassade, sondern sie spiegelte sein Selbstvertrauen wieder, das sich wiederum auf sein tatsächliches Können und seinen Mut stützte. „Ein wahrer Samurai“, schoss mir durch den Kopf. Es erfüllte mich mit Stolz, dass er sich auch auf Lucys und meine Fähigkeiten verließ.
Der Tohopka öffnete seinen Mund und ich konnte zwei Reihen sehr spitzer Zähne erkennen, zwischen denen, wie bei einer Schlange, eine gespaltene Zunge hin und her züngelte. Aus seinem Munde drangen aber nicht zischende, sondern klackende Geräusche, die sich so ähnlich wie die Sprache der kleinen Buschmänner in der Kalahari anhörten.
Nach kurzer Verzögerung übersetzte unser Translater seine Ansprache: „Napayshni, ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Deine Verdienste für Niihama sind mir wohlbekannt. Aber du bist der engste Vertraute des Gottes Svanson. Somit bist du, genau wie er, mein ärgster Feind; deshalb verfolge ich dich schon sehr lange. Jetzt habe ich dich endlich gestellt. Ich werde dich und deine Begleiterinnen jetzt töten, so wie ich dieses Geschmeiß dort unten auch ausgelöscht habe.“ Eine Sekunde später stieß er wieder einen seiner fürchterlichen Schreie aus und griff uns an.
Lucy hatte den Worten konzentriert gelauscht und dabei den Tohopka genau beobachtet. Fast im gleichen Augenblick, als sich das ‘Wilde Biest’ in Bewegung setzte, zischte der erste Pfeil von der Sehne ihres japanischen Kurzbogens. Mit einer unglaublichen Perfektion jagte sie Pfeil auf Pfeil gegen den Angreifer. Annas kniete neben ihr, in der Deckung eines Mauersimses der Templeranlage. Sie nahm die Pfeile, die griffbereit auf dem Steinsims lagen und reichte sie der Bogenschützin an.
Viele Pfeile wehrte der Tohopka mit seinen Schwertern ab, aber zwei trafen ihr Ziel. Für einen Moment stoppte der Außerirdische seinen Vormarsch und versuchte, die gefiederten Geschosse aus den Wunden am Oberarm seines Schwertarmes zu entfernen.
Marc erkannte sofort seine Chance. Mit lautem „Kiai“ sprang er auf den Tohopka zu. Sein Dämonenbringer fuhr mit hellem sirrenden Ton durch die Luft und trennte mit einem Sodesuri die in diesem Moment ungeschützte linke Hand seines Gegners ab. Sofort setzte Marc mit einem Atemi, einem angedeuteten Hieb nach. Der Verletzte sprang irritiert aus der Reichweite von Marcs Katana, das nun seinen Kopf bedrohte.
Damit bot er mir die Gelegenheit, in den Kampf einzugreifen. Er hatte vermutlich die Distanz zu mir und meinem Katana ‘Aku Ryou Taisan’ unterschätzt. Mit einer schnellen Körperdrehung vollführte ich einen Kurumasike. Die Klinge meines Schwertes fuhr dem Tohopka quer durch den Bauch. Verblüfft hielt das schwer verletzte Wesen inne und starrte auf seine tiefe Wunde.
Marc nutzte postwendend die neue Situation. Mit einem Satz verkürzte er seinen Abstand zu unserem vielarmigen Gegner. Sein Katana zischte erneut durch die Luft und schlitzte mit einem Okesa den Oberkörper der Kreatur auf, quer von der rechten Schulter bis hinunter zur linken Hüfte.
Der Tohopka fiel wie in Zeitlupe auf die Knie. Seine beiden verbliebenen Schwerter glitten ihm aus den Händen und fielen scheppernd vor ihm ins Gras. Er schaute Marc mit seinen rot glühenden Augen an und beugte seinen Oberkörper vor. Ein tiefer, schmerzerfüllter Laut drang aus seiner Kehle und sein Körper bebte. Mit erhobenen Katanas standen wir Beide kampfbereit vor ihm und warteten.
Als Annas und Lucy uns erreichten, richtete sich der Todgeweihte wieder auf. Kraftlos zeigte er mit einem Arm auf Marc. „Ihr habt gut gekämpft, aber für euch es ist noch lange nicht vorbei. Meine Brüder werden mich rächen, denn sie wissen von meiner Niederlage.“
Ein schreckliches Keuchen entfloh seinem Mund und ein Zittern durchlief seinen Körper. Nach einem Moment, in dem nur sein röchelnder Atem zu hören war, hob er erneut seinen Kopf. Er blickte Marc an: „Aber jetzt bitte ich Dich um eine letzte Gunst, lass’ mich wie ein Krieger sterben.“
Er drehte seinen Kopf und musterte uns alle der Reihe nach, so als wollte er unser Aussehen in seinem Gedächtnis speichern. Die vorher rot glühenden Augen wurden tiefschwarz, wie das sprichwörtliche schwarze Loch. Dann schloss er die Augen. Marc beendete mit einem Kaishaku das Leben des Tohopka. Als Vollstrecker seines Schicksals, enthauptete der Dämonenbringer ihn mit singendem, ja fast jubelndem Ton.
Der Körper des Tohopka sank in das Gras. Es war ein perfekt ausgeführter Hieb gewesen, den Marc mit einem Gebet zum Kriegsgott Bishamon abschloss. Er vollführte das Chiburui, um die Blutstropfen von der Schwertspitze zu schütteln. Danach säuberte er das Katana mit einem Tuch und führte sein Langschwert in die Saya zurück.
Als ich den toten Tohopka genauer betrachtete, bemerkte ich, dass aus den Wunden nur sehr wenig Blut sickerte. Es gerann an der Luft sehr schnell, wurde dann sofort schwarz und dickflüssig wie Sirup. Sein Gesicht hatte nur wenig Ähnlichkeiten mit menschlichen Zügen. Vielmehr verblüffte mich die Übereinstimmung mit den Abbildungen, die ich schon von Aliens gesehen hatte. Jenen Raumfahrern, die angeblich 1947 in Roswell abstürzten und zum Area 51 gebracht wurden.
Daraus zog ich meine Schlussfolgerungen. Ein kalter Schauer kroch mir über den Rücken und einige Tropfen des kalten Schweißes rannen mir die Schulterblätter hinab. Ich schüttelte mich innerlich und wandte mich ab.
Nach dem obligatorischen Chiburui säuberte ich mein Katana, sprach danach ein kurzes Gebet und dankte Bishamon dafür, dass wir noch am Leben waren. Ich führte mein Katana in die Schwertscheide zurück und gesellte mich wieder zu meinen Gefährten.
Langsam sank unser Adrenalinspiegel wieder auf normale Werte. Schweigend blickten wir in das kleine Tal, welches sich, vor noch nicht zu allzu langer Zeit, uns so friedlich und still dargeboten hatte. Von einem Augenblick zum anderen war hier das Grauen des Todes eingezogen. Ob meinen Gefährten die gleichen Gedanken durch den Kopf gingen? Ich weiß es nicht. Um diese bedrückenden Erlebnisse zu verarbeiten, brauchte wohl jeder mal eine Pause, um in seinem Inneren für Ordnung zu sorgen.
Marc räusperte sich und lobte Lucy für ihre Schiesskunst. „Das war Kazuya in Vollendung, die Kampfkunst des Schnellschießens mit Pfeil und Bogen. So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen“, sagte er voller Bewunderung zu ihr. Sie hatte wieder einmal großen Anteil daran, dass wir die Begegnung mit dem Tod heil überstanden haben.
Dankbar schauten wir sie an, was sie erst mit einem verlegenen Lächeln quittierte, danach aber in Ihrer typischen burschikosen Art kommentierte: „Gekonnt ist eben gekonnt.“
Ich warf ihr einen Handkuss zu und fügte grinsend an: „Ja, ja, so kennen und lieben wir sie.“
Nach einer erneuten schweigsamen Pause wandte ich mich an Marc und fragte nach dem Wesen des außerirdischen Kämpfers. Nach kurzer Überlegung berichtete er uns, was er über diese Spezies wusste. „Die Indianer von Niihama gaben diesen Wesen den Namen Tohopka, das heißt so viel wie ‘Wildes Biest’. Dein Vater dagegen hat sie immer als die ‚Alte Rasse‘ benannt. Sie selbst bezeichnen sich als Ts’ixa.“
Ich wandte mich an meine Gefährten: „Also mein Gefühl sagt mir, dass der Tohopka eben, nicht nur das ‘Wilde Biest’, also diese grausame Kreatur war, sondern dass er sich trotzdem, als Krieger der uralten Rasse, einem ausgeprägtem Ehrenkodex verpflichtet fühlte. Was meint ihr dazu?“ An ihrem Mienenspiel erkannte ich, dass Marc und auch Annas über eine Erklärung nachdachten.
Lucy unterbrach ihre eigenen Überlegungen, indem sie ziemlich forsch behauptete: „So wie ich das sehe, war diese Kreatur nur ein weiteres Beispiel für die ziemlich krassen Geschöpfe deines Vaters.“ Entschuldigend berührte sie meine Schulter: „Tut mir leid Reneé, das ging nicht gegen dich.“
Ich drehte ihr das Gesicht zu und antwortete: „Schon gut, ich bin dir nicht böse. Es ist ja wirklich wahr, dass er für ein paar schlimme Dinge verantwortlich ist.“
Annas war sichtlich bemüht, einen Einwurf dazu in Worte zu fassen. Schließlich sagte sie: „Dafür trägt dein Vater nicht allein die Verantwortung, das ist die Kollektivschuld von uns allen! Wir, die sich selbst so stolz als ‘Götter’ bezeichnen.“ Das klang in meinen Ohren ziemlich verbittert und ich schaute sie aufmerksam an.
Sie machte eine Pause, gab Marc einen Kuss und setzte dann ihre Erklärung fort: „Dein Vater hat die Tohopka nicht erschaffen. Sie sind eine uralte Rasse, vielleicht sogar älter als unser Göttergeschlecht. Wo sie herkommen, wissen wir nicht so genau. Und warum letztendlich sich unsere beiden Völker bis auf den Tod bekämpfen, das entzieht sich meiner Kenntnis.“
Lucy, die sich wieder einmal einmischte, meinte gereizt: „Hat denn schon mal jemand versucht, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, um diese Fehde zu beenden?“ Bärbeißig merkte sie an: „Mit einer vernünftigen Kommunikation kann man sogar Kriege beenden.“
Annas winkte ärgerlich ab: „Soweit ich weiß, hat ein Vetter von Urbansky es einmal versucht. Er wurde, wie es hieß, in vier Teilen zurückgeschickt. Seitdem schlagen wir uns weiterhin die Köpfe ein. Wahrscheinlich solange, bis niemand mehr da ist - keiner von ihnen und keiner von uns.“ Ihr Blick sprach Bände.
Ich versuchte die aufkommende Verstimmung zu stoppen. Deshalb verkündete ich: „Auch darüber werde ich mit meinem Vater sprechen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Fehde zu beenden. Darum sag mal, Marc, wie viele Tohopka’s gibt es eigentlich noch auf Niihama?“ platzte ich mit der nächsten Frage in seine Grübelei.
„Schwer zu sagen“, antwortete er, „aber viele können es nicht mehr sein. Ich schätze die Zahl ihrer Köpfe auf vier bis sechs. Aber dass es noch welche gibt, hat der Kämpfer der ‘Alten Rasse’ uns ja bestätigt. Einfach deshalb, weil er uns mit der Rache seiner Brüder gedroht hat. Sie können sich auf mentaler Ebene über viele Kilometer hinweg verständigen. Übrigens machte dein Vater auch schon mal einen Versuch, eine Zusammenkunft mit den ‘Ts’ixa’ zu arrangieren. Leider vergebens, jedenfalls bis jetzt.“
Lucy schnaufte und sagte sarkastisch: „Na schön! Was macht uns das denn noch aus. Dann sind halt außer den Harpyien, Wölfen und Zentauren, auch noch ein paar ‘Wilde Biester’ hinter uns her.“ Sie sah mich herausfordernd an, als ich kommentarlos zurückblickte, lieferten wir uns mit den Augen ein stummes Kräftemessen. Schließlich hob sie ergeben beide Hände und beendete das lautlose Duell: „Schon gut! Auch kein Problem! Bei dem, was wir bis jetzt schon alles überstanden haben.“
Marc versuchte die Spannung zu entschärfen und lenkte unsere Aufmerksamkeit auf das Rätsel der Herkunft der beiden feindlichen Zivilisationen. Nachdenklich verzog er seine Miene: „Niemand weiß, aus welcher Region des Universums die ‘Ts’ixa’ eigentlich kommen. Aber genauso wenig weiß ich, wo dein Vater und die anderen Götter beheimatet sind. Die Frage habe ich deinem Vater auch schon mal gestellt. Er murmelte da aber ziemlich abweisend etwas vom Asteroidengürtel, so dass ich nicht mehr weiter nachgebohrt habe.“
Er sah mich an, wischte sich mit der Hand eine Haarsträhne aus der Stirn, grinste etwas verlegen und sagte: „Da musst du ihn schon selber fragen. Und meine liebe Annas hier, hat bis heute auch nicht viel Erklärendes dazu beigesteuert.“
Als Annas sich nicht äußerte, wechselte er erneut das Thema. Er sprach mir aus der Seele, als er vorschlug: „Wir sollten einen Scheiterhaufen aufschichten und alle Toten und die Tierkadaver verbrennen. Vielleicht findet das Tal dadurch wieder zu seinem friedlichen Charakter zurück.“
Wir trugen den Tohopka zu seinen Opfern hinunter. Dort errichteten Annas und Lucy ein Holzgestell, worauf die Leichname verbrannt werden sollten.
Marc und ich sammelten die Toten ein. Er bückte sich beim ersten Hirten und zog ihm die Kapuze vom Kopf. Erschrocken prallte er zurück. „Was ist?“, fragte ich. Er blieb stumm und eilte mit schmerzlichem Gesichtsausdruck zu den Resten des zweiten Hirten. Der lag in einer großen Blutlache, entsetzlich zerstückelt im Gras. Wieder zog er dem Toten die Kapuze vom Gesicht. Betroffen schüttelte er den Kopf und eilte dann zum letzten Hirten. Auch hier wiederholte sich der Vorgang.
Nachdem Annas und Lucy das Holzgestell fertig gebaut hatten, kamen sie zu uns. Annas hatte Marc’s seltsames Gebaren bemerkt und schaute ihn fragend an. Marc deutete auf die Toten und äußerte sich sichtlich erschüttert: „Das sind Kriegermönche aus dem Yibö-Orden.“
Annas schlug entsetzt die Hände vor den Mund. „Das kann ich einfach nicht glauben!“, rief sie. Dann sank sie aufgewühlt und mit bleichem Gesicht auf die Knie. Marc eilte zu ihr, richtete sie auf und legte tröstend die Arme um sie.
Lucy und ich standen etwas verloren dabei, setzten aber nach kurzem Zögern das makabre Geschäft fort. Wir sammelten alle Toten ein und legten sie auf den Scheiterhaufen. Lucy zeigte dabei auf die Akatsuki-Tätowierung, die sie auf dem Arm eines Hirten entdeckt hatte. Auch die Säbel des Tohopkas steckten wir zwischen die Holzscheite, damit sie durch die Glut unbrauchbar würden. Danach sammelte Lucy ihre Pfeile wieder ein.
Wir setzten uns anschließend auf einen Felsblock und Lucy säuberte ihre Geschosse. Währenddessen beobachtete ich stumm, wie Marc auf meine Tante einredete.