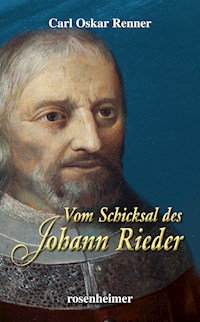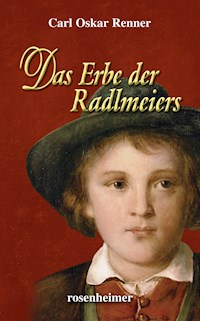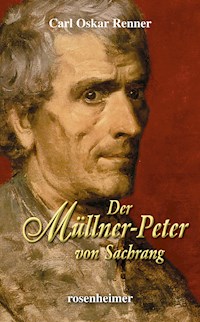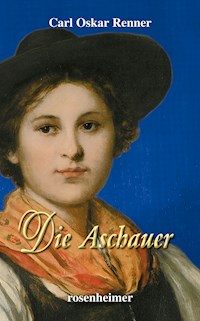
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aschau, Ende des 18. Jahrhunderts: Marei und Resei arbeiten schon seit Jahren in der Schmiede ihres Vaters. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als den Gesellenbrief für ihre guten Leistungen zu erhalten. Doch einige Bürger aus Aschau wollen nicht, dass die beiden Mädchen einen Beruf ergreifen, der bis dahin den Männern vorbehalten war. Der Bannrichter Florian Grießbeck soll vermitteln und verliebt sich in Resei. Marei lässt sich auf den Forstgehilfen Georg Pilgrim ein. Als sie schwanger wird, heiraten sie zwar, doch damit fangen die Schwierigkeiten erst an …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2014
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelbild: Franz von Defregger Lektorat und Satz: Bernhard Edlmann Verlagsdienstleistungen, Raubling Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54413-2 (epub)
Worum geht es im Buch?
Carl Oskar Renner
Die Aschauer
Das Priental erlebt im 18. und 19. Jahrhundert durch die Eisengewinnung eine Zeit des Wohlstandes und des Wachstums. Die Stieftöchter des Nagelschmieds, Marei und Resei, möchten in der Schmiede ihres Vaters arbeiten und noch dazu den Gesellenbrief erhalten. Der Satzmeister Michl, der Pfarrer und einige andere wollen dies unbedingt verhindern und schildern ihre Sorge dem zuständigen Bannrichter von Prien. Der möchte sich das Ganze aus der Nähe anschauen und reist nach Aschau. Beeindruckt von den beiden Mädchen, versucht er zu erwirken, dass diese doch den Gesellenbrief erhalten. Während sich zwischen Resei und dem Richter zarte Gefühle entwickeln, heiratet Marei den Forstpraktikanten Georg Pilgrim, einen Frauenheld, der ständig in Schwierigkeiten gerät.
Inhalt
In der Nagelschmiede
Ein Schreiben an die Landesregierung
Die Teestunde
In der Gewerksstube
Fasching
Der Brand
Die Verhandlung
Der Ziehsohn
Das Flugblatt
Das Hochgericht
Der Tod im Meiler
Zeiten des Umbruchs
Das Explosivum
Die Tiroler kommen!
Die bayerische Armee
Auf der Jagd und bei den Eisenleuten
Die Passion
Familienzwist
»Wir müssen geduldig sein«
Das Hungerjahr
Pankraz Pilgrim
Der Schneesturm
Totentanz
Komtesse Christina
Überraschungen
»Kavalier schleichender Künste«
»So wenig Charakter ist verflucht wenig!«
Die Weinverordnung
»Hier werden wir nicht alt!«
»Die bezauberndste Schlittenfahrt«
Unterm Hammer
18. August 1874
Glossar
In der Nagelschmiede
Der alte Michl klopfte hart an die schwere Eichentür des Pfarrhofs in Aschau. Als Satzmeister der Nagelschmiede durfte er sich einen Besuch beim Geistlichen des Ortes auch noch am späten Abend erlauben. Die Pfarrersköchin öffnete und wies ihn zur Schreibstube. Er war im selben Augenblick schon dorthin unterwegs und trat dort ein, ohne vorher zu klopfen, denn er war das, was die Einheimischen einen »Büffel« nennen. Kein Wunder: Er stammte aus Sachrang.
Pater Onufrius stand am Pult und las im Gebetbuch. Eine Kerze brannte, eine einzige; man musste sparen.
»Pater Onufri« – so nannten die Menschen aus der Umgebung den alten Geistlichen und betonten dabei die erste Silbe – »Pater Onufri, wir Nagelschmiede haben einen Kummer!«
»Michl, gäb’s keinen Kummer, gäb’s kein Leben!«
Diese pfarrherrliche Antwort schien dem Satzmeister nicht sonderlich zu behagen, und er erwiderte leicht erregt: »Unser Kummer hat mit dem Leben nix zu tun, sondern eher mit einer Sauerei!«
Pater Onufrius häufelte sich geruhsam eine kleine Pyramide Schnupftabak auf den Handrücken und sagte: »Michl!« Dann zog er das braune Pulver mit kräftigem Einschnaufen in seine Nase hinauf, nieste noch kräftiger und fächelte mit einem blauen Tuch etliche Male um die gelb unterlaufene Nase. Darauf fuhr er genüsslich fort: »Michl, auch die Sauereien gehören zum Leben!«
»Wollt Ihr mich jetzt anhören, oder soll ich gehen?«
Das war eine Antwort, wie sie sich einem Geistlichen gegenüber nicht gehörte, und der polterte los: »Depp, damischer! Dann geh doch! Oder meinst, ich hätt auf dich gewartet? Wenn du auch der Satzmeister bist, so bist du vor dem Pfarrer immer noch eine arme Seel!«
Dem Michl wurde klar, dass er sich vergriffen hatte. Er bemühte sich um einen bescheideneren Tonfall und eröffnete dann seinen Kummer, so wie er es sich vorher Wort für Wort zurechtgelegt hatte: »Die Sach ist nämlich die: Der Peter, der Unterrheiner, der Zuagroaste aus Siegsdorf, der lässt seine beiden Dirndln zusammen mit dem Gesellen in der Schmiede arbeiten, gerade wie wenn’s so sein dürft! ’s darf aber nit so sein! Nägel schmieden ist Männersach!«
Der Pater überlegte eine längere Weile und fragte dann: »Zusammen mit dem Burschen?«
»Wenn ich’s Euch sag!«
»Ja, können sie’s denn, das Nagelschmieden?«
»’s sieht ganz danach aus, denn es hat noch keinerlei Beschwerden nit ’geben. Aber gehören tut sich das nit! Weiberleut mit der Lederschürzn und nackerten Armen bis zum Hals ’nauf! Und was für Arm’ die haben! Und wenn’s nur die Arm’ wären!«
»Hast vielleicht hingschaut, Michl?«, unterbrach ihn der Pfarrer.
»Ich nit! Aber die Burschen erzählen’s!«
Diese Bemerkung schien dem Pater eine abermalige Prise wert: »Nackert, hast du gesagt?«
»Hab ich gsagt!«
»Hm!«, machte der Pfarrer. Dann machte er noch zweimal »Hm, hm!« und schüttelte den Kopf. Endlich meinte er: » Michl, geh jetzt! Ich dank dir! Ich werd zu gegebener Zeit auf das Kapitel zu reden kommen!«
Etliche Zeit später. Es war der 1. Mai des Jahres 1791, ein schöner, sonniger Tag. Die Mädchen hatten für die erste Maiandacht den Muttergottesaltar in der Kirche prachtvoll geschmückt. Das Gotteshaus war voll bis auf den letzten Platz. Der Kirchenchor droben stand bereit und wartete auf das Glockenzeichens von der Sakristei her, um mit einem Hymnus zu beginnen. Das Zeichen ertönte, die Orgel brauste, und vierzig gesunde Stimmen jubelten hinab ins Kirchenschiff und hinauf ins Gewölbe: »Ave Maria zart, du edler Rosengart!« Da schüttelte es so manchen vor innerer Ergriffenheit.
Nun bestieg Pater Onufrius im blütenweißen Chorrock und mit goldbestickter Stola die Kanzel. Er hatte seine Maipredigt unter das Motto gestellt: »Maria, du starke Jungfrau!« Darin beschrieb er, wie die Gottesmutter, obwohl nur ein unbedeutendes Mädchen aus dem Marktflecken Nazareth, die seelische Kraft besessen hatte, Ja zu sagen zum Heilsplan Gottes. Welch innere Stärke sie besaß! Und wie sehr musste diese Stärke in dem Augenblick, in dem sie dem Engel ihr Ja sagte, noch zugenommen haben!
Und der Pater beschloss seine Kanzelrede mit den markanten Sätzen: »Das ist die wahre Stärke, meine lieben Jungfrauen von Aschau, die aus dem reinen Herzen kommt! Nicht aber die rohe Kraft wuchtiger Arme, mit denen man den schweren Nagelhammer schwingt, um den Burschen zu imponieren! Merkt euch das! Amen.«
Was war das für eine Predigt! Alle jungen Leute drehten sich nach den zwei Schmiedtöchtern um und grinsten. Die aber machten eine vermurkste Kniebeuge – ihr Vater auf der Männerseite machte gar keine – und verließen die Kirche. Sie trafen sich draußen auf dem Platz zwischen der Tafernwirtschaft der Grafen von Hohenaschau und dem Pfarrhof, redeten sehr erregt miteinander und wurden sich schließlich einig, den Bierkeller unterm Burgberg aufzusuchen, wo die Nagelschmiede sich zu treffen pflegten – nicht nur zum Stammtisch, sondern auch zu offiziellen Anlässen, denn dort war ihre Gewerksstube. An diesem Ort würden sich nach der Maiandacht viele einfinden – besonders nach dieser Predigt!
Es saßen nur ein paar Protestantische da; die wunderten sich ebenso wie der Wirt, dass der Peter seine Töchter dabeihatte, denn Weiberleut gehörten nicht da herein. Doch keiner von ihnen sagte etwas.
»Fahr drei Kannen her!«, befahl der Peter, und der Wirt beeilte sich. Nach und nach erschienen, in heftigem Diskurs miteinander, etliche Meister und viele Gesellen; alle verstummten sie aber unter der Tür, als sie den Peter und seine Töchter erblickten. Sie setzten sich abseits von den dreien, soweit es ging – auch der Satzmeister Michl. Und keiner redete laut. Weil jedoch die acht oder neun anderen Nagelschmiedemeister den Michl immer wieder anstießen, sagte der endlich mit gepresster Stimme, als hätte er einen Frosch verschluckt: »Seit wann machen sich denn die Weiber da bei uns herinnen zu schaffen?«
Da wurde es mäuschenstill ringsum.
Peter Unterrheiner stützte das Kinn in die schwielige Hand und schaute vom einen zum anderen. Dann fielen seine Worte hart in den Raum wie die Hammerschläge auf seinen Nagelstock daheim: »Seit wann, fragst du? Seit der Maipredigt, die du dem guten Onufri eingeblasen hast!«
Der Michl stotterte etwas Unverständliches, sodass der Peter ungehindert weiterreden konnte: »Und weil wir gerade so urgemütlich beisammenhocken und den Satzmeister unter uns haben, stell ich vor euch allen den Antrag, dass ihr meinen Dirndln einen sauberen Gesellenbrief aushändigt! Gelernt haben sie bei mir, und jeder kann sich in meiner Schmiede von ihrer Kunst überzeugen.«
Da fingen sie aber an zu maulen und zu fluchen, standen auf, trommelten mit den Bierkannen auf den Tischen herum. Zwei junge Gesellen schoben sich sogar mit geballten Fäusten auf den Peter hin. Das sah bedrohlich aus. Der packte einen Stuhl und warf damit nach dem einen, während das Resei, die jüngere seiner beiden Töchter, dem anderen Gesellen einen derart heftigen Hieb ins Genick verabreichte, dass er umkippte wie ein praller Mehlsack und reglos liegen blieb, bis sie ihm einen Eimer Brunnenwasser übers Gesicht schütteten. Und der Unterrheiner brüllte: »Den Verdruss hättet ihr euch ersparen können! Aber ich geh jetzt ans Gericht!«
Darauf gab er den Mädchen mit dem Kopf ein Zeichen, und gemeinsam verließen sie den Keller. Unter der Tür drehte er sich noch kurz um und rief: »Michl, vergiss fei’ nit, dem Onufri alles zu erzählen, was ihr jetzt erlebt habt! Er wird dir ein sauberes Vergelt’s Gott sagen!«
Mit seinem Gang ans Gericht indes kam der Peter Unterrheiner zu spät. Denn anderentags in aller Herrgottsfrüh sattelte der Satzmeister sein Ross und war bereits in Prien, noch bevor der herrschaftliche Bannrichter das Tor öffnen ließ.
Der kaum dreißig Jahre alte Dr. Florian Griesbeck, vom Herrn Graf Max V. von Preysing-Hohenaschau eben erst in dieses Amt bestellt, hörte sich die langen und breiten Geschichten, die ihm der Zunftmeister der Nagelschmiede auftischte, gelassen an. Was er da vernahm, war weiß Gott nicht alltäglich, und er wollte über die Sache erst gründlich nachdenken. Nicht genug, dass da zwei Brunhilden oder Amazonen aufgetreten waren – hier war auch noch die Kirche mit im Spiel! Sicherlich, Graf Max war ein Jünger der Aufklärung und scherte sich wenig um die Pfarrer. Er vertrat aber die Meinung, man brauche sie, um das gemeine Volk niederzuhalten. Dem musste der Richter Rechnung tragen.
Er versicherte also dem Michl gegenüber, er werde den Fall prüfen, trug ihm einen schönen Gruß an den Pater Onufrius auf und entließ ihn in Gnaden.
Stolz wie ein Gockel auf dem Mist kehrte der alte Michl nach Aschau zurück. Und obwohl er zunächst nichts ausgerichtet hatte, erklärte er am Abend im Burgkeller, die Dinge seien im vollen Gange. Dem Onufri berichtete er im gleichen Sinne und heimste genüsslich dessen anerkennende Worte ein.
Getreu dem zweitausend Jahre alten Rechtsgrundsatz der Römer, der da lautet: »Audiatur et altera pars!« – »Man muss auch die Gegenseite hören!«, bestieg der Bannrichter etliche Tage später seine Herrschaftskutsche und fuhr im Viererzug, wie es ihm aufgrund seines Amtes zustand, nach Aschau. Unter dem Osthang des Burgberges stellte er das Gefährt im Marstall ab und schlenderte dann zu Fuß mit seinem Amtsdiener lässig weiter. Vor dem Märzenbierkeller erkundigte er sich nach den Werkstätten der Nagelschmiede, besonders nach dem Unterrheiner, und bestellte für den Mittag gleich ein »Rossbif mit Kree« vor, das der Wirt sehr empfahl. Dann begaben sich die zwei Herren zum Anwesen »Hatzenberger am Bach«, Nummer 61, und standen vor dem gedrungenen, aber freundlichen Schmiedhaus. Mächtig schoss der Rauch aus dem Kamin, und eine Orgie von Hammerschlägen drang durch das weit geöffnete Tor heraus.
Meinte der Amtsdiener: »Kommod ist diese Arbeit nicht!«
Der Richter erwiderte: »Im Gegenteil!«
Dann standen sie unter dem Tor und schauten in die verrauchte Schmiede hinein. Richtig! Dort, auf der linken Seite, lehnten sie, diese Töchter des Vulcanus, halb knieend an einem schrägen Sitz, während das rechte Bein den Blasebalg trat. Dieses rechte Bein war weit hinauf entblößt und zog die Blicke der beiden Besucher auf sich.
»Was für prächtige Mädchen!«, sagte der Richter.
»Und prächtige Beine!«, ergänzte der Amtsdiener.
»Und mit welcher Leichtigkeit diese kräftigen Arme mit Nageleisen und Hammer umgehen! Was Wunder, dass eine dieser Töchter den Gesellen hat zusammenschlagen können – ›mit einem Hieb‹, hat der Satzmeister berichtet!«
Da stand der Unterrheiner vor ihnen und grüßte ergeben mit der Gebärde des kleinen Mannes: »Die Herren erweisen uns die Ehr?«
»Ob’s eine Ehr ist? Eher ist’s ein Auftrag.«
»Seid bedankt, Herr! Von Aufträgen leben wir.«
»Ihr seid der Meister?«
»Zu Gnaden, ja!«
»Und Ihr beschäftigt auch Weibspersonen?«
»’s sind meine angeheirat’ten Töchter; sie wollen’s nit anders!«
»Sind sie denn diesem schweren Handwerk gewachsen?«
»Ihr seht’s ja selber, Herr; sie bleiben dem Gesellen nix schuldig.«
»Dürften wir etwas näher treten und zuschauen?«
»Nur nit zu nahe! Denn manchmal springt ein Nagel schief aus; der könnt Euch treffen!«
Sie näherten sich dem vordersten Nagelstock, an dem das Resei werkte. Sie warf nur einen kurzen Blick auf den Richter, denn der zwei Ellen lange Drahtstab, den sie zwischen den Backen einer schweren Zange hielt, war glühend und musste mit der anderen Hand ins Nageleisen hineingehämmert werden. Nach etwa dreißig Schlägen sprang der fertige Nagel aus dem Eisen heraus und in den daneben stehenden Wassertrog hinein, wo er zischend erkaltete.
»Dirndl«, fragte der Richter laut, »wie viel Nägel schmiedest du am Tag?«
»Zweitausend muss ein rechter Gesell herbringen!«
»Bist du Gesell?«
»Noch nit! Aber wir wollen’s werden, ich und die Schwester!«
Dem Unterrheiner passte es nicht, dass die Tochter von der Arbeit abgehalten wurde. Darum fragte er: »Herr, wie lautet Euer Auftrag?«
Dass er nun mehr oder weniger hinausgeschmissen werden sollte, passte wiederum dem Richter nicht, hätte er sich doch mit dem Mädchen gern noch eine Weile unterhalten. Darum sagte er jetzt in barschem Ton: »Meister, folgt mir! Ich hab mit Euch zu reden!« und wandte dem Resei den Rücken.
Draußen vor dem Tor eröffnete er dem Peter, dass er der Bannrichter von Prien sei.
»Euer Gnaden«, erwiderte der Nagelschmied respektvoll, »da hat mich gewiss der Satzmeister hingehängt wegen den Dirndln. Ihr könnt aber versichert sein, dass kein einziger Nagelschmiedgesell in der Herrschaft Hohenaschau eine bessere Arbeit verrichtet wie die zwei. Warum sollen sie dann nit Gesellinnen sein, wenn sie eine Freud an der Schmiede haben? Ist mir eh ein Bua versagt geblieben!«
Der Richter bewunderte das klare Gesicht des Mannes und entgegnete: »Darum geht’s uns gar nicht, sondern dass eine Eurer Töchter einen Burschen so zusammengeschlagen hat, dass er bewusstlos war.«
»Haltet ein, Herr!«, kam es da vom Resei. Sie war den Männern gefolgt. »Hätten wir vielleicht zuschauen sollen, wie der andere übern Vater hergefallen wär? So nit, Herr! Wir haben nämlich das vierte Gottsgebot gelernt! – Und noch was! Ich hab den Lattirl erst in der Woch abblitzen lassen, wo er mir hat in die Kammer steigen wollen. Da könnt Ihr verstehn, Herr, was der für eine Stinkwut im Bauch gehabt hat – ich aber genauso!«
»Du scheinst mir eine recht streitbare Jungfrau zu sein! Wie heißt du?«
»Resei heiß ich! Und streiten tu ich nur, wenn’s sein muss; dann aber sakramentisch!«
Das Mädchen drohte sich heißzureden, weshalb der Vater begütigend meinte: »Resei, Resei, geh an den Stock! Das hier ist wirklich Männersach!«
Sie drehte sich ohne Gruß um und verschwand in der Schmiede, während der Richter mit dem Meister und dem Amtsdiener dem Burgkeller zuging.
Ein Schreiben an die Landesregierung
Es war für den Unterrheiner eine rechte Genugtuung gewesen, als sie zu dritt, ins Gespräch vertieft, vor der Schmiede des Satzmeisters ein paar Augenblicke stehen geblieben waren. Hoffentlich sind ihm die Augen aus dem Kopf gefallen, wie er das gesehen hat! Der Richter hatte dem Peter die Hand gereicht und gesagt: »Eure Sache geht in Ordnung!«
Der Wirt stand bereits unter der Tür, als der Richter und sein Amtsdiener sich näherten. Er ging ihnen entgegen und begann gleich mit überschwänglichen Worten sein »Rossbif« zu preisen: »Und erscht der Kree! Meine Herren, der Kree ist wie a scharfs Dirndl – pfeilgrad a Todsünd wert, wenn nit gar zwoa!«
Und er hatte nicht übertrieben. Freilich, Dr. Griesbeck war in Sachen Mittagessen von Kindheit an nicht verwöhnt worden, und auch während seiner Studentenzeit auf der einst jesuitischen Hochschule im flandrischen Löwen hatte er mitunter nur sparsam zu kauen gehabt. Obwohl es ihm in seiner gegenwärtigen glänzenden Stellung hervorragend ging, wusste er immer noch den Kochtopf des kleinen Mannes zu schätzen. Er aß jetzt mit Behagen, trank auch von dem die Zunge lösenden Märzenbier eine nicht unbedeutende Menge. Anschließend nahm sich der Amtsdiener ein Ross aus dem Marstall und ritt hinunter zum Pater Onufrius, um ihm den Antrittsbesuch des neuen Herrn Bannrichters anzukündigen.
Zwei Stunden später standen sich Pfarrer und Richter gegenüber, ähnlich zwei Rüden, die sich erst beschnuppern müssen.
Als Erstes überwand der Pater die Barriere des gegenseitigen Misstrauens und meinte: »Was für eine Meinung auch immer unser Herr Graf Max hat, die Religion betreffend – das eine steht fest: Unser Kurfürst Karl Theodor, dieser abgeseifte Mannheimer, hätt das liebe Bayernland schon längst den Wienern in den Rachen geworfen und wär in die Niederlande ausgerückt, wenn ihn der Herr Graf Max nit immer wieder gebremst hätt.«
»Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass Karl Theodor unseren Grafen trotzdem hoch schätzt.«
»Das wär ja noch schöner, wenn er das nit tät!«, ereiferte sich der alte Herr und bot dem Doktor eine Prise an.
Der lehnte freundlich dankend ab mit dem Hinweis, dass ein Papst einmal das Schnupfen von Tabak mit dem Kirchenbann belegt hätte. Gleichzeitig merkte er, dass die Rösser draußen am Kirchplatz unruhig wurden. Darum musste er sich beeilen, zur Sache zu kommen: »Hochwürdiger Herr, aufgrund einer Anzeige habe ich soeben den Nagelschmied Unterrheiner besucht.«
»Habt Ihr auch die schamlosen Gesellinnen gesehen?«, unterbrach ihn der Pfarrer.
»Apropos Gesellinnen! Was hättet Ihr dagegen, wenn man ihnen den Gesellenbrief erteilte, nachdem sie ihr Metier ausgezeichnet beherrschen?«
»Dagegen, lieber Doktor, hab ich an sich nix! Aber das Nackerte passt mir nit! Auf die Art werden bloß die Mannsbilder wild gemacht!«
Der Richter grinste: »Balbiert wird, wer sich balbieren lässt! Und mit dem Aufreizen und Gereiztwerden verhält sich’s genauso. ›Dem Reinen ist alles rein!‹, heißt es doch schon beim heiligen Paulus; fügen wir hinzu: Den Schweinen ist alles Schwein!«
»Hierin habt Ihr nit unrecht, aber wir müssen auch daran denken, wie überempfindlich und kleinlich meine Schäflein hier manchmal sind. Man darf den Schwachen und Anfälligen kein Ärgernis geben!«
»Pardon, Herr Pfarrer, wollt Ihr in dieser Welt das Ärgernis ausschalten, dann müsst Ihr erst die Menschen erschlagen! Oder sehe ich das falsch?«
Pater Onufrius legte seine dürre Hand auf den Arm des Richters: »Man merkt’s, dass Ihr bei den Exjesuiten studiert habt. Gegen Euch kommt so ein armseliger Landpfarrer nit auf. Aber wenn ich auch nix gegen den Gesellenbrief sag, ganz recht ist mir’s nit, dass die beiden Pertl’schen Dirndln am gleichen Strick ziehen sollen wie die Männer!«
»Heißen die Mädchen Pertl?«
Der Pfarrer nickte: »Der Unterrheiner ist ja nicht der leibliche Vater.«
Dr. Griesbeck fuhr fort: »Gut, dass Ihr mir das sagt, ich hätt sonst lange in der Registratur suchen müssen.«
Sie verabschiedeten sich kurz, aber nicht unfreundlich. Der Pfarrer folgte dem Richter sogar bis unter die eichene Haustür und winkte ihm dann auch noch nach.
Als er wieder in seine Schreibstube zurückging, überlegte er: Registratur! Was haben die Pertl-Töchter in der richterlichen Registratur zu suchen? Sind doch schon im Taufbuch registriert! Ob’s da nit um was anderes geht! …
Ein paar Tage später trat der Michl beim Pater Onufrius ein. »Herr Pfarrer, ich hätt halt gern gewusst, was der Herr Bannrichter zu meiner Anzeig gesagt hat!«
»Von dir war überhaupt keine Red nit. Und was die nackerten Dirndln betrifft, so hab ich meinen Standpunkt vertreten und er den seinigen. Alles andere kratzt mich nit!«
Diese Rede des Pfarrherrn war als Abfuhr gemeint und wurde vom Satzmeister auch als solche verstanden. Er fluchte still in sich hinein, sagte »Gelobt sei Jesus Christus!« und ging.
Zwischenzeitlich hatte sich der richterliche Besuch herumgesprochen, und die ganze Zunft der Hohenaschauer Nagelschmiede verlangte nach einer Erklärung. Der Michl wurde mit Fragen überhäuft, hatte er doch gleich nach seinem Besuch in Prien das Maul sehr voll genommen und ein Urteil, das in seinem Sinne war, schon in greifbarer Nähe gesehen. Doch der Besuch des Richters und besonders dessen lange Unterhaltung mit dem Unterrheiner ließen nicht darauf schließen, dass die Sachlage so war, wie der Satzmeister sie darstellte.
Indes, vierzehn Tage später hatte die Unsicherheit der Nagelschmiede ein Ende. Ein Brief aus Prien war da! Der Satzmeister erhielt ein bannrichterliches Reskript mit dem Inhalt, ein Hochgräflich Preysing’scher Pflegrichter sei nach vielen Recherchen und Eruierungen zu der folgenden Überzeugung gelangt: den angeheirateten Töchtern des Nagelschmiedmeisters Peter Unterrheiner dürfe der Gesellenbrief nicht verweigert werden.
Als der Michl diesen in einer recht gedrechselten Sprache mit vielen Wenn und Aber verfassten Brief seinen Genossen im Burgkeller ausgedeutscht hatte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Es hätte nicht viel gefehlt, da wären sie im Haufen zum Anwesen »Hatzenberger am Bach« gezogen und hätten dem Peter das Haus über dem Kopf angezündet. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Zunftmeister sie mit der Bemerkung beruhigen konnte, es sei nunmehr der gegebene Zeitpunkt, den Fall vor die oberste Landesregierung in München zu bringen – »uns zur Genugtuung und den Nachkommen zum Exempel«, wie er sich gemessen ausdrückte. Diese Ankündigung des Meisters tat ihnen wohl, und so kam es, dass etliche weitere Kannen des süffigen Märzenbiers konsumiert wurden. Es war bereits Nacht geworden, als die Nagelschmiede teils polternd, teils torkelnd den Heimweg antraten. In den Herzen aller hatte sich die Überzeugung festgesetzt: Jetzt kommt die Gschicht ins Rollen!
Da konnte sich’s der Sepp – das war der, den das Resei niedergestreckt hatte – nicht verkneifen, ihr ein paar Steinderl gegen ihr Kammerfenster zu werfen. Ob eines getroffen hat, ist fraglich, denn auch er hatte dem süffigen Trunk reichlich zugesprochen.
Nun galt es, die gewichtige Eingabe nach München zu verfassen. Der Michl war zwar des Schreibens kundig, doch hier war noch mehr gefordert, ein gewisser Pfiff. Da wäre der Pfarrer – schon wegen der lateinischen Kunstbrocken, die er mit eingeflochten hätte – der richtige Mann gewesen; aber der schied aus. Kam noch der Forstmeister Meggendorfer in Frage; der war zwar äußerst gescheit, jedoch ein grober Lackl, dem man tunlichst aus dem Wege ging. Blieb der Schulmeister und Organist Matthias Scheuch übrig, ein Oberösterreicher und der beste Lehrer, den Aschau je hatte. Der war so eine Art Müllner-Peter. Auch er hatte einmal Theologie studiert, aber dann den Plan, Pfarrer zu werden, verworfen, wobei eine paradiesische Eva die Hauptrolle gespielt hatte.
Der Satzmeister wandte sich also an ihn, und gemeinsam schufen sie in monatelanger Arbeit jenen denkwürdigen Brief, der unter dem 20. Oktober 1791 endlich der Post übergeben werden konnte. Das Schriftstück glich einem Orgelpräludium – es wurden wahlweise alle Register gezogen:
Wir, Satzmeister, und alle 90 Zunftgenossen der Nagelschmiede der Hochgräflich Preysing’schen Eisenwerke zu Hohenaschau, geben der Churfürstlich Bayerischen Landesregierung nachfolgende Beschwernis kund und zu wissen:
Ist da unter uns ein Meister Peter Unterrheiner, hat zwei Stieftöchter. Selbige haben ihm von Kindsbeinen an geholfen, gute Nägel zu schmieden. Nun aber erdreistet sich besagter Unterrheiner, der Zunft das Ansinnen zu stellen, sie solle supra dictas filias sich als Gesellinnen einverleiben. Nicht genug, dass solches allem Herkommen radicaliter zuwiderläuft, seien uns noch folgende Gegenargumenta verstattet:
1.: Unsere 70 bis 80 Gesellen befürchten durch die Weibsbilder eine Beeinträchtigung.
2.: Andere Handwerker haben in ihren Werkstätten auch keine Weibsbilder.
3.: Die Weibspersonen des Meisters Unterrheiner sind – weil sich’s nicht anderst machen lässt – bei der Arbeit an manchen Teilen des Leibes so entblößet, dass, wer da auftraggebenderweis dazukommt, erröten muss bis hinter die Ohren.
4.: Diese Stieftöchter erlernen die Hauswirtschaft niemals, es wird kein gescheits Mannsbild um sie werben.
5.: Unsere Gesellen drohen mit Arbeitsniederlegung. Den daraus entspringenden Schaden kann der Unterrheiner nicht ersetzen.
Dieses Zunftschreiben an die Regierung musste natürlich den Dienstweg gehen. Das hieß, es musste zunächst dem Herrschaftsgericht in Prien vorgelegt werden. Dr. Griesbeck ließ eine Abschrift fertigen, zeichnete das Original ab und übergab es mit einem Begleitschreiben dem Nachrichtenreiter der Herrschaft. Drei Tage später lag der Brief in den Händen des kurfürstlichen Posthalters im Alten Hof zu München. Welchen Weg er von hier aus nahm, ist nicht zu ergründen; es muss jedoch ein erschreckend langer und zeitraubender Weg gewesen sein. Denn als kurz vor Weihnachten dieses Jahres 1791 der Bannrichter in Prien seine Korrespondenz überprüfte, war noch immer keine Antwort eingegangen.
Da beschloss nun Dr. Griesbeck – der Besuch in der Nagelschmiede des Peter Unterrheiner wirkte in ihm immer noch nach –, die verklagten Schmiedleut nicht weiters im Unklaren zu lassen. Er schickte am Thomastag in aller Frühe einen ganz gewöhnlichen Kastenschlitten zum Marstall nach Hohenaschau. Der Kutscher musste der Familie Unterrheiner am Bach bestellen, alle vier seien aus gutem Grunde zu einer Teestunde nach Prien zum Herrn Bannrichter geladen. Sie sollten sich nicht überstürzen, denn sie hätten sechs Stunden Zeit, bis sie im Kastenschlitten abgeholt würden.
Die Teestunde
Nachdem sich die beiden Nagelschmiedtöchter bei den Eltern bitter beklagt hatten, sie hätten nichts anzuziehen, schickte sie der Stiefvater unwirsch in ihre Kammern.
Zur Maria aber, seiner Frau, sagte er: »Die Gschicht mit der Einladung nach Prien gefällt mir nit!«
Sie erwiderte in ihrer stillen Art: »Bin auch nit froh drüber, aber …«
Er unterbrach sie: »Die zwei Gäns’ tun, als wenn s’ nackert wären!«
Sie setzte sich zu ihm: »Mein Gott, Vater, ’s sind halt Dirndln! Aber hast schon recht: Mit den feinen Herrn heißt’s aufpassen.«
»Wenn wir den Richter wegen den Dirndln nit bräuchten, ich hätt den Krampf mit der ›Teestund‹ glattweg ausgschlagen.«
Maria schaute unschlüssig dahin und dorthin und meinte dann: »Vielleicht hat sich zu München doch schon was entschieden, und er möcht’s uns a wen’g freundlich mitteilen.«
Das war aber von der Maria bloß eine Verlegenheitsbemerkung, denn sie dachte in diesem Augenblick an etwas, das bisher niemand erfahren hatte, weder ihr erster Mann noch ihr jetziger, der Peter. Sie dachte an ihre eigene Jugendzeit, als auch sie – freilich erst siebzehnjährig – ein so ansehnliches Mädchen gewesen war wie die Töchter. Da hatte sie der Herr Graf Max, damals ein sündhaft schöner Mann mit einem zierlichen Schnauzbärtchen, zu einem Pirschgang auf die Alm eingeladen, sie allein von all den vielen Dirndln in der Herrschaft. Sie war mitgegangen und hatte gestrahlt bis zum Abend, als sie zusammen in der Hütte waren und es Nacht wurde. Am darauffolgenden Morgen hatte sie dann nicht mehr gestrahlt, sondern geweint, als der Herr Graf von ihr fortgegangen war mit der Bemerkung: »Für etwaige Folgen komme ich auf!«
Jetzt kam ihr das in den Sinn – wie schon so oft –, und sie sagte dann wie aus weiter Ferne zu ihrem Mann: »Vater, man weiß halt nit, was der Abend bringt, wenn früh die Sonn aufgeht!«
Der Peter nickte: »Lassen wir’s auf uns zukommen!«
Das zwanzigjährige Resei und das um ein Jahr ältere Marei saßen im Kastenschlitten. Sie hatten ihr Fronleichnamsgewand an, angesichts der Jahreszeit zwar ein wenig gewagt, doch deckte ein dicker Wollschal alle frierende Blöße zu. Und überhaupt, was hätten sie denn sonst anziehen sollen? Das war ja ihr Bestes!
Sie waren gut gewachsene Mädchen, ähnelten sich wie ein Ei dem anderen und hatten leicht gewelltes braunes Haar, das ihnen wie ein Wiesenbach weit über den Rücken hinabrann. Ihre Hände allerdings entsprachen der sauberen Gestalt nicht, sie waren derb, schrundig und schwielig, und hätten die Mädchen sie auch stundenlang gewaschen, die von den sprühenden Funken versengte Haut wäre gelb und schwarz geblieben wie zuvor. Gesellenhände! Nagelschmiedhände! Hände, wie sie im Eisenhüttental der Prien bei den Männern gang und gäbe waren! Das würde der Herr Bannrichter schon verstehen, und er würde auch drüber hinwegsehen! Hatte er doch in ihre Schmiede hineingeschaut. Da musste er sich wohl erklären können, warum diese Hände so aussahen!
Zunächst schwiegen sie alle und lauschten dem schwirrenden Glockenklang an den Geschirren der dahinsausenden Rösser.
Dann sagte der Unterrheiner: »Wenn wir beim Tisch sitzen, redet nur, wenn man euch fragt! Und redet nit zu viel, besonders du, Resei! So ein Herr wie der Richter braucht keine Belehrung von euch! Ist zehnmal gescheiter wie wir alle miteinand!«
»Aber vom Nagelschmieden versteht er nix, der Herr Bannrichter!«, gab das Resei zurück. »Wenn er also da drüber was wissen will, nachher müssen wir’s ihm doch erklären!«
Ein bisschen abweisend erwiderte der Vater: »Er wird nix wissen wollen! Und wenn schon, kann ja ich ihm die rechte Antwort und Auskunft geben!«
Als sie an Umratshausen vorbeifuhren, meinte Frau Maria schüchtern: »Wenn das alles gut ’nausgeht, dann machen wir gemeinsam eine Wallfahrt hierher zum Heiligen Blut Christi.«
»Hoffentlich erleben wir die Wallfahrt!«, warf der Peter dazwischen. Das war zwar eine etwas dumme Antwort, doch er wollte das letzte Wort haben.
Da fasste ihn das Resei unterm Arm: »Aber Vater, du bist allweil so zweiflerisch!«
»Besser vorher aufs Häusl als wie nachher in die Hosen!«, entgegnete er launig und lächelte sie dabei an, denn er mochte sie sehr gern.
Eine gute Stunde hatten sie gebraucht. Der Schlitten hielt vor der Auffahrt des bannrichterlichen Hauses neben der Priener Kirche. Eine Magd öffnete das schöne Tor. Hinter ihr erschien eine weißhaarige Nobeldame, die Mutter des Richters. Mit feiner Liebenswürdigkeit begrüßte sie die derben Gäste aus dem Gebirg. Dann stand auch schon der Dr. Griesbeck da, auch er voller Freundlichkeit und ganz ungezwungen herzlich. Die Schmiedleut waren so überrascht, dass nicht einmal der Peter einen halbwegs vernünftigen Gruß herausbrachte. Aber die Gastgeber taten, als bemerkten sie diese Unbeholfenheit nicht, und so betrat man gleich ebenerdig einen achteckigen, weiten Raum, der mit schweren Teppichen belegt und von einem wuchtigen Ofen mit weiß glänzenden Kacheln wohlig erwärmt war.
»Kinder, Kinder!«, sagte die Dame in gebrochenem Deutsch, denn sie stammte aus dem Böhmischen. »Was hat eich gemacht schreckliche Kälte ganz rote Naserl!« Dabei nahm sie die Mädchen an den Armen und führte sie an den erlesen gerichteten Tisch. »Wird eich Grog guttun bis hinunter in kalte Fußerl!« Sie wies auch dem Elternpaar einen Platz an und schenkte dann selbst das heiße, duftende Getränk ein. Dann stand die Köchin unter der Tür. Sie trug auf silbernem Tableau eine Pyramide von »Kolatschen«, kleinen, runden Küchelchen, die mit einem bunten Gemisch aus Topfen, Pflaumenmus, Zitronenschalen, Konfitüren und großen Rosinen üppig bedeckt waren.
Sagte der Richter, der sich inzwischen zum Schmied gesetzt hatte: »Diese Kuchen bäckt Maman grundsätzlich selber; sie besitzt nämlich ein Prager Geheimrezept dafür.«
Es schmeckte ihnen vorzüglich, und Frau Maria rühmte mit ein paar ehrlichen Worten das köstliche Backwerk. Beim Essen beherzigten die Mädchen eine Mahnung ihres alten Lehrers Matthias Scheuch: »Was der Mensch den Viechern voraushat, ist, dass er nicht fressen muss!« Die Frau des Hauses war daher über die beherrschte Art der beiden Schwestern höchst erstaunt. Auch saßen sie schlicht und gerade da, nicht hingelümmelt wie die Fuhrknechte. Diesen Umstand vermerkte besonders der Richter im Stillen, und zwar mit Genugtuung.
Gesprochen wurde kaum etwas; nur die Gastgeberin war mit nimmermüdem Eifer darauf aus, ihre Gäste mit den Kolatschen sanft zu vergewaltigen – was natürlich nicht ohne den Einsatz einer gewissen Beredsamkeit abging.
Als dann alle jede weitere Zugabe mit dem besten Dank ablehnten, bat der Richter den Unterrheiner auf ein Gläschen in sein Kabinett. Die Weiblichkeit blieb sitzen und naschte von dem Konfekt, das in der Mitte des Tisches in einer Kristallschale aufgebaut war.
»Dass ihr so schweigsam seid, Kinderlein?«, bemerkte die Frau Maman und schaute die Mädchen lächelnd an. »So junges Mädl muss doch sein spritzig wie Heipferderl!«
Die Töchter blickten sich erst gegenseitig, dann die Mutter an, und schließlich sagte das Resei: »Wir sollen nit reden, hat der Vater gesagt, wenn wir nit gefragt sind, bitte!«
»Schän, mein Liebes, sähr schän! – Wie heißt du gleich?«
»Resei, bitte!«
»Das ist gut, liebes Resei, was Vater hat gesagt! Aber wo wir jetzt lauter Weiberleit beisammen sind, no, da muss man doch ratschen ein bisserl! Seit wo mein lieber Mann, was ist gewesen Gardeoffizier bei Herrn Kurfirscht in München, nicht mehr lebt, ist still geworden bei mir. Florian hat zuerscht besucht Michaelsgymnasium, und weil gut war in Latein und Griechisch, Karl Theodor hat ihn geschickt auf Hochschule von Jesuiten nach Löwen, was ist in Flandern. Und wieder alles still und still, in Wohnung, am Abend und in Nacht!« Ein zarter Akzent von Rührung lag in der Stimme der würdigen Dame.
Da hielt das Resei nicht mehr an sich: »Madame, warum habt Ihr keine Enkelkinder nit? Da wär doch gleich Leben im Hause!«
»Mein liebes Resei, wenn man hat Sohn, was ist verheirat’ mit Richterhut und Aktendeckel, so was bringt nicht Kind und nicht Kegel!«
»Und er will immer ledig bleiben?«, wagte jetzt das Marei zu fragen.
»Wer weiß schon, was will? Weiß doch selber nicht, was will!«, gab resignierend die Dame zu.
Da tat sie der Frau Maria leid, die meinte, da sei doch noch nicht aller Tage Abend. Die Mädchen müssten auf den Herrn Richter doch fliegen wie die Bienen in die blühende Linde, bei seinem Alter und seiner Stellung. Nur sei halt Prien vielleicht nicht der Ort, wo dergleichen Bräute lauerten. »Hätt sich eher nach Rosenheim setzen sollen, der Herr Sohn; gibt’s ja auch dort Preysing’sche Untertanen!«
Da fuhr die alte Dame mit der Hand durch die Luft, als ob sie Fliegen verjagen wollte: »Wischen wir’s weg! Bleiben wir bei uns! Bei eich herrlicher Jugend! No, und was hat für Pläne, diese Jugend? Packt aus, Kinder! Eine neigierige Großmutter will hören! In eirem Alter, da scheint doch Mond in alle Fenster!«
Die Mädchen gaben sich aufgeräumt; der Grog und die liebenswürdige Frau hatten dazu beigetragen. Sagte das Resei: »Vielleicht kommt ein rechter Knappe oder gar ein Werkmeister!«
»Oder vielleicht auch einer vom Forst!«, fügte das Marei mit frohem Lachen hinzu, war sie doch schon zwei- oder dreimal mit dem Forstpraktikanten Georg nach der Sonntagsmesse durch die Felder gestrichen und erst auf einem großen Umweg nach Hause gekommen.
Da meinte Frau Maria ein bisschen wehmütig: »Wenn der Vater halt bloß ein einfacher Nagelschmied ist und kein großes Sach nit hat, tun sich die Dirndln hart mit der Heiraterei. Da hilft auch ein saubers Gsichterl nix! Von dem können sie nicht runterbeißen.«
Draußen begann es dunkel zu werden. Dr. Griesbeck hatte dem Vater Unterrheiner die Gegenargumente des Satzmeisters erläutert. Der Nagelschmied sollte wissen, was die anderen gegen seine Töchter vorzubringen hatten, damit er auf eventuelle Anwürfe vorbereitet wäre. Gleichzeitig versicherte er abermals, dass von München ohne Zweifel eine positive Antwort zu erwarten sei. Diese Versicherung konnte er leicht geben, hatte er doch in seinem eigenen Begleitschreiben für die Sache des Unterrheiners wärmstens plädiert. Allerdings konnte er das seinem Gegenüber nicht einfach so offen sagen.
Peter Unterrheiner war beim Wein recht aus sich herausgegangen. Und weil er den Eindruck hatte, dass der Hauptgrund für die Einladung nach Prien die beiden Mädchen waren, hatte er stark betont, dass ihm das künftige Geschick der Dirndln, obwohl sie nur seine Stieftöchter waren, genau so am Herzen liege wie sein eigenes und das seiner Frau. Er selbst habe ja nichts gehabt als seinen Beruf und das unverschämte Glück, von der Pertl-Maria geheiratet worden zu sein. »Wer sich aber in ein gemachtes Nest setzt, hat ein großes Schuldbuch mit übernommen!«, sagte er zum Abschluss, und der Richter pflichtete ihm bei.
Jetzt kamen sie zu den Frauen, und der Peter meinte, es sei hoch an der Zeit, sich zur Heimfahrt zu rüsten. Der Richter ließ sofort einen Nachrichtenreiter kommen und befahl ihm, vor dem Schlitten Spur zu machen. Es hatte nämlich ein leichtes Schneetreiben eingesetzt; das konnte sich aus dem Sachranger Tal heraus möglicherweise verstärken. Da war Vorsicht geboten.
Weil mittlerweile auch die Kälte angezogen hatte, ließ die alte Dame von der Magd noch zwei Bärenfelle herbeischaffen: »So können Goscherl und Naserl nicht eingefrieren!«, sagte sie, und beide – Mutter und Sohn – geleiteten die Gäste zum Schlitten hinaus, der vor der kleinen Auffahrt schon bereitstand.
Bei den Frauen gab es ein rührend herzliches Abschiednehmen, das der Madame sogar ein paar Tränlein entlockte. Der Unterrheiner bedankte sich für die Gastfreundschaft und versicherte, dass er mehr als seine Worte nicht habe, die aber kämen aus ehrlichem Herzen.
Dann ging’s in die Nacht hinaus.
Nach zwei Stunden stiegen vier glückliche Menschen am Hatzenbergerhof ab. Der Reiter und der Kutscher sollten weisungsgemäß die Nacht im Marstall unterm Schloss verbringen und anderentags nach Prien zurückkehren, nicht ohne vorher noch beim Pfarrer vorbeigefahren zu sein und ihn nach »etwelchen Wünschen« gefragt zu haben. Mit dem guten Pater Onufrius wollte sich’s der Richter nicht verderben, denn der verfügte über die Seelen, er selbst aber bloß über die Leiber!
Mutter und Sohn saßen an diesem Abend im Gerichtshaus zu Prien noch lange beisammen. Sie stimmte ihrem Florian bei, dass die Pertl-Mädchen wertvolle Frauen werden könnten, falls sie in die richtigen Hände gerieten. Dann fragte sie, weil sie den Braten bereits gerochen hatte: »Welcher von den beiden würdest du geben den Vorzug? Mir gefällt besser das Resei. Ist frisch und lebendig wie Bachstelze, wird freilich nicht sein so handsam wie Marei.«
Etwas verlegen erwiderte der Sohn: »Mein Gott, Maman, wer kann das wissen!«
Da wurde die alte Dame energisch: »Willst du Frische, musst du werden frischer! Willst du Handsame, kannst du bleiben, wie du bist: lätschig!«
Über Hohenaschau heulte der Sturm um die Burg. Er pfiff auch um den wuchtigen Kamin der Pertl’schen Nagelschmiede. Vor dem Schlafengehen flüsterte das Resei der Schwester zu: »Heut ist Sankt Thomastag. Von wem du jetzt in der Nacht träumst, der ist dein Schatz! Den wirst kriegen!«
Als sie am anderen Morgen miteinander zum vereisten Brunnentrog hinausgingen, um sich zu waschen, schmunzelte jede in sich hinein. Und während sie einander das Wasser aus ihren hohlen Händen übermütig ins Gesicht spritzten, sagte das Marei: »Bei mir war’s der Georg!« und das Resei: »Bei mir der Richter!«
In der Gewerksstube
Der Dreikönigstag des Jahres 1792 war vorbei, und in den Kanzleien und Schreibstuben der Landesregierung in München fing man wieder sachte an, sich aufs Arbeiten zu besinnen.
Da fiel einem untergeordneten Sekretarius wie durch Zufall das Schreiben des Hohenaschauer Satzmeisters in die Hände. Mit einem Blick auf das Datum erkannte er, dass es für die Erledigung schon überreif war, und brachte es seinem Vorgesetzten. Der las bloß das Begleitschreiben des herrschaftlichen Bannrichters. Darauf musste sich der Sekretarius ans Schreibpult begeben und die folgende Entschließung des Hofgerichtsadvokaten Obermaier notieren: »Wer einen Beruf tüchtig gelernt hat, soll ihn auch tüchtig ausüben können!«
Mehr diktierte der Herr nicht, sondern setzte nur noch seine gestochen scharfe Unterschrift darunter.
Die Herren in der Münchner Regierung waren nämlich keine großen Freunde der Herrschaft Hohenaschau. Denn in ihrem Geheimarchiv stand Schlimmes über diese Grundherren. Schon der alte Pankraz von Freyberg zu Hohenaschau hatte damals, vor fast 250 Jahren, obwohl Vertrauter des Herzogs und ein hoher Beamter am Münchner Hof, mit den Lutheranern sympathisiert und sogar angestrebt, seine Besitzungen zwischen Sachrang und Chiemsee, zwischen Hochries und Kampenwand reichsunmittelbar, also vom Herzog unabhängig zu machen. Deshalb hatte er sich bereits eine Forstordnung, eine Almordnung und eine Hammerwerksordnung geschaffen; er hatte alle Bäche im Priental, all die riesigen Waldungen ringsum und alle Eisenerzgänge zusammengeramscht und zusammengegaunert. Bis ihm dann der gottselige Herr Herzog Albrecht auf die Schliche gekommen war und ihn im Münchner Falkenturm dingfest gemacht hatte. Dort haben sie ihn zugrunde gerichtet – was freilich nit hätt sein müssen.
Das waren die Gedanken, denen sich der Hofgerichtsadvokat Obermaier genüsslich hingab. Und weiter: Dann waren die Preysing gekommen, die die Herrschaft von den Freybergern erheiratet hatten! Jetzt tun sie so, als wären sie die treuesten aller Bayern, aber, aber – »Geh, Secretarius, reiche Er mir doch den Akt ›Wildenwart‹ her! – Danke!«
Da haben wir beispielsweise diesen gegenwärtigen Grafen Max V., einen zweifellos tatkräftigen Verfechter bayerischer Interessen! Aber: Was weiß man da von seinem Schloss Wildenwart, vom großen Erkerzimmer im zweiten Stock, den er selber bewohnt? Was ist da eingeritzt in eine Fensterscheibe gegen Nordwesten? Mit einem Diamanten, ganz klein eingeritzt in lateinischer Sprache? – Als ob unsereiner nit auch Latein gelernt hätt!
Und der Herr Hofgerichtsadvokat las und übersetzte halblaut den Text dieser Inschrift – ein Wildenwarter Kammerknecht hatte sie fein säuberlich abgeschrieben in einem Geheimbrief nach München gemeldet: »Am 27. September hat hier der dankbare Gast Graf Morawitzky seinen allerbesten Bekannten und süßesten Freund, den Grafen Max von Preysing, besucht.« So steht’s auf dem Glas! Und freimaurerische Zeichen stehen auch darunter! Na also! Ein böhmischer Illuminat! Man kennt doch diese Brüder! Diese umstürzlerischen Weltverbesserer! Und so was ist der »süßeste Freund« des Preysing! Lieber Graf Max, bedenkt man das, so nimmt man dir deinen bayerischen Patriotismus nit mehr ab! Jetzt quittieren dir’s sogar schon deine Hohenaschauer Untertanen, dass du auf zwei Schultern trägst! Zerstritten sind Volk und Richter! Zerstritten Arbeit und Recht! Es scheint, der Apfel wird langsam reif, und eines Tages fällt er ganz von selber in unseren schönen, großen bayerischen Früchtekorb. Seitdem sie drüben in Frankreich die Revolution gemacht haben und dort die hochnobelsten Köpf’ rollen, weht nämlich ein anderer Wind durchs Abendland – der lässt Äpfel reifen …!
»Ab mit der Nachrichtenpost nach Prien!« Der Hofgerichtsadvokat Obermaier warf den Brief seinem Sekretarius hin. Dann erhob er sich, nahm den Dreispitz und verließ die Kanzlei. Für heute hatte er genug gearbeitet!
Am 10. Januar dieses neuen 1792er-Jahres gab der Nachrichtenreiter den Brief der Landesregierung im Banngerichtsgebäude zu Prien der Magd am Tor in die Hände: »Dem Herrn Dr. Griesbeck!«
Der Richter brach das Staatssiegel auf und nestelte eine Weile an der Spagatschnur herum, weil er den Knoten lösen wollte. Weil ihm das aber nicht gleich glückte, verlor er die Geduld und griff nach der Schere. Dann las er die »Entschließung« des Herrn Obermaier – und ärgerte sich. Der Münchner Kanzleigewaltige war einer Stellungnahme in puncto Gesellenbrief für die Schmiedtöchter glatt aus dem Weg gegangen! Gut, hier stand geschrieben, sie durften Gesellenarbeit verrichten! Aber streng genommen brauchte sie der Satzmeister nicht in die Zunft aufzunehmen. Es gab also weder einen Sieger noch einen Verlierer. Wahrhaftig, das könnt ihr, ihr schlauen, verschlagenen Federfuchser im Alten Hof: das Recht zwischen den Zeilen hin und her schieben, bis es zerfasert!
Der Doktor fühlte einen schalen Geschmack im Mund. Als er seine Gelassenheit wiedergefunden hatte, begab er sich zur Maman: »Ich muss morgen nach Hohenaschau und werde den ganzen Tag aus sein.«
›Ob er vorfühlen wird?‹, fragte sich die Frau, quittierte jedoch seine Ankündigung nur mit einem bestätigenden Kopfnicken.
Er sandte dann einen Oberreiter zum Satzmeister Michl mit der Weisung, die herrschaftlichen Nagelschmiede – Meister und Gesellen – sollten sich anderentags nach der Schicht in ihrer Gewerksstube vollzählig einfinden – auch die beiden Pertl-Töchter.
Es läutete gerade zu Mittag, als der Reiter beim Satzmeister aus dem Sattel stieg. Er brachte seine Botschaft an, erhielt einen Obstler, nach dem er sich beinahe die Lunge herausgehustet hätte, und ritt in den Marstall. Der Michl schlang hastig ein paar Bissen hinunter und machte sich dann auf den Weg, die Versammlung bei seinen Zunftgenossen bekannt zu machen. Bei jedem, zu dem er kam, betonte er, dass auch die Pertl’schen anwesend sein würden. Das rief meistens heftige Entrüstung hervor. Er wusste die Leut aber mit der Bemerkung zu besänftigen, die Landesregierung werde den Hochnäsigen schon einen kräftigen Dämpfer aufgesetzt haben. Zum Unterrheiner selbst ging er nicht hinein, sondern ließ die Einladung durch einen Lehrbuben bestellen, was der Peter zunächst als eine Gehässigkeit vermerkte, am Ende aber als Dummheit empfand.
Der Abend des 11. Januar dämmerte, die Hammerwerke hörten auf zu pochen; nur die Hochöfen glühten. Die Nagelschmiede drängten sich zum Burgkeller. Der Wirt zapfte frisch an, denn der Herr Bannrichter und sein Amtsdiener sollten eine süffige Maß kriegen. Wieder hatten sie sich in zwei ungleiche Lager getrennt: hier der Peter und seine Dirndln, dort die Meister und Gesellen, alles in allem hundert Menschen. Als jeder seine Kanne vor sich stehen hatte, erhob sich der Bannrichter. In der Hand hielt er das Papier der Regierung mit dem einen Satz.
»Es ist die Aufgabe des Richters«, begann er, »Recht zu sprechen und dadurch Frieden zu stiften. In eurem Fall hat die Landesregierung in München Recht gesprochen. Ob durch ihren Spruch der Friede erreicht wird, liegt bei euch; ich will das Meinige dazu beitragen. Es ist nämlich nichts hässlicher als eine zerstrittene Gemeinschaft; sie ist der Nährboden für Mord und Totschlag. Die Sache der Stieftöchter des Meisters Unterrheiner betreffend, erklärt die Regierung kurz und bündig – ein jeder von euch kann das Papier hier einsehen –: ›Wer einen Beruf tüchtig gelernt hat, soll ihn auch tüchtig ausüben können!‹ Punktum. Gezeichnet: Hofgerichtsadvokat Obermaier.«
Der Doktor machte eine kurze Pause. Ringsum blieb es still.
Dann fuhr er fort: »Dass es euch die Stimme verschlagen hat, verstehe ich jetzt ebenso, wie ich vor Monaten euer Schreiben nicht verstanden hab. Wer hat euch denn zu Sittenpredigern oder gar zu Propheten berufen? Wenn euch die Dirndln zu nackig sind, dann schaut nit hin! Und dann die Prophezeiung, niemand werde um die Schmiedtöchter werben! Ich kann euch versichern, die eine hat bereits einen ernsten Bewerber! Und die andere wird einen kriegen! Dann seid ihr der Pflicht enthoben, ihnen den Gesellenbrief auszustellen – auch wenn sie euch alle Ehr gemacht hätten. – Und schließlich die Drohung von neunzig Gesellen, die Arbeit niederzulegen, weil zwei Dirndln mit ihnen am gleichen Nagelstock stehen und die gleichen Nägel schlagen wollen – meine lieben Freunde, dümmer geht’s nit! Gewiss, ihr würdet die Herrschaft schädigen, aber wovon wollt ihr denn leben, ihr und eure Leut, für die ihr verantwortlich seid? Wollt ihr Hunger und Elend in dieses Tal bringen, das eure Vorväter seit Gründung der Eisenhütte vor 250 Jahren so reich gemacht haben – und das Ganze wegen zweier Dirndln? Sagt das ja nit weiter, denn die Leut draußen im Land müssten sich einen Ast lachen!«
Da hob einer der Gesellen die Hand: »Herr Bannrichter, um die zwei Dirndln geht’s gar nit so sehr, aber wenn das Schule macht!«
Alle schauten sich nach dem Sprecher um. Das war ja gar keiner von ihnen! Das war doch der Georg, der junge Bursch von der Forstverwaltung! Wie hatte sich der da mit hereingeschwindelt? Schon wollte ihm der Satzmeister das Wort verbieten, doch weil der Georg eine gute Frage gestellt hatte, ließ er es.
Nun war das Wort beim Richter: »Wenn das Schule macht, fragst du! Richtig! Wenn das Schule macht, dann stehen eines Tages Männer und Weiber gleich da; gleich in der Arbeit, gleich im Lohn, gleich in der Hauswirtschaft, gleich vor dem Gesetz …«
»… und gleich im Kinderkriegen!«, schrie der Forstmann dazwischen. Alle lachten.
»Oder sind wir vor unserm Herrgott nicht auch alle gleich?«, rief darauf der Richter laut in die Menge der Lacher.
Doch der andere war schon wieder da: »Sachte, Herr Bannrichter, sachte! Lasst den Herrgott aus dem Spiel! Denn in der Bibel steht – und das ist Gottes Wort! –: ›Ihr Weiber, seid euren Männern untertan!‹ Also nix von Gleichheit, Herr Bannrichter!«
»Du irrst, mein Lieber! Gleichheit im Recht ist keinesfalls Gleichheit der Pflichten! Und weil eine Familie, die in sich uneins ist, zugrunde geht, muss einer da sein, der Vater, der allen ihre verschiedenen Pflichten zuweist und sie so in Liebe und Gerechtigkeit vereint!«
»Das sind Haarspaltereien, und außerdem geht mich das Ganze gar nix an!« Er packte seinen Hut, warf sich die Pelerine um und verließ den Wirtssaal.
Der Richter wandte sich an den Satzmeister: »Michl, was soll das heißen? Hattet ihr euch da einen Krawallmacher herbestellt?«
Dem Michl war der Auftritt selbst peinlich: »Weiß nit, Herr Bannrichter, wie der da hereinkommt. Wir von der Handwerkslade haben ihn jedenfalls nit hergeholt. Nehmt’s ihm nit übel, er ist etwas eigen! Der Herr Forstmeister meint ebenfalls, dass es bei ihm nit ganz stimmt!«
»Aha, der gehört zum Forst?«
»’s ist der Georg Pilgrim, kommt aus der Gegend vom Bodensee und praktiziert bei uns.«
»Ein komischer Heiliger!«
»Und eine Goschn hat er wie ein Scherenschleifer. Ihr habts ja gemerkt, Herr!«
Die bisher gereizte Stimmung schien sich zu entspannen. Man redete wieder miteinander, ruhig und ohne Aufregung, und der Wirt schenkte mit seinem Hausl fleißig Bier nach. Auch Dr. Griesbeck und sein Amtsdiener stemmten ihre Kannen und prosteten sogar den Meistern zu. Bis sich dann nach einer Weile der Richter erneut erhob:
»Meine lieben Nagelschmiede, verfahrt jetzt mit den beiden Schwestern, wie ihr wollt! Gebt ihnen den Gesellenbrief oder gebt ihn nicht, sie werden das bleiben, was sie sind: brave Schmiede und stramme Dirndln!«
Warf das Resei dazwischen: »Wir verzichten auf den Gesellenbrief! Auf Gnad und Barmherzigkeit sind wir nit angewiesen!«
Erneut sah der Richter den Frieden, den er stiften wollte, in Gefahr: »Mädchen, so geht das nit! Eben weil ihr nicht auf die Gnade und Barmherzigkeit der Handwerkslade angewiesen seid, würde euch ein großmütiges Vergeben und Vergessen gut zu Gesicht stehen! Fragt euren Vater! Er ist gewiss meiner Meinung. Wenn man vergangene Streitereien immer wieder aufwärmt, erzeugt das bloß böses Blut!«
Das Resei wollte zu einer Antwort ausholen, doch legte ihr der Vater begütigend die Hand auf den Arm.
Der Richter sah das und fuhr fort: »Ich habe in meiner richterlichen Eigenschaft auch die Aufgabe, zu vermitteln. Wenn euch also wo der Schuh drückt, mault nicht und schimpft nicht und geht nicht gleich in die Luft! In der Luft hängen die Lösungen von Problemen kaum. Kommt zu mir! Ich bin zwar euer Richter, hab jedoch nie aufgehört, ein Mensch zu sein! – Und jetzt: Wirt, jedem eine Maß der Versöhnung auf Gerichtskosten!«
Lautstark bekundeten die Nagelschmiede ihre Begeisterung, doch das, was Dr. Griesbeck sich eigentlich erhofft hatte, geschah nicht: Weder der Satzmeister noch der Unterrheiner machten Anstalten, versöhnlich aufeinander zuzugehen.
Murmelte der Amtsdiener: »Büffel bleibt Büffel!«
Peter Unterrheiner und seine Töchter nahmen die herrschaftsrichterlich gestiftete Maß nicht mehr an, sondern verabschiedeten sich von den beiden Herren mit Händedruck. Dabei schauten der Doktor und das Resei einander eine Spur länger in die Augen, als es sich eigentlich gehörte.
Auf dem Heimweg zum Hatzenbergerhof am Bach fragte der Peter das Marei: »War das vielleicht der Forstmensch, mit dem du da umeinanderziehst?«
»Meinst den Georg, Vater?«, erwiderte sie spitz.
Er darauf: »Ja, wen denn sonst? Scheint mir ein arg hinterhältiger Krowot zu sein! Ich warn dich! Schneid dich nit in die Finger! So was heilt lang nit!«
Fasching
Die Kirche war aus; die Frauen liefen heim in ihre Häuser, um den Sonntagsbraten rechtzeitig auf den Tisch zu bringen, die Mannsbilder stolzierten in die Wirtschaften, um ihr Bier zu trinken und vielleicht einen zünftigen Schafkopf zu dreschen. Die jungen Leute taten sich auch zusammen. Am Kirchplatz benahmen sie sich noch etwas zurückhaltend, aber außerhalb der Ortschaft, auf den Feldern, verloren sich die Hemmungen schnell. Es gab eine Faschingspredigt des geistlichen Herrn Onufri zu verlästern. Was der ihnen alles unter die Nase gerieben hatte! Man möcht fast meinen, er wär in seiner Jugend selber ein rechter Draufgänger gewesen, sonst könnt er doch das alles gar nit so wissen!
Der Georg Pilgrim hatte sich gleich das Pertl-Marei gepackt und war mit ihr in Richtung Forsthaus gegangen. Dort war ihm von Amts wegen im Beihaus eine kleine Wohnung eingeräumt worden. Er sonderte sich meist von den Aschauern ab, schließlich war er ja auch etwas Besseres.
Der Unterrheiner, seine Maria und das Resei schlenderten geruhsam ihrer Schmiede am Bach zu. Mit dem Marei hatten sie in den letzten Wochen viel Verdruss gehabt. Die lief anscheinend mit Scheuklappen durch die Gegend und wurde außerdem noch dreist und frech.
»Wenn’s unten anfängt, hört’s oben auf!«, sagte der Peter und spuckte seitlich weg.
»Gott sei’s geklagt!«, erwiderte die Maria und seufzte.
Das Resei aber dachte sich: Wer weiß, ob sie nit besser dran ist als ich! Sie spürt wenigstens, wohin sie einmal gehören wird. Mir geht’s wie dem Schwalberl, das den Abflug verpasst hat …
Während sich die Mutter daheim sofort an den Kochherd begab – es war ja schon alles hergerichtet –, nahm das Resei den Peter beim Arm und flüsterte: »Bitt schön, geh mit in die Schmiede!« Er war nicht ihr Vater, aber er liebte sie wie eine eigene Tochter.
Sie stellten sich an den Nagelstock hin, an dem er zu arbeiten pflegte, und das Mädchen sagte mit einem feinen Tränenschleier in den Augen: »Vater, ich bin in den Richter verliebt!«
Er schien von diesem Bekenntnis nicht überrascht zu sein und erwiderte ohne langes Bedenken, das sei für einen jungen Menschen ein ganz normaler Vorgang; schlimm werde die Geschichte freilich, wenn eine unerfüllbare Hoffnung dazukomme.
»Wär’s unerfüllbar?«
Lange schaute er vor sich auf den Boden nieder, wo eine dicke Schicht Eisenspäne lag. Er stocherte mit der Fußspitze darin herum und meinte dann: »Unerfüllbar wär’s an sich nit, mir kommt sogar vor, ihm geht’s so wie dir; ob das aber bloß so ein Strohfeuer ist oder ob’s Bestand haben könnt, das weiß der liebe Herrgott allein!«
»Vater, ich brauch aber eine Gewissheit; ich werd sonst noch verrückt!«
Er legte ihr die Hand auf die Schulter: »Dirndl, spinn dich aus! 21 Jahr’ alt, kerniger Nagelschmied – und ein hauchdünnes Seelerl wie ein verwöhntes Nesthakerl!«
Da fiel sie ihm um den Hals und weinte zum Gottserbarmen. Als sie eine Weile so gestanden waren, rief Frau Maria zum Essen.
Im Hinübergehen sagte er leise zu ihr: »Ich werd mit der Mutter reden. Die hat noch allweil einen guten Rat gewusst.«
Das Marei kam nicht zum gemeinsamen Tisch. Sie holte sich, wenn sie schließlich erschien, irgendetwas Kaltes aus der Speiskammer. Meistens aß sie gar nichts. Ihre Arbeit am Nagelstock taugte auch nicht mehr viel; kaum die Hälfte ihrer Nägel war abzusetzen. Der Vater hatte erst neulich erklärt, er müsse einen neuen Gesellen einstellen; sie solle deshalb ihren Platz räumen.
Heute war es nun so weit. Beim Kaffeetisch, zu dem sie gerade noch rechtzeitig gekommen war, warf sie mit gleichgültiger Miene die Bemerkung hin, sie werde noch vor dem Aschermittwoch heiraten, weil sie schwanger sei, und dann sofort zum Georg ziehen. Eine Hochzeitsfeier komme für sie nicht infrage, ebenso wenig wie Brautkleid und Kammerwagen und der andere Kaas. Der Georg sei eben unten beim Onufri, um eine ganz stille Trauung zu bestellen. Und noch eines: In die Schmiede solle sie nicht mehr gehen, habe der Georg gesagt. Dafür solle sie die Aussteuer möglichst bald ins Forsthaus bringen – vielleicht etliche Male mit dem Handwagerl hin und her fahren –, damit er schon alles einrichten könne.
Niemand hatte sie bei ihrem Gerede unterbrochen, niemand sagte auch jetzt ein Wort. Das Resei und die Eltern schoben den Kaffee beiseite und gingen hinaus. Darauf zog sie sich in die Kammer zurück und packte ihre Wäsche zusammen – viel war es ja nicht.
Die drei anderen standen hinten auf der Tenne. Als Erste gewann Frau Maria die Fassung wieder: »Mag es sein, wie’s will, sie ist mein Kind, und ich darf sie nit fallen lassen!«
»Wer red’t denn vom Fallenlassen! Aber ihr hinten hineinkriechen, das tu ich nit!«, sagte der Peter, packte einen Rechen, der dort stand, und schleuderte ihn quer über die Tenne bis an die hintere Wand, dass die Hälfte der Zähne abbrach.
Sie wurden in aller Stille getraut: die »tugendsame Jungfrau« Maria Pertl und der »ehrenfeste Jüngling« Georg Pilgrim. Jedermann wusste, warum so und nicht anders. Darum gab’s in Hohenaschau auch weiter kein Gezischel und Gesums, denn was denen passiert war, wird noch vielen passieren, und man darf, wenn man ganz nah am Glashaus sitzt oder sogar schon drinnen, keine Steine werfen. Nur ein paar fromme alte Weiber, die dürfen; die haben ja auch kein Glashaus!
Dann brachen die letzten drei närrischen Faschingstage oder, besser gesagt, Faschingsnächte an. Wer ein rechter Hammerschmiedgesell sein wollte, den durfte da keine Müdigkeit oder gar Schwäche überkommen. Diese Schand durfte man sich nicht antun! Schon wegen der Leut nicht, die von auswärts kamen und das zünftige Treiben der Eisenarbeiter bestaunen wollten – wie zum Beispiel der Herr Bannrichter von Prien! Er war am Sonntag schon frühzeitig angekommen, zusammen mit seiner Mutter. Sie hatten die Messe in der Schlosskapelle besucht, darauf zwei Gästezimmer belegt und aus der Hofküche gespeist. Die alte Dame hatte sich ausbedungen, nach der Mahlzeit allein mit dem Amtsdiener ein kleines Spaziergänglein zu machen. Und so begleitete sie der Mann, wie sie’s verlangt hatte, zum Hatzenbergerhof am Bach, Nummer 61. Die Begrüßung dort glich einer Wiederholungsübung auf einer Schauspielschule: Umhalsungen, Küsse, Händedrücken wechselten einander so lange ab, bis die Helden müde waren und sich in die große Stube begaben, um endlich das Gespräch in Gang zu bringen, das allen am Herzen lag.
Die Mutter des Richters ging das gewünschte, ersehnte, erhoffte, gefürchtete Heiratsproblem an wie ein spanischer Matador, der mit dem Stier in die letzte Kampfesphase eintritt: offen, klar und zielsicher. Dass ihr Sohn das Resei möge und von ihrer Gegenliebe überzeugt sei, stehe außer Zweifel. Nach ihrer Überzeugung komme diese spontane Zuneigung einem Naturereignis gleich. Freilich dürfe man sich Naturereignissen – wenn möglich – nicht willenlos ausliefern, sondern müsse sie beobachten und prüfen: »Liebes Resei-Schatzerl, prüf ihn, fühl ihm auf hohlen Zahn, wenn er hat!« Das sei natürlich auf Distanz unmöglich; also müssten sie in diesen drei Faschingstagen fleißig miteinander spazieren gehen und essen gehen und tanzen gehen »und überhaupt alles machen, was eier Herzerl von eich verlangt«!
Der gute Peter Unterrheiner hockte daneben und kam gar nicht mehr richtig mit. Weil er aber sah, wie Tochter und Mutter mehr und mehr zu strahlen begannen, hatte er dem losgebrochenen Sturzbach der weiblichen Beredsamkeit nichts entgegenzusetzen; er schickte sich gottergeben ins Unaufhaltsame. ›Unser Resei ist ja brav!‹, das war sein stets wiederkehrender Gedanke.
Sogleich wurde natürlich die leidige Kleiderfrage angesprochen, doch die alte Dame blockte auch da jegliches Bedenken ab: »Fronleichnamsdirndl, was hast angehabt neilich bei uns! Gibt’s nix Schäneres bei solche Figur!«
Während sie diese Frage hin und her diskutierten, stand mit einem Mal Dr. Griesbeck unter der Tür. Sein Gesicht verriet innere Erregung: »Hab ich mir’s doch gedacht! Maman, Ihr erweist mir da keinen guten Dienst; im Gegenteil, Ihr habt mich bloßgestellt! Als ob ich nicht selber Manns genug wär!«
»Entschuldige!«, erwiderte die alte Frau kleinlaut und setzte sich hin wie ein gerügtes Schulmädchen. Darauf bat er seinerseits die Unterrheiners um Entschuldigung und gab jedem die Hand.
Zunächst herrschte betretenes Schweigen. Bis der Peter meinte: »Nix für ungut, Herr Bannrichter, aber was die Frau Mutter da gemacht hat, wird jede Mutter und jeder Vater machen, wenn’s ums Wohl des Kindes geht! Kinder sind unser Hausschatz; wenn wir den hergeben – und früher oder später müssen wir’s –, dann möchten wir ihn natürlich in gute Hände legen.«
»Ich dank Euch, Unterrheiner! Ihr habt für meine Mutter eine Lanze gebrochen und zugleich mir selber eine Belehrung erteilt. Der Belehrung hätt es nicht bedurft! Ich bin kein Windhund! Ich bin herausgekommen zu euch, dass wir uns in den drei Tagen ein wenig kennenlernen, denn niemand kauft die Katz im Sack. Wochentags habt ihr keine Zeit, und ich auch nicht.«
»Wir sehen’s nit ungern!«, erwiderte der Peter.
»Ich seh’s sogar ganz gern!«, sagte das Resei und lächelte spitzbübisch.
Dr. Griesbeck war in seiner kurzen Amtszeit mit Sitten und Brauchtum an der Prien noch wenig bekannt geworden. Deshalb nahm er in diesen Hohenaschauer Faschingstagen jede Gelegenheit wahr, den verschiedenen »Sack- und Wurschthupfats« so wie den ergötzlichen »Eier- und Schubkarrenrennats« beizuwohnen. Und wenn ihn dabei der eine oder andere Kasperl im Gesicht anrußte, so hatte er nichts dagegen; vielmehr sah er es sogar als ein Zeichen des Vertrauens an: Sie mochten ihn – was will ein Herrschaftsrichter mehr!
Abends war er mit dem Pertl-Resei auf den Tanzböden zu sehen. Er tanzte flott und elegant, und die beiden zogen die Augen aller auf sich. Anfangs wunderten sich vor allem die Nagelschmiede über das unverschämte Glück dieses Dirndls. Dann aber empfanden sie es als eine persönliche Ehrung, dass es fast so etwas wie eine der Ihren war, die sich da der Herr Bannrichter auserwählt hatte: Ja, Herrschaftseitn! Wo gibt’s denn so was! – Bei uns gibt’s es halt!
Madame Griesbeck konnte in den frühen Morgenstunden nach dem Kehraus mit Genugtuung feststellen, dass alle Ziele, die sie in verknüpfender Weisheit anvisiert hatte, erreicht worden waren. Der Hofgeistliche zeichnete bei der Frühmesse allen Burgleuten – auch den Gästen, unter denen sich das Resei befand – das Aschenkreuz auf die Stirn mit der Mahnung: »Gedenk, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst!«, sodann geleiteten Mutter und Sohn das Mädchen nach Hause. Man gab sich bei dieser zweiten Begegnung gelöst, alle amtliche Steifheit war gewichen.
Von Heirat wurde im Ton der Selbstverständlichkeit gesprochen und ein Termin noch im November des gleichen Jahres erwogen. Resei wollte bis zum Fest der Sommersonnwende weiterhin beim Vater arbeiten, denn zwei neue Gesellen kurz hintereinander, das wäre der Schmiede nicht gut bekommen. Danach aber sollte sie nach dem Wunsch des Richters auf Schloss Wildenwart ziehen und versuchen, das höfische Leben ein wenig kennenzulernen. Eine Hofdame würde ihr dort an die Hand gehen. Außerdem war Wildenwart von Prien nur einen Katzensprung entfernt, an beiden Orten standen Rösser. Man war sich also nahe.