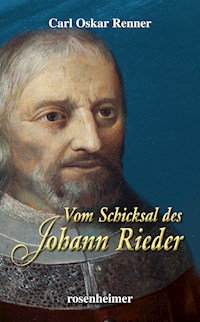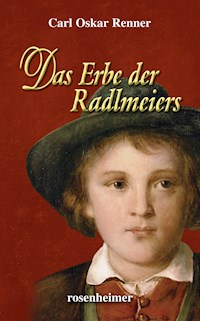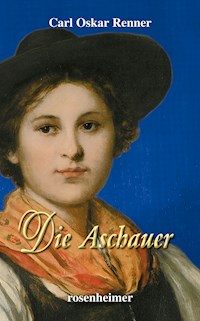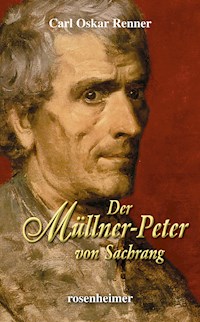
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Müllner-Peter von Sachrang ist eine Legende. Er war Arzt, Apotheker und ein ausgezeichneter Musiker, dessen Werke heute noch gespielt werden. In dem kleinen Dorf im Aschauer Tal an der Grenze zwischen Bayern und Tirol erlebt er die napoleonische Besatzung. Als junger Mann soll er Priester werden. Er entschließt sich gegen diesen Weg und bringt damit die ganze Gemeinde gegen sich auf. Aber stets hilft ihm seine Begabung einen Weg in die Herzen der Menschen zu finden. Ebenso schwer hat er es mit der Frau an seiner Seite. Die dickköpfige Maria Hell weigert sich jemals zu heiraten, da sie den Männern nicht traut. Sie wird Schreinerin, verkleidet sich als Mann und arbeitet jahrelang unerkannt in einem Kloster. Doch immer wieder kreuzen sich ihre und Peters Wege …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Meiner Frau, dem spiritus rector meines Lebens
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelbild: Franz von Defregger Layout und Satz: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig Das in der Grafik abgebildete Mühlrad befindet sich auf einer Steinplatte im Anwesen vom Müllner-Peter in Sachrang. Autor und Verlag danken allen, die geholfen haben das Buch auszustatten. Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54239-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Carl Oskar Renner
Der Müllner-Peter von Sachrang
Der Müllner-Peter von Sachrang ist eine Legende. Er war Arzt, Apotheker und ein ausgezeichneter Musiker, dessen Werke heute noch gespielt werden. Als junger Mann bricht er 1785 die Ausbildung zum Geistlichen ab und enttäuscht damit seine Heimatgemeinde. Durch sein besonderes Wesen, sein umfangreiches Wissen und seine einnehmende Art gelingt es ihm dennoch, sich als angesehenes Mitglied in Sachrang zu etablieren und er wird weit darüber hinaus bekannt.
Inhalt
Die von Lilien
In der Mühle
Der rote Franto
Scheidung der Geister
Es geschehe Gerechtigkeit
Burg Grünwald
Ernte
Die Erbfolge
Hochzeit
Der neue Besen
Anno 1796
Der Klosterschreiner
Das Verhör
Der Strich unter die Rechnung
Fünf Jahre danach
Sub sigillo
Gartenzäune
Die Ertlhofbäuerin
Der Handstreich
Es wendet sich das Blatt
Der Rächer
Michaeli
Nächtliche Besuche
Das Oktoberfest
Auf der Blutenburg
Der Andere
Der Pächter
Sub auspiciis
Die erhobenen Zeigefinger
Der Entschluss
Die Hochzeitsnacht
Gespräche
Das Christfest
Wiedersehen
Das Hungerjahr
Der Bürgermeister
Der lange Johann
Die Bischofsweihe
Das Hochwasser am neunzehnten Juli 1824
Die Totenwache
Gefeiert
Vorspieler Seiner Majestät
Das letzte Kapitel
Glossar
Die von Lilien
Das Haus mit der schweren eichenen Wappentür und dem kupfernen Türklopfer am Viktualienmarkt in München steht heute nicht mehr. Damals, als es noch stand – im Jahr 1785 –, zählte es mit zu den schönsten der Stadt. Kein Wunder: Es gehörte dem Baronengeschlecht von Lilien.
In jenem Jahr nun, einen Tag nach dem Todessprung der Fanny von Ickstatt aus dem obersten Fenster des Nordturmes der Frauenkirche, betraten ein Jesuit und ein neunzehnjähriger Student das beschriebene Haus mit der Wappentür. Während sie sachte auf der breiten knarrenden Treppe empor stiegen, sagte der Pater: »Ich möchte dir noch raten, nicht gar so maulfaul zu sein, wenn dich die Baronin rufen wird; es macht sonst une mauvaise impression.«
»Ich will mich bemühen, Pater!«, entgegnete der junge Mann.
»Na aber selbstverständlich! Du wartest im Vorzimmer, derweil werde ich die Sache mit der Herrschaft vorbesprechen.«
So betraten sie das Vorzimmer. Auf den Zeigern der marmornen Kaminuhr spiegelte sich die hereinstrahlende Morgensonne.
Aus der gegenüberliegenden Tür trat ein Mädchen heraus: »Ah, bonjour, Père Massart!«
»Bonjour, Demoiselle!«, antwortete der Jesuit. »Sind die Herrschaften schon wach?«
»Exzellenz sind von der gestrigen Jagd noch nicht zurückgekehrt.«
»Schade!«
»Herr Pater werden von der gnädigen Frau Baronin erwartet. Darf ich melden?«
»Bitte!«
Das Mädchen, gekleidet wie ein Ritterfräulein, huschte zurück. Pater Massart legte seinem Schützling die Hand auf den Arm: »Also, Peter, etwas mehr Esprit, hm?«
»Ja, Pater!«
»Ja, Pater!«, wiederholte der andere mit fast vorwurfsvollem Ton in der Stimme und fuhr fort: »Warum denn alles so hölzern? Bist wie einer von des Preußen-Friedrichs Langen Kerlen. Fehlte nur noch, dass du strammstehst …«
»Die gnädigste Frau Baronin lässt bitten!« Das Mädchen sprach’s und wandte sich mit artiger Verbeugung zur Seite. Dann schloss sich die Tür. Der junge Mann stand allein im Vorzimmer.
Drinnen aber begann ein Gespräch, das der damaligen Zeit entsprechend in den hohen Gesellschaftskreisen halb französisch geführt wurde. Zudem besaß Frau Baronin von Lilien das oft beneidete Talent, über Nichtigkeiten mit der verschwenderischen Wichtigkeit von Staatsaktionen zu sprechen.
»Oh la la, quelle surprise, mon reverend Père Massart!«
»Je vous salue très affectueusement, gnädigste Frau Baronin! Darf ich nach dem werten Befinden fragen?«
»Ça va, mon reverend, man ist zufrieden! Die leidigen Umständ’ rechnet man eben nicht mit!«
»Leidige Umständ’? Ich habe doch recht gehört?«
»Ja, stellen Sie sich vor, der Skandal, die Schande!«
»Oh!«
»Dass uns die Ickstatt so was antun konnte! Non, non, non, c’est abominable!«
»Gnädigste Frau Baronin reden in Enigmen; die Ickstatt? Mademoiselle Fanny von Ickstatt?«
»Mais oui, die Fanny! Stürzt sie sich doch gestern von der Frauenkirche herunter. Natürlich tot! Und dabei steht ihre Familie unserem Hause nahe. Oh mon dieu! Welche Schande! Non, non, non!«
»Selbstmord? Weiß man die Ursache?«
»Besser, man erführe sie nicht! Oh, die Schande würde nur noch schändlicher! Aber entre nous …«
Dem Jesuiten wurde dieser Diskurs ungemütlich. Darum setzte er der eben begonnenen Lüftung des Geheimnisses mit hartem Ausdruck einen Schlusspunkt: »Ich verstehe – Also, Frau Baronin, ich bin gekommen …«
Die redefreudige Dame begriff – zum Teil, denn sie fiel dem Pater ins Wort: »Oh mille fois pardon, mon Père, ich ließ Sie zu uns bitten und nun belästige ich Sie mit solchen Dingen! Aber die Ickstatt hat mich vollkommen derangiert, vollkommen, vollkommen! Imaginez-vous die Schande, wenn unter den Trauerschleifen auch das Wappen des Barons von Lilien, unser Wappen, erscheint! Unausdenkbar, mon tres reverend Père, unausdenkbar!«
Mit würdevoll kalter Miene erwiderte der Jesuit: »Das arme Fräulein! Möge ihr der Herr ein milder Richter sein!«
Die Baronin fühlte sich durch diese abermalige Abweisung verletzt: »Ja, lassen wir das!« Dann holte sie tief Atem.
Nun begann der Jesuit mit sachlicher Ruhe: »Baronin, ich habe also unter unseren Rhetorikern herumgeschaut. Ich glaube, den besten Korrepetitor für den jungen Herrn Sohn gefunden zu haben. Er ist neunzehn Jahre alt, möchte vielleicht Priester werden, heißt Peter Huber.«
»Doch wohl nicht ein Bürgerlicher!«
»Madame, ich habe diesen Einwand erwartet.«
Die Baronin verschränkte die Arme über der Brust und neigte den Kopf nieder, sodass ihr Doppelkinn glänzend über der Halskrause erschien: »Aber, Pater, ich kann doch unseren Sohn, einen von Lilien, nicht in die Hände eines Bürgerlichen geben! Das können wir doch nicht! Was würde man von dem Hause Lilien halten! Ein Bürgerlicher, oh non, non, non!«
Der Jesuit ließ sich in seiner Ruhe nicht stören: »Der junge Mann vereinigt in sich die Vorzüge eines feinen Charakters mit denen eines genialen Geistes. Außerdem spricht er Französisch, Englisch und Italienisch, und seine Manieren sind ohne Tadel.«
Gequält erwiderte die Frau: »Das Letztere versöhnt.«
»Eh bien, ich habe mir erlaubt ihn vorzustellen. Wenn Madame gütigst befehlen wollen?«
Die Baronin rief dem Mädchen ins Nebenzimmer zu, dass Monsieur kommen möge und fragte den Jesuiten: »Wie heißt er gleich?«
»Huber, Madame, Peter Huber.«
Spöttisch verzog sie den Mund: »Ah mon dieu, Huber, Huber, jeder zweite Domestique heißt Huber!«
Weiter kam sie nicht, denn dieser trat jetzt ein, neigte sich über die dargebotene Hand, wobei ihm das dunkle Haar an den Schläfen hereinfiel, und sagte mit klarem Ausdruck: »Ich küsse die Hand, gnädigste Frau Baronin!«, indem er einen Handkuss andeutete. Madame war vom ersten Eindruck nicht unbefriedigt. Peter Huber fuhr fort: »Pater Massart führte mich in das Haus derer von Lilien; er wird für mich sprechen, Frau Baronin!«
Spitzig und mit etwas hochgezogener Nase meinte die Frau: »Ist Er ein Bürgerlicher?«
»Ja, Madame! Peter Huber.«
»Hat Er vielleicht in seiner Bekanntschaft oder Verwandtschaft einen Adligen?«
»Nein, Madame!«
»C’est domage, das ist schade!«
Peter Huber empfand diese Bemerkung wie einen Schlag ins Gesicht. Er biss die Zähne aufeinander, dass man auf seinen Wangen die Kaumuskeln spielen sah, und schwieg.
»Warum antwortet Er nicht?«
»Ich danke, Madame!«
Fistelnd und die Beleidigte markierend, rief die Baronin: »Wieso dankt Er?«
Ruhig und aufrecht stand der junge Mann da, kniff die Augen ein wenig zusammen und erwiderte: »Der Mann, den eine Dame grundlos beleidigt, dankt und geht!« Er verneigte sich wieder und wandte sich der Tür zu.
»Oh la la, das ist sogar eingebildet!«, keifte ihm die Baronin nach, während der Jesuit, bloßgestellt, ihm nachging und auf ihn einredete: »Peter, du wirst doch einen Spaß verstehen! Bedenke …«
Da tat sich die Tür auf. Lautes Männerlachen und Mädchengekicher und schwere Schritte drangen aus dem Vorzimmer. Der Baron trat ein.
»Guten Morgen, meine Herrschaften! Ja zum Kuckuck! Hat sich die Baronin einen jungen Mann bestellt? Und den Beichtvater gleich dazu? Hahaha!«
Während sich der Jesuit und Peter Huber tief verbeugten, antwortete die Frau: »Wie kann man so reden, Baron von Lilien! So gewöhnlich, Baron von Lilien!«
Nun betrat die ganze Jagdgesellschaft das Zimmer, der Junker und das Fräulein mit lachenden Gesichtern, die der kühle Morgen und der gute Frühtrunk frisch gerötet hatten.
»Setzt euch nieder. Kinder, setzt euch nieder!«, sagte der Baron. »Catharine, lass Wein bringen! Meine Kehle, pfui Teufel, ist wie eine rostige Säbelscheide!«
Während das Zimmermädchen diesem Auftrag nachkam, drängte sich die Baronin an ihren Gemahl und flüsterte: »Baron von Lilien, ich bitte! Wir haben Leute!«
»Aber was, teure Gesponsin, der Jesuit ist gewiss kein Kostverächter. Und Er, junger Mann, komm Er her, Er gefällt mir! Was will Er?«
Peter trat näher; alle sahen ihn an und schwiegen. »Exzellenz, ich war als Korrepetitor für Ihren Herrn Sohn vorgesehen.«
»Ausgezeichnet! Stramme Kerle mag ich gern um mich haben. Er bleibt! Kann Er schießen?« – »Ja, Exzellenz!« – »Wieso? Woher ist Er?« – »Von Sachrang im Gebirg, Exzellenz!« – »Ja, dort sind die Wilddiebe daheim. Ganz ausgezeichnet! Baronin, der einzig richtige Korrepetitor! Hat ihn unser Borgias schon gesehen?«
»Aber, lieber Baron …«
»Kein Aber! Weiß schon, was dein Hemmschuh ist. – Junger Mann, wie heißt Er? Heißt Er vielleicht Oberhuber oder Hinterhuber?«
»Mit Verlaub, Exzellenz: Peter Huber.«
»Na, da haben wir’s ja! – Pater Massart, kann er was, dieser Peter Huber?«
»Halten zu Gnaden, Exzellenz, Huber rechtfertigt unsere schönsten Hoffnungen.«
»Also, teure Baronin, er kann was! Schießen kann er, Latein und Griechisch kann er; versteht Er vielleicht auch was von Musik, Peter Huber aus Sachrang?«
Da klärte sich das Gesicht des jungen Mannes auf: »Mit Verlaub, Exzellenz, ich liebe die Musik!«
»Ei, ei, ei! Was hat seine Stimme plötzlich für einen zarten Klang? Mir scheint, Peter Huber, die Musik ist seine Liebste! Also versuche Er’s gleich mit unserer Tochter! – Terry, hopp, und nimm deine Geige! Peter Huber, dort ist die Harfe!«
Aus dem Kreise der jungen Leute löste sich ein Mädchen im Reitkleid und führte unter dem Jubel der Übrigen den jungen Mann in den dunklen Hintergrund des Zimmers, wo auch ein vergoldetes weißes Spinett stand. Die befohlenen Instrumente wurden gleichgestimmt, dann erklang ein kleines Tiroler Stückchen. Das Edelfräulein errötete während des temperamentvollen Spiels, Peter Huber aber saß hinter der Harfe, den schwarzen Schopf seitlich den flimmernden Saiten zugeneigt. Manchmal schaute er zu seiner Partnerin auf, als wollte er an ihr eine stumme Bestätigung der Zufriedenheit wahrnehmen. Sie aber lächelte. Denn von den drei Meistern, bei denen sie bisher gelernt hatte, vermochte keiner die Harfe besser zu spielen als dieser junge Mann; nur dass der obendrein eine schwungvolle Kraft besaß.
»Bravo, bravo, c’est merveilleux! C’est magnifique!«, erscholl es ringsum, als sie zu Ende waren. Selbst die allergnädigste Frau Baronin konnte ihre auf Stelzen schreitende Anerkennung nicht versagen.
»Da schaut her!«, brüllte der von Lilien in die allgemeine Begeisterung hinein. »Große Dinge geschehen im raschen Zugriff! Meine Herrschaften, hier ist Wein! Teure Baronin, du lächelst; ja, lächle nur und komm an meine Seite, du Glanz meines Lebens!« Und zu Peter Huber gewandt: »Junger Mann, ich mache Sie hiermit auch zum Korrepetitor für Musik! Einverstanden, Fräulein Terry?«
»Avec plaisir, Herr Papa!«, erwiderte mit frohem Gesicht die Tochter.
Ein Jahr später, 1786, feierte Karl Theodor, Kurfürst von Bayern seinen Geburtstag in der Amalienburg, die im Nymphenburger Schlosspark steht. Es war das Jahr als von Frankreich die ersten Stimmen der späteren Revolution vereinzelt herüberdrangen und in Österreich dem Kaiser Josef II. bis dahin unerhörte Neuerungen proklamierte.
Die Amalienburg, ein Kleinod der Hochkunst des Barock, wurde – wie es damals so der Brauch war – von einem Kurialen verwaltet. In diesem Jahre war die hohe Ehre dem Baron Darius von Lilien zugefallen.
Ein lauschiger Abend. Rings auf den weißkiesigen Parkwegen sah man kleinere und größere Grüppchen dahinwandeln; die einen lachten, kicherten, andere sahen sich verliebt und stumm in die Augen. Duft von Jasmin drang betäubend aus den Büschen. Duft von Flieder entströmte den Riechfläschlein der Damen.
Man hörte aus dem Hundezwinger der Amalienburg, die damals als Jagdschloss betrachtet wurde, das heftige Gebell der Meute. Dort führte Darius von Lilien soeben einen seiner berühmten und häufig nachgeahmten Dialoge mit dem Oberjäger Christophorus Brummer.
»Christophorus, rufe Er eine Anzahl Knechte! Man führe die gesamte Meute fort und verbleibe auswärts, bis das herrschaftliche Souper beendet ist!«
»Àvotre service, Exzellenz!«, antwortete der Angeredete und wandte sich zum Gehen.
»Christophorus, was läuft Er denn davon? Habe ich ihm gesagt, dass Er davonlaufen soll?«
»Pardon, Exzellenz!«
»Also, Christophorus: Im Spiegelsaal alles in Ordnung?«
»In Ordnung.«
»Löffel abgezählt?«
»Abgezählt.«
»Kerzen brennen?«
»Brennen.«
»Reservekerzen?«
»Reservekerzen.«
»Weine bereitgestellt?«
»Kalt und warm.«
»Küche in Ordnung?«
»In Ordnung.«
»Christophorus, ich bessere ihm sein Salaire um zwanzig Gulden auf, wenn diese Festivität zu unserer Zufriedenheit verläuft.«
»Zuviel der Gnade, Exzellenz!«
»Christophorus, und merke Er sich: dass mir während der Tafelmusik ja nicht mit dem Geschirr geklappert wird! Schärfe Er das allen Domestiken ein! Potz Donner und Doria, ich reiße ansonst einem jeden die Ohren aus!«
»Die Ohren aus, Exzellenz!«
»Er muss nämlich wissen, Christophorus – so trete Er doch näher, ich will’s ihm zuflüstern –, heut wird unsere Tochter Terry die Ehre haben, vor dem durchlauchtigsten Herrn Kurfürsten zu musizieren. Versteht Er’s nun?«
»Oh, Exzellenz, dann will ich gleich selber das Geschäft des Ohrenausreißens besorgen!«
»Gehe Er, Christophorus, die ersten Gäste kommen!«
Auf der rechten Seite hinter dem Schloss zieht sich ein schattiger Weg beim Pan vorbei. Auf diesem Wege spazierte Terry von Lilien und ließ sich von Peter Huber an der Hand führen. – Peter Huber hatte nun seit einem Jahr den jungen Herrn Borgias von Lilien in den klassischen Sprachen unterrichtet, was ihm dank seiner Ruhe und pädagogischen Feinfühligkeit erfolgreich gelungen war. Nebenher, aber nicht nur nebenbei, war auf Spinett, Harfe, Viola und Zither nicht minder emsig musiziert worden. Wie gern und, ach wie heimlich steigen doch auf den Tonleitern Herzen einander entgegen! Terry jedenfalls konnte dies von dem ihrigen sagen, sagte es auch, aber ganz leise und nur zu sich allein.
»Papa will, dass unser Spiel heute ein Erfolg wird.«
»Unser Spiel? Baronesse meinen Ihr Spiel.«
»Papa denkt eben nur an das Äußere, an das Äußerliche. Seitdem ihn der Herr Kurfürst zum Verwalter der Amalienburg gemacht hat, zählt bloß noch Jagen, Feste arrangieren, Bischöfe empfangen, Kurtisanen unterhalten. Daheim ist er immer bloß für ein paar Stunden, gleichsam auf Besuch. Deshalb wird auch Mama so eigen. Muss man da nicht eigen werden? – Geben Sie mir doch Recht und schweigen Sie nicht fortwährend!«
Peter Huber schaute auf den abendlich geröteten Himmel und zuckte leicht mit den Schultern: »Alles eine Folge unserer Gesellschaftsordnung.«
Barsch erwiderte das Mädchen, das eine Kundgebung seines Mitleids erwartet hatte: »Was heißt das wieder?«
Huber fuhr fort: »Alles ist Zwang. Wer auf der Leiter eine Sprosse höher kam, versucht eilfertig dem, der unter ihm steht, auf den Kopf zu treten. So tritt der Große den Kleinen, der Reiche den Armen, und den Letzten beißen alle Hunde; das sind in dem Falle wir, die Bauern. Indes, Baronesse, der Uhrenzeiger ist schon vorgerückt, es gärt! Der Geist der Aufklärung bricht durch: Der große Kaiser in Wien hat seine Bauern von der Leibeigenschaft befreit!«
Entrüstet blieb Terry stehen: »Wie können Sie, ausgerechnet Sie, für den Kirchenstürmer Joseph eine Lanze brechen? Sie wollen doch Priester werden?« Lauernd blickte sie ihn von der Seite an.
Nach einer längeren Pause entgegnete er tonlos: »Pardon, Baronesse, ich sollte.«
»Sie wollen also nicht?«, und fügt leise hinzu: »Haben Sie ein Mädchen gern?«
Peter Huber antwortete und sein Wort klang trocken wie eine Scherbe: »Muss da immer gleich das Weib die Ursache sein?«
Erschreckt, im Innern betroffen, replizierte die Baronesse: »Muss nicht, aber …«
Der junge Mann unterbrach sie und schaute ihr geradeaus ins Gesicht: »Ich will Ihnen etwas sagen, Baronesse: Schauen Sie sich diesen Pan hier an, wie friedlich er daliegt und seine Ziege hütet. Ich mag mich nicht auf die Leiter stellen und von obenher treten lassen. Ich gehe heim ins Gebirge, wo mein Vater eine Mühle hat. Dort werde ich Mehlbutten über die steile Treppe tragen. Und nächtens, wenn ich aufgeschüttet habe, werde ich in der Müllerstube sitzen, Harfe spielen und Bücher lesen. Ich werde frei sein, frei wie dieser Gott Pan mit seiner Ziege.«
»Man könnte Sie beneiden, wenn man Sie nicht bedauern müsste!«
»Bedauern? Charmant gesprochen, Baronesse! Warum bedauern?«
»Ein solches Genie – ein Müllerbursch! Studieren Sie doch Medizin oder Jura oder meinetwegen Philosophie!«
Peter zog ihre kleine Hand an seine Lippen und lächelte: »Das alles will ich tun, aber nicht als Vorgespann einer Staatskarosse.«
Da traten dem Edelfräulein gar ein paar Tränen in die Augen: »Peter, bitte, bleiben Sie in München!«
Er jedoch schüttelte sich das schwarze Haar in den Nacken zurück und wandte sich um: »Baronesse, mir scheint, wir müssen umkehren; unser letztes gemeinsames Konzert wird bald beginnen …«
Der Spiegelsaal der Amalienburg hatte sich inzwischen mit Gästen gefüllt, Damen und Herren von Rang und Namen, unter ihnen durch seinen Purpur deutlich erkennbar der päpstliche Nuntius Monsignore Ventinuglio. Ihn begleitete der untergebene Pater Massart, dem die Betreuung der Priesteramtskandidaten anvertraut war. Obwohl sich damals fast der gesamte Adel Bayerns der Kirche ergeben zeigte, erregte Ventinuglio durch seine betonte Art dennoch den geheimen Unmut aller. Er wirkte im bunten Gewimmel der Herrschaften wie ein roter Hahn; und wer genau hingesehen hätte, würde gemerkt haben, wie sich die meisten an seiner Nähe durch besonders ausgesuchte Höflichkeit vorbeidrückten.
Auf den Stufen der Eingangstür erschien jetzt der Annonceur in weiß-himmelblauer Livre und klopfte mit seinem vergoldeten Stab auf das Eichenparkett. Die Herrschaften wandten sich ihren vorgeschriebenen Plätzen zu und hörten auf zu reden.
»Unser durchlauchtigster Herr, Karl Theodor, Pfalzgraf bei Rhein, in Ober- und Niederbayern, Herzog des Heiligen Römischen Reichs, Erztruchsess und Kurfürst!« Der Annonceur rief’s in den Saal. Während des sich erhebenden Beifalls trat der Kurfürst in Begleitung des Barons von Lilien ein und begab sich, nach allen Seiten freundlich lächelnd, auf seinen Platz. Abgestuft nach Würde und Amt setzten sich die Gäste nieder, angefangen vom Nuntius bis hinunter zum jüngsten Freifräulein.
Nun begann Darius von Lilien, dem der Hals angelaufen war wie einem Truthahn, seine mühsam eingelernte, von der Gattin verfasste Begrüßungsrede:
»Hohes Haus! Es hat unserem durchläuchtigsten Herrn Kurfürsten gefallen, anlässlich seines dreiundvierzigsten Geburtsfestes einen Teil seines hochverdienten Adels und seiner hohen Würdenträger um sich zu versammeln. Als Verwalter dieses Schlosses mache ich von meinen hausväterlichen Rechten Gebrauch und begrüße das Hohe Haus im Namen unseres gnädigsten Herrn. In einer Zeit wie dieser, wo es in aller Welt brodelt und braust, wo Aufklärung und Illuminatentum an den überlieferten und heiligen Grundfesten unserer Gesellschaftsordnung rütteln, tut es doppelt not, dass die seit Jahrhunderten kulturtragenden Kreise der geistlichen und weltlichen Hierarchie zusammenhalten, ihre Rechte wahren, ihre Prärogativen schützen. Es dürfte dem Hohen Hause bekannt sein, welch üble Postillen aus dem befreundeten Frankreich über die Grenze an unser Ohr dringen. Wir sind erschüttert und entsetzt, wenn wir hören, dass ein Comte de Mirabeau, ein Bischof Talleyrand sich zu Sprechern des gemeinen Haufens machen und gegen das Feudalrecht in Frankreich und in aller Welt eifern, gegen jenes Recht, das unsere Väter und Urväter mühsam geformt haben und von tausenden Segnungen unserer heiligen Mutter Kirche betauen ließen. Hohes Haus, wir wollen uns mit Entrüstung von solchen Abtrünnigen wenden und uns im Entschluss der Einigkeit und Zusammengehörigkeit festigen, zu unserem Fürstenhaus stehen, in unverbrüchlicher Treue und Kraft. Es lebe unser Recht! Es lebe unser Fürst!«
Der mächtige Applaus war ehrlich, insbesondere von seiten der Geistlichkeit.
Nun stand Karl Theodor auf. Er liebte es nicht in der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen – er war auch kein Redner. Bei den Bayern ist er zeitlebens nie richtig warm geworden. Er entgegnete französisch: »Mesdames, Messeigneurs, à une telle eloquence de notre baron il n’y a rien à ajouter. Wir wünschen bon amusement!«
Man klatschte wieder eifrig in die Hände, weil sich das gehörte. Darauf setzte langsam der übliche Gesellschaftstrubel mit gegenseitigen Begrüßungen und Handküssen ein.
Auf einmal kam Terry zum Papa gelaufen: »Peter tut nicht mit!«
Darius, noch erhitzt von der Wucht seiner Worte, fuhr diesen an: »Er ist wohl wahnsinnig, Peter Huber!«
Die entwaffnend ruhige Antwort: »Vielleicht haben Exzellenz einen Spitzel bei der Hand; lassen Sie mich abführen!«
Warum weigerte sich der junge Mann? Er fühlte sich durch die Rede des Barons beschimpft. Er selbst gehöre nämlich auch zu dem »gemeinen Haufen«, von dem der Baron gesprochen habe. Er sei ein Bürgerlicher, ja nicht einmal dies; ein Bauer sei er aus dem gottverlassensten Winkel Bayerns. Allerdings sei er trotzdem ein Mensch und in diesem Punkte um nichts weniger als die Herrschaften vom Adel. Dieses Bewusstsein sei zwar in den Augen der Herren frevelhaft, immerhin gebe es ihm die Berechtigung, sich nicht zum Steigbügel adliger Emanzipation machen zu lassen. Er habe geglaubt, mit Terry gemeinsam der Kunst zu dienen, die alle Menschen adle. Darin habe er sich jedoch geirrt; denn nach den Worten Seiner Exzellenz gebe es keinen anderen Adel, als den der Geburt – alles andere sei »illuminiert.« – »Aber gottlob, dass es Erleuchtete gibt, Exzellenz!«
Mit dieser Erklärung war aus der sonst so feierlichen Ruhe Peters ein ungeahntes Temperament aufgebrochen, das den Baron aufhorchen ließ: »Peter Huber aus Sachrang, nun kennt Er mich ein Jahr, verkehrt täglich in meinem Hause, speist an meinem Tische und denkt einen solchen Stiefel, pardon, ich rede soldatisch! Ich hätte ihn für klüger gehalten, wahrhaftig, und für reifer! Weiß Er, was Diplomatie ist? Wenn ja, dann schaue Er sich die Gäste da drin an und urteile selbst, ob ich anders reden durfte!«
Peter Huber war wieder in seine gewohnte Ruhe zurückgefallen. Mit einer leichten Verneigung erwiderte er: »Exzellenz, mit Verlaub, darf man denn schwarz und weiß sein?«
Der Baron fasste ihn an der Schulter: »Peter, da, unter der Weste, da hat man nur eine Farbe; aber es gibt viele Westen, und je bunter die Kollektion, desto besser! Doch das kann Er noch nicht verdauen, ich werde mit ihm später darüber reden; und noch später wird ihn das Leben selbst belehren. Jetzt mache Er aber keine Fisimatenten, sondern spiele Er anständig wie immer! Entendu? – Ich kündige euch an, Kinder!«
Ein Gongschlag ertönte im Saal, es wurde ruhig, alle schauten zum Vestibül hin, unter dessen gewölbtem Gardinenbogen der Baron stand. Er lächelte: »Selbst auf die Gefahr, dass das Hohe Haus unseren Eifer in etwas tadeln sollte: Unsere Tochter Terry von Lilien will sich die Ehre nehmen und diese Festivität mit Musik verschönen.« Darauf der übliche Beifall.
Das Edelfräulein, ganz in Weiß und duftigem Himmelblau, schwebte herein; dahinter in schwarzem Samt wie ein Schatten der große Gebirgler Peter Huber. Er schlug am Spinett einen Akkord leise an, Terry stimmte das A ihrer Geige. Dann wandte sie sich mit dem vorgeschriebenen Knicks dem Kurfürsten zu und sprach: »Aus dem Adelaide-Konzert von Monsieur Wolfgang Amadäus Mozart.«
Das Spiel begann, schwungvoll und jung wie der junge Mozart.
Karl Theodor hatte viel Sinn für Musik und noch mehr für schöne Frauen. So neigte er sich sichtlich dem Nuntius zu und raunte: »Ein schönes Paar, diese beiden.«
Der Nuntius erwiderte: »Wie Tristan und Isolde.«
Darauf der Kurfürst: »Wenn die in der Ehe auch einmal so nett harmonieren wie hier, dann gibt’s ein feines Konzertchen.«
»En effet, Hoheit! Sind sie wohl einander verlobt? Ich kenne den jungen Herrn nicht.«
»Ich auch nicht. Vielleicht kann es uns ja Père Massart sagen.«
»Unser Konversationslexikon!« Selbstgefällig lächelnd, wandte sich Ventinuglio dem Jesuiten zu: »Wie heißt der charmante Partner der Baronesse von Lilien?«
»Oh, Monsignore, mein enfant terrible! Ein simpler Müllerssohn aus dem Gebirg, er heißt Peter Huber, aber ein Genie! Ich hatte die Hoffnung, er werde Theologie studieren. Glaube es aber nicht mehr! Der Geist der Aufklärung, die Ingolstädter Illuminaten und die Musik …«
»Ist er mit Lilien liiert?«
»Nicht wahrscheinlich, Monsignore! Denn selbst wenn von Seiten des Fräuleins der Wunsch da wäre, und man kann es nicht leugnen: Er ist da, so hat doch dieser Huber einen unbändigen Stolz.«
»Oho, interessant! Der Stolz des kleinen Mannes! – Den Burschen möchte ich sprechen!«
»Wie befehlen, Monsignore!«
Ventinuglio kehrte sich dem Kurfürsten zu: »Hoheit, der Partner der Baronesse ist bloß ein Bürgerlicher. Instructeur et cetera …«
»Domage! Gäbe ein reizendes Pärchen!«
Der Kurfürst sprach’s und ließ kein Auge von Terry ab. Der Nuntius hingegen musterte den jungen Mann.
Es war gewiss ein herrliches Bild. Die zarten Finger des Edelfräuleins glichen Falterfühlern. Mit emsiger Geschäftigkeit hüpften sie auf der braunen Violine auf und nieder. Dabei bog sich das Mädchen ganz leicht in der Taille und unterstrich mit dieser spontanen Gebärde den Wohlklang des meisterlichen Werkes. Peter Huber jedoch folgte mit exakter Aufmerksamkeit jeder kleinsten Nuance seiner Partnerin. Bisweilen fiel ihm das dunkle Haar an den Schläfen herein. Dann schüttelte er kurz, warf den Kopf zurück und schaute dabei stets einen Augenblick auf Terry, fast als wollte er von ihrem Gesicht inspiriert werden.
Diese beiden jungen Menschen – das erkannte jedermann im Saale – waren aufeinander abgestimmt wie ihre Instrumente. Selbsttätig und zugleich in künstlerischer Harmonie verstrickt. Ob sich wohl auch die beiden Herzen in dieser Harmonie verfangen haben? Karl Theodor fragte sich im Stillen und lächelte bejahend zu seiner eigenen Frage. Er war ein Gourmand von feinen Sitten und konnte sich auch am Genusse anderer freuen, fast so sehr, als genösse er immer wieder selbst.
Das Konzert verklang, der letzte Akkord verstummte und ein mächtiger Beifall erhob sich. Die Kerzen am Lüster und an den Wänden flackerten in freudiger Erregung mit. Darius von Lilien legte seine schweren Arme um die Schultern der beiden Künstler und schrie, nachdem sie ins Vestibül zurückgegangen waren: »Kinder, Kinder! Großartig! Der Kurfürst strahlt übers ganze Gesicht!«
Da trat auch schon der Annonceur herein und wandte sich an den Baron: »Pardon, Exzellenz! Die Baronesse von Lilien zu Seiner Hoheit, und Monsieur zu Monsignore, dem Hochwürdigen Herrn Nuntius!«
»Allez-y et bonne chance!« Damit geleitete Darius die Gerufenen bis zur Saaltüre.
Während nun das Fräulein die artigsten Komplimente zu hören bekam und dazu das vorläufige Versprechen, dass man sich ihrer bei Hofe noch näher erinnern werde, wobei die Blicke der Hoheit öfters auf dem Dekolleté haften blieben, nahm die Unterredung Peter Hubers mit Ventinuglio einen nicht ganz glücklichen Verlauf.
Es war damals Brauch, dass sich der Laie zur Begrüßung eines Kirchenfürsten aufs linke Knie niederlassen und dem Würdenträger den großen Fingerring küssen musste. Pater Massart, der auf Peter Huber unter dem Türbogen des Vestibüls gewartet hatte, raunte ihm diesen zeremoniellen Akt noch leise zu, worauf jedoch Huber verneinend den Kopf schüttelte. Dann standen sie vor dem Nuntius.
»Meine untertänigste Verehrung, Monsignore!« Der junge Mann verbeugte sich tief. Dann sahen sie einander in die Augen. Die Taktlosigkeit Hubers, ein allgemein gültiges Zeremoniell zu missachten, was selbst unter dem höchsten Adel niemand gewagt hätte, ließ den Nuntius blass werden: »Weiß Er seinem Nuntius nicht mit dem gebührenden Gruße der Ehrfurcht zu begegnen?«
Peter verneigte sich abermals: »Verzeihung, Monsignore, ich beuge mein Knie vor Gott und seinem Priester im Dienste Gottes – nicht aber, wenn er bei Tische ist.«
»Glänzend, glänzend, Er hat Grundsätze! Nur ist Er für seine Grundsätze noch etwas zu jung, junger Mann!«
Peter schoss das Blut in den Hals. Eine halbe Stunde vor dem hatte ihm der Baron von Lilien Unklugheit und Unreife vorgehalten; jetzt machte der Nuntius seine Jugend zum Vorwurf.
»Pardon, Monsignore, ich weiß nicht, ob meine selige Mutter eine Rüge verdient, weil sie mich nicht früher zur Welt geboren hat!«
Ventinuglio horchte: Das war Affront, Widerstand. Wer solches unternahm, hatte dazu eine Begründung. »Wir spüren in seinen Worten eine Widersetzlichkeit. Peter Huber, dafür schuldet Er uns eine Erklärung!«
»Monsignore, ich habe die Visitenkarte Euer Gnaden gesehen. Darauf steht die Kirche als Frau, fahrend über geduckte Menschenleiber. Wer sich unter Wagenräder hinducken muss, ist ein Sklave. Christus hat uns nicht zu Sklaven gemacht, sondern zu Gottes Kindern.«
Unsicher schaute der Nuntius auf den Pater Massart, der wie eine in schwarz gekleidete Marmorstatue beiseite stand. Der Jesuit, dem die harte Schule seines Ordens für alle Situationen die rechte Diskretion mitgegeben hatte, neigte sein Haupt einige Zentimeter nach vorne, senkte die Augen und sprach mit der ihm eigenen würdevollen Unnahbarkeit: »Verzeihen, Monsignore!« Damit brachte er sowohl die Berechtigung der spontanen Anklage des jungen Mannes, als auch die Bitte um berechtigte Vergebung zum Ausdruck. Das merkte Ventinuglio. Er antwortete: »Peter Huber, Er hat uns gemaßregelt; wir danken ihm! Er soll der erste sein, der von uns eine andere Visitenkarte erhält.«
Da beugte Peter Huber das linke Knie und küsste dem Nuntius den großen goldenen Fingerring.
In der Mühle
Es ist uns nicht vollkommen bekannt geworden, auf welche Art und Weise sich die Lösung Peter Hubers aus dem Kreise der für das Priestertum auserlesenen Kandidaten vollzogen hat. Aus den Umständen kann mit viel Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, dass Peter nicht imstande war, seinen übermäßigen Drang nach Freiheit dem heiligen Gehorsam zu unterwerfen. Der Verzicht auf den Beruf der Auserwählten mag ihm nicht leicht gefallen sein; denn damit zertrat er einen letzten Willen seiner verstorbenen Mutter und die Sehnsucht des alten Vaters, nicht zuletzt auch eine langgehegte Erwartung seiner Heimatgemeinde Sachrang.
Seit nämlich der zwölfjährige Müllner-Peter das Dorf verlassen hatte und nach München gezogen war, um Theologie zu studieren, war in den armen frommen Gebirgsbauern eine persönliche Anteilnahme am Leben dieses jungen Menschen erwacht. Er war einer der Ihrigen, und die Gnadenfülle, die einmal durch seine geweihten Hände strömen sollte, musste an erster Stelle sie selbst berühren – dazu war er doch einer ihres Stammes. Seine Vorfahren hatten Männer und Frauen ihres Blutes geheiratet, man war also verwandt mit ihm, und darum besaß man auch ein Recht auf die Verheißung seiner Zukunft.
Wir können den jähen Bruch und den wehtuenden Riss kaum mitfühlen, den alle Bewohner von Sachrang empfanden, als sich die Kunde verbreitete, dass der Müllner-Peter von München zurückgekehrt sei und kein Geistlicher werden wolle, sondern die Mühle seines Vaters, des alten Müllner-Schorsch, übernehmen werde.
Alle waren beleidigt, empört. Nun hassten sie ihn, der sie enttäuscht hatte, und drückten seinem Vater ein unverhohlenes Beileid aus, fast so, als hätte er seinen Sohn zu Grabe getragen. Das tat dem alten Schorsch ebenso weh wie die beschämende Heimkehr des Kindes. Noch dazu bohrte es in ihm, dass der Bub nicht reden wollte. Wiederholt hatte er ihn nach den Ursachen dieses Umbruchs befragt, unvermittelt und auf Umwegen, doch ohne Erfolg. Der Peter war heimgekommen, hatte den Hut an den Holznagel hinter der Tür gehängt und gesagt, dass er ohne Schimpf und Schande von München fortgegangen sei und von nun an ein rechter Müllerbursch und ein ordentlicher Sägewerker sein wolle, wenn’s dem Vater recht sei.
Nun, das war ihm natürlich recht. Denn der andere, der noch zu Hause war, der Thomas, du lieber Himmel!, der war nicht viel wert. Der hatte nur das Musizieren im Kopf, ließ Säge und Mühle stundenlang leerlaufen und saß stattdessen über seinen Notenblättern. Wenn ihn jemand abgelöst hätte, wären zwei Wünsche auf einmal erfüllt, nämlich der seine und der des Vaters. Ob aber der Peter nun der Rechte wäre? Freilich, er war groß und kräftig und von Kindsbeinen auf mit der Müllerei vertraut. Aber die Leute!
Erst vor etlichen Tagen hatte der Ertlbauer vom Noppenberg, ein ordentlicher Bauer und eine gute Kundschaft, mit unverhohlener Gehässigkeit gefragt, wie sich denn der geistliche Herr Müllerbursch anlasse. Sie warfen allen Groll auf den Peter und würden lieber zwei Stunden weiter in die Aschauer Mühle fahren, als dass sie den leben ließen, der sie so enttäuscht hatte. – Die sorgenvollen Gedanken des Vaters waren nicht unberechtigt.
Als Peter am ersten Sonntag nach seiner Heimkehr vormittags zum Gottesdienst gegangen war, hatte sich niemand zu ihm in die lange Bank gesetzt, obwohl in den Gängen alle eng beisammen standen. Nach der Messe aber stauten sie sich am Kirchhof. Und als auch er herauskam, brachen sie ihre sonst so lauten Gespräche ab und brummten und tuschelten wie über einen öffentlichen Sünder.
Seitdem ging Peter sonntags nicht mehr in die Dorfkirche, sondern stieg zur alten Ölbergkapelle hinauf, die gegenüber seinem Vaterhaus am Berghang lag. Diese Kapelle war ein uraltes Heiligtum, der Sage nach von einem irischen Mönch über der Opferstätte der einst heidnischen Bewohner dieser Bergwälder erbaut.
Dieses Gotteshaus, seit Jahrzehnten von den Chiemseer Bischöfen dem heiligen Dienst entzogen, war seitdem völlig verwahrlost. Fliegenhungrige Spinnen hatten in den Fenstern ihre Netze gespannt, und unter dem morschen Schindeldach nisteten die Tauben. Eine Orgel stand noch da, ein ganz altes Werk, verstimmt, verschmutzt und verquollen. Den Blasbalg hatten die wandernden Waldmäuse bis auf jene kleinen Restchen aufgezehrt, die unter den Kappennägeln eingeklemmt waren.
Als der Müllner-Peter an jenem Oktobersonntag dort hinaufstieg, während unten auf dem Gemeindewege die Kirchengänger vorüberwanderten, war sein junges gärendes Herz bitter. Was hatte er ihnen denn angetan, den Männern mit den Händen in den Hosentaschen und den Weibern mit den großen Betbüchern unterm Arm?
Weil ihr’s euch eingebildet hattet, sollte ich ein Geistlicher werden; was wisst denn ihr, was ein Geistlicher, ein Priester ist! Ja wenn ich ein solcher hätt’ werden können, wie ihr ihn euch vorstellt – ein wenig lateinisch singen, ein wenig von der Kanzel herunterschimpfen und abends beim Kegelschieben im Wirtshaus mit euch herumduzen. Wenn ich das gekonnt hätt’, weiß Gott, ich wär’s geworden und nichts wär’ leichter gewesen als das! Aber das hab ich eben nicht gekonnt. Und das andere, das bedächtige Sprossenklettern auf der Hühnersteige der Fürstengunst, das hab ich nicht gewollt! Jetzt wisst ihr’s! Nein, ihr wisst’s nicht! Ist mir auch egal, ob ihr’s wisst oder nicht! Ich weiß es und ich werde von nun an in dieser verkommenen Kapelle meinen Sonntag heiligen.
Peter schob die morsche Tür beiseite. Sie knarrte und schreckte die Vögel unter den Dachsparren auf.
Später betrat er von außen her den kleinen Chorraum. Er klappte den Spieltisch der Orgel auf und griff über die fünf Oktaven. Die meisten Tasten blieben unbeweglich, einige gaben nach – dann knisterte es irgendwo und husch! stoben ein paar Mäuse in die Ecken. Aha, dachte Peter, und dann sah er die Verheerung mit dem Blasbalg. Er überprüfte die Orgelpfeifen. Sie waren noch alle da, in den Windladen fraß der Wurm. Von den metallenen hob er einige heraus, das D, das F und das A. Er blies sie hintereinander an und dann alle gemeinsam. Wie das klang! Noch einmal blies er, blies, bis ihm der Atem ausging. Und dabei hörte er die hohen, ganz feinen Töne mit und die grollenden Bassstimmen, hörte das gewitterartige Brummen der Sechzehnfuß-Pfeifen, die in dieser kleinen Orgel gar nicht standen. Ja, und dann hörte er niederrieselnde Kadenzen und rauschende Kaskaden und wiederum weich hinflutende Melodien, und immer wieder blies er seine drei Töne.
Er kam heim. Als sie gegessen hatten und vom Tisch aufgestanden waren, begann Peter ein Gespräch mit dem Knecht Thomas.
Thomas, mit dem merkwürdigen Zunamen Krautnudel, war seit etwa zehn Jahren in der Mühle. Peter hatte ihn schon gekannt, noch ehe er zum Studium nach München geschickt worden war. Denn schon damals hatte er gern bei ihm in der Müllerstube gesessen und hatte zugeschaut, wie er aus Birnbaum schöne Figuren schnitzte, nicht zu reden von den seltsamen Landschaften ohne Berge und ohne Hügel, die er mit Kohlestiften an die Wände seiner Schlafkammer gemalt hatte. Peter hatte diese Bilder erst vor einigen Tagen wieder gesehen und sich an ihnen erfreut. Es mussten wohl jene Gegenden sein, aus denen Thomas kam.
Thomas war nämlich ein Zugereister, ein Franzose oder, wie man sagte, ein Emigrant. Damals, vor neun Jahren, war er noch ein junger Bursche gewesen, hatte nur wenig Deutsch verstanden und fast nichts zu reden vermocht. Inzwischen war ihm aber mit der eifrigen Lektüre in Gebetbüchern, andere gab es in der Mühle nicht, eine beachtliche salbungsvolle Geläufigkeit des Ausdrucks zuteil geworden.
Peter redete Thomas an: »Wenn du einige Stunden Zeit hast, Thomas, könntest du mir helfen.«
»Was soll ich helfen, Monsieur Pierre?«
»Du musst mit mir gehn, hinauf zur Ölbergkapelle.«
»Soll ich helfen beten? Wahrlich, ich habe gebetet in heiliger Messe, eine Stund, und gehört eine Predigt, auch eine Stunde, sind zwei Stunden, Monsieur Pierre! Reicht aus für eine Woche!«
»Geh, Thomas, wer redet vom Beten!«
»Pardon, Monsieur, wir gehen zur Kapelle!« Und er lachte.
So schritten sie langsam von der Mühle quer durchs Tal und stiegen den Hang hinauf. Peter erklärte Thomas seine Bewunderung für die Bilder in der Schlafkammer.
»C’est la patrie, Monsieur, und wer kann schon die Heimat vergessen?«
»Dass du dann zu uns in die Berge gekommen bist, wo doch deine Heimat in der Ebene zu liegen scheint?«
»Oh, Monsieur, leichter verkriecht sich das Mäuschen im Steinhaufen, leichter verbirgt sich der Räuber im Gebirge.«
»Hast du eine Übeltat auf dem Gewissen?«
»Que voulez-vous? Wer kein Sünder ist, der möge auf mich werfen den ersten Stein. Ich war siebzehn Jahre alt. In Torigny, einem unwichtigen Ortchen der Normandie, galt ich als ein charmanter junger Mann. Da starb das Weib des Grafen Guy de Matignon. Er trauerte eine kleine Zeit, dann machte er mich zum Verwalter in seiner Kanzlei und reiste über Land, um ein anderes Weib zu suchen. Nach etlichen Monaten brachte er aus dem Süden ein reizendes Liebchen mit, das noch ein junges Mägdlein war, justement achtzehn – und bei ihm zählten sie fast ein halbes Jahrhundert. Was soll ich sagen, Monsieur? Es vergingen etliche Wochen, da versuchte die kleine Gräfin, wie in der Bibel bereits das Weib des Potifar, mich zu versuchen. Ich handelte aber nicht wie einst der ägyptische Joseph und ließ es geschehen. Voilà, Monsieur, c’est la vie! Und wieder nach ein paar Wochen, da kam Guy de Matignon beim Morgengrauen von der Jagd heimgeschlichen. Ich sprang über den Balkon und fiel zu den Goldfischen in den Teich. Das war nicht schlecht, doch die Frau Gräfin hatte mein Gewand. Ich flüchtete über die Wiesen und kam glücklich in einen Wald. Hier sammelte eine alte Frau Laub für die Ziegen. Als sie mich sah, erschrak sie und hielt sich die Hände vor das faltige Gesicht. Da zog ich ihr die Jacke und den Rock aus und verhüllte meinen Kopf mit ihrem Schultertuch. Nach vielen Tagen war ich in Dieppe am Meer. Da hörte ich, dass sie mich suchten.
Matignon gelüstete es nach meiner Haut. Ich verkroch mich zwei Tage, dann fassten mich die Spitzel am Hafen. Wochenlang ließen sie mich fasten, dann verurteilten sie mich auf eine Galeere.
Aber ich war zum Rudern nicht fähig, so ketteten sie mich nicht an. Grace à Dieu! Zwei Wochen später legten wir bei Dunkercken an. Ich hüpfte ihnen davon, was bei dem commerce florissant in dieser Stadt leicht gelang. Sie fanden mich nicht wieder. Fast ein ganzes Jahr lang habe ich habe dann noch vieles getan, Monsieur Pierre, das nicht gut war. Eh bien, ich habe zu mir gesagt, on recommence! Und so kam ich zu euch. C’est tout!«
Thomas schwieg und blieb stehen.
Peter gab ihm die Hand und sagte: »Thomas, ich danke dir! Wenn’s Gott gefällt, dann wollen wir viele Jahre beisammen sein.«
Da bekam der Knecht feuchte Augen, so hatte in Sachrang noch niemand zu ihm gesprochen.
Thomas war geschickt, in den neun Jahren seiner Tätigkeit als Müller und Säger hatte er das bewiesen. Vater Schorsch, der Alte, hielt große Stücke auf ihn und vertraute ihm ohne Bedenken.
Peter führte ihn auf den Orgelboden der Ölbergkapelle und zeigte ihm die große Verwüstung, die sich in dem einst beachtlichen Instrument breitgemacht hatte. Thomas erkannte seine eigene Aufgabe in der Erneuerung sämtlicher Windladen. Sie bauten die Windladen und den Blasbalg aus, numerierten die Pfeifen und stellten sie gruppenweise zusammen. Die ganz kleinen vom Flauto-Register bündelten sie mit einem Strohband und legten sie behutsam in eine Kiste. Dann krochen sie in die Mechanik hinein und entfernten aus den Drähten die noch warmen Mäusenester.
Den beiden Männern stand der Schweiß auf der Stirn, und ihr üppiger schwarzer Haarwuchs war grau gestäubt, gerade als wären sie aus der Mühle gekommen. So war es Abend geworden.
Als sie heimkamen, hatte Ursula bereits den Abendtisch gedeckt. Sie aßen mit ihr allein, denn der Vater war in die Dorfwirtschaft gegangen, und der Bruder spielte wie gewöhnlich mit dem Schlosskaplan und den Schulmeistern auf Hohenaschau Quartettmusik. Die Ursel zählte zwar noch nicht vierzehn Winter, versah aber die Hauswirtschaft mit mütterlich ererbter Geschäftigkeit und Umsicht. Alle Männer aus der Mühle, der Vater eingeschlossen, verehrten sie und gingen mit ihr um wie mit einem Rauschgoldengel – behutsam und schützend. Das wusste sie auch. Und so strahlte sie jene kindliche Reife aus, die – weil nicht kopiert, sondern unter einer Aufgabe gewachsen – Achtung fordert. Sie war auch die eigentliche Ursache, weshalb es zwischen dem Vater und dem heimgekehrten Peter zu keiner offenen Auseinandersetzung gekommen war, denn sie behandelte den Bruder mit ausgesuchter Verehrung und Liebe. Der Vater merkte das und schluckte deshalb viele Fragen ungefragt hinunter. Der schöne Friede im Haus war mehr wert als das Wissen um Dinge, die man vielleicht nicht einmal richtig verstehen konnte.
Es kam der Winter. Seit Menschengedenken war er nicht so schneereich gewesen wie in diesem Jahr 1786. In den Wäldern zu beiden Seiten des Sachranger Tales knallte und krachte es Tag und Nacht. Der Vater meinte immer wieder mit jammervollem Ausdruck, kein Mensch könne den Schaden ermessen, den dieser Schneebruch verursachte, und erst im Frühjahr werde man das Greuel der Verwüstung sehen.
Im kommenden Frühjahr würden draußen die aufgespaltenen, geschlitzten und abgedrehten Baumleichen liegen, die man nicht einmal als Brennholz nehmen mag, weil man an ihnen die Handsägen zerreißt!
Wie wäre es denn? … – Ganz plötzlich kam Peter die Idee in den Sinn –, wie wäre es, wenn man diese Katastrophe in den Wäldern mit der Sorge der Ahnen verbände? Man behaut die verdrehten Stämme roh und schichtet sie nebeneinander ins Mühlbett. So entsteht eine glatte Sohle und man hat das Gerinn beschleunigt. Beschleunigung aber ist Erhöhung der Stoßkraft, ist Steigerung der Energie! Und daran hat’s schon immer gefehlt. Doch wer bezahlt die Zimmerleute, die zum Behauen so vielen Holzes nötig sind? Peter dachte weiter. Gelingt es, ins Sägegatter ein zweites Blatt zu hängen, kann man die Stämme mitten durchlaufen lassen, und sie sind glatter, als der beste Zimmermann sie zuhauen kann.
Die Säge stand seit altersher stets als zweite im Rang. Nicht ihr, sondern der Mühle dankte man es, dass die Müller im Aschacher Grund einen guten Batzen Gold in der Truhe hatten. Wenn also aus der Sache mit den zwei Sägeblättern etwas werden sollte, dann eben nur im Frühjahr. Bis dahin mussten die Stämme aus dem Walde herein sein: ein unmäßiges Stück Arbeit. Wer soll das vollbringen?
Wer anders, als er, der Peter, mit dem Thomas Krautnudel, vorausgesetzt, dass der Vater tagsüber die Mühle versehen könnte. Nun, darüber, wie überhaupt über das ganze Projektum, musste mit dem Vater eingehend gesprochen werden.
Die Unterredung geschah dann zwei Tage später. Der alte Müller ließ seinen Sohn ganz zu Ende reden und unterbrach ihn nicht. Und er schwieg noch eine ganze Weile, als Peter schon fertig war. Dann drehte er sich halb zu ihm hin, legte seine runzlige Hand auf das Knie des Sohnes und sagte: »Peter, hätt’ net denkt, dass du so viel Lieb zu unserem Sach hast. Und ich könnt mir net denken, weg’n was dös net gehn sollt. Aber dös braucht noch übaschlafen!«
In den folgenden Tagen nahmen alle im Haus wahr, dass mit dem alten Schorsch eine Wandlung vor sich ging: Er wurde jünger. Sein müder Schritt schien sich zu festigen, seine dunklen Augen hatten mehr Licht, sogar seine krummen Schultern strafften sich.
Fünf volle Tage fuhr der alte Schorsch so fort. Am sechsten begab er sich vom Wohnhaus hinunter zur Mühle, die als ein eigenes Gebäude noch ungefähr zweihundert Fuß hinter der Säge lag, und trat in die Müllerstube ein, wo Peter und der Knecht Thomas mit der Ausbesserung von Orgelteilen beschäftigt waren. Er schickte den Knecht hinaus und setzte sich dem Sohne gegenüber. In diesem Hinsetzen lag Feierlichkeit – so etwa setzen sich Bischöfe hin, wenn sie ihren brokatenen Ornat anhaben. Dem Peter war das nicht entgangen, erwartungsvoll schaute er den Vater an.
»Also, Peter, dös mit derer Mühlbachg’schicht geht net. Eigentli’ ganget’s schon, nacha müsseten aber die Bam gleich jetzt aus’m Holz ’raus. Und dös kann neamand machen. Bei dem Schnee und bei derer Hundswitterung kann dös neamand machen!«
Peter überlegte. Nach all den langen Tagen, nach denen sich der Vater so intensiv mit dem Projekt beschäftigt hatte, hatte er eine günstigere Entscheidung erwartet. Nun, der Vater musste es ja wissen. Sein Wort allein galt in diesen Dingen. Etwas anderes aber war die Begründung, die er angeführt hatte, hierauf konnte geantwortet werden.
»Ja mei, Vater!«, sagte er also, »wann’s sonst nix wär, wie die Bam, nacha is dös net schlimm. Oder moanst net, dass i’s mit’m Thomas fertig brächt?«
»Der Thomas kunnt’s scho, aber du net. Du bist koa Holzknecht net, Peter, und von dir mag i dös a net hab’n. Oder moanst, i lass di noch besser auslachen? Du bist mei Bua und du kriegst amoi mei Sach, dös woaß i. Nacha derf ma aber a net arbeiten wie a Knecht, dös ghört si net.«
»Und wenn ma mit’m Thomas noch ein’n andern dingen tät?
»In Sachrang kriegst jetzt koan Hund net.«
»Und wann i oan kriagat tät, Vater?«
»Ja, dös wär was anders! Aber glaub mir’s, du kriegst koan, in Sachrang net und drüber der Grenz a net.«
Damit war die Angelegenheit des Mühlbaches als erledigt zu betrachten.
Der rote Franto
Ihn hatte der böhmische Wind über den Wald hergeweht. Das war vor etwa zehn Jahren gewesen, damals, als man den Müllner-Peter just zum Studium in die Hauptstadt schickte. Der rote Franto, ein fester Dreißiger, hatte die bildhübsche schwarze Anja, sein junges Weib, mitgebracht. Beim Ertlbauern drüben am Noppenberg hatten sie sich als Knecht und Magd verdungen. Das ging einige Jahre sehr gut.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!