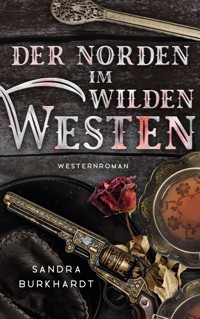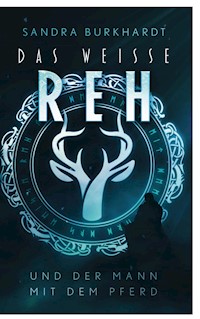Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Außenwelt
- Sprache: Deutsch
178 Jahre nach dem Tag des Zerfalls. Zurückgeblieben ist eine unterdrückte Gesellschaft in einer vermeintlich perfekten Stadt, umringt von todbringender Natur. Außerhalb der schützenden Stadtmauern kämpft die als Abtrünnige gebrandmarkte Ranya um das Überleben ihrer kleinen Gemeinschaft ausgestoßener Bürger. Doch nach einem gescheiterten Diebstahl ist nichts mehr, wie es vorher war. Verstört muss sie feststellen, dass der Mythos der Tiermenschbestien, die in der Außenwelt ihr Unwesen treiben, einen Funken Wahrheit innehat. Durch eine rätselhafte Verbindung mit dem überheblichen Fuchshybriden Argon wird jede Rückkehr in ihr vorheriges Leben unmöglich. Als auch noch der Alpha der Hybriden von der verbotenen Verbindung in seinem Volk erfährt und die Wächter der weißen Stadt immer tiefer in den Giftwald vordringen, holt Ranya ihre Vergangenheit ein und droht ihr düsteres Geheimnis zu enthüllen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Steven, Johanna und die wunderbaren Hutträger hoch zu Ross
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Prolog
„Sie ist ein Mädchen, Doktor.“, sagte der junge Student verwundert.
„Welchen Studiengang haben Sie gleich noch belegt, dass sie solch eine Beobachtungsgabe gelehrt bekommen haben?“ Augenrollend wendete sich der Arzt dem schlanken Mann an seiner Seite zu.
„Also... ich... Sie sagten doch es handelte sich um eine Lösung für das Problem?“ Völlig damit überfordert die spärlichen Informationen, die man ihm vor seiner Anstellung zu diesem Projekt gegeben hatte, mit der Wirklichkeit, die gerade vor ihm stand zu verbinden, sah der junge Mann wieder auf das Mädchen.
Wahrscheinlich hatte er etwas anderes erwartet. Ein Gerät oder eine Chemikalie, vielleicht auch eine Gruppe Männer, ausgerüstet mit hochtechnisierten Waffen.
Aber da stand nur ein tanzendes Mädchen. Dabei war es viel mehr eine heranreifende Frau, die dort hinter einer Glasscheibe in perfekter Haltung an einer flüssigen Sissone arbeitete. Ein minimales Zittern, kaum zu bemerken, zog sich durch ihre angespannten Muskeln, wenn sie in der Grundhaltung aufkam.
Der Arzt zuckte kurz verärgert mit den Mundwinkeln, als es beim nächsten Sprung wieder passierte. Auch ihr missfiel scheinbar dieser Fehler, der diesem anmutigen Tanz jedoch bei Weitem keinen Abbruch tat. Wieder ging sie zurück in Grundstellung. Ihre Arme bildeten einen perfekten Kreis, um den definierten, schlanken Oberkörper, der unter dem engen weißen Stoff verborgen war. Die helle Haut ihrer Finger, war von einigen roten Striemen unterbrochen. Erneut atmete sie aus, dann schloss sie die Augen, um mit dem Takt der wundervollen Klaviermelodie einen neuen Versuch zu wagen. Doch wieder durchzog das leichte Zittern ihre Waden bis in die nackten Oberschenkel. Entrüstet atmete sie aus, ließ ihren Oberkörper in die Entspannung fallen, während ihre Füße weiter in der Grundposition verharrten. Mit geballten Fäusten stürmte der Arzt in den Raum und ließ den jungen Studenten verwundert zurück. Krachend öffnete er die Tür. Erschrocken zuckte das Mädchen zusammen. Ihre gerade noch so grazilen Bewegungen, wurden zu einem stolpernden Rückzug in die Ecke des Raums.
„Wieso konzentrierst du dich nicht?“, schrie er sie an.
„Ich versuche es doch.“ Verschreckt hielt sie sich die Hände vor den Körper, als müsste sie eine schmerzhafte Konsequenz erwarten.
„Versuchen? Versuchen? Wie kannst du dieses alberne Rumgehüpfe auch nur als Versuch bezeichnen?“ In den Falten auf seiner Stirn zeigte sich offen sein Zorn.
„Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht enttäuschen.“ Sie wagte es kaum, ihn anzusehen.
Ohne Vorwarnung gab er ihr eine schallende Ohrfeige, sodass ihr Gesicht zur Seite schlug. Wimmernd hielt sie sich die Hand an die Wange, drückte ihren Körper fester in die Ecke und sank darin zusammen. Mit angehaltenem Atem starrte der junge Student weiter durch die Glasscheibe.
„Da draußen steht ein junger Mann. Frisch von der Universität. Er hat zahllose Tests durchlaufen, um an dir mitwirken zu können. Glaubst du er hat das alles investiert, damit er dieses tollpatschige Gehampel unterstützt?“
Energisch stellte sich der Arzt vor das schluchzende Mädchen.
„Du hast ihn enttäuscht, direkt an seinem ersten Tag. Und wieder einmal hast du mich enttäuscht, obwohl ich doch der Einzige bin, der hier für dich einsteht.“ Verachtend schaute er auf sie herab.
„Was soll nur aus dir werden, mein Mädchen?“ Seine Stimme veränderte sich aus der Wut in eine liebevolle Fürsorglichkeit.
Er kniete sich zu ihr hinunter, strich ihr behutsam über die gerötete Wange und sah sie besorgt an. Weinerlich schaute sie zu ihm auf. Dass, was der junge Student dort mit ansah, war genauso wirr, wie die Geschichte selbst, die man sich unter den Wächtern und Bürgern Atmoras erzählt.
1
Ich spürte eine sanfte Wärme, die schwerelos meine Haut streichelte. Langsam öffnete ich meine müden Augen und blickte auf das spärlich, mit Planen geschützte Dach, durch dessen Löcher mich das Licht des Tages begrüßte. Der Staub funkelte zauberhaft, wie kleine Edelsteine im Schimmer des Morgens.
Eine grüne Plastikplane überspannte das verwitterte Holz des Dachstuhls meiner alten Baracke. Doch das unberechenbare Wetter hatte seine Spuren darin hinterlassen, denn dort wo jetzt so friedlich die Sonne hindurch schien, stürzten sich an anderen verregneteren Tagen kleine Wasserfälle in mein Zuhause. Für einen kurzen Augenblick, fasziniert von der Schönheit des Moments, war ich zufrieden. Keine Sorgen oder Ängste bedrängten mich. Nur tiefe Entspannung umhüllte meinen Körper. Doch so schnell wie dieses Gefühl aufkam, so rasch verschwand es wieder. Die Realität holte mich ein, während ich an das Dach starrte. Träge setzte ich mich auf, wodurch meine Hängematte leicht schaukelte.
Als wäre ich zum ersten Mal hier aufgewacht, schaute ich mich um. Dabei lebte ich hier schon seit fast sechs Jahren. Zog ich die ersten Tage gejagt umher, fand ich in dieser maroden Hütte Zuflucht. Im Laufe der Zeit hatte ich mich immer mehr eingerichtet, kleine persönliche Gegenstände platziert, ein paar Möbel aus diversen Fundsachen aufgebaut und die Hütte immer weiter abgedichtet. Ich lauschte nach draußen, um zu hören, ob schon jemand wach war. Doch es blieb gewohnt still. Nur das Summen einiger Fliegen im Raum drang in mein Ohr.
Vor sechs Jahren hatte ich dieses Lager gefunden und aufgebaut. Zunächst nur für mich allein, doch bei dem Leid, dass sich in diesem Giftwald abspielte, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich die erste arme Seele hier aufnahm. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr. Meistens fand ich sie auf meinen Versorgungsgängen. Aber manchmal kamen sie von ganz allein durch die Büsche gestolpert. Entkräftet, geschunden von der Außenwelt, brachen sie hier mitten im Lager zusammen. Es war ein geschützter Ort, versteckt im Wald, umrandet von hohen Sträuchern, die uns vor den Augen unserer Feinde verbargen. Doch den Wenigsten gelang es unbeschadet, den Wald auf seinen schmalen Pfaden bis zu den alten Baracken, in denen wir lebten, zu durchqueren. Die meisten Mitglieder meiner kleinen Gemeinschaft waren Frauen mit Kindern, die ihre Männer verloren hatten. Mit waghalsigen Fluchtversuchen waren sie den Fängen der Wächter entkommen und irrten dann verängstigt durch den Wald, bis ich sie fand. Schon oft habe ich die von Maden übersäten Leichen derer gefunden, die es nicht geschafft haben. Niedergestreckt von der erbarmungslosen Natur dieser Erde, hatten sie ihr jähes Ende gefunden. In meinem Kopf blitzten die Bilder der kalten, auf dem bodenliegenden Körper auf, in den Armen fest an sich gedrückt, die fahlen zerbrechlichen Kinderleiber. Übelkeit stieg in mir auf, als ich in meiner Erinnerung den furchtbaren Leichengeruch wahrnehmen konnte.
Ich dachte an meine eigene Flucht und welches unsagbare Glück mir zuteilgeworden war, nicht so qualvoll gestorben zu sein. Wir alle hatten eins gemeinsam. Geflüchtet, um den Wahnsinn Atmoras zu entkommen. Atmora, die große Stadt, die wie ein dreistöckiger Pilz in die Höhe ragt. Steril versiegelt hinter einer hohen Mauer aus fanatischen Drang zur Perfektion. Umhüllt von der allgegenwärtigen Propaganda des Herrschergeschlechts. Keine Kriminalität, kein Hunger, kein Leid, keine Meinung, kein Leben. Reichtum und Macht waren nur den treusten Anhängern der Herrscherfamilie vergönnt. Die normalen Bürger wurden mit gnadenloser Gewalt zu eiserner Disziplin gezwungen. Für alle die sich gegen das System wehrten oder die Herrscherfamilie in Frage stellten, ist Atmora eine lebensfeindlichere Umgebung als die Außenwelt, weshalb viele die Flucht hier hinaus in Erwägung zogen. Aber dennoch verkaufte sich Atmora als perfekter Lebensraum. Es war ein offenes Geheimnis das Atmoras Wächter mit uns Abtrünnigen kurzen Prozess machten. Diese treubrüchigen Bürger wurden nachts schreiend aus ihren Häusern gezerrt. Auf offener Straße, damit jeder es sah, vergewaltigten sie die Frauen. Die Kinder malträtierten die angeblichen Schützer der weißen Stadt mit zahllosen Elektroschocks solange, bis ihre Lumpen Feuer fingen und schlussendlich richteten sie die Männer, die diese Grausamkeiten auf Knien um Gnade flehend mit ansahen, durch einen gezielten Schuss hin. An manchen Abtrünnigen wurde hingegen ein anderes Exempel statuiert. Sie werden entkleidet, mit auf dem Rücken gebundenen Händen vor dem Tor ausgesetzt und dann zum Abschuss freigegeben. Die einzige Chance bestand darin, in den Giftwald zu flüchten, wo der Tod einige Tage später, doch umso qualvoller auf sie treffen würde. Es wird schweigend toleriert, was dort beinahe täglich geschieht. Die Bewohner Atmoras ertragen diese Gewalt, weil die Furcht das Gleiche, zu erleben, viel zu groß ist.
Nach jeder Hinrichtung gibt es eine propagierende Rede mit der drohenden Ankündigung, es mit jedem gleichzutun, der abtrünniges Gedankengut hegt.
Schließlich, so die verlesenen Worte des Herrschers, sind diese Maßnahmen notwendig, damit die vorbildlichen Bürger geschützt werden können.
Vorbildliche Bürger fügen sich bedingungslos ihrer angeborenen Sektion. Die Sektionen bestimmen das Leben. Welchen Beruf man ausüben darf, wen man lieben muss, wo man sich bewegen soll und wie man sich zu verhalten hat.
Hinter der Abschottung dieser Stadtmauern wissen die Menschen nicht genau, was hier in der Außenwelt passiert. Aber sie erzählen ihren Kindern die Schauergeschichten von dieser Welt da draußen. Meiner Welt.
Ich schüttelte meinen Kopf, um die Gedanken zu verscheuchen. Mein Genick war steif von der unbequemen Position, in die meine Hängematte mich jede Nacht zwang. Doch lieber einen krummen Rücken, als auf dem Boden, zwischen den Mäusen und den Asseln zu schlafen. Meine Finger griffen nach dem dünnen verdreckten Stoff, der mich einigermaßen vor der nächtlichen Kälte schützte.
Nach einem tiefen Atemzug befreite ich mich von der löchrigen Decke. Wie auf einer Schaukel ließ ich meine Beine über den Boden hängen. Ummich selbst zu motivieren, streckte ich meinen Oberkörper. Langsam stellte ich so meine Beweglichkeit wieder her. Meine Sinne schärften sich, als ich mich aus der Hängematte heraus aufstellte. Kleine Schaben suchten panisch nach einem Versteck, als meine nackten Füße den staubbedeckten Boden berührten. Meine Augen verfolgten ihre Flucht über die Holzdielen. Nichts war hier wichtiger als wache Sinne, sonst würde einen der Tod direkt hinter dem nächsten Baum überraschen. Noch einmal hob ich die Hände streckend nach oben und stellte mich auf die Zehenspitzen. Meine Gelenke machten befreiende knackende Geräusche, als ich sie überstreckte. Währenddessen atmete ich tief ein, hielt die Luft an und ließ sie, beim Herabsenken der Arme, wieder aus meinen Lungen.
Ich ging einige Schritte zu meiner Kunststoffkiste, in der ich die wichtigsten Sachen wettergeschützt lagerte. In der Hocke öffnete ich mit beiden Händen die Verschlüsse. Gähnend hob ich den hellen verschmutzten Deckel an. Mit einem kräftigen Atemzug pustete ich darüber hinweg, so dass der Staub in kleinen Wirbeln durch die Luft flog.
„Dieser elende Staub!“, flüsterte ich ärgerlich zu mir selbst.
Unter dem Deckel klebte ein Foto eines kleinen Hauses, davor winkten zwei altertümlich gekleidete Erwachsene in die Kamera, auf ihren Armen trugen sie zwei kleine Kinder. In meiner Bewegung hielt ich inne, während mein Blick von dem alten verwitterten Bild angezogen wurde. Erneut schüttelte ich den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, die sich meiner Erinnerung bemächtigen wollten. Meine Hände griffen nach den zusammengeknüllten Kleidungsstücken, die ich den Abend zuvor erschöpft hinein geworfen hatte. Routiniert schlüpfte ich in meine braune Hose, dann strich ich das schwarze, viel zu große Shirt, das ich während der Nacht an hatte, glatt. Danach nahm ich lange dunkle Stoffstreifen heraus. Diese wickelte ich mir straff um die Hände, hinauf bis kurz hinter meine Ellenbogen, damit nur meine Finger unbedeckt waren. Zum Schluss stieg ich in meine alten Stiefel, schnürte sie fest zu, band mir mein dunkelgrünes Tuch um den Hals und war bereit für diese Welt. Jetzt war ein Großteil meiner Haut bedeckt, um mich vor den Dornen und den giftigen Blättern der Pflanzen zu schützen. Nachdem ich die Kiste wieder dicht verschlossen hatte, lief ich zu der Metallplatte, die meine Tür darstellte. Mit einem beherzten Ruck zog ich sie zur Seite.
Der orangerote Morgen begrüßte mich in seiner ganzen Schönheit. Über den Dächern unserer Baracken schwebte der morgendliche Nebel und zog einen zusätzlichen Schleier über die vom atmosphärischen Staub geschwächte Sonne.
War der Himmel für gewöhnlich mit dicken grauen Wolken verhangen, schien die Sonne nun, wie eine rettende Laterne im Dunst an einem der ersten düsteren Tage des Dunkelhalbjahrs. Meine Augen brauchten einen Moment, um sich an das helle Licht zu gewöhnen. Mein Blick schweifte prüfend über das gesamte Lager. Unsere Feuerstelle in der Mitte schwelte nur noch etwas. Das war das Erste, was ich erledigen musste. Also lief ich hinüber, legte ein wenig Holz nach, um die Glut neu zu entfachen.
„Ranya! Ranya! Ranya guck mal!“ Schräg hinter mir unterbrach eine aufgeregte Kinderstimme die gegenwärtige Stille.
Noch bevor ich mich herumdrehte, tauchte in meinem Augenwinkel ein kleines Mädchen auf. Aufgeregt hielt sie ein Fellbüschel in die Luft. Sanft lächelnd schaute ich sie an. Ihre kleinen Beine stolperten über die Erde in meine Richtung. Die langen blonden Haare waren zerzaust. Erde klebte an ihren Wangen und den etwas zu großen Kleidern.
„Was hast du denn da?“, fragte ich.
Interessiert hockte ich mich zu ihr herunter.
„Guck mal! Hab ich selbst gefangen! Ganz alleine!“ Mit stolzgeschwellter Brust hielt sie mir das Fellbüschel unter die Nase.
Sie stellte sich kerzengerade, wie eine kleine Soldatin, hin. Eine mickrige Maus oder Ähnliches hing dort tot in ihrer Hand. Natürlich war sie sichtlich stolz auf ihren ersten Jagderfolg. Bewundernd begutachtete ich ihre kleine Beute.
Schwer beeindruckt nickte ich. „Am besten du bringst es deiner Mutter, die kann es sicherlich gebrauchen!“
Sie war von diesem, durchaus ernstgemeinten, Vorschlag begeistert. Wir hatten kaum genug Nahrung für alle. Jede noch so wässrige Mäusesuppe brachte wenigstens einen von uns über den Tag. Freudig tippelte sie in Richtung ihrer Hütte. Zwischenzeitlich brannte das Feuer wieder auf.
Allmählich kam Leben in meine Gemeinschaft. Plastikvorhänge raschelten, einige Türen knarrten beim Öffnen der Baracken. Überall kamen eingehüllte Menschen heraus, die sich verschlafen begrüßten, bevor sie auf mich zukamen.
In kurzer Zeit waren alle wesentlichen Menschen um mich versammelt. Sie sahen mich mit schläfrigen, aber erwartungsvollen Augen an. Mittlerweile waren wir sechs arbeitsfähige Personen. Der Rest der Gemeinschaft waren Kinder, Mütter oder Verletzte. Ich schaute in die Augen meiner Mitstreiter. Zwischen uns herrschte ein fester Zusammenhalt, der trotzdem von einem beständigen Misstrauen untergraben wurde. Wer hier draußen überleben wollte, vertraute nur sich selbst. Trotzdem wusste ich, dass ich mich auf alle der umstehenden Personen verlassen konnte, auch wenn ich den einen oder anderen mehr unter Beobachtung hielt.
Sam hatte die Arme verschränkt. Obwohl er die Hälfte seines Gesichts hinter einem Tuch verbarg, sah man ihm seine immerwährende schlechte Laune an. Er war ein erstaunlich talentierter Jäger, bewegte sich geschickt durch das dichte Geäst, als wäre er hier draußen aufgewachsen. Wenn ich ihm eine Aufgabe übertrug, wusste ich, dass er sie problemlos erledigen würde, trotzdessen er damit zu kämpfen hatte Befehle von mir, einer Frau, entgegenzunehmen. Aber seine Widerworte hatte er mittlerweile aufgegeben.
Jetzt trafen mich nur noch verärgerte Blicke, wenn ich ihm etwas befahl, dass ihm widerstrebte. Innerlich war er ein guter Mensch, dessen war ich mir sicher.
Außerdem war er für uns unverzichtbar geworden. Äußerlich hingegen war er ein schwieriger Charakter, äußerst schweigsam und unvorhersehbar still. Falls er doch etwas zu sagen hatte, klang es immerzu mürrisch. Allerdings konnte er auch aufbrausend sein, wenn ihm etwas missfiel. Zu Beginn war ich deshalb in einigen Situationen der Entscheidung nahe, ihn aus der Gemeinschaft zu werfen.
Aber ich hatte die Vermutung das Atmora oder die Tage im Wald ihn gebrochen hatten. Sicherlich verbarg er hinter seiner undurchdringlichen Fassade eine fürchterlich traurige Geschichte. Er war hier in der Gemeinschaft der Einzige, der nie ein Wort über seine Vergangenheit verloren hatte. Zunächst hatte ich mich darum bemüht, mehr über ihn zu erfahren, doch nach einigen eskalierten Gesprächen, habe ich beschlossen ihn damit in Ruhe zulassen. So hoffte ich, dass er irgendwann genug Vertrauen aufbaute, um seine Geschichte von selbst zu erzählen.
Mein Blick wanderte zu Boran, der neben Sam stand. Er bildete das genaue Gegenteil zu ihm ab. Ein schlanker, großer Mann, der seine schwarzen Haare gepflegt nach hinten gekämmt hatte. Gutgelaunt lächelte er alle an, während er seine Hände in den Hosentaschen versteckte. Ungeduldig auf meine Befehle wartend, wippte er immer wieder federnd mit seinen Füßen auf und ab. Ich wusste, welcher Tatendrang aus ihm sprudelte, wie sehr er die zahlreichen Gespräche mit den Gemeinschaftsmitgliedern genoss. Jeder konnte sich seiner Hilfe oder seines Rats sicher sein. Boran war für viele in der Gemeinschaft ein Halt. Oft beschäftigte er sich väterlich mit den Kindern. Meist nannten die ihn liebevoll Onkel Bo. Sie fühlten sich in seiner Gesellschaft sichtlich wohl. Er sorgte dafür, ihnen in dieser feindlichen Umgebung etwas unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Hierfür war ich ihm sehr dankbar. Wenn er jedoch von seiner eigenen Familie sprach, sah man die ganze Trauer in seinem Gesicht. Für sie nahm er die Verbannung in den Wald auf sich, opferte sich für das Fehlverhalten seines Sohnes, damit sie friedlich in Atmora weiterleben konnten.
Wir fanden ihn, geschunden von den messerscharfen Blättern und Dornen, durchtränkt mit dem Gift der Pflanzen, auf einer kleinen Lichtung. Hier im Lager heilte er langsam, erst physisch, dann psychisch. Schlussendlich lernte er von Sam und mir, sich zu schützen und zu versorgen.
Neben ihm stand Kuro, ein junger euphorischer Mann, nahezu modisch gekleidet, den man immer ein wenig im Auge haben sollte, damit er sich nicht aus Versehen selbst in Gefahr brachte. Er war unser neustes Mitglied und noch nicht vertraut mit den ungeschriebenen Gesetzten der Außenwelt, wobei ihm seine Tollpatschigkeit immer wieder im Weg stand. Sam hatte sich recht schnell geweigert ihn weiterhin mit auf die Jagd zu nehmen, da er ihn am laufenden Band aus bedrohlichen Situationen befreien musste, in die Kuro sich selbst hinein manövriert hatte. In Atmora hatte er Medizin studiert. Er war ein Experte seines Faches. Aber er war eben ein Theoretiker, kein Praktiker. Doch jemand mit seinem Wissen war hier draußen von unschätzbarem Wert. Bis heute ist mir unklar, wie er mit der Leichtigkeit eines Spaziergangs spielend ins Lager hinein schlendern konnte. Einer wie er, wäre normalerweise direkt zu Tode verurteilt worden. Gelehrte oder Bürger aus höheren Sektionen werden unverzüglich aus dem Weg geschafft. Die Gefahr, dass sie andere bekehren würden, wäre zu groß.
Früher oder später werde ich ihn darauf ansprechen, um meine Skepsis ihm gegenüber vollständig fallenzulassen. Allerdings waren wir vorerst um einiges sicherer mit ihm, auch wenn wir auf seine Unwissenheit achten müssten. Als hätte er meine Gedanken gehört, schob er sich seine Brille mit dem Zeigefinger überzeugt auf seiner Nase nach oben.
Lyra und Jarina beugten sich einander zu. Undeutlich tuschelnd flüsterten sie sich gegenseitig irgendetwas ins Ohr. Der verstohlene Blick beider Zwillinge in Kuros Richtung ließ mich erahnen, worum es in ihrer Geheimniskrämerei ging. Sie glaubten ernsthaft, dass es mir nicht auffallen würde, wie offensichtlich beide an dem jungen Mann interessiert waren. Doch bei aller Naivität, die diese beiden Mädchen ausstrahlten, musste man sie für ihren ungebrochenen Lebenswillen bewundern. Die wenigsten Fünfzehnjährigen hätten den Verlust ihrer Eltern und die Verbannung in die Außenwelt so gut verkraftet, wie diese beiden. Es war eine himmelsgleiche Fügung, dass ich sie direkt, nachdem man sie vor den Toren ausgesetzt hatte, fand. So konnte ich dem Tod wieder zwei Leben entreißen, die ihm versprochen waren. Dabei wusste ich doch insgeheim, dass dieses Tauziehen schon längst verloren war. Konnte ich auch nur einen befreien, holte sich der Tod dafür mindestens zwei andere Seelen.
Erst jetzt bemerkte ich die auffordernden Blicke in meine Richtung. Abermals war ich in meinen Gedanken völlig abgeschweift. Scheinbar war heute wieder einer dieser tiefsinnigen Tage, an denen ich mich kaum konzentrieren konnte.
Bevor ich etwas sagte, holte ich tief Luft, damit meine Stimme die nötige Dominanz aufweiste, um meine Befehle zu erteilen.
„Kuro, du bleibst im Lager und kümmerst dich um die Schwangere, sowie die zwei Verletzten! Sieh zu was du bei dem einen noch retten kannst. Falls du etwas brauchst werden Lyra und Jarina es für dich besorgen. Außerdem sollen sie dir assistieren, so können sie die Medizin näher kennenlernen.“ Die aufkeimende Heiterkeit, die mein bewusst gewählter Befehl ausgelöst hatte, äußerte sich augenblicklich in kleinen Freudensprüngen der Zwillinge.
„Boran, bitte kümmer‘ dich um Brennmaterial für die Feuerstelle und füll‘ die Wasservorräte auf.“ Mit einem flüchtigen Nicken bestätigte er.
„Sam, du kommst mit mir auf die Jagd.“ Ich konnte sehen, wie Sam hinter seinem Tuch genervt ausatmete.
„Hat einer Fragen?“ Erwartungsvoll schaute ich in die Gesichter meiner Leidensgenossen.
Wortlos schüttelten alle den Kopf und begannen mit ihren Aufgaben.
2
Einzig Sam blieb still stehen, während er mich gereizt anfunkelte. Natürlich wäre ihm lieber gewesen, wenn ich ihn alleine auf die Jagd geschickt hätte, doch ich brauchte ihn heute, um an der Mauer nach dem Rechten zu sehen. Er war mutig genug, um sich mit mir bis an die Tore Atmoras zu wagen. Paradoxerweise war er auch der Einzige, dem ich an diesem gefährlichen Ort das größte Vertrauen entgegenbrachte. Den Anderen verschwieg ich mein Vorhaben, damit sich niemand unnötig Sorgen machte. Ich zog mein Tuch ins Gesicht und marschierte auf den verborgenen Durchgang zu, der in den Wald führte. Sam folgte mir mit etwas Abstand. Als wir hinter dem ersten Geäst verschwunden waren, begannen wir zu laufen. Wir eilten geschickt durch das Unterholz. Mit erfahrener Leichtigkeit bewegten wir uns durch den Wald, sprangen über Felsen und Baumstämme, immer weiter den Jagdgebieten entgegen. Sam lief parallel zu mir, sodass ich ihn hinter den Ästen immer wieder sah und wir versichernde Blicke austauschten. Zwischen den Geräuschen des Waldes hörte ich meinen eigenen Atem rauschen. Immer wieder hielt ich meine Arme schützend vor mein Gesicht, um die giftigen Triebe von meiner Haut fernzuhalten. Unser Ziel war der kleine Hügel auf der schmalen Lichtung, auf dem Boran vor ein paar Wochen einige fette Ziesel erlegt hatte. Auf ein unsichtbares Kommando hielten wir nebeneinander am Rand der Bäume. Konzentriert beobachteten wir den kleinen Anstieg direkt vor uns. Ich hielt den Atem an, kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Doch nichts tat sich auf dieser dunkelgrünen Wiese.
Obwohl kleine Erdlöcher vermuten ließen, dass dort Kaninchen lebten. Der Wind ließ die Grashalme sich sanft in seinem Rhythmus wiegen. Nur am Himmel zogen einige hellgraue, dicke Wolken vorüber. Vielleicht würde es bald beginnen zu regnen. Nachdenklich schaute ich in die Baumkronen hinauf, während ich weiter in die trügerische Stille des Waldes lauschte. Doch es gab keinen Hinweis auf ein Kaninchen, kein Rascheln oder Fiepen, nicht einmal ein Klopfen war zu hören. Nichts als das leise Flüstern des Windes und das nervtötende Summen der zahllosen Mücken, die sich auf meine Kleidung gesetzt hatten, wo sie gierig nach einer geeigneten Stelle suchten, um mein Blut auszusaugen. Mittlerweile hatte ich mich so an diese lästigen Viecher gewöhnt, dass ich nur noch nach ihnen schlug, wenn sie direkt an meinem Ohr vorbei flogen.
Immer weniger Beute war im Wald aufspürbar, dafür umso mehr Insekten, die einem das Leben ausgesprochen schwer machen konnten. Ich erinnerte mich an die Geschichten, die davon erzählten, dass es viele Tiere gegeben haben soll.
Ganz Kleine und ganz Große, Fliegende und Schwimmende, Friedliche und Gefährliche. Angeblich haben sie vor dem Tag des Zerfalls die ganze Erde bevölkert. Der maßlose Konsum, Kriege sowie Experimente der Menschen führten wohl dazu, dass es nur noch diese kleinen hasengroßen Tiere gab.
Manche behaupten sogar, dass auch die Pflanzen genießbar gewesen sein sollen.
Der Großteil hätte weder Dornen noch messerscharfe Blätter gehabt.
„So ein fanatischer Unsinn.“ Erneut verbannte ich die eigenwilligen Gedankengänge aus meinem Kopf. Auf dem Hügel hatte sich bislang nichts bewegt. Enttäuscht atmete ich aus.
„Lass...“ Gerade wollte ich zu Sam schauen, doch er war nicht mehr zu sehen.
Meine Gedanken hatten mich so im Griff, dass ich sein Weggehen überhaupt nicht bemerkt hatte. Wenig überraschend hatte er sich diese Chance nicht entgehen lassen, alleine weiter zu jagen. Mit einem letzten prüfenden Blick auf die Erdlöcher der Wiese wendete ich mich ab.
Gedanklich suchte ich nach einem erfolgversprechenderen Jagdgebiet. Als ich meine Auswahl getroffen hatte, eilte ich durch die Farne und Sträucher, die den Boden hinter ihren täuschend schönen Blättern versteckten. Ein kleiner Wassergraben, über den ich mühelos springen konnte, markierte die Grenze zu einem lichteren Waldstück. Die Bäume wurden gewaltiger, während die Erde von einer tiefen Laubschicht bedeckt war. Dazwischen lugten immer wieder breite Wurzeln hervor. Zügig lief ich zwischen den alten Stämmen entlang, bemüht das Rascheln, dass meine Schritte im Laub verursachten, möglichst leise zu halten. Ich gelangte zu einer großen Eiche, die alle anderen Bäume weit überragte. Der Stamm war so dick, dass es mehrere Menschen brauchen würde, um ihn zu umfassen. Zwischen den Wurzeln entdeckte ich kleine Erdlöcher, die wieder auf Kaninchen hindeuteten. Vor den Ausgängen der Löcher war das Laub ein wenig zur Seite geschoben. Die feuchte Erde davor wies darauf hin, dass diese Höhlen bewohnt waren. Mit meinen Fingerspitzen prüfte ich die Windrichtung, um herauszufinden, wo die beste Position sein würde, um sich auf die Lauer zu legen. Mein Blick war konzentriert auf den Kaninchenbau gerichtet, damit mir kein Hinweis meiner Beute entgehen würde. Ohne meine Augen von dem Höhlenausgang abzuwenden, griff ich nach meinem Jagdmesser. Lautlos legte ich mich auf den Bauch hinter einen der Ausgänge, weiter fest auf mein Ziel fixiert. Im Laub verschmolz mein Körper förmlich mit der Natur, um mich herum. Jeder meiner Muskeln war in regungsloser Anspannung zum Angriff bereit. Auf der Klinge meines Messers zeichneten sich in feuchten Nebeln meine regelmäßigen Atemzüge ab. Kaum hörbare Schritte kündigten meine ahnungslose Beute an. Die steigende Anspannung festigte die letzte Zelle meines Körpers. Als Erstes schob sich eine vorsichtig prüfende Nase in mein Blickfeld.
Die hellen Schnurrhaare zitterten unter der schnellen Atmung des Tieres.
Geräuschlos hob ich meine Hand mit dem Messer, den Griff so fest umschlossen, dass die Haut über meinen Knöcheln weiß wurde. Ich war bereit zuzuschlagen, sobald es nur weit genug aus seinem Bau hinaus gekrochen käme. Zögerlich, als hätte es eine Vorahnung, was gleich geschehen würde, schlich es einen Schritt nach vorne. Jetzt sah ich endlich den braungesprenkelten Kopf mit den langen stehenden Ohren. Blitzschnell setzte es die Hinterläufe an, um aus dem Loch zu flüchten. So gleich trieb ich die Klinge kraftvoll in den wehrlosen Körper und entschied das ungleiche Duell für mich. Ein schrecklich hoher Ton durchdrang die aufgeladene Stille, hallte langsam in einem schwächer werdenden Echo ab.
Der schrille Todesschrei schien weitere Tiere der Kolonie in Panik aufgescheucht zu haben. Hinter mir raschelte es im Laub. Aus dem Augenwinkel erkannte ich zwischen den fliegenden Blättern einen weiteren dunkelbraunen Kaninchenkörper. In einer fließenden Bewegung zog ich das Messer aus dem toten Tier und warf es gezielt hinter mich. Auch dieses Kaninchen hatte keine Chance, meiner Klinge zu entkommen. Das Messerwerfen war meine Spezialität.
Nur in den seltensten Fällen entkam etwas meinem tödlichen Können. Erneut erklang der schrille Pfiff mit dem letzten Atemzug des getöteten Kaninchens, dann kehrte eine bedrückende Stille zurück. Auch wenn das Töten ein fester Bestandteil meines Lebens war, unabhängig davon ob es sich um ein kleines Kaninchen oder einen Menschen handelte, blieb ich stets mit diesem ernüchternden Gefühl zurück. Hier draußen kämpfte jeder ums nackte Überleben. Mit allen Mitteln, die dazu nötig waren. Nun war wieder nur das leise Säuseln des Windes in den Baumkronen zu hören. Schwerfällig richtete ich mich auf und nahm meinen Fang in Augenschein. Umhüllt vom Laub lagen die zwei großen Kaninchen. Ihre Augen waren weit aufgerissen, die Mäuler geöffnet, als würden sie noch immer um ihr Leben schreien. Das samtig weiche Fell wurde im Blut getränkt, während die tiefrote Flüssigkeit der Schwerkraft folgend auf den Waldboden tropfte. Ich wendete meinen Blick von den Tieren ab, um mich kritisch umzuschauen. Aller Voraussicht nach hatte Sam ebenfalls etwas erwischt, doch um das herauszufinden musste ich ihn erstmal finden. Mit geübter Hand sammelte ich die Kaninchen ein, wickelte einen Strick um die Hinterläufe, damit sie sich leichter tragen ließen. Ich warf sie mir über die Schulter, so das Eines über meinen Rücken und das Andere über meiner Brust hing. Dadurch hatte ich beide Hände frei, falls ich stürzen oder angegriffen werden sollte.
Aufmerksam hörte ich in den Wald hinein. Doch in meiner unmittelbaren Nähe blieb es still. Ich legte zwei blutverschmierte Finger auf meine Unterlippe.
Mit einem kräftigen Atemzug presste ich die Luft durch die schmale Öffnung zwischen Fingern und Lippe, wodurch ein lautes Pfeifen ertönte. Mein Ruf verhallte im Wald. Erwartungsvoll horchte ich wieder in die Natur. Dann hallte ein leiser Pfiff als Antwort zurück. Sofort lief ich in die erfasste Richtung.
Mühelos überwand ich die Hindernisse des Waldes, bis ich unter einem Baum stehen blieb. Ein seltsames Gefühl ließ mich misstrauisch werden. Unbewusst griff ich nach meinem Messer. Plötzlich bemerkte ich einen Schatten hinter mir, gefolgt von einem stampfenden Geräusch. Erschrocken wirbelte ich mit gezogener Klinge herum. Im selben Atemzug hielt ich sie meinem Angreifer an die Kehle. Sam hob wehrlos die Hände. Starr im Angesicht meiner Verteidigung sah er mich an. Als ich ihn erkannte, ließ ich meine Drohung umgehend fallen.
Erleichtert atmeten wir beide aus.
„Himmel! Bist du wahnsinnig? Erschrick mich doch nicht so!“, fuhr ich ihn an.
Langsam beruhigte sich mein Puls wieder.
„Lass dich doch nicht so erschrecken.“, entgegnete er mir gleichgültig.
Seine Augen aber verrieten, dass er sich an meiner kurzen Fassungslosigkeit erfreute. Über seiner Schulter hing ein dicker Biber, dessen große orangefarbene Zähne aus dem verhältnismäßig kleinen Maul ragten.
„Du warst auch erfolgreich.“, sagte ich.
Bewundernd betrachtete ich das leblose Tier. Er nickte und zuckte halbherzig mit den Schultern.
„Na gut. Lass uns zur Mauer gehen, um nach zu sehen, was dort los ist.“
Wir drehten uns in die Richtung, in der Atmora lag.
Erneut zuckte er nur lethargisch mit den Schultern. In flinken Bewegungen schlichen wir geräuschlos durch den Wald. Nun aber nur eine Armlänge voneinander entfernt, um dem anderen direkt zur Hilfe eilen zu können, falls die Wächter uns bemerkten. Wir waren uns beide der wachsenden Gefahr bewusst.
Doch die Hoffnung, auf einen Sieg im Spiel mit dem Tod, war größer. Außerdem war jeder überlebende Abtrünnige ebenfalls ein kleiner Triumph gegen die Machthaber von Atmora. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollten, dass wir Abtrünnigen uns hier draußen gut durchschlagen konnten, mussten sie dabei zusehen, wie wir im Verlauf der Jahre immer mehr wurden. Im Laufen beobachtete ich Sam von der Seite, während wir uns in gleichbleibendem Tempo durch das Unterholz bewegten. Je näher wir der Mauer kamen, desto fester wurden seine Gesichtszüge. Fokussiert schaute er nach vorn. Mit den Händen wehrte er im instinktiven Automatismus die Pflanzen vor seinem Gesicht ab.
Auch ich richtete meinen Blick wieder auf unser Ziel, als wir den schmalen Pfad zwischen den Sümpfen erreichten. Ein modernder Geruch stieg mir in die Nase, unwillkürlich verzog sich mein Gesicht vor Ekel. Glänzende Spieglungen der Baumkronen im Wasser verrieten das toxische Terrain. Schlanke moosbewachsene Bäume ragten friedlich aus den braunen Tümpeln und versicherten einen vermeintlich festen Untergrund. Tanzende Mücken und Fliegen lenkten meinen Blick auf sich. Sie versammelten sich in undurchsichtigen Schwärmen über einer aufgequollenen Frauenleiche, deren aufgekratzte Hände sich verzweifelt an einer Schilfpflanze festhielten. Der Kopf hing überstreckt nach hinten, aus dem weit geöffnetem Mund strömten noch mehr Fliegen und Maden. Die Haut war von der Fäule schwarz gefärbt und hing in ledrigen Fetzen vom Gesicht. Der Rest des Körpers wurde erbarmungslos vom Boden verschluckt. Dieser Sumpf war für viele von Panik getriebenen Flüchtlinge zur tödlichen Falle geworden, so auch für diese Frau. In meiner Kehle stieg mein Mageninhalt auf, während ich die Leiche anstarrte. Sams schweres Schlucken befreite mich von dem furchtbaren Anblick. Verhalten sah ich zu ihm herüber. Er erwiderte meinen Blick mit dem gleichen besorgten, fast ängstlichen Ausdruck in den Augen. Es gab nur wenige Gründe, weshalb eine Frau aus Verzweiflung die Außenwelt wählte. Die Stofffetzen an den Ärmeln verrieten uns, dass sie nicht ausgestoßen wurde. Wahrscheinlich hatte sie während der Schicht als Mauerarbeiterin die Flucht ergriffen. Innerlich betete ich, dass sie alleine geflohen war. Doch der Gedanke, dass sie wegen eines Zweitgeborenen diesen Weg gewählt hatte, schnürte mir die Kehle zu. Für Bürger der unteren Sektion galt ein striktes Ein-Kind-Gesetz, um die Bevölkerungsanzahl zu kontrollieren. Zweitgeborene wurden von den Wächtern direkt getötet oder der Familie in die Ungewissheit entrissen. Leider war genau das der häufigste Beweggrund für die Flucht der Mütter. In meinen Kopf drängte sich die Befürchtung, dass unter der friedlichen spiegelglatten Oberfläche mindestens ein Kind qualvoll erstickt war. Sam legte seine Hand auf meine Schulter, worauf ich erschrocken zusammenzuckte. Sein besorgter Blick galt nun mir. Mit einem zögerlichen Nicken versuchte er, sich bei mir zu versichern, ob alles gut sei. Sofort schüttelte ich meine Gedanken ab und zwinkerte ein paar Mal, um mich wieder zu fassen. Dann nickte ich bestätigend.
Zwischen den vereinzelten kleinen Schilfinseln gab es einen kaum zu erahnenden schmalen Trampelpfad, mit dem man den Sumpf überqueren konnte.
Mit gezielt platzierten Schritten folgten wir dem Weg auf die andere Seite, begleitet von dem beklemmenden Gefühl, dass die Frauenleiche in uns ausgelöst hatte. Wir ließen den Sumpf hinter uns. Nach etwas Entfernung verzog sich auch der strenge Verwesungsgeruch.
Ein durchgehendes Brummen legte sich drohend über die natürlichen Geräusche des Waldes. Dieses unheilvolle Surren war der leise Vorbote für das, was uns gleich erwarten würde. Bereits jetzt zog sich mein Brustkorb unter dem niederfrequenten Ton zusammen. Zwischen den Baumkronen konnte ich das grelle Weiß der Mauer ausmachen, das im Vergleich zum kräftigen Grün der Blätter nahezu blendete. Mein Herz begann kämpferisch in meiner Brust zu klopfen und wir verlangsamten unser Tempo. Das war nun feindliches Gebiet.
Jedes unbedachte Geräusch hätte uns verraten können. Eine falsche Bewegung und die Schützer der Mauer, die Wächter Atmoras, würden uns, ohne zu zögern, umbringen. Mein Atem war kaum hörbar, nur die gleichbleibende Bewegung meines Tuchs verriet mein Luftholen. Der Wald war hier dankbar dicht. Die schützenden Schatten der Pflanzen ließen unsere Körper im Dickicht unsichtbar werden. Schlanke biegsame Bäume eiferten ihren großen Baumgeschwistern nach und streckten sich in die Höhe. Es würde noch Jahrzehnte dauern, bis sie die gleiche Größe erreichen würden. Über den Boden zog sich ein grüner Teppich aus Moosen und Farnen, der sich wie eine Decke um einen alten entwurzelten Baumstamm legte, dessen riesige Wurzel senkrecht in die Höhe ragte. Hinter dem mächtigen Stamm schlichen wir in geduckter Haltung weiter Richtung Mauer. Mit aufeinandergebissenen Kiefern schaute ich nach oben durch die Baumkronen. Die gigantische Mauer ragte weit in den Himmel hinein, sodass ich das Ende kaum sehen konnte. Darüber leuchtete in transparentem blauen Licht die elektrische Schutzhülle, wie eine monumentale Krone. Obwohl ich schon oft an der Grenze zu Atmora gewesen war, schüchterte mich dieses immense Bauwerk immer wieder von neuem ein. Für den Diktator war diese undurchdringliche Begrenzung der Schutz vor der mörderischen Natur, die unsere Vorfahren erschaffen hatten. Während es für die Bürger der unteren Sektion ein tödlicher Käfig war, aus dem es kein Entrinnen gab und für mich persönlich war es das verabscheuungswürdige Symbol dieser grausamen Stadt, in der ich meine Kindheit zugebracht hatte. Unbekannte Männerstimmen ließen mein Herz einen Aussetzer machen. Sam sah mich mit angehaltenem Atem an.
Wir waren uns wortlos darüber einig, dass diese Stimmen zu den Wächtern gehörten. Geräuschlos legten wir uns flach auf den Boden. Langsam krochen wir zwischen den giftgrünen Farnblättern an den Waldrand. Vor uns tat sich nun endgültig das gewaltige Ausmaß dieses Bauwerks auf. Die Mauer ragte auf beiden Seiten bis zum Ende unseres Blickfelds. Sie zerschnitt die wilde Natur, wie ein geschärftes Schwert, mühelos in der Mitte. Dieser riesige Schutzwall wurde aus Angst erbaut, mit Angst erhalten und verbreitete diese in alle Richtungen. Während wir in der Außenwelt Furcht vor dem Inneren dieser Mauer hatten, ängstigten die Bewohner Atmoras sich vor dem Äußeren.
Argwöhnisch betrachtete ich den breiten offenen Grasstreifen, der die Stadt von der Natur trennte. Das Gras war kurz gehalten, wirkte unnatürlich gleichmäßig.
Die Überquerung dieses Todesstreifens war so gut wie unmöglich. Die Wächter hatten freie Sicht und ein freies Schussfeld, um Flüchtige oder Abtrünnige gnadenlos abzuschießen. Ab diesem Streifen war die Menschenjagd offiziell eröffnet. Es war allseits bekannt, dass einige Wächter an diesem abscheulichen Spiel ihren Spaß hatten. Gerade als ich daran dachte, sah ich einige, die in Ihren strahlend weißen Schutzanzügen an der Mauer entlang patrouillierten. Ihre Gesichter verbargen sie hinter dem undurchsichtigen Visier des Helms, was es uns unmöglich machte ihre Blicke zu verfolgen. An ihren Gürteln trugen sie die Taser, die sie mit gnadenloser Brutalität im Nahkampf einsetzten. Eine Berührung reicht aus, um jegliche Kontrolle über Muskeln zu verlieren und wehrlos zitternd zusammenzubrechen. Es bereitete ihnen ein zweifelhaftes Vergnügen, ihre Opfer mit diesen fürchterlichen Geräten stundenlang zu quälen.
Die Schmerzen dieser Folter waren zu schwach, um einen zu töten, aber zu stark, um es damit auszuhalten. Auf dem Todesstreifen vor uns wurde hingegen direkt mit den tödlichen Elektroimpulswaffen geschossen, die in den Halftern am Oberschenkel zum Einsatz bereit waren. Beim Anblick dieser Division Wächter stieg eine tiefverwurzelte Wut in mir auf, gegen die ich machtlos war. Bilder meiner Vergangenheit drängten sich schonungslos in meinen Kopf. Angespannt kämpfte ich mit dem innerlichen Drang, mich auf sie zu stürzen und ihnen das Messer in die Brust zu rammen. Sam knirschte ebenso wutgeladen mit den Zähnen. So offenbarte er mir unbewusst für einen Moment seine Gefühle. Die meisten Abtrünnigen verspürten Angst, wenn sie Wächter sahen. Nur das Verlangen nach Rache, ließ einen bei ihrer Anwesenheit Zorn verspüren. Das wusste ich selbst nur all zu gut. Skeptisch beobachtete ich ihn von der Seite, spekulierte über den Grund für seine Wut. Doch dann zog eine Gruppe Bürger der untersten Sektion meine Aufmerksamkeit auf sich. Es waren Mauerarbeiter, die nur mit einem grauen Mantel und spärlicher Kleidung geschützt, dazu gezwungen wurden, die Natur von der Mauer und dem Grünstreifen fernzuhalten. Mit einfachsten Werkzeugen dämmten sie den Wald mit seinen giftigen Pflanzen ein. Es war ein unendlicher Frontenkrieg, der seit Jahrhunderten anhielt. Mensch gegen Natur. Sie kamen gerade von der Arbeit zurück. Umringt von den bewaffneten Wächtern wurden sie in das Stadtinnere geleitet. Diese Arbeit forderte täglich Verletzte, nicht selten starben die Zwangsarbeiter an dem Gift der Pflanzen. Dabei hielt nur dank ihres lebensgefährlichem Einsatzes, diese angeblich unzerstörbare Mauer der Außenwelt stand. Die Natur holte sich jeden Fleck dieser Erde zurück. Die Verachtung für diese aufgeblasenen Machthaber Atmoras war mir ins Gesicht geschrieben. Sam stupste mich plötzlich an und machte mich mit einer warnenden Augenbewegung auf einen Wächter aufmerksam, der nur wenige Meter von uns entfernt war. Mit langsamen, aber unaufhaltsamen Schritten suchte er die Waldgrenze nach Spuren von Flüchtlingen ab. Drohend klopfte er immer wieder seinen Taser, auf die Innenseite seiner mit weißen Handschuhen bedeckten Handfläche. Es wirkte fast so, als würde er an der Waldgrenze entlang schlendern, nur darauf wartend, endlich einen Menschen mit einem surrenden Stromschlag zur Strecke zu bringen. Wenn er jetzt noch etwas weiter laufen würde, könne er sein Verlangen an zwei lebendigen Abtrünnigen ausleben. Auch wenn Sam und ich uns gegen diesen einen Wächter mit der Überraschung auf unserer Seite gut verteidigen könnten, würde es nur den Bruchteil einer Sekunde dauern, bis die alarmierten Wächter uns umzingelt hätten. Damit würde unsere Situation aussichtslos werden. Meine Atemzüge wurden unregelmäßiger, als läge ein gewaltiger Stein auf meiner Brust. Mit meinen Augen suchte ich nach einem Ausweg, aber wenn wir jetzt langsam zurück kriechen würden, machten wir ihn mit dem Rascheln erst recht auf uns aufmerksam. Dann kämen wir nicht schnell genug auf die Beine, um davon zu rennen oder uns ihm entgegenzustellen. Mein ganzer Körper bebte im ungleichen Rhythmus meines Herzschlags. Auch Sam war zunehmend nervöser, ballte zitternd vor Wut die Fäuste, während er den Wächter nicht aus den Augen ließ. Er schien sich kampfbereit zu machen, doch ich legte meine Hand auf seine Schulter. Ganz leicht schüttelte ich den Kopf, um ihm zu signalisieren, das dies keine Option war.
„Nein, Sam! Das würde eine Kettenreaktion auslösen!“, flüsterte ich eindringlich.
Sam schaute mich verärgert an. Es war ihm genau anzusehen, wie schwer es ihm fiel, meinen Worten Folge zu leisten. Die Schritte des Wächters waren inzwischen deutlich hörbar. Damit blieb uns keine Zeit mehr für eine längere Überlegung. Ich sah Sam ernst an, während ich konzentriert auf die näherkommende Gefahr hörte.
„Jetzt oder nie! Lauf!“, rief ich, dass ich beinahe selbst unter meiner Stimme zusammenzuckte.
Als hätte jemand den Startschuss losgelassen, stemmte ich mich kräftig ab, um auf die Beine zu kommen. In einer überstürzten Bewegung drehten wir uns herum, drückten die Füße in den Boden, um loszurennen. Im gleichen Augenblick hörte ich die Rufe und das surrende Geräusch der Waffen. Neben meinem Fuß blitzte ein heller Lichtkreis auf, als das erste Geschoss sein Ziel verfehlt hatte. Sofort regnete es wild krachende Schüsse auf die Stelle, auf der wir eben noch gelegen hatten. Erschrocken von der Tatsache, knapp von der Elektrizität getroffen worden zu sein, drehte ich mich mit aufgerissenen Augen kurz nach hinten. Zwischen den aufkommenden Schüssen, die knallend im Boden versanken, ertönten die alarmierenden Rufe der Wächter.
„Abtrünnige!!!“, schrie einer, der durch das Gebüsch gestürzt war und die Verfolgung aufgenommen hatte.
Mit einem kraftvollen Sprung schwangen wir uns über den umgestürzten Baumstamm. Das Moos bohrte sich wie tausende kleine Nadeln in meine ungeschützten Fingerspitzen. Als meine Füße den Boden wieder berührten, erkannte ich im Augenwinkel, wie ein weiterer viel zu naher Schuss den Stamm direkt unter meiner Hand traf. Von der Angst um mein Leben angetrieben, rannte ich weiter. Noch einmal wendete ich mich nach hinten und sah die anonymen Wächter einzeln durch den Waldrand brechen. Mit ihren Waffen im Anschlag zielten sie im Laufen auf uns. Etwa eine Handvoll von ihnen hatte die Verfolgung aufgenommen. Sie sprinteten uns Befehle schreiend hinterher. Wir mussten sie schnellstens abhängen, bevor sie einen von uns treffen würden. Im Rausch des Adrenalins durchquerten wir das Dickicht. Wir hetzten mit etwas Abstand hintereinander her, wichen den Pflanzen mit geübten Manövern aus.
Neben uns brannten die verfehlten Stromschläge kreisrunde Löcher in die sonst so undurchdringlichen Pflanzenvorhänge. Als ein Schuss direkt neben meinem Ohr vorbeiflog, zuckte ich erschrocken zur Seite weg und hielt mir die Arme schützen über meinen Kopf. Der Schuss traf den Stamm eines mit Moos bewachsenen Baumes. Ein schwarzes Loch brannte sich mit kleinen blauen Flammen in die grüne Moosdecke. Es sah aus, als hätte der Tod sein Portal geöffnet, um nun nach uns zu greifen. Entsetzt, dass dies mein Körper hätte sein können, rannte ich getrieben von der Panik weiter. Unser einziger Vorteil war die Erfahrung mit diesem Wald. Meine Lungen pumpten aufgeregt die Luft ein und aus, sodass ich nur meinen Atem in den Ohren rauschen hörte. Plötzlich endete der Beschuss, unter dem wir standen. Die aggressiven Rufe der Wächter verstummten. Womöglich hatten sie die Verfolgungsjagd abgebrochen, weil wir zu tief in den Wald geflohen waren. Sicherheitshalber rannten wir noch ein Stück weiter, aber je näher wir dem Sumpf kamen, desto mehr verschwand das bedrohliche Gefühl verfolgt zu werden. Der Leichengeruch stieg mir erneut in die Nase, wodurch sofort das Bild der Frau im Sumpf vor meinen Augen aufblitzte. Instinktiv legte ich eine Vollbremsung ein und beendete daraufhin meine Flucht, um die Umgebung zu prüfen. Krampfhaft versuchte ich, meinen Kreislauf zu beruhigen, um klarer hören zu können. Sam lief einige Schritte weiter, bis er mein Stehenbleiben bemerkte.
„Bist du bescheuert? Lauf!“, rief er mir ohne Stimme, aber außer Atem zu, während er sich hektisch umsah.
„Schhhhht!“ Verärgert zog ich meine Augenbrauen zusammen, legte meinen Finger auf den Mund, damit er endlich leise blieb und ich lauschen konnte.
Er ballte die Fäuste, schnaubte seine Wut über meine Geste aus.
„Sie folgen uns nicht!“, flüsterte ich kopfschüttelnd, ohne seinem Zorn Beachtung zu schenken.
„Kein Grund es darauf anzulegen!“ In großen wütenden Schritten kam er zu mir, doch ich ignorierte sein Verhalten weiter, während ich mich einmal mehr versicherte keine Geräusche hinter mir zu hören.
Bis er mich plötzlich am Arm packte und so versuchte, mich zum Weiterlaufen zu bewegen.
Mit einer ruckartigen Bewegung entriss ich mich seinem Griff.
Augenblicklich ging ich auf Abstand. Unsere Blicke trafen sich brennend vor Zorn über das Verhalten des jeweils anderen. Mitten im Wald, umringt von einer trügerischen Stille und dem abscheulichen Verwesungsgeruch, fixierten wir uns wutgeladen. Erneut hatte er meine Autorität untergraben. Mit seinem unnachgiebigen Auftreten forderte er mich nur weiter heraus.
„Sam!“ Meine Stimme klang warnend.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wendete er den Blick ab. Dann trat er ein Stück zu Seite. Seine Augen verrieten mir, dass er noch immer vor Wut kochte, aber ich würde nicht darauf reagieren. Von jedem anderen hätte ich, nach einer solchen Respektlosigkeit eine Entschuldigung erwartet. Doch bei Sam war es Entschuldigung genug, dass er mir den Weg frei machte. Mehr konnte ich nicht von ihm erwarten. Um nicht weiter dieser Situation ausgesetzt zu sein, lief ich entschlossen an ihm vorbei. Ich warf ihm einen letzten strafenden Blick zu. Er drehte sein Gesicht verärgert weg. Dann folgte er mir mit etwas Abstand. Auf dem Weg zurück herrschte ein unangenehmes Schweigen zwischen uns. Nun hatte er sich wieder hinter seinem schlechtgelaunten Gesichtsausdruck versteckt, was mein beständiges Misstrauen nur verstärkte.
Aber warum reagierte er immer wieder so? Wir waren doch schon so oft aneinandergeraten! Wieso konnte er sich nicht einfach unterordnen, wie der Rest es tat?
Die Meisten der Gemeinschaft waren mir dankbar für die Unterstützung und das Obdach, aber Sam blieb immerzu skeptisch, als würde er mir selbst nach drei Jahren in unserer Gemeinschaft nicht zutrauen, die Führung und die damit einhergehende Verantwortung tragen zu können. Des Friedens willen ließ ich ihn schweigen. Der Weg zum Lager kam mir selten so lang vor, wie an diesem Tag.
Doch irgendwann war der unscheinbare Durchgang zu erahnen. Eine Pflanze mit großen Blättern und stachligen blauen Beeren bot dem Eingang in unser Zuhause einen Sichtschutz. Wenn man es nicht wusste, würde man hinter diesen unscheinbaren Pflanzen, kaum ein bewohntes Lager vermuten. Ich hob die Arme wieder schützend vor mein Gesicht, um hin durch zu gehen.
Die Sonne des Morgens war gänzlich verschwunden und das alltägliche graue Wolkenband zog sich über den gesamten Himmel. Das Feuer knisterte in der Mitte des Lagers. Zwischen den Baracken stieg der Rauch empor. Entnervt zog ich mein Tuch vom Gesicht. Endlich konnte ich wieder frei atmen. Obwohl ich mich bemühte einen neutralen Ausdruck zu wahren, war es mir nicht möglich, meinen Ärger gänzlich zu verbergen. Eine Frau mit grau meliertem langem Haar, das über ihre Schultern fiel, lächelte mich mitleidig an. Die Blicke der umstehenden Gemeinschaftsmitglieder hingen unsicher an meinem Gesicht. Mir war bewusst, dass sie genau wussten, dass Sam und ich wieder aneinandergeraten waren. Auch wenn sich keiner traute, es auszusprechen, wussten alle, dass Sam es immer wieder darauf anlegte, mich stetig herauszufordern. Wir liefen stumm auf die Feuerstelle zu. Dort hatte sich ein Großteil der Gemeinschaft versammelt. Einige Kinder stocherten mit länglichen Stöcken in den Flammen herum, während ihre Mütter dahinter Platz genommen hatten und sich aufwärmten. Kuro und Boran standen auf der anderen Seite des Feuers. Sie unterbrachen ihr Gespräch, als sie uns kommen sahen. Sam stampfte, ohne mich eines Blickes zu würdigen, an mir vorbei. Er ließ den Biber wortlos neben der Feuerstelle fallen. Dann wandte er sich ab und rempelte gegen Borans Schulter, als er das Lagerfeuer verließ. Boran stolperte einen Schritt zur Seite.
„Was ist denn mit dem schon wieder los?“ Er hob ahnungslos die Hände.
In den Gesichtern der anderen sah ich, wie dankbar sie Boran für die Frage waren. Entnervt rollte ich mit den Augen. Zuerst legte ich die toten Kaninchen behutsam neben den Biber, bevor ich ihm antwortete. Hier im Rauch des Feuers verschwanden die lästigen Insekten, die sich immer wieder auf die toten Körper setzten.
„Wir waren an der Mauer. Ihr wisst, wie er ist und solche angespannten Situationen tun ihr Übriges dazu.“, sagte ich.
Eigentlich wollte ich nicht weiter darüber sprechen.
„Was hat der für ein Problem?“ Boran schüttelte verständnislos den Kopf.
Die Anderen sahen Sam hinterher.
„Warum nimmst du ihn überhaupt zur Mauer mit?“ Kuro richtete seine Brille wieder gerade.
„Wieso gehst du überhaupt zur Mauer?“, fragte eine Mutter, mit braunen gekräuselten Haaren, während sie mich besorgt ansah.
Verwundert über die Welle an Fragen zog ich meine Augenbraue hoch.
„Werde ich jetzt verhört, oder wo soll das hinführen?“, fragte ich vorwurfsvoll und stemmte die Hände in die Hüften.
„Nein, entschuldige.“ Boran wandte sein Gesicht beschämt ab.
Alle drehten sich wieder zum Feuer. Es herrschte ein bedrückendes Schweigen um die sonst so lebendige Feuerstelle. Obwohl ich mich nicht rechtfertigen wollte, musste ich diese unangenehme Stimmung wieder auflösen.
Verständlicherweise bereitete es ihnen Sorgen, dass ich mich so nah an die Mauer wagte. Aber meine Toleranz gegenüber Sams respektlosem Verhalten warf langsam Fragen auf. Früher oder später würde es zu Unbehagen in der Gruppe führen.
„Ich gehe regelmäßig zur Mauer, weil ich nachsehen möchte, was dort vor sich geht. Außerdem finde ich die Abtrünnigen gerne, bevor sie tot im Sumpf versunken sind. Gerade ihr solltet wissen, wie chancenlos es ist, auf sich selbst gestellt und schutzlos im Wald herumirrend, wenn man nichts als die sterile Welt Atmoras kennt.“ Ich hielt ihnen ihre eigene Erinnerung vor Augen.
Erneut dachte ich an die Leiche der Frau im Sumpf und überlegte, ob wir nicht nach den Kindern hätten suchen sollen. Möglicherweise waren sie noch am Leben. Sie irrten vielleicht jetzt alleine durch den Wald. Ein fürchterlich schlechtes Gewissen ließ meinen Magen sich krampfhaft zusammenziehen.
Bittere Übelkeit stieg in mir auf, als ich mir eingestand, dass wir ohnehin zu spät gewesen waren. Der Verwesungszustand der Leiche zeigte, dass sie bereits einige Tage in diesem Sumpf lag. Selbst wenn die Kinder dem Moor entkommen waren, hätten sie kaum länger als ein paar Stunden zwischen den Pflanzen überlebt. Ich schaute gedankenversunken zum Waldrand. In illusorischer Ruhe wiegten sich die Blätter der Baumkronen im aufkommenden Wind. Die Dämmerung brach langsam herein und färbte die Bäume dunkelgrün, fast schwarz. Nur unser Feuer erhellte die Lichtung ein wenig. Doch die flackernden Schatten auf den Sträuchern und Büschen wirkten, wie ein dämonischer Freudentanz der Natur über die genommenen Leben. Wieder schüttelte ich die Gedanken ab. Ich schaute zurück in die schwermütigen Gesichter meiner Gemeinschaft. Sie hatten mich alle schweigend dabei beobachtet, wie ich gedankenversunken in den Wald starrte.
„Der einzige Grund weshalb Sam hier bleibt ist, dass er bei der Jagd außerordenliches Talent beweist. Auch wenn ich es leid bin, jedes Mal aufs Neue mit ihm zu diskutieren, brauchen wir ihn hier. Jeder hat seine Geschichte. Es wird seine Gründe haben, weshalb er so ist, wie er eben ist.“ Irgendwie ärgerte ich mich ein wenig über mich selbst, dass ich Sam so viel Verständnis entgegenbrachte.
Aber wir waren auf jede helfende Hand angewiesen. Außerdem erinnerte er mich ein wenig an mich selbst.
„Warum redet er dann nicht darüber? Dann könnten wir ihn alle besser verstehen.“ Shannon, eine junge Frau, fast selbst noch ein Mädchen, mit einem besorgniserregend kleinen, schwachen Säugling im Arm sah mich fragend an.
„Ihr wisst, dass er nicht darüber reden will. Das müssen wir respektieren.“
Bedauernswert betrachtete ich das kleine Wesen in ihrem Arm.
Sie nickte niedergeschlagen und streichelte mit einem Finger über das zarte Gesicht ihres Kindes.
„Wie geht es ihm?“, fragte ich, ohne den Blick von diesem kränklichen Kind zu lösen.
Sie sah mich mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck an, während sie ihn fester an sich drückte. Allein an ihrer Reaktion konnte ich ablesen, dass es ihm schlechter ging. Das er Tag für Tag schwächer wurde. Mit einem Funken Hoffnung sah ich zu Kuro, doch der schüttelte nur den Kopf. Damit war meine Zuversicht zerschmettert. Das wortlose Todesurteil für das junge Leben war ausgesprochen. Für gewöhnlich wuchsen die Kinder in meiner Gemeinschaft gesund auf, doch bei Shannon hatte das Gift der Pflanzen, die Schwangerschaft massiv verkompliziert. Sie war eine ausgestoßene Abtrünnige, weil sie sich einem Wächter verwehrt hatte, der seine Fleischeslust an ihr befriedigen wollte.
Nach dem er sie trotzdem gewaltsam missbrauchte, dichtete er ihr feindliches Gedankengut an. So sorgte er dafür, dass sie als Abtrünnige gebrandmarkt wurde. Nackt auf der Flucht blieb es nicht aus, dass sie sich an den Pflanzen verletzte. Nur dank eines Zufalls begegnete sie mir auf der Jagd im Wald.
Selbstverständlich nahm ich sie mit zu uns. Einige Wochen später vertraute sie sich mir an und verriet mir ihre Schwangerschaft, sowie die Umstände, unter welchen dieses Kind gezeugt wurde. Trotz dass dieses kleine Wesen das Ergebnis eines Gewaltakts war, umsorgte sie es mit der Liebe einer aufopferungsvollen Mutter. Dafür bewunderte ich sie immer wieder aufs Neue.
Umso furchtbarer war es, dass sie dieses Kind verlieren würde. Still schlich ich zu ihr. Setzte mich neben sie und legte meine Hand um ihre zarten Schultern, um sie an mich zu drücken. An ihrer Atmung spürte ich, dass sie angefangen hatte zu weinen. Ihre stummen Tränen flossen in mein Shirt. Meine andere Hand hatte ich schützend vor das in Tücher gewickelte Kind gelegt. Er war so schwach, dass er nicht mal die Augen öffnen konnte. Dieses kleine Wesen hatte sichtlich damit zu tun seinen dürren Körper am Leben zu erhalten. Während Shannon an meiner Schulter weinte, schaute ich zu den anderen um uns herum. Die anderen Mütter hatten ihre Kinder zu sich gezogen und hielten sie fest, als würden sie befürchten, dass auch ihnen ihre Kinder entrissen werden würden. Kuro und Boran hatten sich ebenfalls im Schneidersitz auf die Erde gesetzt. Boran hatte die erlegten Tiere zu sich gezogen. Mit leerem Blick nahm er unsere Beute aus, trennte das Fell von ihren Körpern, während Kuro ihn mit ebenso leeren Augen dabei zusah. Keiner sagte etwas. Die traurige Stille wurde nur vom Geräusch des Windes unterbrochen. Als Boran sein Messer weglegte, waren aus den deutlich unterscheidbaren Tieren von vorhin, nur noch drei gleichfarbige Gebeine geworden. Er tauschte wortlos einige Blicke mit der Mutter des kleinen Mädchens von heute Morgen aus, um die Stille nicht zu unterbrechen. Shannon hatte sich beruhigt, aber starrte an meine Schulter gelehnt in die Flammen. Die Mutter des kleinen Mädchens schob ihre Tochter von ihrem Schoß, dann stellte sie sich auf, um aus dem kleinen Zelt hinter Boran den Grillrost für das Abendessen zu holen. Sie konzentrierte sich bewusst ausschließlich auf das Vorbereiten des Essens. Auf die angebotene Hilfe ihrer kleinen Tochter ging sie nicht näher ein. Mir kam der Gedanke, dass sich die anderen Mütter im Camp schuldig fühlten, weil ihre Kinder am Leben waren und vermutlich bleiben würden. Nachdem sie den Rost mit etwas Wasser abgespült hatte, hing sie es zwischen die beiden Metallpfähle, die ich vor Jahren dafür in den Boden geschlagen hatte. Boran reichte ihr die drei Körper, damit sie diese nebeneinander über das Feuer legen konnte. Die Flammen züngelten mit den Spitzen an dem frischen Fleisch. In zischenden kleinen Bläschen floss das wenige geschmolzene Fett aus den Muskeln und tropfte in die Glut. Ein schmackhafter Geruch breitete sich aus. Mein Magen knurrte leise. Das Fleisch färbte sich langsam braun. Die rohen Tiere verwandelte sich allmählich in eine nahrhafte Mahlzeit, die uns alle an diesem Abend halbwegs sättigen würde.
Auch wenn die Stimmung bedrückt war, lockerte sich unser Verhalten zögerlich wieder auf. Erwartungsvoll schaute ich zu Sams Baracke, langsam musste er das Essen doch bemerkt haben. Aber er kam nicht nochmal heraus. Derweil gesellten sich Jarina und Lyra zu uns. Verwundert darüber, dass sie sich auf großen Abstand zueinander ans Feuer setzten, beobachtete ich sie. Sie ignorierten einander völlig. Auch wenn mich interessierte, was los war, wollte ich sie nicht vor der gesamten Gemeinschaft darauf ansprechen. Während des Abendessens hatten wir uns über das Leben in Atmora unterhalten. Kuro erzählte von alltäglichen Kleinigkeiten der mittleren Sektion. Aufmerksam lauschten wir seinen Anekdoten über die verrückten Ansichten und Verhaltensweisen dieser gebildeten Bürger der Mitte. Sogar Shannon lächelte immer wieder. Wir schüttelten die Traurigkeit ein wenig ab. Als wir fertig waren, lag nur noch ein Stück Fleisch für Sam auf dem Feuer. Ich sah nochmal zu seiner Hütte, doch es blieb unbewegt dunkel.
„Ich werde mal nach ihm sehen.“, sagte ich.
Wohl eher anstandshalber, entschied ich mich dazu, zu ihm zugehen. Mit etwas Schwung stellte ich mich auf die Beine, klopfte meine Hände an meiner Hose ab. Dann lief ich zu seiner Hütte herüber. Im Hintergrund hörte ich die Gemeinschaftsmitglieder tuscheln. Das Licht des Feuers wurde schwächer, die Dunkelheit stärker, als ich auf die Baracke zuging.
„Sam?“ Ich klopfte an das hölzerne Brett, das den Eingang der Hütte verschloss.
Stille, keine Antwort.
„Sam?“, wiederholte ich etwas lauter.
Ein weiteres Mal klopfte ich gegen das Brett. Dann hörte ich Schritte im Inneren der Baracke. Erschrocken von der ruckhaften Bewegung, mit der er das Brett zur Seite schob, zuckte ich kurz zusammen. Aber ich schaute ihm besorgt in die Augen. Er baute sich vor mir auf, hatte die Arme abwehrend vor seinem Oberkörper verschränkt. Mit einem gewissen Ärger in den Augen sah er mich an.
Es war einer der wenigen Momente, in denen ich ihn ohne Tuch vor dem Gesicht sah. Seine Wangenknochen verrieten, dass er geräuschlos den Unterkiefer hin und her schob. Scheinbar schluckte er seinen Groll noch immer herunter. Ohne ein einziges Wort sah er mich nur erwartungsvoll an. Unsere Blicke trafen sich wieder mit der gleichen Standfestigkeit, wie vorhin im Wald. Einen Moment lang dachte ich darüber nach, ihn solange anzusehen, bis er das erste Wort sagen würde. Doch mit ziemlicher Sicherheit hätte er sich eher wieder herum gedreht und mir das Brett vor der Nase zugezogen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Anfang zu machen.
„Alles in Ordnung? Möchtest du nichts essen?“, fragte ich, um die Situation zu lockern, aber ohne meinen festen Blick aufzugeben.
„Nein!“, antwortete er knapp mit deutlich genervter Stimme.
Ich zog wenig überzeugt die Augenbrauen hoch. Auf welcher der beiden Fragen war diese Antwort bezogen? Er schien es nicht für nötig zu halten, mir näher zu erläutern, was er wollte.
„Du widerst mich an!“ Jarinas wütender Schrei riss uns heraus.
Überrascht drehte ich mich herum.
„Du kommst doch nur nicht damit klar, dass er mich will!“, schrie Lyra wutentbrannt zurück.
Es war passiert, die Situation zwischen den beiden Schwestern war eskaliert. Obwohl es mir von Anfang an klar war, hatte ich nicht so schnell damit gerechnet. Mit einem Krachen hatte Sam das Brett wieder zugezogen. So hatte er sich jetzt doch nicht wirklich aus der Situation gestohlen? Ungläubig starrte ich das Brett an. Er hatte mich ernsthaft eiskalt stehen lassen. Doch das Wutgeschrei von Jarina und Lyra ließ mir keine Zeit, mich mit ihm auseinanderzusetzen.
„Wie mit einer Horde Kleinkinder. Warum mach‘ ich das überhaupt?!“, zischte ich mich selbst an.
Mit zügigen Schritten lief ich zurück zur Feuerstelle. Boran hatte sich zwischen die Mädchen gestellt. Beruhigend versuchte er, auf sie einzureden, doch in ihrer Wut beachteten sie ihn gar nicht. Kuro, der Mann um den es mit aller Wahrscheinlichkeit ging, stand nur überfordert neben Lyra. Anscheinend wusste er nicht mit der Situation umzugehen.
„Was für ein Waschlappen!“, rutschte mir versehentlich leise über die Lippen.
Ein wenig schockiert über mich selbst, verzog ich meinen Mund. In Gedanken tadelte ich mich.
„Hey!“ Meine Stimme hallte laut bestimmend über die Feuerstelle.
Während alle mich erschrocken ansahen, funkelten sich Jarina und Lyra noch immer zornig an. Boran zog sich einen Schritt zurück. Er überließ mir dankbar das Feld.
„Was ist hier los?“ Meine Stimme war so dominant, dass die Kinder unter meinen Worten zusammenzuckten und sich hinter ihren Müttern versteckten.
Aber die Schwestern trennten die wütenden Blicke nicht voneinander.
„Jarina! Lyra! Ich rede mit euch!“ Mit noch lauterer Stimme machte ich auf mich aufmerksam.
Damit riss ich sie endlich aus ihrer blinden Wut. Sofort sahen mich beide, wie aus einem Traum erwacht an. Ich hob auffordernd die Hände, um endlich eine Antwort zu erhalten. Beide zögerten. Sie schauten sich an, bis Lyra den Mund öffnete, um etwas zu sagen.
„Es ist nichts!“, unterbrach Jarina sie, bevor sie ein Wort sagen konnte.
„Nichts? Euch hat garantiert noch der letzte Bewohner Atmoras gehört!“, sagte ich verständnislos.
Doch die beiden Mädchen blieben still. Sie scheuten sich davor mir die Wahrheit zu erzählen.
„Es ist wegen Kuro, nicht wahr?“, löste ich die Situation endlich auf.
Das Warten auf die Antwort der beiden Jugendlichen dauerte mir zu lange.
Beide schauten mich schockiert an, dann wendeten sie sich rotwerdend ab.
„Schluss mit diesem Kinderkram!“ Entnervt sah ich die Zwillinge an.
„Aber Ranya…Wir…“ Kuro stammelte nervös dazwischen und nahm Lyras Hand, woraufhin Jarina ihr Gesicht verachtend wegdrehte.