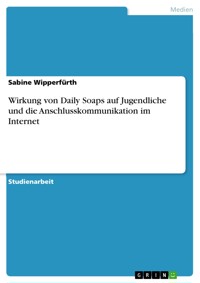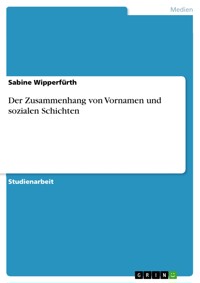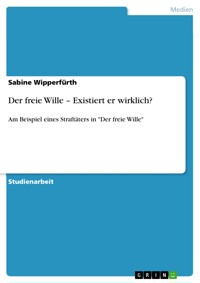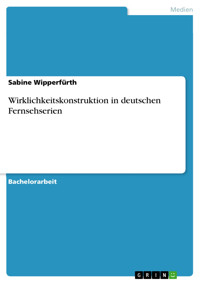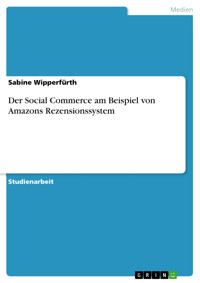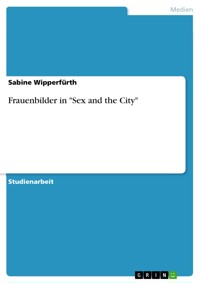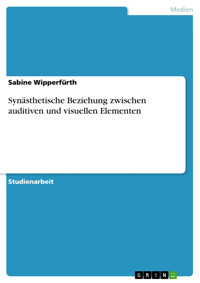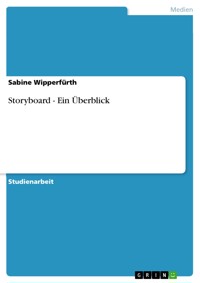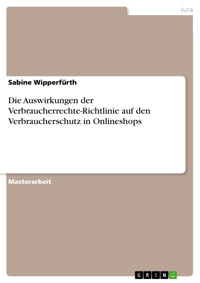
Die Auswirkungen der Verbraucherrechte-Richtlinie auf den Verbraucherschutz in Onlineshops E-Book
Sabine Wipperfürth
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Jura - Medienrecht, Multimediarecht, Urheberrecht, Note: 1,7, Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln (Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Potenzial des grenzüberschreitenden Online-Handels in der Europäischen Union ist bei Weitem noch nicht erschöpft. Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist es daher an der Zeit die wichtigsten Verbrauchervorschriften zu überarbeiten und an die sich schnell wandelnde digitale Welt anzupassen. Daher hat der Rat der Europäischen Union am 10.10.2011 die Richtlinie über Verbraucherrechte (2011/83/EU) 4 verabschiedet, welche am 13.06.2014, in nationales Gesetz umgesetzt, in Kraft tritt. Ziel dieser Arbeit wird es sein, herauszufinden, welche gesetzlichen Änderungen durch die Verbraucherrechte-Richtlinie Auswirkungen auf den Verbraucherschutz in Onlineshops haben und ob sich diese für die Verbraucher positiv oder negativ auswirken werden. Dazu soll zuerst grundlegend geklärt werden, wieso ein spezieller Verbraucherschutz für den Onlinehandel notwendig ist und welches Verbraucherleitbild diesem zu Grunde liegt. Im Zuge dessen wird analysiert, welche besonderen Gefahren sich durch das Internet ergeben und wie sich diese auf das Verbraucherleitbild auswirken. Danach wird kurz erläutert, welche Rechtsbereiche im Internetrecht zur Anwendung kommen, um dann die bestehenden Probleme im EU-Verbraucherschutzrecht zu diskutieren. Im Anschluss daran ist die Verbraucherrechte-Richtlinie Bestandteil der Betrachtung, die kurz vorgestellt wird, um dann deren einzelnen rechtlichen Regelungsbereiche einer Analyse in Bezug auf die jeweiligen Gesetzesänderungen zu unterziehen. Zudem wird jeweils die Umsetzung in das deutsche Recht dargestellt. Zum Schluss werden einige Kritikpunkte zusammengefasst und ein Fazit in Bezug auf die Stärkung und Schwächung der Verbraucherschutzrechte gezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen – Onlineshop und E-Commerce
3 Der Verbraucherschutz
3.1 Verbraucherleitbilder
3.1.1 Verbraucherleitbild der älteren deutschen Rechtsprechung
3.1.2 Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs
3.1.3 Einfluss des Internets auf das Verbraucherleitbild
3.2 Vertragsfreiheit versus Verbraucherschutz
3.3 Risiken im E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel
3.4 Zwischenfazit
4 Gesetzliche Grundlagen
4.1 Das Internetrecht
4.2 Das Verbraucherschutzrecht
5 Bestehende Probleme im EU-Verbraucherrecht
5.1 Mindestharmonisierung
5.2 Rechtsunsicherheit
5.3 Wirtschaftliche Probleme
5.4 Nachteile für Verbraucher
5.5 Zwischenfazit
6 Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (RL 2011/83/EU)
6.1 Umsetzung in deutsches Recht
6.2 Anwendungsbereich
6.3 Parallele der VRRL zum Gemeinsamen Europäisches Kaufrecht
7 Verbraucherschutzrelevante Änderungen durch die VRRL
7.1 Definitionen
7.1.1 Verbraucherbegriff
7.1.2 Unternehmerbegriff
7.1.3 Fernabsatzvertrag
7.2 „Button-Lösung“ – Schutz vor Kostenfallen im Internet
7.2.1 Die Ausgangslage
7.2.2 Die alte Rechtslage
7.2.3 Personeller und sachlicher Anwendungsbereich
7.2.4 Neuregelung des § 312g Absatz 2 BGB
7.2.5 Neuregelung des § 312g Absatz 3 BGB
7.2.6 Rechtsfolgen
7.2.7 Umsetzung in der Praxis
7.2.8 Wirksamkeit der Button-Lösung
7.3 Informationspflichten
7.3.1 Formale Anforderungen
7.3.2 Inhaltliche Anforderungen
7.4 Widerrufsrecht
7.4.1 Widerrufsfrist
7.4.2 Ausnahmen
7.4.3 Ausübung des Widerrufsrecht
7.4.4 Rechtsfolgen des Widerrufs
7.4.5 Zusammenfassung der Änderungen im Widerrufsrecht
7.5 Sonstige Verbraucherrechte (Artikel 18–22 VRRL)
7.5.1 Lieferung
7.5.2 Entgelte für Zahlungsmittel
7.5.3 Risikoübergang
7.5.4 Telefonische Kommunikation
7.5.5 Zusätzliche Zahlungen
7.6 Kritik
7.6.1 Gesetzesaufbau
7.6.2 Problem der Informationsflut
7.6.3 Unterschiede bleiben bestehen
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Erkärung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Der Online-Handel hat sich mit einem geschätzten Umsatzvolumen von 246 Milliarden Euro inzwischen als wesentlicher Absatzmarkt des europäischen Handels etabliert und wächst in großen Schritten weiter.[1] Denn viele Verbraucher[2] ziehen es vor Produkte online zu bestellen statt im stationären Handel, da das Internet die Möglichkeiten eröffnet, räumlich und zeitlich unabhängig einzukaufen und einen umfassenden Überblick über das Warenangebot auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen bietet. Zudem ist den Verbrauchern ein einfacher und schneller Preisvergleich möglich, so dass sie aus einem riesigen Angebot das für sich Beste auswählen können. Dennoch ist das Potenzial des grenzüberschreitendenOnline-Handels in der Europäischen Union bei Weitem noch nicht erschöpft. Nicht nur die europäische Wirtschaft, sondern auch dasVerbraucherschutzrecht bietet aktuell eine Vielzahl von Herausforderungen im Bereich des Onlinehandels, da es den fast500 Millionen EU-Bürgern oft an Vertrauen in den Binnenmarkt, Rechtssicherheit und Schutz vor drohenden Gefahren im Internet fehlt.Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist es daher an der Zeit die wichtigsten Verbrauchervorschriften zu überarbeiten und an die sich schnell wandelnde digitale Welt anzupassen.[3] Daher hatder Rat der Europäischen Union am 10.10.2011 die Richtlinie über Verbraucherrechte (2011/83/EU)[4] verabschiedet, welche am13.06.2014, in nationales Gesetz umgesetzt, in Kraft tritt.
Ziel dieser Arbeit wird es sein, herauszufinden, welche gesetzlichen Änderungen durch die Verbraucherrechte-Richtlinie Auswirkungen auf den Verbraucherschutz in Onlineshops haben und ob sich diese für die Verbraucher positiv oder negativ auswirken werden. Dazu soll zuerst grundlegend geklärt werden, wieso ein spezieller Verbraucherschutz für den Onlinehandel notwendig ist und welches Verbraucherleitbild diesem zu Grunde liegt. Im Zuge dessen wird analysiert, welche besonderen Gefahren sich durch das Internet ergeben und wie sich diese auf das Verbraucherleitbild auswirken. Danach wird kurz erläutert, welche Rechtsbereiche im Internetrecht zur Anwendung kommen, um dann die bestehenden Probleme im EU-Verbraucherschutzrecht zu diskutieren. Im Anschluss daran ist die Verbraucherrechte-Richtlinie Bestandteil der Betrachtung, die kurz vorgestellt wird, um dann deren einzelnen rechtlichen Regelungsbereiche einer Analyse in Bezug auf die jeweiligen Gesetzesänderungen zu unterziehen. Zudem wird jeweils die Umsetzung in das deutsche Recht dargestellt. Zum Schluss werden einige Kritikpunkte zusammengefasst und ein Fazit in Bezug auf die Stärkung und Schwächung der Verbraucherschutzrechte gezogen.Die vorliegende Arbeit soll sich größtenteils auf den Kauf von physischen Waren in Onlineshops beschränken, weshalb nicht auf Dienstleistungs- und Streamingangebote sowie auf den Download von digitalen Inhalten, wie Software, Musik usw. eingegangen wird. Zudem werden nur Onlineshops und keine Auktionsplattformen wie eBay oder der stationäre Handel Bestandteil dieser Arbeit sein. Auch wenn die Verbraucherrechte-Richtlinie die folgenden Bereiche erfasst, sind Vertragsabschlüsse per E-Mail, Verbraucherdarlehen, außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossene Verträge und Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen nicht Gegenstand dieser Arbeit.
2 Begriffsbestimmungen – Onlineshop und E-Commerce
Da in dieser Arbeit der Verbraucherschutz in Onlineshops näher untersucht werden soll, muss erst einmal eine Definition der wichtigsten Begriffe vorgenommen werden. Ein Onlineshop wird auch synonym als Internetshop oder in englischer Schreibweise Electronic Shop oder kurz E-Shop bezeichnet. Mit einem Onlineshop wird eine Plattform geschaffen, auf der ein Anbieter seine Waren oder Dienstleistungen dem Interessenten mit Hilfe von Bildern und Produktinformationen präsentieren und anbieten kann. Durch einen Onlineshop ist es möglich die Anbahnung von Transaktionen, den Vertragsschluss, die Zahlung und Abwicklung sowie den Service, je nach Art des Produktes, teilweise oder komplett, z.B. bei digitalen Inhalten, die nicht über den Postweg verschickt werden müssen, auf elektronischem Wege abzuwickeln.[5] Im Rahmen des Electronic Commerce (kurz: E-Commerce), also des elektronischen Geschäftsverkehrs, werden Onlineshops als Verkaufs-Plattformen genutzt. Der E-Commerce bezeichnet generell den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen und auch alle elektronisch abgewickelten Geschäftsprozesse wie z.B. Werbung, After-Sales-Services oder Onlinebanking über elektronische Verbindungen wie das Internet oder Netzwerke der Mobilfunkanbieter.[6] Das Internet ermöglicht dabei einen Handel zwischen Personen, die sich nicht kennen und auch nicht unbedingt wissen, wo der Vertragspartner seinen Standort hat. Vorteile des E-Commerce gegenüber herkömmlichen Vertriebsformen, wie einem Ladengeschäft, sind für Unternehmen theoretisch die Reduzierung der Transaktionskosten, da das Internet es ermöglicht, entfernungsunabhängig mit den Vertragspartnern zu kommunizieren und Informationen zu beschaffen. Zudem fallen keine Kosten für den Betrieb von Filialen und ein umfangreiches Vertriebssystem an. Ein weiterer Vorteil ist eine Erhöhung der Markteintrittschancen und der Marktpräsenz. Da ein Onlineshop 24 Stunden am Tag für den Verbraucher zur Verfügung steht und dessen Kosten für Erstellung und Pflege überschaubar sind, ist es besonders kleinen und mittleren Unternehmen leicht möglich, ihre Waren weltweit über das Internet anzubieten.[7] Ob diese Vorteile des E-Commerce in der Praxis wirklich ausgeschöpft werden können, gilt es in einem späteren Abschnitt zu thematisieren.
3 Der Verbraucherschutz
Um den Verbraucherschutz in Onlineshops bewerten zu können, müssen zuerst die Hintergründe, die den Verbraucherschutz erst möglich machen, näher erörtert werden. Dazu muss zuerst eine Abgrenzung des Verbraucherbegriffs vom Unternehmerbegriff vorgenommen werden. Verbraucher sind nach der Legaldefinition des §13 BGB[8] natürliche Personen, die Rechtsgeschäfte zu privaten Zwecken abschließen. Unternehmer hingegen sind laut §14 BGB natürliche oder juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.[9] Die grundsätzliche Frage, die sich im Bereich des Verbraucherschutzes stellt, ist, warum hauptsächlich Verbraucher und nicht Unternehmer durch den Gesetzgeber geschützt werden müssen. Denn auch Unternehmen treten, in der Masse zwar geringer, aber im Umsatzvolumen meist höher, als Nachfrager auf dem Markt auf und tragen so ebenfalls zur Förderung der Wirtschaft bei. Des Weiteren ist zu fragen, ob Verbraucher überhaupt besonders geschützt werden müssen oder ob der Markt nicht selbst in der Lage ist, für eine Vertragsgerechtigkeit zwischen Unternehmer und Verbraucher zu sorgen. Auch soll die Frage aufgeworfen werden, ob der Online-Handel besondere Risiken birgt und daher ein weitergehender Schutz als im stationären Handel zu rechtfertigen ist. Die europäischen Verbraucherschutzvorschriften werden – in Übereinstimmung mit der traditionellen Meinung – in der deutschen Literatur und Rechtsprechung meist damit begründet, dass der Unternehmer dem Verbraucher überlegen ist. Ob diese Begründung wirklich stimmig ist, lässt sich am europäischen Verbraucherleitbild festmachen, welches als Grundlage für die Höhe der Schutzbedürftigkeit der Verbraucher ausschlaggebend ist.[10]
3.1 Verbraucherleitbilder
Verbraucherleitbilder sind Verhaltensmuster bzw. Rollenbilder, welche der Gesetzgeber dem Verbraucher zuschreibt. Sie sind nicht einheitlich definiert oder festgelegt und daher nur schwer greifbar, aber von großer Bedeutung für die Rechtsprechung und deren Auslegung von Normen und die Bemessung der Schutzbedürfnisse der Verbraucher.[11] Aus den Leitbildern kann abgeleitet werden, was dem Verbraucher zugemutet werden kann und was nicht, um ihn letztendlich vor Irreführung und Täuschung durch den Unternehmer zu schützen.[12] Wird dem Verbraucher eine eher langsame Auffassungsgabe zugeschrieben, wird ein höheres Schutzniveau von Nöten sein, als wenn von einem mündigen Verbraucher mit schneller Auffassungsgabe ausgegangen wird. Daher ist es wichtig, zu erörtern, welches Verbraucherleitbild dem deutschen und europäischen Verbraucherschutzrecht zu Grunde liegt und wie sich die Internetnutzung auf dieses Leitbild auswirkt. Denn Verbraucherleitbilder unterliegen immer einem dynamischen Prozess der Veränderung in Bezug auf die technische, moralische und gesellschaftliche Entwicklung.[13]
3.1.1 Verbraucherleitbild der älteren deutschen Rechtsprechung
Besonders im Wettbewerbsrecht ist das Verbraucherleitbild ausschlaggebend, um beurteilen zu können, ob eine Werbehandlung für den Verbraucher irreführend und damit wettbewerbswidrig ist oder nicht. In älterer deutscher Rechtsprechung[14] und Literatur vertrat man die Meinung, dass, besonders bei Geschäften des täglichen Bedarfs, der Verbraucher mit keiner besonderen Aufmerksamkeit, sondern eher flüchtig und unkritisch den angebotenen Waren gegenüber tritt. Daraus resultiert die Tatsache, dass wenn auch nur ein sehr geringer Teil der Verbraucher sich durch Werbeaussagen täuschen lässt, dieses Leitbild auf die Gesamtheit der Verbraucher angewendet wird und das Verbraucherschutzniveau und der damit einhergehende Eingriff in die Privatautonomie relativ groß sind.[15] Durch die sich daraus ergebene Einschränkung der Markttätigkeit von Unternehmen kam es in der Vergangenheit immer mehr zu Gegenstimmen in der Literatur bezüglich des hohen Schutzniveaus, die nicht zuletzt von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geprägt waren.
3.1.2 Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs
Der Europäische Gerichtshof hat im Gegensatz zu deutschen Gerichten schon Anfang der 90er Jahre in einer Fülle von Entscheidungen[16] ein Leitbild des situationsadäquat aufmerksamen, durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers geprägt, welches sich durch weitere Urteile bis heute manifestiert hat.[17] Demnach wird dem Verbraucher durchaus ein gewisses Maß an Eigenverantwortung zugetraut und nicht jede Nachlässigkeit als schützenswert erachtet.[18] Durch die Gut-Springheide-Entscheidung 1998[19] formulierte der EuGH sein Leitbild des mündigen Verbrauchers als regelrechte Rechtsanweisung an die nationalen Gerichte. Der Bundesgerichtshof ist dieser Linie erstmals in der Orient-Teppichmuster-Entscheidung[20] 1999 gefolgt und hat festgestellt, dass auch der vernünftig handelnde, aufmerksame Verbraucher einen Großteil der Werbung nur flüchtig wahrnimmt. Aber ehe er eine größere Investition tätigt, wird er sich mit dem jeweiligen Angebot näher auseinandersetzen und sich so verhalten, wie sich verständige Menschen vernünftigerweise verhalten, wenn sie nicht nur Kleingeld ausgeben wollen. Die Begriffe flüchtig und verständig schließen sich damit gegenseitig nicht aus. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs folgt damit auf der einen Seite vollständig der Linie des EuGH, auf der anderen Seite trifft sie aber auch die nötige Vorsorge dagegen, dass auf der Ebene der Instanzgerichte eventuell nicht nach dem Sinn, sondern nach dem genauen Wortlaut der EuGH-Rechtsprechung geurteilt werden könnte.[21] Der BGH modifiziert das europäische Verbraucherleitbild dahingehend, dass er den jeweiligen Einzelfall berücksichtigt und den Grad der Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der jeweiligen Situation abhängig macht. Das europäische Verbraucherleitbild orientiert sich „an der Rolle des Verbrauchers in einer offenen Marktwirtschaft mit wirksamem Wettbewerb.“ [22] Der Verbraucher wird dabei als Motor des Binnenmarktes gesehen und soll animiert werden, grenzüberschreitend zu konsumieren. Dieses Modell des verständigen Marktbürgers harmoniert mit dem Informationsmodell des Gemeinschaftsrechts. Der EuGH erklärte dazu in einem Leitsatz, dass das „Gemeinschaftsrecht eines der grundlegenden Erfordernisse des Verbraucherschutzes in der Unterrichtung der Verbraucher sieht.“[23] Das Informationsmodell beruht auf der Vorstellung, dass ein ausreichend informierter und aufgeklärter Verbraucher in der Lage ist, seine Interessen selbst wahrzunehmen und die für ihn günstigste Entscheidung zu treffen. Eingriffe in den Markt sollen möglichst nur auf das Vorliegen von Informationsdefiziten beschränkt sein. Zudem soll auf die Kräfte der freien Marktwirtschaft vertraut werden. Um dies zu erreichen, versucht der Gesetzgeber in erster Linie Informationspflichten, aber auch Widerrufsrechte, Formvorschriften und Inhaltskontrollen von AGB-Klauseln, zu gewährleisten, die Vertrauen beim Verbraucher aufbauen, was sich wiederum positiv auf den Binnenmarkt auswirken soll.