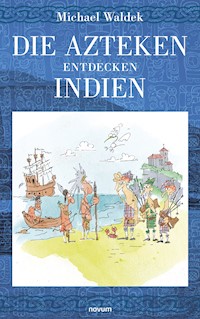
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Montezuma, Kaiser der Azteken, träumt von feinsten Handelswaren aus dem fernen Indien – und schickt eine tapfere Seemannschaft kurzerhand auf Expedition. Columboxotl, sein Erster Offizier Kaleutl und eine mutige Schiffscrew machen sich auf, um eine neue Welt zu finden – und das verläuft anders als gedacht. Die Flotte lässt in weiterer Folge kein Abenteuer aus. Die Crew entdeckt auf ihrer monatelangen Reise nicht nur exotische Länder und fremde Kulturen, sondern auch neue Feinde, Freunde und manch einer sogar die große Liebe. In der Zwischenzeit bleibt auch im Reich der Azteken kein Stein auf dem anderen. Montezuma verliert zunehmend an Einfluss und die Azteken begehren gegen ihn auf. Sehnsüchtig erwartet er die Rückkehr seiner Flotte. Doch wird die Mannschaft heil zurückkehren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Impressum 3
Mein zweites Buch in der Reihe „Stellen Sie sich das mal vor!“ 4
Danksagung 6
1. Kapitel 7
2. Kapitel 14
3. Kapitel 23
4. Kapitel 31
5. Kapitel 39
6. Kapitel 47
7. Kapitel 52
8. Kapitel 57
9. Kapitel 62
10. Kapitel 68
11. Kapitel 77
12. Kapitel 90
13. Kapitel 107
14. Kapitel 112
15. Kapitel 116
16. Kapitel 124
17. Kapitel 131
18. Kapitel 136
19. Kapitel 149
20. Kapitel 154
21. Kapitel 158
22. Kapitel 162
23. Kapitel 168
24. Kapitel 172
25. Kapitel 178
26. Kapitel 189
27. Kapitel 193
28. Kapitel 204
29. Kapitel 208
30. Kapitel 212
31. Kapitel 217
32. Kapitel 224
33. Kapitel 236
34. Kapitel 241
35. Kapitel 247
36. Kapitel 256
37. Kapitel 263
38. Kapitel 267
39. Kapitel 272
40. Kapitel 281
41. Kapitel 284
42. Kapitel 288
43. Kapitel 300
44. Kapitel 307
45. Kapitel 318
46. Kapitel 323
47. Kapitel 327
48. Kapitel 334
49. Kapitel 339
50. Kapitel 342
51. Kapitel 349
52. Kapitel 357
53. Kapitel 366
54. Kapitel 368
55. Kapitel 370
Quellen und Anmerkungen 377
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-627-5
ISBN e-book: 978-3-99131-628-2
Lektorat: Hannah Lackner
Umschlaggestaltung: Stefan Waldek, Leipzig
Umschlagkarikatur: Fadi Esper, Berlin
Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Mein zweites Buch in der Reihe „Stellen Sie sich das mal vor!“
Wieder war eine absurd clownereske Idee das Initial zur Vermischung von Fiktionen mit geschichtlicher Wirklichkeit, mit neuem Blick auf eine spannende Verdrehung von Weltgeschichte. Diesmal allerdings 4000 Jahre später. Ich verlagere eine groteske Handlung in das Reich der Azteken in Mittelamerika und in einige Landstriche von West- und Mitteleuropa zum Zeitpunkt des Übergangs vom 15. in das 16. Jahrhundert, mit reiner Lust am Fabulieren als Stilmittel. Mit Anspruch auf Tiefe. Geht das?
Erfahren Sie es selbst. Tauchen Sie ein, wenn erfundene Figuren mit tatsächlichen Persönlichkeiten der Geschichte zu einer Romanhandlung verwoben werden, die dem geneigten Leser staunend und schmunzelnd völlig neue Zusammenhänge von tragenden Ereignissen des späten Mittelalters offerieren.
Im letzten Kapitel meines Debütromans „Das große Hochstapeln – Ein Bauleiter packt aus“, welcher September 2021 im novum Verlag erschien, versucht eine „Höhere Ebene“ herauszufinden, welche von zwei Optionen für die Entwicklung der Menschheit von größerem Nutzen wäre. Ist es die Entdeckung Indiens (Europas) durch die Azteken oder ist es die Entdeckung Amerikas (Seeweg nach Indien) durch die Spanier? Beide Varianten fielen vor 4500 Jahren durch das Raster der Vernunftabwägung. Die Entdeckerintentionen der auserwählten Protagonisten Montezuma und Columbus waren dem mystischen Gremium einfach zu trivial gewesen. Der eine wollte mit der Entdeckung Indiens (Europas) doch tatsächlich das Getränkesortiment seines Volkes erweitern und nebenbei das Repartier an Menschenopferressourcen aufstocken. Der andere wollte der spanischen Krone neue Provinzen mit ihren Reichtümern an Gold erschließen und die wilden Eingeborenen zu Untertanen machen. Insofern schafft mein zweiter Roman einen fließenden Übergang von einem Sternstundenereignis der Menschheit, dem Pyramidenbau im alten Reich der 4. Dynastie Ägyptens, zu einem weiteren Großereignis mit historischer Tragweite, nämlich der Entdeckung eines neuen Kontinentes. Bloß eben andersherum.
Nun, viele meiner Mitbürger können sich noch gut an den Schulstoff im Fach Geschichte erinnern und schrieben in Klassenarbeiten, dass Columbus als erster Europäer den Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte. Das ist längst widerlegt. Es wird immer noch gern ignoriert, dass der isländische Seefahrer Leif Eriksson circa 1000 n.Chr. der eigentliche Entdecker Amerikas war. Eine rekonstruierte Wikingersiedlung bei Vinland in der kanadischen Provinz Neufundland bestätigt diese historische Tatsache eindrucksvoll. Aber die Geschichte rund um Columbus ist schillernder und spektakulärer. Die Konsequenzen der Eroberung des Kontinentes durch die Spanier kommt bewegender und ergreifender daher, als die Gründung einer kleinen Siedlung niedriger Erdhäuser in einem kalten finsteren Gebiet, ohne jegliche Aussicht auf ein sagenumwobenes El Dorado. Genau dort setzt meine Geschichte an. Es hätte durchaus anders kommen können.
Verehrte Leser,
lassen Sie sich darauf ein, wie es gewesen sein könnte, wenn eine „Höhere Ebene“ die Entdeckung Indiens (Europas) durch Montezumas Bevollmächtigten veranlasst hätte. Am Ende des Romans wird man verstehen, warum es in der Wirklichkeit dann doch anders gekommen ist, denn die Geschichte ist zu sehr aus dem Rahmen gefallen. Das ist der Stoff, aus dem reines Lesevergnügen entsteht. So zumindest die Hoffnung des Autors.
Viel Vergnügen wünscht der Autor
Danksagung
Ein Dankeschön
an Regine als kritische Muse
an Fadi Esper für die Karikatur auf dem Cover und
an Stefan Waldek für die Covergestaltung
1. Kapitel
Ein Sturm zieht auf
Ich bin wütend und verzweifelt. Wütend, weil Montezuma (1) mir diese verdammte Schiffsreise zumutet und ich mich darauf eingelassen habe. Verzweifelt, weil die Wetterprognosen unseres Wettermeisters für die nächsten Stunden mir ernsthafte Sorgen bereiten. Die seit Tagen frustrierend quälende Flaute soll in dieser Nacht in einen Sturm umschlagen, so die aktuelle Prophezeiung des Xotl Barometl. Wir haben diesen alten Seebären zum Zwecke der Wettervorhersage und der Deutung der Meeresströme mit auf die Reise genommen. Seine chronische Rheumaerkrankung befähigt ihn, die meist schmerzhaften Signale seiner Gelenke halbwegs verlässlich in wichtige Reisewetterlagen umzudeuten. Es ist erstaunlich, wie treffgenau Xotl seine Wettervorhersagen formuliert. Er bezieht sich dabei auf seine Kontaktaufnahmen zum Wettergott Kachelmantl, dem er gelegentlich eine Ratte aus dem Inneren des Schiffsrumpfes für eine steife Brise in die richtige Segelrichtung opfert.
Es klopft an meine Kajütentür.Jetzt bloß keine Störung,ich lasse das Eintrittsbegehren unreflektiert. Nach einer kleinen Pause wiederholt sich das Klopfen, jetzt energischer. Ungehalten wird gefragt: „Störe ich dich? Kann ich reinkommen oder hast du Damenbesuch?“
Ich vernehme ein Kichern, dass deutlich hinter der schweren Tür zu hören ist.
„Sei nicht albern und komm rein“, gewähre ich meinem Ersten Offizier Eintritt.
Kaleutl ist eine imposante Seemannsgestalt. Seine Statur ist wirklich Respekt einflößend. Er muss sich tief bücken, um sich nicht am Türsturz zur Kajüte zu stoßen. Nun steht er vor meinem Arbeitstisch, breitbeinig und entspannt. Ein leichtes Grinsen kann er nicht verbergen.
„Ei Ei Columbuxotl, die Henne hat gelegt und die Eier sind ausgetragen“, scherzt mein erster Offizier.
„Die Besatzungen der Quetzal-Nina und der Quetzal-Pinta (2) wissen Bescheid, bin persönlich rüber gerudert und habe das sofortige Einholen der Segel angewiesen. Sie bereiten sich auf den Sturm vor, sichern die Ladung und haben ab sofort Tequilaverbot (3).“
„Ja, gut so“, entgegne ich Kaleutl immer noch gereizt.
„Unsere beiden Begleitsegelschiffe werden durch den Sturm keine größeren Schwierigkeiten bekommen. Es sind schlanke wendige Segler mit geringem Tiefgang. Nicht so unser umgebautes Frachtschiff. Es ist eine lahme Ente, ein schwerfälliges Schiff und bei starkem Seegang überhaupt nicht manövrierfähig. Wir sind den Wellen einfach ausgesetzt und können sie nicht gezielt mit dem Bug brechen. Furchtbar.“
„Komm schon, Columbuxotl, male nicht so schwarz. Deine Quetzal-Santa Maria ist robust und du befehligst eine fähige Mannschaft. Die Leute sind frisch und ausgeschlafen. Dein Schiff ist geräumig, im Unterdeck lagern die schweren Fässer, das Aztekengold und die Waffen, den Schwerpunkt des Schiffes nach unten verlagernd. So schnell wird die alte Maria nicht kentern.“
Dieser Optimismus ist bewundernswert. Ich versuche ihn anzunehmen. Aber es gelingt einfach nicht. Mir fallen die Sprüche ein, die Montezuma kurz vor dem Auslaufen im Hafen von Veracruz an der Ostküste abgesondert hatte. Schreckliche Phrasen, die nur so von rhetorischem Schleim trieften und die der Kaiser der Mexika (4) über die abenteuerbereiten aztekischen Seefahrer zum feierlichen Abschied ergossen hatte. Ich erinnere mich, wie unser Regierungschef vor genau vierundsiebzig Tagen, im Stile eines politischen Großmauls, die Entdeckerqualitäten des von den Göttern auserwählten Aztekenvolkes für die Mission der Findung eines Seeweges zum sagenumwobenen Land der Inder von der Ehrentribüne heruntergeschrien hatte: „Gen Osten tapfere Azteken, gen Osten und wir werden reich belohnt“, überschlug sich höchst peinlich seine Stimme. Es war grässlich gewesen.
Nicht wenige meiner Landleute sprechen unserem Staatsoberhaupt die Fähigkeit zur Führung meines stolzen Volkes ab. Immer wieder zettelt er bewaffnete Konflikte mit unseren Nachbarvölkern an und verkündet vollmundig den Sieg, noch bevor die Schlachten geschlagen wurden. Dann nerven die ständigen Opferungen seiner Kriegsgefangenen und den Blödmännern, die sich freiwillig ehrenvoll in den grausig herbeigeführten Tod begeben. Er will mit diesen religiösen Ritualen die Götter gnädig stimmen, die dann dem Volk der Azteken reichlich Ernten und gutes Urlaubswetter bescheren. Vulkane und Erdbeben sollen gezähmt werden und vor allem sollen sie die Kriegsausgänge zu Gunsten des eigenen Heeres regeln. Wie ich finde, ist da eine ganze Menge Romantik dabei. Unter vorgehaltener Hand wird er im Volk auch schon mal als „Häuptling Große Fresse“ bezeichnet! Wenig schmeichelhaft für einen Staatenlenker.
Die absolute Krönung der albernen Abschiedszeremonie war die extra für dieses staatstragende Ereignis komponierte Hafenauslaufmelodie „Eiem sehling, eiem sehling“ gewesen, vorgetragen von Rod, unserem Steward aus der Kombüse. Er ist ein treuer und musisch talentierter Schiffskellner, der mit ausgebreiteten Armen am Bug gestanden und, begleitet von einer Mariachi Gitarren- und Trompetencombo, die Festgemeinde mit seiner Sangeskunst in Bann gehalten hatte. Tragisch gewesen war ein bisschen, dass genau zum Zeitpunkt des Intonierens der neuen Seefahrthymne, der Wind landeinwärts gedreht hatte. Unsere Schiffsarmada war so kaum eine Meile aus dem Hafen gekommen, trotz eilig organisierter Opferung einiger Gefangener, die zu ihren Ungunsten gerade zufällig im Hafen rumgelungert waren. Erst am vierten geplanten Reisetag hatte der Wind in Richtung Osten gedreht. Wir erreichten endlich die offene See und begannen unsere Abenteuerreise in das Unbekannte.
Ich schüttle mich kurz und wende mich wieder meinem ersten Offizier zu. Die Gefahren des heraufziehenden Unwetters verlangen nun meine vollste Konzentration.
„Bring mir die Sextanten“, weise ich Kaleutl an.
„Sind doch Frauen an Bord?“
Die Frage amüsiert nur mein Gegenüber, der wohl keine Sorgen hat. Auf der einen Seite kennen seine Albernheiten offensichtlich in jeder noch so angespannten Lage keine Grenzen und mit seinen anrüchigen Witzen kann er vielleicht bei Teilen der Mannschaft landen. Bei mir jedenfalls ist diese Art der Heiterkeit verpönt. Auf der anderen Seite hat sein natürliches Verlangen komisch zu sein, für die Stimmungslage an Bord gewisse Vorteile, die ich durchaus zu schätzen weiß. Wir segeln jetzt bereits fast ein viertel Jahr in Richtung Osten. Die Quetzal-Nina und der Quetzal-Pinta, unsere beiden Schwesternschiffe, kommen durch ihre Bauweise schneller voran als unser schwerfälliger Kahn. Dadurch müssen die kleineren Segler immer wieder die Segel raffen und auf uns warten. Das bringt die Stimmung der Besatzung dieser Boote natürlich in den Keller. Als Armada müssen wir jedoch unbedingt zusammenbleiben, um uns in Gefahrensituationen gegenseitig beistehen zu können. Das ist mein strikter Befehl. Außerdem trägt die Quetzal-Santa Maria die Hauptlast der Versorgungsgüter und der Goldvorräte für den Tauschhandel. Reichliche Mengen an Wasser, Tequila, Essig, gepökeltem Fleisch und gesalzenem Fisch sind im Schiffsbauch verstaut. Daneben liegen dort Säcke mit getrocknetem Maismehl, Bohnen und einer Art Schiffszwieback, der extrem hart gebacken ist, um beim Verzehr den Eindruck einer üppigen Mahlzeit vermitteln zu können. Die Vorräte sollen für circa 12 Monate reichen, so die Berechnungen der logistischen Reisevorbereitung. Wenn wir unser Reiseziel in dieser Zeitspanne nicht erreichen, sind wir verloren! Jedem an Bord der drei Schiffe ist das klar. Das steht exakt formuliert und rechtlich wasserdicht in den Arbeitsverträgen unserer maritimen Mitarbeiter. Eventuelle Schadensansprüche erbschleichender Nachkommen haben somit keine Chance. Für diesen schlimmsten Fall der Fälle, habe ich in meiner Kajüte, natürlich streng gesichert, vorsorglich ausreichend Kapseln an schnell wirkenden Giftstoffen vorrätig. Dieses Gift wurde aus den Schneidezähnen des heimischen gemeinen Südhanghamsters gewonnen und garantiert einen harmonisch eintretenden Tod.
Kaleutl hatte sich losgemacht, um die Sextanten zu holen. Wir müssen uns beeilen, denn jeden Moment können Wolken die Sicht auf die Sterne verdecken. Ich betrachte die Sterne am Firmament als unsere Freunde. Spätestens nach dem Besuch eines Lehrganges für Astronavigation bei dem befreundeten Nachbarstamm der Maya, einem Volk der Bienenzüchter und der Astronomen, ist uns bewusst geworden, wie faszinierend zuverlässig sich die Positionen auf den Längengraden und die Standorte auf den Breitengraden auf See über den Sternenhimmel bestimmen lassen. Im Süden geschieht dies mittels dem Sternbild des Kreuzes, im Norden über den Fixstern Polaris (5). Mit den Sextanten können wir je nach Position des Schiffes über oder unter dem Äquator (6) die Winkel zu den jeweiligen Fixpunkten Nord und Süd messen und auf den Breitengrad schließen. Über die Fixierung der Sonne mit dem Sextanten kann man jeweils zur Mittagszeit die Schiffsposition der Längengrade messen. Täglich trage ich die Positionsmessungen in mein Logbuch und auf meiner Seekarte ein. So entsteht ein nautisches Protokoll, welches für die Rückreise und für nachfolgende Schiffsreisen durch dieses unbekannte Terrain von höchstem Nutzen sein kann. Der Dank gebührt den Maya, denn die nautischen Fähigkeiten meines Volkes sind bisher eher bescheiden entwickelt.
Kaleutl kommt mit den beiden Sextanten.
„Sie sind gereinigt und gelüftet“, spinnt er schon wieder.
Es wird Zeit, dass wir mit den Messungen zur Schiffsposition beginnen, denn immer mehr Wolken ziehen über den Abendhimmel. Das Unwetter naht. Wir orten beide unabhängig voneinander, um Messfehler über das statistische Mittel der Ergebnisse zu minimieren. Die Daten werden in die Seekarten als Punkte übertragen und untereinander mit Linien verbunden. So entsteht allmählich ein topographischer Polygonzug, der uns den Trend zur beabsichtigten Himmelsrichtung aufzeigt. Weil das Reiseziel irgendwo im Osten liegt, genügt schon die Kenntnis über die richtige Himmelsrichtung. Nur der unerschütterliche Glaube an die Existenz der Fremden, die irgendwo im Osten leben, verleiht uns die Energie für dieses gefahrenvolle Abenteuer. Wir müssen verrückt sein, um ohne konkrete Kenntnis vom Reiseziel einfach loszusegeln. Nur die archäologischen Deutungen von Fachexperten aus den besten Universitäten unseres Landes über sensationelle kulturhistorische Funde, haben unseren Kaiser Montezuma dazu bewogen, mich und meine Leute auf Expedition in das Land Indien zu schicken. Ein Himmelsfahrtkommando.
Die Karte mit der eingezeichneten Ostküste des aztekischen Reiches liegt schon lange nicht mehr auf dem Stapel. Vor uns liegen leere Blätter mit dünnen Linien imaginärer Koordinaten. Keine Eintragungen von Untiefen, von kleineren oder größeren Inseln, keine Landmassen, die vermessen sind, nicht einmal kleinere Atolle, wie wir sie von unserer Heimatküste kennen, nichts. Nur das unendliche Wasser des großen Meeres, eine einzig weiße Kartenfläche. Gleichwohl zeigt uns das tägliche Verlängern des Routeneintrages, egal ob kürzer oder länger, dass wir bereits einen beträchtlichen Weg zurückgelegt haben müssen.
„Die linearen Abweichungen zur Nordost-Richtung sind gering. Ich bin durchaus zufrieden. Gefühlsmäßig müssten wir bald den sagenumwobenen Meeresstrom erreichen, der unsere Reise bei günstigem Wind und einigermaßen ruhiger See beschleunigen wird.“
Ich prüfe die Wirkung meiner Worte in den Augen meines ersten Offiziers. Kaleutl überlegt kurz, er ersinnt natürlich etwas Schalkhaftes.
„Columbuxotl, ich sehe das ebenso. Ich erzähle deinen Männern täglich, dass wir bald eine fiktive Strömung erreichen werden, an die man nur richtig glauben muss. Dazu wird das Szenario einer ruhigen See bei starken Ostwinden eintreten. Wie gemalt. In regelmäßigen Abständen werden Piratenschiffe auftauchen, die uns frisches Wasser und gegrilltes Büffelfleisch bringen. Ich habe deinen Männern erzählt …“
„Schluss jetzt, Kaleutl! Langsam nervt mich dein aufgesetzter Humor. Sag einfach, dass du Schiss hast, genauso viel Schiss, wie ich ihn auch habe. Ich, mein Freund, setze auf das Prinzip Hoffnung und habe starkes Vertrauen in die Wissenschaft. Unseren besten Archäologen ist es nämlich gelungen nachzuweisen, dass es Fremde geschafft haben müssen, das große Wasser zu überqueren. Nur eben aus einer anderen Richtung. Es existieren ausreichend entschlüsselte Aufzeichnungen der unbekannten Seefahrer. Mein Freund, lass uns gemeinsam, auch im innigen Verbund mit den zuständigen Göttern, dieses Abenteuer bestehen und die Entdeckung eines östlichen fremden Landes zu einem guten Ende bringen. Wir kommen in friedlicher Absicht, wollen Handel treiben. Um diese Botschaft glaubhaft zu machen, habe ich Montezuma überzeugen können, diesmal auf die üblichen Massenopferungen, wie bei staatstragenden Ereignissen üblich, zu verzichten. Schweren Herzens hat er, im Wissen damit seine Priester zu erzürnen, eingewilligt. Sie vermuteten sogar eine Verschwörung. Wir hingegen setzen auf Vernunft und Willenskraft, das ist unser Credo.“
Ich nehme zwei frische Becher und gieße Tequila ein. Wir stoßen an, pfeifen auf das Alkoholverbot und streifen uns wasserdichte Kleidung über. Draußen hören wir bereits den singenden Ton des Sturmes in den Masten und das Plankenknarren des Schiffrumpfes.
Jetzt sind Kerle gefragt.
2. Kapitel
Ein sensationeller Bericht der archäologischen Fakultät der Universität von Tenochtitlán
Die Privatbibliothek im Palast ist Montezumas liebster Raum. Umgeben von Kunstschätzen und von geschichtsträchtigen Faltbüchern seiner Gelehrten findet er hier nach stressigen Regierungsgeschäften Ruhe und Entspannung. Das Licht im Raum ist gedämpft. Das Interieur der Bibliothek ist opulent folkloristisch und zeugt vom Können meisterlicher aztekischer Innenarchitektur. Der große Kaiser lässt in dieser Atmosphäre seinen Gedankenflüssen freien Lauf. Das Raumklima ist angenehm, denn er kann es durch speziell angeordnete Zu- und Abluftöffnungen manuell steuern. Seine Wachmannschaften sind instruiert, strengstens darauf zu achten, dass kein Lärm durch die Türen, Fenster und das Gemäuer des Raumes dringt. Alle sich in der Nähe der Bibliothek befindlichen Personen dürfen nur auf Zehenspitzen Fortbewegung betreiben, so ein Schwerpunkt in den Dienstanweisungen des Sicherheitspersonals. Gleichzeitig dient die Bibliothek Montezuma als Arbeits- und Gesellschaftszimmer. Hier werden im Geiste die Richtlinien seiner Herrschaft geboren. Hier werden im engsten Kreis seiner Vertrauten die exekutiven Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Politik besprochen und hier finden die romantischen Begegnungen mit auserwählten Freizeitdamen statt, die er für Empfänge und besinnliche Nächte benötigt. Dafür wurde extra die Planstelle eines Frauenbeauftragten innerhalb seines Beamtenapparates geschaffen.
Soeben hatte Montezuma die schriftliche Richtlinie seiner Priester zur Durchführung einer größeren Opferung auf der Mondpyramide überreicht bekommen. Die Regenzeit steht bevor. Da sollte man gegenüber den zuständigen Göttern aktiv werden. Auf keinen Fall dürfen die benötigten Regenmengen ausbleiben. Die Volksernährung muss unter allen Umständen abgesichert sein. Kurz denkt Montezuma über eine Aufstockung der Zeremonie nach, um auch die Götter des Schutzes vor Reiseeinschränkungen gnädig zu stimmen und damit seiner Expedition höheren Beistand zu gewähren. Aber er verwirft die Idee, denn er hat seinem Reiseleiter Columbuxotl in die Hand versprochen, die vereinbarte friedliche Mission nicht mit Opferblut zu besudeln.
Montezuma liebt es, in den alten Schriften der Geschichte seines Volkes zu stöbern und dabei die Großartigkeit der aztekischen Gesellschaftsentwicklung dokumentiert vorzufinden. Eine große Anzahl von Faltbüchern, mittels Papel Amate (7) gebunden, farbenprächtig mit beeindruckenden Piktogrammen und Ideogrammen in der Zeichensprache der Azteken abgefasst, befinden sich in seiner unschätzbar wertvollen Privatsammlung. Für das Inventar öffentlich zugänglicher Bibliotheken, gestattet er in besonderen Fällen Plagiatsanfertigungen, mit denen er meist Mitglieder der höheren Kreise betraut, weil die sich gelegentlich der Technik des Abschreibens bedienen. Heute blättert Montezuma im Bericht seiner archäologischen Fakultät der Universität von Tenochtitlán (8). Er liest über die Schlussfolgerungen zu den vor zwei Jahren abgeschlossenen Ausgrabungen nahe der Siedlung Vinland (9) an der Ostküste von Neufundland, das weit über dem Büffelland befreundeter Steppenstämme liegt. „Neue Funde in Neufundland“, so lautet die Überschrift der Abhandlung. Ob bewusst oder unbewusst gewählt, jedes Mal kann er über dieses Wortspiel schmunzeln. Er erinnert sich auch heute noch gern an folgendes: Nach aztekischem Vorbild hatten zwei verwegene Eingeborene dieses kalten und spärlich bewachsenen Landes die Absicht gehegt, einen Ballspielplatz anzulegen. Dabei hatten sie bei den Aushubarbeiten für die Fundamente merkwürdig gebogene Holzplanken gefunden, dazu Waffen aus einem unbekannten Material und gegerbte Tierhäute mit schriftähnlichen Zeichen. Die Funde waren schnell zur wissenschaftlichen Sensation geworden. Sofort war das Gelände auf Bitte Montezumas von den zuständigen neufundländischen Behörden gesperrt und für weitere Ausgrabungen den Archäologen aus der aztekischen Hauptstadt übergeben worden. Zu Beginn der Erschließung des Areals hatte noch niemand ahnen können, welche immense Bedeutung die geborgenen Funde noch erlangen würden. Erst nach und nach war dies in das Bewusstsein der aztekischen Forscher eingedrungen. Montezuma gegenüber äußerten sie sich immer dramatischer. Sie sprachen von DEN Entdeckungen der Epoche, die dem Ansehen des aztekischen Herrscherhauses gut zu Gesicht stehen würden. Als wären diese Entdeckungen vom Schicksal Montezumas vorbestimmt, hatte der Kaiser nicht lange gefackelt und erklärte die Ausgrabungen zur Chefsache. Die Fundstelle befand sich in einem ausgedehnten Moorgebiet. Das machte auch erklärbar, warum die ausgegrabenen Artefakte dieser fremden Kultur so gut erhalten geblieben waren. Mit restaurativer Geduld und ein wenig Glück hatten die Wissenschaftler spektakuläre Deutungen über die Bewandtnis der Funde gezogen. Es war ihnen schließlich auch gelungen, die Schrift auf den Tierhäuten und die Symbolik der bildhaften Verzierungen an Ringen, Ketten, Helmen, an kleineren Statuen und den Waffen einigermaßen zu entziffern und in die aztekische Sprache Nahuat (10) zu übersetzen. Die Fremden hatten seltsame Hinweise auf ein Land im Osten hinterlassen, jenseits des großen Wassers, aus dem sie scheinbar kostbare Stoffe und exotische Gewürze bezogen. Reste köstlicher Würzmischungen in bunt bemalten Tonkrügen und gut konservierte feinste glattglänzende Stoffreste hatten die Ausgräber und den Kaiser fasziniert. Auch von den Waffenfunden war Montezuma angetan gewesen. Die Schilde waren aus Holz gefertigt worden und wesentlich stabiler, als es das Heer der Azteken kennt. Schwerter und Dolche bestanden aus einem unbekannten Material, welches viel härter als die aztekischen Pfeil- und Speerspitzen, die traditionell aus Obsidian, einem vulkanischem Gesteinsglas, gefertigt war. Eine ungeheure Schlagkraft musste sich hinter dieser Kriegsausstattung verbergen, so die berechtigte Schlussfolgerung seiner Militärberater. Nur ein paar Meter von der Wikingersiedlung, dort wo sich der Übergang von Moorlandschaft zum Meeresufer vollzog, hatten die Archäologen Teile eines Bootes bergen können. Mit Geschick und viel Phantasie rekonstruierten die Wissenschaftler einen hochseetauglicher Schiffsrumpf aus den Überrestenrekonstruierten, bei dem sogar die Vorrichtungen der Verankerung von zwei Segelmasten erhalten geblieben waren. Das Boot musste Jahrhunderte im Moorboden überdauert haben. Umso erstaunlicher war es gewesen, welche herausragende Technik des Schiffsbaues die Fremden beherrschen mussten. Die größte Überraschung jedoch war die schwierige, aber gelungene Entzifferung des Namens des Bootes gewesen, der am Bug des Bootes beidseitig in die Schiffsplanken eingebrannt worden war. Nach mühsamen linguistischen Verrenkungen anerkannter Sprachwissenschaftler, hatte der Schiffsname „Leif Eriksson der Wikinger“ entziffert werden können. Dieser Name sorgte für Heiterkeit, da etwa zur gleichen Zeit in den aztekischen Hitparaden der Song „Leif ist Leif“ Spitzenplätze erlangte. Das größte Rätsel aber war die Zuordnung der Gewürze und Stoffe in der Kultur der Wikinger gewesen. Nach langem Grübeln und zahlreichen Streitgesprächen hielten die Sprachexperten es schließlich für möglich, dass jenseits der Heimat der Wikinger ein anderes, noch viel ferneres Land existieren musste, obwohl man sich mehr auf Indizien als auf Beweise stützte (11).
Man entwickelte damals schwärmerisch Theorien darüber, wie die Eingeborenen des sagenumwobenen Landes herrliche Gewürze ernteten und zubereiteten und wie sie es mittels einer kleinen domestizierten Seidenraupe verstanden, einen Faden für glänzende Stoffe zu gewinnen. Ständig warm könnte es dort sein, der Boden wäre wahrscheinlich fruchtbar, geeignet für mehrere Ernten im Jahr. Überall könnten dort Blüten in dichten Wäldern duften. Man fand bildhafte Indizien, dass sich in diesem wundersamen Land überall auf den Straßen und Wegen heilige herumlungernde Rinder verteilten, die religionsbedingt unantastbar waren und deren Fleisch nicht gegessen werden durfte. Für die Azteken war das alles unvorstellbar. Denn wenn sie Essen herumliegen sehen, dann nehmen sie es selbstverständlich zu sich.
Mit glänzenden Augen erinnert sich Montezuma weiter, wie er vor etwa zwei Jahren Kostproben der Gewürzfunde seinen Sterneköchen der Palastküche zum Ausprobieren übergeben hatte. Die waren sofort hellauf begeistert gewesen und kreierten mit diesen exotischen Zutaten umgehend köstliche neuartige Gerichte. Im Rahmen eines eilig organisierten Festbankettes wurden gedünstetes Leguanfleisch auf Chili und schwarzem Pfeffer, dazu ein Gemüse aus Kraut und Bohnen, unterlegt mit Kurkuma, marinierten Larveneiern und getrockneten Ingwerhappen aufgetischt. Ein Maisarrangement nach Sylvie-Art ergänzte die bewusst herbeigeführte Opulenz. Zum Nachtisch war Tapiermilchpudding mit cremig gerührter Anissoße gereicht worden. Das Festessen wurde eine Sensation. Die Gäste waren durchweg von hohem Rang gewesen und die wichtigsten Beamten des Führungszirkels im aztekischen Staatapparat hatten dazugezählt. Die Heeresgruppenführer der aztekischen Armee, einflussreiche Richter und Journalisten der staatsgewogenen Presse, sie alle nahmen an der Verkostung teil und waren des Lobes voll. Die Mischung aus traditioneller aztekischer Küche mit fremden Gewürzen hatte den Küchenchef veranlasst, auf der Speisekarte zu vermerken, dass es sich um „indernationale Küche“ handeln würde. Der Schreibfehler war peinlich gewesen, war aber von den Gästen mit ausgelassener Heiterkeit quittiert worden. Diese Gästereaktion hatte Montezuma veranlasst, die Gewürzhersteller des fremden Landes einfach als „Inder“ zu bezeichnen. Ein noch größerer Heiterkeitsausbruch der gesamten Tafelrunde war die Folge. Genau so hatte es sich damals zugetragen und es ist überliefert, dass das fremde Land seine Staatsbezeichnung einem Schreibfehler verdankt und folglich den Namen „Indien“ tragen sollte!
Seither brennt in Montezuma das heftige Verlangen, mehr dieser köstlichen Geschmacksveredlungsstoffe beschaffen zu lassen. Nicht viel anders verhielt es sich mit den Stoffrestfunden. Selbst nach fünfhundert Jahren glänzten und leuchteten sie in fantastischen Farben. Die Stoffproben waren glatt und erzeugten bei einer Berührung ein wundervolles Gefühl mit Gänsehauteffekt. Besonders Montezumas Freizeitdamen waren davon angetan und schwärmten vom Besitz ganzer Kollektionen aus diesem Material. Die Schäferstündchen des Kaisers wurden allmählich von diesem Thema dominiert. Der Lustgewinn sank beträchtlich. Es musste also etwas geschehen! Und es geschah.
Der Kaiser der Azteken war über seinen Schatten gesprungen und hatte einen großen Wurf angeordnet. Er versammelte seinen engsten Beraterkreis um sich und hatte verfügt, dass eine von der Regierung entsandte Expedition das Stoff- und Gewürzland Indien über den östlichen Seeweg aufspüren solle. Vom Expeditionsleiter sei vor Ort zu entscheiden, ob die Kostbarkeiten mittels kriegerischer Gewaltanwendung vereinnahmt werden könnten oder ob bei militärischer Überlegenheit der fremden Eingeborenen nicht besser Handelsbeziehungen aufgenommen werden sollten. Um die zweite Option durchführen zu können, seien ausreichend Goldmengen als Handelsargument auf die Entdeckerreise mitzuführen. Da im aztekischen Reich, besonders in seinen gebirgigen Gegenden, eine ganze Menge dieses Edelmetalls zur Verfügung stand, besaß diese höchste Festlegung keinen größeren Schwierigkeitsgrad.
Wesentlich komplizierter war es allerdings gewesen, einen geeigneten und jovialen Expeditionsleiter zu finden. Es musste ein unerschrockener Mann sein, der als glühender aztekischer Patriot die Interessen Montezumas für edle Gewürze und feinem Tuch unabdingbar vertreten würde. Er musste in der Lage sein, sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die einerseits das Kriegshandwerk beherrschte und andererseits in der Lage sein musste, mit Leib und Seele auf See zu fahren. Sie sollte Erfahrung im Umgang mit Segelschiffen vorweisen können und vor allem, sie musste stets furchtlos sein. Eine Garantie zum ausgelobten Land zu kommen, die konnte den Männern niemand geben. Kurz, sie mussten ganze Kerle sein.
Für die Vorbereitung der Expedition hatte Montezuma eine Arbeitsgruppe einberufen. In ihr hatten sich Fachexperten des Schiffsbaus versammelt, die das ausgegrabene Wikingerschiff als würdige Blaupause für einen größeren Nachbau von drei Seglern betrachteten. Eine Delegation von Astronomen aus Palenque, einer Stadt im Staatsgebiet Chiapas des befreundeten Stammes der Maya wurde dafür gewonnen, mit der auserwählten Crew Lehrgänge zur nautischen Ausbildung durchzuführen. Außerdem hatten Meeresströmungskundler, zur Definition des groben Auslaufkurses der Armada und Ernährungswissenschaftler, zur Bemessung der Reiseproviantvorräte an den Beratungen teilgenommen. Aus dem medizinischen Bereich berief man neben einem Psychologen, einen praktizierenden Wundheilungsschamanen und einen international renommierten Beschwörungstheoretiker in das Vorbereitungsteam. Für die Hofberichterstattung war ein Team erfahrener Schriftdesigner zusammengestellt worden, das vorrangig Heldenhaftes der Mission ideologisch aufarbeiten sollte und die Sonnengleichheit Montezumas als Lenker und Denker hervorzuheben hatte. Ein Vertreter der Staatsbank hatte die verschiedenen Größen und den Reinheitsgrad der Goldbarren katalogisiert, die als Tauschmittel in die vertrauliche Obhut des Expeditionsleiters gelangen sollten. Schließlich war noch ein Militärwissenschaftler hinzugezogen worden. Der Bewaffnungsexperte hatte für den Fall der gewaltsamen Gewürz- und Tuchbeschaffung den Auftrag bekommen, die richtigen taktischen Waffen zu ordern. Für den Fall der Notwendigkeit der Abwehr eines Angriffs, sollte er die entsprechenden Abwehrmittel vorschlagen und den Verhaltenscodex der aztekischen Krieger neu definieren. Diese Aufgabe hatte sich als besonders schwierig erwiesen, denn die Waffenfunde am eisigen Nordmeer verhießen nichts Gutes. Das harte Material, aus welchem die Schwerter, Äxte und Lanzen der Wikinger bestanden, ließ erahnen, dass man sogar von einer militärischen Überlegenheit der fernöstlichen Stämme ausgehen musste. Dementsprechend galt es klug und vorausschauend zu planen.
Montezumas Bauchgefühl sagt ihm, dass das Gold im Bauch seines Führungsschiffes somit eine hohe Bedeutung hatte. Leise misstraut er ein bisschen der Qualität des aktuellen aztekischen Bewaffnungstandes. Gepaart mit der beabsichtigten Strategie der pazifistisch angelegten Kontaktaufnahme, sollte es seiner Delegation deshalb besser gelingen, die begehrten Gewürze und Stoffe friedlich zu akquirieren. Später könnte man dann die Bedingungen zum Aufbau eines internationalen Handelskonsortiums in dem fremden Land schaffen.
Montezuma legt das Faltbuch mit den Chroniken der Expeditionsvorbereitungen zur Seite, schließt die Augen und denkt an die Crew auf dem unbekannten großen Wasser. Wird es Columbuxotl mit seinen Männern schaffen? Werden die verwegenen Haudegen das gelobte Land betreten und seinen Auftrag erfüllen können? Manchmal quälen ihn diese Fragen, manchmal machen sie ihn stolz. Eine melancholische Stimmung erfasst den Kaiser jetzt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Schiffstaufe der drei Segler hat Montezuma von seinem Hofkomponisten ein Hohelied auf sein Führungsschiff, die Santa Maria, dichten lassen. Er mag den Text und auch die Melodie. Starke Emotionen erfassen ihn und der Kaiser singt das Lied von der Santa Maria (12):
Umdada umdada umdada …
Santa Maria, Segelschiff aus Träumen geboren.
Ich habe meine Sinne verloren, In dem Fieber, das wie Feuer brennt.
Santa Maria, Nachts die schneeweißen Wellenkronen, hielt ich ihre Treue in den Händen
Glück, für das man keinen Namen kennt.
Umdada umdada umdada …
3. Kapitel
Das bedrohliche Knarren und Ächzen der Masten und Spieren
Es ist so weit. Einige Matrosen beten, andere weinen oder rufen nach ihrer Mama. Die meisten aber sind still und ergeben sich bibbernd ihrem Schicksaal. Spätestens jetzt verfluchen die Seemänner ihre Berufswahl. Sie ignorieren schlagartig das faszinierende Naturschauspiel der auf- und untergehenden Sonne auf See und verdrängen die bezaubernde Romantik des Einfahrens in die Häfen und in die ein oder in die andere Spelunkenbraut. Der Sturm hat die Armada erreicht.
Wir sind den Elementen ausgeliefert. Es ist stockdunkel. Nur selten tritt etwas Mondlicht durch die Wolkenfetzen. Dennoch nehmen wir wahr, dass wir die Wellen mit unserem Schiffsrumpf seitlich vom Bug schneiden. Die Gefahr des Kenterns ist damit etwas geringer. Wenn wir quer zur Welle stehen würden, hätte das fatale Folgen. Um das Schiff zum Wellenbrechen auf Kurs zu halten, habe ich mich mit Kaleutl hinter dem Steuermann im Bereich des Ruders angebunden. Laut schreiend versuche ich, dem Mann am Steuerrad Anweisungen zu geben. Vergebens. Das Tosen der Wellen und des Windes verhindert jegliche Kommunikationsversuche. Wir müssen uns mittels seemännischer Zeichensprache behelfen. Kaleutl versucht indes verzweifelt, das Licht der Sturmlampe zu schützen, nur so können wir uns wenigstens etwas über die Lage an Deck orientieren und vor allen zeigt das Licht unseren beiden Schwesterschiffen unsere Position an. Wenn die hohen Wellen es erlauben, können wir auch deren Lichter erkennen. Sie sind nicht weit weg. Es ist gut zu wissen, dass die Armada dem Sturm noch standhält und wir derzeit keine Rettungsmaßnahmen unternehmen müssen. Selbst, wenn es notwendig werden würde, wir hätten bei diesem starken Sturm keine Chance. Ich versuche mich auf die jetzt notwendigen Kommandos zu konzentrieren. Ich höre, wie einige Seile des Tauwerkes reißen. Damit verstärkt sich das Knarren und Ächzen der Masten und Spieren. Wie einen Peitschenknall höre ich die Schoten um unsere Ohren fliegen. Ein paar nicht definierbare Gegenstände, die sich aus der Vertäuung gerissen haben, verfehlen uns nur knapp. Hier auf Deck ist es kreuzgefährlich. Jederzeit könnte uns eine Monsterwelle über Bord spülen. Zwischen dem Tosen höre ich ein paar Wortfetzen meines Ersten Offiziers.
Ich kann nicht glauben, was er brüllt: „Chef, haben wir Surfbretter an Bor…“, seine Stimme wird im Sturm erstickt. Dann vernehme ich noch: „Ich denke, … nie wieder so gute … ich … alter Extremsportler …“
Kaleutl hat sich verschluckt. Das Wasser einer Welle hat die oberen Bereiche seiner Luftröhre erreicht und zwingt ihn, das Witzereißen zu unterlassen. Er hustet nun herzzerreißend.
„Bis du bescheuert, du verrückter Kerl? Wie kannst du jetzt an Surfsport denken?“, brülle ich zurück. Merkwürdigerweise stimuliert die groteske Situation meinen Heldenmut. Der Kampf gegen den Sturm auf See erzeugt in mir ungeahnte Kräfte, ich fühle mich plötzlich bärenstark. So besiege ich meine Angst. Der Tod auf See verliert seinen Schrecken. Kaleutl muss meinen Ärger nicht verstanden haben. In einer kurzen Sturmpause grinst er mich an und fragt: „Chef, das mit den Surfbrettern war nur Spaß! Aber wenn wir eine Hochseeangel hätten …“ Der Rest der Worte verschwindet im Tosen der nächsten Monsterwelle.
Die Erfahrung des Seebären ist die wichtigste maritime Orientierungshilfe. Er kennt die Landmarken, wie zum Beispiel Steilküsten, Windmühlen, Kirchtürme undLeuchtfeuer, die gängigen Seezeichen in Gestalt von Baken, Körben, Tonnen und er kennt die Meeresströmungen. Er beobachtet die Sonnenhöhe und den Sternenstand, zieht seine Schlüsse aus Wolken und Wind, aus den Eigentümlichkeiten des Wassers, orientiert sich an Farbe, Salzgehalt, an treibendem Seetang, der auf Küstennähe schließen lässt und aus der Art der gesichteten Vögel und dem Vorkommen bestimmter Fischarten. Das alles gilt bei normaler See, bei Tageslicht und in den landnahen Gewässern des aztekischen Reiches. Hier jedoch herrscht Sturm, totale Finsternis und das flaue Gefühl in unbekannten Seegebieten orientierungslos herumzutreiben. Selbst in diesem Chaos erinnere ich mich jetzt an die weisen Verse des landesweit präsenten Götterspeiseproduzenten Horstl Sternelichter, der mit seiner Beschwörungsformel „Auf See und mit meinem Jüngsten Gericht bist du in Huitzilopochtlis (13) (Gottes)Hand“ genau den Nagel auf den Kopf traf. Damals hatte ich den Spruch nicht verstanden. Jetzt jedoch intoniere ich ihn laufend und sprechgesanglich als Gebet, seit der Sturm seine volle Wucht entfaltet hatt. Wenigstens dieser eine Gott sollte uns beistehen.
Ein Matrose kriecht aus dem Unterdeck kommend auf uns zu. Offensichtlich will er uns eine wichtige Mitteilung geben, denn er riskiert, von einer Welle über Bord gespült zu werden. Sein Gesicht ist blutverschmiert, sein Blick ängstlich. Er wendet sich flehentlich, seinen Ersten Offizier missachtend, direkt an mich:
„Unter Deck herrscht Chaos, Chef. Die Leute sind völlig verängstigt und planen, zu murren zu beginnen.“
Dann bricht er zusammen. Er hat offensichtlich starke Schmerzen. Ich will mehr erfahren, komme aber nicht dazu, ein paar Fragen an ihn zu stellen.
„Und hier oben ist Ordnung, du kümmerlicher Angsthase“, herrscht Kaleutl den informierenden Mitarbeiter stattdessen an.
„Merke dir folgendes, du Clown“, brüllt er. „Dort wo Chaos und Ordnung aufeinandertreffen, da ist Leben. Kapierst du das?“
Verdattert schaue ich meinen Ersten Offizier an. Der bemerkt die Fragezeichen in meinem Gesicht und ergänzt schnell, während er sich an den Auslöser seines Wutanfalls wendet: „Wir leben, verstehst du, wir leben noch! Das mag jetzt philosophisch klingen, aber es ist die reine süße Wahrheit. Du und der Jammerhaufen da unten solltet das gefälligst schnellstens kapieren und euren Arsch nach oben auf Deck bewegen.“
Kaleutl schickt den Mann mit dem Befehl zurück unter Deck, dass sich die Mannschaft zusammenreißen solle.
„Denkt an das Leben. Wer jetzt nicht mitzieht, der soll abhauen. Von mir aus von hier direkt in den Jahresurlaub“, brüllt er dem Mann hinterher.
Tatsächlich zieht sich der Informant zurück und verschwindet in der Decksluke. Ich schaue Kaleutl völlig entgeistert an, nicht sicher, ob das jetzt wieder einer seiner Späße war oder ob er argumentativ den richtigen Ton für die prekäre Situation gefunden hat. Unter Deck ist es ruhig, kein Murren ist zu vernehmen. Dieser Vorfall führt mir blitzartig vor Augen, an welchem seidenen Faden der Erfolg unserer Expedition hängt, wie schnell Dünnhäutigkeit und das berühmte dicke Fell aneinandergeraten können. Ich schaue zu Kaleutl, danach zum Steuermann und gebe mit seemännischer Zeichensprache zu verstehen, dass ich es für richtig halte, mal kurz unter Deck zu gehen. Ich will mir selbst ein Bild vom Zustand der Crew machen. Die beiden bestätigen meine Absicht mit Kopfnicken und signalisieren mir, dass sie für diese Zeit allein die Ruder und die Stellung halten werden.
Ich hangele mich zur Einstiegsluke. Dabei werde ich hin und her geschleudert. Mit etwas Glück und ein paar Schrammen erreiche ich wohlbehalten den Mannschaftsraum, klettere die Stiege hinab und stelle mich vor meine Männer. Die geplante Ansprache meinerseits jedoch ist nicht mehr erforderlich. Vier bärenstarke Kerle stellen sich vor mir auf, nicken mir einzeln im Vorbeigehen ins Gesicht und steigen nach oben. Der Letzte der Männer legt seine Hände auf meine Schulter und gibt mir zu verstehen, dass sie sich nicht mehr länger im Schiffsbauch verkriechen wollen. Sie wollen sich auf Deck nützlich machen und dem Unwetter als Männer trotzen. Ich bin beeindruckt und erleichtert. Eine Meuterei jetzt, das wäre eine Katastrophe. Mit ein paar Belohnungsaufzählungen, die abhängig vom Erfolg der Expedition in die Hände und Kehlen des Restes der Mannschaft gelangen würden, gelingt es mir, die Laune unter Deck erheblich zu verbessern. Beruhigt steige ich wieder hinauf und stelle überrascht fest, dass der Sturm nachgelassen hat und die Santa Maria nicht mehr so schlingert. Erste Anzeichen von Morgenrot zeichnen sich am Horizont ab. Die See beruhigt sich.
„Der Fisch hat angebissen, setzen wir wieder die Segel. Ich denke, dass wir die Winde noch nutzen sollten. Ich habe Polaris orten können und bin mir ziemlich sicher, dass die Winde uns gen Osten tragen. Nutzen wir die Gunst der Stunde“, sagt Kaleutl in überraschend sachlichem Ton. Mich ergreift nun ebenfalls eine erhöhte Neigung zur seemännischen Betriebsamkeit auf Deck. Ich stimme dem Ersten Offizier zu, weise den Bootsmann an, die Segel setzen zu lassen und verlange nach unserem Wetterfrosch Xotl Barometl. Noch völlig eingeschüchtert vom Erlebten steht der Wetterfachmann vor uns und meldet sich zum Dienst.
„Nun alter Windbeutel, was sagen deine Vorhersagegelenke?“, fragt Kaleutl wenig charmant.
„Ich weiß nicht, ich weiß nicht“, entgegnet Xotl unsicher. Er grübelt eine Weile.
„Vom Gefühl her spüre ich ein merkwürdiges Gelenkziehen. Irgendetwas ist nach dem Sturm anders. Das Schiff bewegt sich merkwürdig. Wir kommen schneller voran, als dass uns das die Bugwellen und die Wasserwirbel am Heck signalisieren. Lasst mich mal in den Mastkorb steigen. Ich will mir von oben einen genaueren Überblick verschaffen.“
„Lass dich doch von deinen Gelenken hochziehen, das geht schneller“, kalauert Kaleutl und lacht als Einziger. Ich hebe die Hand, Spaß ist jetzt unangebracht. Der Offizier versteht, schweigt sofort und überwacht das Setzen der Segel. Xotl Barometl quält sich mittlerweile die Strickleiter zum Mast hoch. Ich schaue dem Mann nach und mache mir ein wenig Sorgen. Da oben am Mast darf man bei diesem immer noch starken Wind keinen Fehler machen. Fehltritte enden nicht selten tödlich. Auch ist zu hoffen, dass der Magen des Wetterexperten leer ist. Die diensthabenden Matrosen, die zur Mastwache eingeteilt sind, haben acht Stunden vor Dienstantritt striktes Essenverbot. Diese Regelung haben wir während unserer Reise schnell eingeführt, denn oft haben wir erleben müssen, dass der Mageninhalt bei ähnlichem Wetter dann auf den Deckplanken gelegen hatte. Eine unappetitliche Komplettreinigung des Decks und der Takelage war meist die Folge gewesen.
Alle Segel sind jetzt gesetzt. Die Bäuche der Segeltücher sind prall, das Zeichen für guten Wind. Ich beuge mich über die Reling an der Spitze der Santa Maria und beobachte die Bugwellen. Tatsächlich, die Fahrtwellen sind mäßig. Ein Blick auf die Segel bestätigt, dass sich die Ahnungen unseres Wetterexperten bestätigt haben. Die Wellen sind sonst wesentlich höher. Den gleichen Test führe ich nun am Heck durch und stelle fest, dass auch die Verwirbelungen des Wassers gleich hinter dem Ruder nur gering ausgeprägt sind. Merkwürdig. Ich habe einen Verdacht, will mich aber ohne Konsultation mit unserem Wetterverantwortlichen noch nicht dazu äußern.
Ich schaue zum Mastkorb. Xotl ist immer noch auf Mastwache. Ich rufe seinen Namen so laut ich kann. Er reagiert nicht. Ich mache mir Sorgen und bitte den Bootsmann, nachzuschauen. Ich weiß, dass die beiden befreundet sind und brauche den obersten Vorarbeiter der Decksmannschaft nicht zweimal darum zu bitten. Schnell ist er die Strickleiter hinaufgeklettert und steigt in den Mastkorb. Kurz darauf beugt sich der Bootsmann über den Korbrand und ruft zu uns hinunter: „Keine Sorge, Xotl ist schlecht … der wird wieder.“
Kaleutl steht wieder neben mir und flüstert: „Xotl ist nicht schlecht. Er ist ein Guter.“
Ich ignoriere den sinnlosen Spruch und weise den Bootsmann an, sofort in Erfahrung zu bringen, welche Beobachtungen Xotl im Mastkorb machen konnte.
„Ei Ei, Chef, ich komme runter. Xotl will, dass wir den Holzpflocktest machen. Er selbst ist derzeit dazu nicht in der Lage.“
„Hast du ihm Medizin gegen sein Unwohlsein gegeben?“, frage ich den Bootsmann während er die Strickleiter behände herabgleitet.
„Klar, einen doppelten Tequila“, so seine Angabe zur Medikamentenauswahl. Ich bestätige und lass von einem herumstehenden Matrosen den Holzpflock mit der Leine holen. Er ist in einer Kiste auf Deck verstaut, in der sich die wichtigsten Messinstrumente der aztekischen Seefahrt befinden. Neben dem Holz sind noch verschiedenlange Seile mit Knoten in der Kiste verstaut. Die Knoten haben definierte und regelmäßige Abstände und können so beim Eintauchen in das Wasser Aufschluss über die Tiefe der See bringen. Als Senklot am Ende der Seile sind schwere Goldgewichte befestigt. In der nautisch wichtigen Kiste sind außerdem noch eine Sanduhr, Peilstöcke verschiedener Längen und zwei Sturmlampen untergebracht. Für den Notfall und zur Kommunikation mit den Schwesterschiffen ergänzen das Inventar noch ausreichend Leuchtfackeln und zwei schwere Schiffsglocken. Eine Nebelsignalanlage aus einem ausgehölten Büffelhorn und zwei einklappbare Vogelkäfige vervollkommnen den Inhalt. Die beiden Sextanten sind zu wertvoll, als dass sie auf Deck neben den anderen nautischen Geräten verstaut werden können. Stattdessen sind sie in einer Nebenkammer meiner Kajüte unter strengem Verschluss untergebracht und dürfen nur von mir und dem Ersten Offizier benutzt werden.
Wir lassen das Holzscheit zu Wasser und geben ihm circa drei Knoten (14) Seillänge. Wir beobachten, wie das Holzstück langsam Backbord am Schiffsrumpf zum Heck hin schwimmt. Ich sehe die Segel voll aufgebläht, dann sehe ich Kaleutl an und bin mir sicher: „Das muss die Meeresströmung sein. Leute, wir haben sie gefunden!“, schreie ich meine Freude auf die See. Spontan umarmen wir uns und werfen unseren Federschmuck in den Wind. Außer Rand und Band rufe ich nach Xotl, um ihm meine lebenswichtige Erkenntnis mitzuteilen. Der Seefahrtmeteorologe schaut gequält über den Mastkorbrand und versucht zu lächeln.
„Ich habe es geahnt. Ich gratuliere, Chef. Du bist ein ganz Großer der Seefahrt. Nach deinen Berechnungen haben wir bereits mehr als die Hälfte unserer Seereise hinter uns. Jetzt wird es schnell gehen, denn die Strömungen in Richtung Nordost sollen nach den Aufzeichnungen der Wikinger stark sein.“
„Tequila und gepökeltes Büffelfleisch für alle“, weise ich Rod unseren Steward an. Die Mannschaft hat die glückliche Wendung der Reise mitbekommen. Die Stimmung ist prächtig. Über Seezeichen machen wir unseren Schwesterschiffen Mitteilung und beginnen zu feiern. Die ordnungsgemäßen Logbucheintragungen entfallen für heute. Das hohle ich morgen nach. Spät in der Nacht, nach Einteilung der Nachtwache, falle ich todmüde in meine Koje. Zuerst ziehe ich das linke Bein unter die Decke. Das rechte Bein schaffe ich nicht mehr. Es bleibt die Nacht über draußen. So müde bin ich.
4. Kapitel
Ein besonderes Meisterschaftsspiel
Eigentlich ist es üblich, dass auch die ganz hohen Herren zu besonders staatstragenden Anlässen den Ort des Geschehens zu Fuß betreten. Nicht so heute. Montezuma, seine diensthabende Freizeitdame und seine wichtigsten Vertrauten werden zum Höhepunkt der aztekischen Ballspielmeisterschaft in kaiserlichen Sänften zum Ort des sportlichen Spektakels getragen. Der Präsident des gastgebenden Hauptstadtclubs überlässt dem höchsten Repräsentanten des aztekischen Staates seine VIP-Loge unentgeltlich, allerdings nicht ganz uneigennützig. Diese Selbstverständlichkeit muss nicht besonders reflektiert werden, findet Montezuma und würdigt den kleinen Sportfunktionär bei Betreten des Bereiches der teuren Eintrittskarten keines Blickes. Der Kaiser lässt noch ein paar Dinge aus der Luxusloge entfernen, prüft den Blick auf das Spielfeld und verlangt dann vom Clubpräsidenten, mit der angekündigten opulenten Bewirtung zu beginnen. Dieser übernimmt persönlich das Auftragen des Festmahls. So ganz hat er seinen Plan, Montezuma als Hauptsponsor seines Teams zu gewinnen, noch nicht aufgegeben. Der Kaiser registriert ungerührt, dass der Präsident ihm die größten Happen des Dinners auflegt. Er verlangt die Mannschaftsaufstellung des Trainers. In der Startelf fehlen ein paar bekannte Namen. Ungefragt begründet der Funktionär dies mit der derzeit hohen Ausfallquote durch Verletzungen seiner besten Spieler. Stirnrunzeln auf der Stirn des Kaisers.
„Die Truppe ist ein Überraschungsei, taube Nüsse sozusagen. Sag mir einen Grund, warum ich mir das Spiel einer B-Mannschaft antun soll“, kommentiert Montezuma die Namen der Startformation erbost.
„Du sollest die Einkaufspolitik deiner hochdotierten Clubmanager überprüfen. Ich sage dir, alle deine Spieler sind verwöhnte Schoßhündchen, die nur für Leckerli Kunststücke machen. Für ihre hohen Gehälter hätten sie gefälligst so zu trainieren, dass sie von Verletzungen verschont bleiben“, vernichtet der Kaiser den Clubpräsidenten weiter.
Montezuma zieht jetzt eine argumentative Parallele zu seiner vor Wochen entsandten Expedition in das ferne Indien: „Präsident, deine lächerliche Aufstellung ähnelt eher einem Streichelzoo, wenn ich mir diese Bemerkung im Vergleich mit meinen verwegenen Abenteurern da draußen im stürmischen unbekannten Ozean erlauben darf“, umschreibt er sarkastisch seinen Zorn über die Aufstellung. Seine Freizeitdame lacht dümmlich über die blumigen Worte der Verachtung ihres Gebieters. Sie muss das tun, es gehört zu ihren Dienstpflichten. Auch die meisten Teilnehmer am Begleittross des Monarchen nicken anerkennend, obwohl sie sich in der Regel in der Materie des höheren Leistungssports nicht auskennen.
„Sag das deinen Memmen. Dort geht es um Leben oder Tod, hier um die Höhe der Siegprämien. Statt hart zu trainieren, treiben sich deine Stars in Tanzclubs, Hautmarkierungsstudios und bei Haarstylisten herum. Sie betreiben Designerlinien für Sonnenbrillen, Männerdüfte und für ausfallenden Federschmuck. All dieser fürchterliche unsinnige Quatsch geht zu Lasten der körperlichen Fitness. Früher wurden solche Spieler nach einer Niederlage geopfert. Das muss denen mal einer klar machen. Präsident, schmeiß diese Pfeifen raus und kauf dir neue gierige Spieler, so wie es dein heutiger Gegner macht. Die nehmen nur richtige Typen, die sich in jeden Ball schmeißen, sich für den Verein zerreißen und Fans den entsprechenden Respekt zollen. Die wollen immer gewinnen, egal wie groß und berühmt die Mannschaft des Gegners ist. So, nun pack dich, Präsident. Geh in die Kabine und sag deiner Flaschensammlung, dass der große Kaiser der Azteken erwartet, dass deine teure Mannschaft heute gegen den billigen Stadtrivalen aus den Armenvierteln gefälligst gewinnt. Andernfalls werde ich über mein weiteres Mäzenatentum zu Entwicklung deiner Truppe zu einem internationalen Spitzenteam neu nachdenken.“
Der Präsident verbeugt sich tief und verlässt rückwärtsgehend seine eigene VIP-Loge.
„Wird gemacht, Hoheit. Die Mannschaft wird dich nicht enttäuschen. Wir werden gewinnen.“
Auf dem Weg zur Spielerkabine hält er kurz inne. Sein Magen signalisiert ein baldiges Übergeben. Er hat jetzt eine sehr schwierige Aufgabe zu erfüllen. Er muss den Spielern und seinem Trainer jetzt als oberste Respektsperson des Vereins rigoros klare Kante geben. Er bereut nun das erste Mal so richtig, dass er das Ehrenamt des Präsidenten als erfolgreicher Lendenschurzunternehmer übernommen hat und den Etat des Ballspielclubs mit erheblichen Schenkungen verbessern konnte. Damit generierte der Manager des Vereins die besten und teuersten Spieler des Landes und stellte ein schlagkräftiges Team zusammen. So die gedachte Zielstellung, die bereits seit vergangener Spielzeit erheblich ins Wanken geraten ist. Warum hat er sich das nur angetan, fragt er sich angesichts der soeben erduldeten Erniedrigung Montezumas. Er fängt an, sein Engagement in dieser Ballsportart zu bereuen.
Er öffnet die Tür zur Mannschaftskabine und kann es nicht fassen. Ein gut gelaunter Haufen Leistungssportler lästert über den Gegner und debattiert locker über die Höhe des Sieges. Dabei schließen einige Spieler Wetten ab, die mit astronomischen Einsätzen die Überheblichkeit des Teams vor dem Gegner eindrucksvoll dokumentieren. Der Präsident bittet erschrocken um Aufmerksamkeit: „Die Herren, ich darf doch bitten. Der Vorstand unseres Traditionsvereins wünscht sich von Ihnen, dass Sie das Spiel mit höchster Mentalität angehen. Wir hoffen auf einen klaren Sieg und die dazu erforderliche bedingungslose Aufopferung für den Verein. Unterschätzen Sie keinesfalls den Gegner. Das erbitte ich im Namen des Vorstandes und des Aufsichtsrates unseres stolzen Clubs. Wenn heute kein Sieg gelingt, dann …“
„Was dann, he?“, stellt sich der Mannschaftskapitän vor seinen Präsidenten auf und grinst ihn an.
„Was dann, Präsi?“, wiederholt er bedrohlich.
„Dann werden wir über Suspendierungen unwilliger Spieler nachdenken müssen“, verkündet der Präsident kleinlaut. Kaum hat er den Satz ausgesprochen, bereut er ihn auch schon. Sofort ist im klar, dass in diesem Fall die Spieler mit ihren Beratern die besseren Karten in der Hand haben. Ablösefrei können sie dann jederzeit einem neuen Verein beitreten und dazu noch ein lukratives Handgeld kassieren. So ist das, wenn man sich eine Mannschaft voller Stars zusammenkauft, resigniert der Vereinsoberste und verlässt die Kabine. Er muss sich jetzt auf den Trainer verlassen. Der muss das hinkriegen. Der Präsident sucht die am nächsten zur Verfügung stehende Herrentoilette auf und übergibt sich. Nach dem Entfernen der Brechreste aus seinem Gesicht, schaut er völlig zerstört in den Spiegel und beendet das Drama mit dem Satz:
„Hau, der Präsident hat gebrochen.“
Es ist der Spieltag des Stadtderbys zwischen dem von der Wirtschaft und den regionalen Fürsten protegierten Club der Reichen, „Pink Skin Tenochtitlán“ und dem Club der weniger betuchten Handwerker, Angestellten und Bauern, „Tenochtitláner Red Skins“. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der beiden Clubs, um geeignete Spieler zu verpflichten, könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Ballspielarenas unterscheiden sich zum Beispiel beträchtlich im Fassungsvermögen an Zuschauern, auch in der Erschließung der Infrastruktur und in den Besitzverhältnissen. Die Pink Skins nennen ihr Sportstadion ihr Eigen, während die Red Skins für ihren Sportplatz bei der zuständigen Stadtbezirksverwaltung eine saftige Pacht bezahlen müssen. Die letzten drei Spieltage der aktuellen Saison sind zu absolvieren. Erster und Zweiter der Meisterschaftstabelle treffen aufeinander. Wenn die Pink Skins heute gewinnen, ist ihnen die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Man bezeichnet diese Partie seit Jahren als den „El Classico“ der aztekischen Ballspielmeisterschaft oder auch die Partie zwischen Arm und Reich mit Klassenkampfcharakter. Für die Fans beider Vereine ist der Tag des Derbys ein Festtag und für nicht wenige Anhänger der Tag der offenen und organisierten Randale. Mehrere Hundertschaften schwer bewaffneter Polizeieinheiten sind für dieses Ereignis abgestellt. Der besondere Auftrag der Ordnungshüter besteht hauptsächlich darin, die Ultras (15) der Fangruppen auseinander zu halten. Es soll dringend verhindert werden, dass vom jeweiligen Gegner Gefangene genommen werden. Wenn das doch gelingt, kann es durchaus zu Opferungen auf offener Straße kommen. Dieses Grundrecht der Exekutive und der Religionsführer soll allerdings dem Staat und der Glaubenskonklave vorbehalten bleiben. Insofern sind derartige Vorkommnisse strikt zu unterbinden.
Montezuma hadert schon lange mit diesen hässlichen Auswüchsen der Ballspielfankultur. Im Normalfall beendet er störende Einflüsse im sozialen Miteinander seines Volkes sofort konsequent und hart und es wäre leicht, die militanten Gruppierungen zu liquidieren. In diesem Fall jedoch, muss er klug abwägen. Einerseits passen die hässlichen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängergruppen der Vereine und der Staatsgewalt nicht zum gewohnt friedlichen Bild der aztekischen Gesellschaft, andererseits weiß er ganz genau, dass das Ballspiel ein großartiges Ablenkungsszenario zu den immens hohen Tributbelastungen des Volkes, zu den Machtstrukturen und zu den Zielen des Staatsapparates darstellt. Staatsdoktrin der Regierung Montezuma ist und bleibt es, dass das Volk der Azteken keinen Hunger leiden muss. Ob arm oder reich, für alle müssen genügend Nahrungsmittel zu Verfügung stehen. Die Landwirtschaft ist modern und kann aufgrund der Fruchtbarkeit der Böden und dem günstigen Klima ausreichend nahrhafte Produkte liefern. Dazu benötigt Montezumas Staat eine funktionierende Verwaltung und eine starke Exekutive, die die gerechte Verteilung organisiert und durchsetzt. Das ist teuer und erfordert hohe Aufwendungen. Außerdem muss das große Heer der Azteken bei Laune gehalten werden. Eine gute kriegsentscheidende Moral der Truppe erreicht man am besten mit hohen Zuwendungen und durch eine spannende Ballspielmeisterschaft. Die Jovialität zum Herrscher und seiner Staatsform wird seit Aztekengedenken schon immer besonders gewürdigt. Die Privilegien der Beamten Montezumas sind hart an der Grenze des Zumutbaren für das Volk, zumal in der Regel das Preis-Leistungsverhältnis seit längerem schon im Krankenstand ist.
Das Volk begreift das natürlich, denn es ist gängige Praxis, dass schamlos mit dem Reichtum in der Öffentlichkeit geprahlt wird. Vereinzelt gibt es bei den ärmeren Schichten schon ein leises Murren über diese skandalösen Klassenunterschiede. Hin und wieder verbünden sich Intellektuelle aus dem Rechtswesen und der Wirtschaft mit den unteren Schichten. Sie schreiben Manifeste, die von der Notwendigkeit des Abstreifens der Ketten künden und die Enteignung der herrschenden Kaste propagieren.
Montezuma und sein zuständiges Ministerium lassen diese Entwicklung natürlich nicht unbeobachtet. Aktuell sorgen die Ereignisse um die Vorbereitung der Ostexpedition und das Auslaufen der drei Schiffe für politischen Wirbel. Wie kann es sein, dass der Herrscher immense Tributmittel des Volkes in die Hand nimmt, um damit seine Köche und Freizeitdamen mit exotischen Gewürzen bzw. mit feinen Stoffen auszustatten? Montezuma weiß, dass es im Volk gärt. Gerade deshalb ist das Ereignis eines Ballspielderbys von höchstem gesellschaftlichen Rang, dem er sich nicht verschließen kann. Eigentlich langweilt ihn das Spiel. Er kann nicht verstehen, welch Anziehungskraft das Schlagen eines Spielballes aus Panamakautschuk von einer Spielfeldseite auf die andere mit Hilfe der Hüften oder der Ellenbogen entwickelt. Nur selten gelingt es einem Spieler, das Spielgerät durch einen Ziel-Ring, der an den Seitenmauern des Spielfeldes ziemlich hoch befestigt ist, zu schleudern und entscheidende Spielpunkte zu sammeln. Nur dann durchzuckt Montezuma gelegentlich eine leichte Begeisterung für das Spiel. In der Regel verbringt das Staatsoberhaupt seine Zeit während des Spiels mit der Akquirierung von Geschäften. Das ist auch der Sinn eines VIP-Bereiches in den Sportarenen. Es muss sich lohnen, Unsummen für das Anmieten einer Loge in der Saison zu bezahlen. Kalt rechnende Geschäftsleute würden dies sonst nicht tun. Die engsten Vertrauten seiner Gefolgschaft sind bereits in den anderen Logen unterwegs und akquirieren Kontakte zur Wirtschaft.
Sein Besuch heute soll aber auch den Zuschauern im Stadion suggerieren, wie volksverbunden ihr Herrscher ist. Gönnerhaft winkt Montezuma den Massen aus seiner Loge zu, die diese Geste allerdings kaum quittieren. Zu sehr sind sie in der allgegenwärtigen Begeisterung um das Spiel gefesselt. Die wahren hinterlistigen Absichten ihres Kaisers können sie nicht durchschauen. Montezuma ist nun bereit, die Gastgeschenke der beiden Vereine entgegenzunehmen. Erst nach diesem traditionellen Akt der Verehrung des Staatsoberhauptes wird er das Spiel freigeben und dem Schiedsrichter signalisieren, das Gaudi anzupfeifen. Wie gewöhnlich erhält er vom Arbeiter- und Bauernsportverein einen Vereinsschal mit aufgesticktem Schriftzug zum heutigen Derbyereignis. Seine Freizeitdame nötigt er, den Schal zu tragen. Für ihn selbst kommt das nicht in Frage. Mit einem Schlag ist das Gesamtkunstwerk einer durchgestylten und modebewussten Frau futsch. Der Frau ist der Schmerz über die offensichtliche Verhunzung des Farb- und Formenkonzeptes ihrer Kleidung ins Gesicht geschrieben. Sie wird die tiefe Schmach jedoch ertragen, wie so vieles andere, wenn Montezuma sie zum Dienst bestellt.
Das Gastgeschenk des wohlhabenden Clubs lässt auf sich warten. Der Beginn des Spiels verzögert sich. Die Zuschauer, Spieler und der Schiedsrichter warten. Der Sportdirektor der Pink Skin Tenochtitláns wirft sich in die Loge und erklärt Montezuma die Verzögerung der Geschenkübergabe mit einer leichten Unpässlichkeit des Präsidenten. Der Vereinsmedizinmann wäre bereits im Behandlungsmodus und stellt die baldige Erholung des Funktionärs in Aussicht. Montezumas Blick schweift vom Spielfeld über die Zuschauertribünen bis in den VIP-Bereich. Alle warten demütig. Nur vereinzelt wird zurückhaltend Unmut geäußert. Der Kaiser der Azteken ist zufrieden. Er hat alles im Griff.
5. Kapitel
Von Seetang und Vögeln
Gestern Abend, zum Routinerundgang auf Deck, fasste ich den Entschluss, für heute eine Lagebesprechung einzuberufen. Der Bootsmann erhielt die Anweisung, den Schwesterschiffen die Botschaft über Sturmlampen und Signalflaggen zu übermitteln. Die Bestätigungssignale kamen prompt. Die Disziplin scheint intakt, konnte ich zufrieden feststellen. Der Sturm vor fünfzehn Tagen hat schwere Schäden an den Schiffen, an der Ausrüstung und an der Moral der Truppe hinterlassen. Noch so ein Unwetter auf hoher See würde die Expedition mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Untergang verurteilen. Ich vergewissere mich noch einmal im Logbuch. Hier steht es. Der letzte Jour fixe-Termin mit den Kapitänen der Quetzal-Nina und der Quetzal-Pinta fand vor 10 Tagen statt. Das ist ein großer Abstand. Denn vereinbart war, dass die Besprechungen des Führungspersonals der Expeditionsarmada jeden fünften Tag auf See stattfinden sollten. Nach der derzeitigen Lage der Dinge kann aber nicht mehr wie gewohnt verfahren werden. Jede überflüssige Kraftanstrengung muss vermieden werden. Energien sind nur noch bei höchster Priorität des Verbrauchsanlasses einzusetzen. Heute aber ist die Führungsbesprechung zwingend notwendig. In etwa einer Stunde werden die Kapitäne und deren nautische Offiziere mitsamt den Bootsmaaten (16) zur Quetzal-Santa Maria rudern und an der von mir angeordneten Lagebesprechung teilnehmen. Auf den üblichen Snackimbiss zur Führungsbesprechung wird verzichtet. Die Lebensmittelressourcen gehen bedenklich zur Neige, deshalb sind auch die Sonderrationen für die Führungskräfte gestrichen worden. Sentimentalitäten sollten auf See eigentlich keine Rolle spielen, so lautet ein wichtiger Ausbildungsgrundsatz an den Seefahrtsschulen. Insofern muss ich mir heute eingestehen, dass meine gestrige Gefühlsanwandlung nach der Einberufung der Krisenbesprechung, eindeutig einen Verstoß gegen die Prinzipien von Führungsqualität darstellt.





























