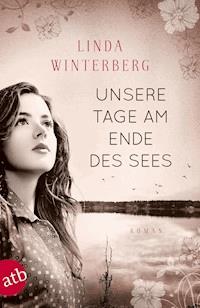10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kinder-der-Berge-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Hebamme kämpft für die Rechte der Frauen.
Berghebamme Maria hat in dem Landarzt Georg ihre große Liebe gefunden und führt gemeinsam mit ihm eine eigene Praxis. Alles könnte perfekt sein, doch Marias innigster Wunsch erfüllt sich nicht: Sie möchte Mutter werden. Um sich von ihrer Trauer abzulenken, beschließt sie, ein Wohnheim für verstoßene Schwangere zu gründen. Ein Unterfangen, das für große Missbilligung seitens der Dorfbewohner sorgt, denn ledige Mütter gelten als Schande. Und schon bald kommt es zu einem Vorfall, der nicht nur Marias Existenz bedroht, sondern auch das Leben der Frauen, die bei ihr Schutz suchen ….
Der fulminante Abschluss der bewegenden Hebammen-Saga von Bestsellerautorin Linda Winterberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Oberbayern 1899: Berghebamme Maria hat ihr Glück gefunden. Nicht nur liebt sie Georg über alles, sie teilt auch ihre Berufung mit ihm: Täglich kämpfen die beiden in der gemeinsamen Praxis für das Wohlergehen und die Selbstbestimmung ihrer Patientinnen. Doch mit der Zeit legt sich ein Schatten über ihr Leben – Marias Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Doch statt mit ihrem Schicksal zu hadern, verschreibt sich Maria mit noch mehr Energie ihrer Herzensangelegenheit und gründet ein Wohnheim für verstoßene Schwangere. Im Dorf ist diese »Einrichtung der Schande« allerdings sofort verhasst. Als eines Tages ein Feuer gelegt wird und eine der Frauen in den Flammen ihr Leben verliert, stehen Maria und Georg vor dem Ruin. Können sie das Frauenwohnheim retten und als Paar ihr Glück finden?
Über Linda Winterberg
Hinter LINDA WINTERBERG verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus.Im Aufbau Taschenbuch liegen von ihr zahlreiche Romane vor, darunter die Berliner Hebammen-Saga mit den Titeln »Aufbruch in ein neues Leben«, »Jahre der Veränderung«, »Schicksalhafte Zeiten« und »Ein neuer Anfang«. Nach dem großen Erfolg dieser Reihe widmet sich die Autorin nun ihrem Herzensprojekt: eine Hebammengeschichte aus ihrer eigenen Heimat zu erzählen.Alle lieferbaren Titel der Autorin sehen Sie unter aufbau-verlage.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Die Berghebamme – Zeit der Kinder
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel — 3. August 1899
2. Kapitel — Am selben Tag
3. Kapitel — 7. August 1899
4. Kapitel — 12. August 1899
5. Kapitel — 12. September 1899
6. Kapitel — 14. September 1899
7. Kapitel — 4. Oktober 1899
8. Kapitel — 1. November 1899
9. Kapitel — 15. November 1899
10. Kapitel — 6. Dezember 1899
11. Kapitel — 31. Dezember 1899
12. Kapitel — 15. Januar 1900
13. Kapitel
2. Februar 1900
14. Kapitel — 20. April 1900
15. Kapitel — Am selben Tag
16. Kapitel — 27. April 1900
17. Kapitel — 6. Mai 1900
18. Kapitel — 7. Mai 1900
19. Kapitel — 15. Mai 1900
20. Kapitel — 4. Juni 1900
21. Kapitel — 7. Juni 1900
22. Kapitel — 12. Juni 1900
23. Kapitel — 15. Juni 1900
24. Kapitel — 20. Juni 1900
25. Kapitel — 23. Juni 1900
26. Kapitel — 30. Juli 1900
27. Kapitel — 2. August 1900
28. Kapitel — 10. August 1900
29. Kapitel — 13. August 1900
30. Kapitel — 14. August 1900
31. Kapitel — 15. Oktober 1900
Nachwort und Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
1. Kapitel
3. August 1899
Maria stand an der Eingangstür ihres Hofes und blickte einer ihrer Patientinnen nach, wie sie im Watschelgang an ihrem Bauerngarten vorüberlief. Die Ärmste wurde von Wassereinlagerungen in den Beinen geplagt, was bei der anhaltenden Wärme der letzten Wochen ein häufiges Problem darstellte. Gerade zu dieser Stunde flirrte die Hitze regelrecht über den Wiesen und Feldern, und auch heute zeigten sich über den Gipfeln der Berge nur wenige, harmlose Schönwetterwolken.
Ihre Hausmamsell Burgi kam jetzt mit einem gut gefüllten Einkaufskorb näher. Ihr Gesicht war puterrot, und der Schweiß lief ihr in Strömen die Schläfen hinab. Schwer atmend stellte sie den Korb auf dem Tisch vor dem Haus ab.
»Mei, was ist das heut bloß für eine Hitz«, jammerte sie. »Ich hab denkt, ich muss auf dem Heimweg zerlaufen. Also ich hab ja nix gegen warme Tage, aber so arg muss es auch nicht gleich sein.«
»Ja, heute ist es besonders belastend«, stimmte Maria ihr zu. »Diese leidige Hitzewelle ist auch für die werdenden Mütter nicht gut, so viele Fälle mit Wasser in den Beinen hatte ich lange nicht. Darüber, wie beschwerlich eine Geburt unter diesen Umständen ist, brauchen wir gar nicht erst reden. Selbst nachts kühlt es kaum ab. Gestern war es in der Schlafkammer der Miltstetters so heiß, ich hab zwischenzeitlich gedacht, ich müsste ersticken.«
»Und da jammere ich umeinand, weil ich bei der Hitz zur Gundel laufen muss«, erwiderte Burgi reumütig. »Was schämen sollt ich mich. Ich mein, bei mir in der Kammer war es schon auch stickig, aber ich musste kein Kind auf die Welt holen. Was meinst, wollen wir uns eine schöne Pause und ein kühles Kracherl gönnen? In der Speis steht auch noch was von dem Zwetschgendatschi.«
»Das klingt nach einer ausgezeichneten Idee«, antwortete Maria freudig. »Komm, lass uns den Tisch decken.«
Zehn Minuten später saßen die beiden Frauen auf der zum Glück schon im Schatten liegenden Hausbank, und auf Marias Teller lag das zweite Stück Zwetschgendatschi. Ihnen leisteten einige Hühner Gesellschaft, die darauf hofften, dass einige Krumen für sie abfielen. Ein besonders vorwitziges Hühnchen hopste neben Burgi auf die Bank und pickte nach ihrem Kuchen. Sie schrie erschrocken auf.
»Du schon wieder«, zeterte sie los und wedelte mit den Armen. »Schleich dich, Trudi, aber sofort!« Empört gackernd suchte das Huhn das Weite. »Also ehrlich«, sagte Burgi und schüttelte den Kopf. »Ein frecher Bettelbruder ist unsere Trudi, glaubt ständig, sie hat Sonderrechte. Die kommt auch andauernd in die Küche. Neulich saß sie auf dem Tisch und hat im Brotteig gepickt. Wenn sie nicht so fleißig Eier legen würde, wäre sie schon längst in der Supp’n gelandet.«
Maria schmunzelte. Wie sehr sie ihre Burgi für solche Momente doch liebte. Sie war so viel mehr als ihre Hausmamsell. Burgi war Familie und stand ihr mit ihrer resoluten Art und ihrer Herzlichkeit schon seit dem Beginn ihrer Hebammentätigkeit in Brannenburg zur Seite.
Nachdem Maria den letzten Bissen Kuchen gegessen hatte, lehnte sie sich zufrieden zurück und ließ ihren Blick über das zu ihrem Dammerhof gehörende Grundstück schweifen. Das alte Bauernhaus hatte bereits mehr als hundert Jahre auf dem Buckel und war vor einigen Jahren noch dem Verfall preisgegeben gewesen. Doch mit viel Tatkraft hatten sie es wieder in ein richtiges Zuhause verwandelt. Den früheren Stall hatten sie zu einer Arzt- und Hebammenpraxis ausgebaut. Zum Haus gehörte eine weitläufige Obstbaumwiese, auf der ihre Ziegen grasten, am Zaun des großen Bauerngartens blühten Sommerblumen. Sogar eine ganze Reihe an Bienenkästen nannten sie ihr eigen. Maria war so froh darüber, wieder in diesem Haus leben zu dürfen, denn sie verband damit wunderschöne Erinnerungen. Hier war sie aufgewachsen und von ihrer geliebten Gertie mit Zuneigung überschüttet worden, der liebevollsten Kinderfrau, die sich kleine Menschen wünschen konnten. Der Dammerhof war früher das beste Findelhaus im gesamten Umkreis gewesen. Wer zu Gertie kam, konnte sich glücklich schätzen, denn es war nicht selbstverständlich, dass elternlose Kinder, abfällig als Bankerte bezeichnet, in einer herzlichen Umgebung aufwuchsen.
Marias Herkunft wog schwer. Ihr Blick wanderte zu St. Margarethen, der kleinen Kirche mit dem Treppengiebel, die auf einem unweit gelegenen Hügel im sommerlichen Nachmittagslicht wie gemalt aussah. Vor ihren Toren hatte Marias Mutter sie in einer eisigen Winternacht voller Verzweiflung ausgesetzt. Lange Zeit war ihr Leben ein Kampf gegen ihre eigene Vergangenheit gewesen, gegen die Schande ihrer Mutter. Doch sie hatte sich davon nicht unterkriegen lassen und war ihren Weg gegangen. Heute war sie mit dem Dorfarzt verheiratet, die Kinder nannten sie liebevoll »Brannenburger Storchentante«, und die Bewohner der Gegend respektierten sie. Es war ein Geschenk, aber auch eine Bürde. Maria wusste, dass sie stets mehr leisten musste als die Hebammen vor ihr. Unterlief ihr nur der kleinste Fehler, könnte sie wieder in Ungnade fallen. Voller Stolz konnte sie jedoch sagen, dass sie tatsächlich besser war als ihre Vorgängerinnen. Sie war eine ausgebildete Hebamme, die erst kürzlich wieder an einer Fortbildungsmaßnahme der Münchner Hebammenlehranstalt teilgenommen hatte und durch ihr Fachwissen vielen Frauen die Geburt leichter machte. Wegen ihrer akribischen Hygienemaßnahmen starb kaum noch eine Mutter unter ihrer Obhut an dem gefürchteten Kindbettfieber. Vor ihrer Vorgängerin Alma hatten sich viele Frauen gefürchtet, vor Maria hatte niemand Angst. Sie betreute mit Herz und Verstand, und sie freute sich über jedes einzelne Kind, das sie auf die Welt holte. Das Leben war ein Wunder, und dabei zuzusehen, wie ein Menschlein seinen ersten Atemzug tat, fühlte sich immer wieder berauschend schön an.
Nur leider wollte das Schicksal ihr kein eigenes Wunder schenken. Von Traurigkeit erfüllt, legte sich Maria die Hand auf den Bauch. Kurz nach ihrer Rückkehr in den Morgenstunden waren ihre Hoffnungen darauf, endlich ein Kind zu empfangen, wieder enttäuscht worden. Aus einem unerfindlichen Grund verweigerte ihr das Schicksal diesen immer sehnlicher werdenden Wunsch. Tagtäglich war sie von Müttern und Säuglingen umgeben und wusste, dass ihre Empfindung falsch und unangebracht war, doch sie konnte nicht anders: Sie war neidisch.
Der Mann ihres Herzens kam just in diesem Moment auf seinem Fahrrad angefahren. Sein Anblick vertrieb die schwermütigen Gedanken, und es wurde ihr wieder leichter ums Herz. Georg war die Liebe ihres Lebens, er war ihr perfekter Topfdeckel, wie es Burgi irgendwann einmal ausgedrückt hatte. Sie hatte bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen Schmetterlinge im Bauch gehabt. Damals, auf dem Weg zum Wendelsteingipfel hinauf, als sie umgeknickt war und er ihr geholfen hatte. Sie hatte lange gedacht, dass sie aufgrund ihrer Vorgeschichte niemals ein Paar werden könnten. Schließlich war Georg ein angesehener Arzt und sie ein Bankert ohne jede Mitgift. Aber es war anders gekommen, und dafür, dass Georg sie mit all seiner Liebe und Wärme durchs Leben begleitete, war sie dem Herrgott jeden Tag dankbar.
Georg lehnte sein Fahrrad an den Zaun des Bauerngartens, nahm seine Arzttasche vom Gepäckträger und kam zu ihnen. Er war locker gekleidet, trug ein helles Hemd und dazu eine graue leichte Baumwollhose. Auf seinem Kopf lag ein Strohhut. Sein Anblick sorgte selbst heute noch dafür, dass sich in Maria ein wohlig warmes Gefühl ausbreitete. Er war aber auch ein attraktiver Mann. Sein blondes Haar trug er kürzer als zu ihrer Kennenlernzeit, und sein Oberlippenbart war ausladender geworden. Maria liebte am allermeisten seine leuchtend blauen Augen. In ihnen konnte sie sich auch heute noch verlieren.
Zur Begrüßung gab er Maria einen kurzen Kuss.
»Ihr macht genau das Richtige an einem solch heißen Sommernachmittag«, meinte er, und sein Blick wanderte über den gedeckten Tisch.
»Komm, setz dich her, schaust recht mitgenommen aus. Magst ein Kracherl? Wie steht es denn mit der Bernriederin?«, erkundigte Burgi sich, während sie ein ansehnliches Stück Datschi auf einen Teller verfrachtete. »Ist es besser? Mit so einem Herzkasperl ist nicht zu spaßen. Und sie ist noch keine sechzig. Ich hab vorhin im Laden mit der Gundel drüber geredet, und sie ist total erschrocken. Seit wir die Else kennen, war sie nie krank, nicht einmal einen Schnupfen hat sie g’habt.«
Georg stieß einen Seufzer aus. Begriffe wie »privat« oder »ärztliche Schweigepflicht« würden für viele Brannenburger für immer ein Fremdwort bleiben. Und Gundels Kolonialwarenladen galt immer noch als der Treffpunkt der Tratschweiber schlechthin.
»Es geht ihr den Umständen entsprechend gut«, antwortete er. »Sie muss sich noch schonen. Bekomme ich jetzt Limonade? Mein Hals ist wie ausgedörrt«, erinnerte er Burgi.
»Freilich.« Sie wollte Georgs Glas füllen, doch es kamen nur noch wenige Tropfen aus dem Krug. »Na, da haben wir aber einen saubern Durscht g’habt«, sagte sie. »Ich geh rasch Nachschub holen.«
Burgi verschwand im Haus, und Georg setzte sich Maria gegenüber.
»Was für ein Tag«, sagte er. An seiner ernsten Miene und seinem Tonfall erkannte Maria, dass es keine guten Nachrichten gab. »Die Kleine von der Anni Wildgruber ist heute Nachmittag verstorben«, sagte er. »Als ich zum Hausbesuch kam, war es schon geschehen, der Pfarrer war auch schon da. Ihre Lungen waren doch zu schwach. Mit Frühgeborenen ist es nie leicht, aber sie war ja schon fast vier Jahre alt, nächste Woche hätte sie Geburtstag gehabt. Ich hab tatsächlich geglaubt, sie könnt es schaffen. So ein kleines Menschlein zu verlieren, ist immer wieder eine Tragödie. Du solltest Anni bis zur Geburt ihres Kindes engmaschiger überwachen.«
»Die arme Anni, wie schrecklich«, antwortete Maria bestürzt. »Das ist schon das dritte Kind, das sie innerhalb von zwei Jahren verliert. Selbstverständlich werde ich die Tage bei ihr vorbeischauen. Manchmal sind Gottes Wege wahrlich unergründlich.« Maria bekreuzigte sich.
Georgs traurige Neuigkeiten ließen ihre Gedanken zurück zu ihrer eigenen Kinderlosigkeit wandern. Es war wie eine düstere Wolke, die sich auf ihr Gemüt legte.
»Wenn einem nach solch kurzer Zeit das Kind sowieso wieder genommen wird, dann ist es vielleicht besser, wenn man es gar nicht erst zu lieben beginnt«, sagte sie. Georg wusste ihre Worte zu deuten.
»Es hat also wieder nicht geklappt«, sagte er, und Maria schüttelte, den Tränen nahe, den Kopf. Georg jeden Monat aufs Neue mitteilen zu müssen, dass ihre Bemühungen nichts erbracht hatten, zerrte an ihren Nerven.
Burgi kam mit dem aufgefüllten Krug zurück.
»Das ist der letzte Rest Kracherl«, teilte sie ihnen mit und füllte Georgs Glas. »Ich setz nachher gleich neuen Sirup an. Ich weiß doch, wie gern ihr die Limonade habt’s.«
Ihre Dienstmagd Antonia, die von allen Toni gerufen wurde, kam mit einem Wäschekorb um die Hausecke. Bereits kurz nach ihrer Hochzeit hatten Maria und Georg beschlossen, zur Unterstützung Burgis eine Magd einzustellen. Schließlich war das Anwesen bedeutend größer als das Zuhäusl des Bichlhofs, welches Maria und Burgi zuvor bewohnt hatten. Außerdem war Burgi nicht mehr die Jüngste, auch wenn sie das nur ungern hörte und bis heute beteuerte, alles problemlos allein hinzubekommen. Das stämmige Mädchen mit dem roten Lockenkopf hatte sich schnell in den Betrieb eingelebt und war eine wahre Frohnatur.
»Also bei dem Wetter ist das Wäschetrocknen die reinste Freude«, sagte sie gut gelaunt. »Kaum hängen die Laken auf der Leine, kann ich sie auch schon wieder abnehmen.«
»Immerhin eine, die sich über die Hitze freut«, sagte Burgi, bot Toni eine Limonade an und klopfte neben sich auf die Sitzbank. »Geh her, Madl. Setz dich bisserl in den Schatten, sonst kriegst noch einen Hitzschlag.«
Toni stellte ihren Wäschekorb ab und setzte sich neben Burgi.
Sie streckte ihr Bein aus und entblößte dabei eine ihrer Fesseln. Marias Blick blieb daran hängen, und ihr fiel auf, wie geschwollen Tonis Füße waren. Es kam ihr seltsam vor. Viele Frauen litten an warmen Tagen unter Wassereinlagerungen, aber die meisten waren entweder älter oder schwanger. In ihr begann eine Alarmglocke zu schellen. War es vielleicht möglich, dass ihnen Toni eine Schwangerschaft verheimlichte? Andererseits zeigte Toni keinerlei Anzeichen einer Schwangerschaft, und Maria war keine größere Gewichtszunahme aufgefallen. Allerdings war Toni recht korpulent, und nach Marias Erfahrung waren Schwangerschaften in diesem Fall schwerer zu erkennen. Ihr kam eine Begebenheit in den Sinn, die sich vor zwei Jahren auf dem Winnerhof in St. Margarethen zugetragen hatte. Eine junge Magd hatte urplötzlich starke Bauchschmerzen bekommen, und man hatte nach dem Arzt gerufen. Es war jedoch weder ein Infekt oder gar eine Blindarmentzündung gewesen. Das Madl hatte in den Wehen gelegen, und Georg hatte sie kurz nach seinem Eintreffen von einem gesunden Jungen entbunden. Das Madl hatte steif und fest behauptet, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben. Vielleicht war es bei Toni ähnlich? Sie war die jüngste Tochter eines Tagelöhners aus Fischbachau und hatte sich bis zu seinem Tod hingebungsvoll um ihn gekümmert. Vielleicht hatte sie eine Liebschaft gehabt? Am Ende war ihr Gewalt angetan worden? Letzteren Gedanken tat Maria wieder ab. Toni hatte ein solch heiteres Wesen, sie wirkte nicht so, als würde eine solch abscheuliche Tat sie belasten. Maria seufzte innerlich. Wenn sie ihren vagen Verdacht bestätigt haben wollte, dann würde sie mit Toni reden müssen.
Ein alter Mann näherte sich humpelnd dem Haus. Maria erkannte ihn. Es war Caspar Gruber, ein Kramer, der sich als fliegender Händler seinen Unterhalt verdiente. Er trug ein schmutziges graues Hemd und eine braune Stoffhose, dazu ausgetretene Schuhe. Auf seinem Rücken befand sich eine Kiepe mit allerlei buntem Inhalt. Kochgeschirr, Nähgarn, Schnürsenkel, Knöpfe und Rasierzeug. Maria kaufte ihm ab und an aus Mitleid etwas ab. Armut hatte viele Gesichter.
»Grüß Gott beisammen«, sagte Caspar, als er nähergetreten war, und lüpfte kurz seinen Filzhut. »Mei, das ist eine Hitz heute. Aber das Geschäft muss ja weitergehen. Brauchts ihr was? Ich hätt heut ein Nähset im Angebot, beste Kochlöffel, da geht einem ja immer mal einer kaputt. Nicht wahr?« Hoffnungsvoll sah er Maria an. Ihr fiel sein gerötetes Gesicht auf, seine Augen wirkten eingefallen, und an seinen Händen schälte sich die Haut. Caspar sah wie ein Mensch aus, der innerlich vertrocknete.
»Kochlöffel hört sich gut an«, antwortete Georg. »Ist dir da nicht neulich einer kaputtgegangen, Burgi?« Er sah Burgi eindringlich an, und sie verstand zum Glück.
»Freilich ja, der ist mir runtergefallen und einfach so entzweigebrochen«, antwortete sie beflissen.
»Da ist es gut, dass du den Weg zu uns gefunden hast, Caspar«, sagte Georg. »Magst dich nicht hersetzen, und dann schauen wir uns an, was du dabeihast? Du hast bei der Hitze bestimmt Durst. Wir haben frische Hollerlimonade, kannst auch ein Stückchen Kuchen haben. Komm, ich helf dir mit der Kiepe.«
Georg stand auf, half Caspar, seine schwere Last abzulegen, und erkundigte sich freundlich nach dem Grund für sein Humpeln.
»Ich bin vor einer Weile in einen rostigen Nagel getreten. Die alten Schuhsohlen halten auch nix mehr stand.«
»Verstehe«, antwortete Georg, und seine Miene wurde sorgenvoll. Mit solchen Wunden war nicht zu spaßen.
»Wenn du nichts dagegen hast, schau ich mir die Verletzung nachher mal an. Musst auch nix dafür zahlen. Geht aufs Haus«, sagte er.
Für solche Momente liebte Maria Georg noch viel mehr als sowieso schon. Für seine Rücksichtnahme gegenüber den Schwächsten ihrer Gesellschaft. In ihr verstärkte sich das warme Gefühl der Zuneigung, und sie lächelte milde.
Burgi verschwand im Haus, denn der Datschi war aufgegessen, zum Glück gab es in der Speisekammer Nachschub.
Just in dem Moment, als sie wieder nach draußen zurückkehrte, näherte sich dem Haus ein Pferdekarren. Auf dem Bock saß einer der Knechte des Hafnerhofs aus Irlach. Maria wusste, noch bevor der Knecht etwas sagte, weshalb er gekommen war: Bei der Jungbäuerin hatten die Wehen eingesetzt. Somit war die Pause im Schatten bedauerlicherweise beendet.
2. Kapitel
Am selben Tag
Die Dunkelheit war längst hereingebrochen, als Maria, von der langen Geburt erschöpft, Anni Berthaler ihr drittes Kind, ein gesundes Mädchen, in die Arme legte.
»Schau nur, wie hübsch sie ist«, sagte Maria matt lächelnd.
»Ja, mein erstes Madl«, antwortete Anni. »Und sie ist ganz der Vater, genau dasselbe Gesicht. Wenn sie auch noch seinen Sturschädel geerbt hat, dann können wir uns warm anziehen.«
Maria entlockten Annis Worte, obwohl sie sich wie erschlagen fühlte, ein Schmunzeln.
»Dann wollen wir mal hoffen, dass sie das sanftmütige Wesen ihrer Mama geerbt hat«, antwortete sie und zwinkerte Anni zu. Ihre Worte waren nicht gelogen. Anni Berthaler war eine ruhige und besonnene Frau, Maria beneidete sie manchmal um ihre Ausgeglichenheit, die Anni selbst in den herausforderndsten Situationen nicht verlor. Sogar während der Presswehen hatte sie bei allen drei Geburten erstaunlich beherrscht gewirkt, wenig geschrien und schon gar nicht, wie so manch andere Gebärende, mit Schimpfwörtern um sich geworfen.
Marias Blick haftete auf dem Neugeborenen, und sie konnte nicht verhindern, dass sich das ungute Gefühl des Neids wie der spitze Stachel einer Rose in ihr Herz bohrte. Wieder einmal fragte sie sich, weshalb Gott so ungerecht war. Anni hatte zehn Monate nach der Eheschließung ihr erstes Kind zur Welt gebracht, kurz nach dem Ende der Wochenbettzeit war sie wieder guter Hoffnung gewesen, und ihre dritte Schwangerschaft hatte sich ähnlich flott eingestellt. Wieso funktionierte die Empfängnis bei Anni und vielen anderen Frauen so reibungslos und bei ihr nicht? Was war falsch mit ihr? Angeblich nichts, so hatte es der Arzt im Rosenheimer Krankenhaus nach einer eingängigen Untersuchung ihres Unterleibs vor einigen Monaten gesagt. Sie bräuchten eben Geduld. Doch mit jeder neuen Enttäuschung verlor sie diese mehr, und langsam begann sie sich zu fragen, wie lange sie sich das Mutterglück der anderen noch mitansehen konnte. Momente wie diese hatten sie früher mit Freude erfüllt. Heute wurde sie wehmütig und traurig, wütend auf sich selbst. Wütend deshalb, weil sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle bekam, weil sie das zu verabscheuen begann, was sie eigentlich mehr liebte als alles andere auf der Welt: Kinder ins Leben zu holen.
»Sie soll Elisabeth nach der Oma vom Jakob heißen«, riss Anni Maria aus ihren düsteren Gedanken. »Meinst, der Name passt zu ihr?«
»Ja, das tut er«, antwortete Maria. »Ein hübscher Name.«
Sie bemühte sich, die trübsinnigen Gedanken abzuschütteln. Ihre volle Aufmerksamkeit hatte jetzt Anni und ihrer kleinen Tochter zu gelten. »Dann will ich der kleinen Elisabeth mal ihr erstes Bad angedeihen lassen und sie wiegen. Ich tippe darauf, dass sie weniger Gewicht hat als ihre Geschwister.« Sie nahm Anni den Säugling behutsam aus den Armen und ging zur Kommode, auf der die Waschschüssel bereitstand.
Zwei Stunden später befand sich Maria mit ihrem Hebammenkoffer und einer Gaslaterne auf dem Heimweg. Jakob hatte ihr angeboten, sie zu fahren, doch sie hatte mit der Begründung abgelehnt, dass ihr ein Spaziergang in der frischen Nachtluft guttun würde.
Bedauerlicherweise war die Nachtluft alles, aber nicht erfrischend. Eine unangenehme Schwüle hatte sich ausgebreitet, und stetiges Wetterleuchten über den Berggipfeln deutete auf ein Gewitter hin. Es war so stickig, Maria fiel das Atmen schwer, und sie musste, von Schwindel erfasst, immer wieder stehen bleiben. Sie schob es auf ihre Unpässlichkeit, die sich durch ein unangenehmes Ziehen im Unterleib bemerkbar machte. Kurz bevor sie die über den Grießenbach führende Brücke erreichte, wurde ihr erneut schwummrig, und sie sank auf eine Bank am Wegesrand.
Ich hätte mich doch besser heimbringen lassen sollen, dachte sie, und ihr Blick wanderte sorgenvoll Richtung Wetterleuchten. Inzwischen hatte sich ein leichtes Donnergrollen dazugesellt, das ein baldiges Unwetter vermuten ließ. Trotzdem blieb sie noch einen Augenblick sitzen.
Ach, wäre dieser Schwindel doch ein Symptom einer frühen Schwangerschaft, kam ihr in den Sinn, und sie legte sich die Hand auf die Körpermitte. Dieses Mal war sie fünf Tage über der Zeit gewesen und hatte bereits zu hoffen gewagt. Erneut sah sie vor ihrem inneren Auge die kleine Elisabeth in den Armen ihrer Mutter, Jakob hatte seine Tochter ganz überwältigt begrüßt und sogar den Mut gehabt, das kleine Fräulein in seine Arme zu nehmen. Er war so sanft mit ihr umgegangen, als handelte es sich um eine Porzellanpuppe. Georg sollte das auch tun dürfen. Sein eigenes Kind zum ersten Mal behutsam halten und es voller Ehrfurcht und Freude betrachten dürfen. Aber sie schaffte es einfach nicht, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Was wäre, wenn er sie deswegen irgendwann nicht mehr lieben und vielleicht sogar gegen eine andere Frau austauschen würde? Sie war eine Versagerin. Ihr Unterleib krampfte sich schmerzhaft zusammen, und Tränen liefen ihr die Wangen hinab, sie schluchzte auf. Das Glück war wahrlich ein flüchtiger Geselle. Sie schien nicht in der Lage zu sein, es für längere Zeit festzuhalten.
Ein dicker Regentropfen fiel auf ihren Handrücken und riss sie aus ihrer Traurigkeit. Ein weiterer landete auf ihrer Wange. Es folgte ein lauter Donnerschlag, der ihr durch Mark und Bein ging. Alarmiert sprang sie auf und wischte sich die Tränen vom Gesicht.
»Was bin ich bloß für eine Dummerl«, schalt sie sich. »Da naht ein Unwetter, und ich sitze heulend auf einer Bank.«
Sie nahm ihren Hebammenkoffer und die Gaslaterne auf und eilte über die Brücke. Am Abzweig zur Biberstraße öffnete der Himmel endgültig seine Schleusen, und es begann zu schütten. Nach wenigen Metern war Maria vollkommen durchnässt. Das hatte sie von ihrer Bummelei. Sie wusste doch nur zu gut, wie unberechenbar das Wetter in dieser Gegend war.
Maria fühlte sich wie eine getaufte Maus, als sie den Flur ihres Zuhauses betrat. Die Nässe tropfte von ihrem Kleid und ihrem Haar auf den roten Fliesenboden. Ihr war trotz ihrer Eile und des starken Regens aufgefallen, dass in Georgs Sprechzimmer noch Licht brannte. Vielleicht saß er über Schreibarbeiten, oftmals erledigte er sie abends. Aber zu solch später Stunde?
Gedämpfte und ihr äußerst vertraute Laute drangen an ihr Ohr. Hatte etwa eine ihrer werdenden Mütter sie aufgesucht? Das war ungewöhnlich, denn die Frauen der Gegend zogen in der Regel Hausgeburten vor.
Sie stellte rasch die Gaslaterne ab und schob die angelehnte Tür zu den ehemaligen Stallungen auf, in denen Georgs und ihr Sprechzimmer und neuerdings auch ein Krankenzimmer für besonders schwierige Fälle untergebracht waren. Sie hörte Georgs beschwichtigende Stimme.
»Atmen, so ist es gut. Ruhig weiteratmen. Gleich ist der Schmerz wieder vorbei.«
»Ich kann das nicht mehr«, antwortete eine Maria bekannte Stimme. In diesem Augenblick bestätigte sich ihr Verdacht vom Nachmittag: Ihre Toni erwartete tatsächlich ein Kind. Wie hatte sie bloß so blind sein und es all die Monate nicht bemerken können?
Maria betrat den Raum, und Georg sah sie erleichtert an. Er mochte Arzt sein, doch Frauen oftmals stundenlang während der Wehen beizustehen, zählte nach seiner eigenen Aussage nicht zu seinen Stärken, und er bewunderte Maria in dieser Hinsicht für ihre Geduld und Ausdauer.
Toni hatte sich seitlich und mit angewinkelten Beinen auf der Untersuchungsliege zusammengekrümmt, ihre Schlappen lagen davor auf dem Boden. Sie trug ihr Nachtgewand, und die roten Locken waren zu einem Zopf geflochten.
Die Wehe schien wieder nachzulassen, Maria erkannte, wie sich Tonis Gesichtszüge entspannten.
»Guten Abend, Maria«, begrüßte Georg sie. »Toni kam vor einer Stunde zu mir und klagte über Bauchschmerzen. Schnell war klar, dass es sich um Wehen handelt.«
»Es tut mir so leid«, brachte Toni heraus und schluchzte auf.
Maria ging neben ihr in die Hocke und legte ihre Hand auf die von Toni.
»Du musst dich nicht entschuldigen«, sagte sie. »Ich bin hier. Georg und ich werden uns kümmern. Du hättest uns das mit der Schwangerschaft doch sagen können, wir hätten dich nicht weggeschickt. Du kennst doch unsere Einstellung, wir würden niemals eine Frau in Not fortschicken.«
»Aber ich hab doch gar nicht bemerkt, dass ich ein Kind erwarte«, antwortete Toni. »Das schwör ich bei allem, was mir heilig ist. Ich hatte auch noch meine Zeit, und einen dicken Bauch hab ich auch ohne Kind.« Sie begann zu stöhnen und legte sich die rechte Hand auf den Bauch.
Maria schätzte den Abstand zwischen den Wehen auf ungefähr drei Minuten.
»Ruhig atmen«, wies sie Toni an. »Ja, so ist es gut. Der Schmerz ist gleich wieder vorüber.«
Nachdem die Wehe nachgelassen hatte, sagte Georg: »Ich verabschiede mich. Maria kümmert sich jetzt um dich. Ich glaube dir, dass du die Schwangerschaft nicht bemerkt hast. Solche Fälle kommen vor, nicht sehr häufig, aber es gibt sie. Wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, dass diese Geburt reibungslos verläuft. Alles weitere besprechen wir später.« Er tätschelte Toni die Schulter.
Maria und Georg führten sie in das nebenan liegende Krankenzimmer und legten sie auf eines der weißen Metallbetten. Rasch holte Maria ihren Hebammenkoffer und weitere Utensilien.
Nachdem Georg sie allein gelassen hatte, stellte Maria intimere Fragen, die Toni in der Georgs Anwesenheit vielleicht peinlich gewesen wären. Sie erfuhr, während sich der Abstand der Wehen weiter verringerte, dass Toni eine Liebesbeziehung mit einem der Söhne ihres Nachbarn gehabt hatte. Ein reicher Bauer mit viel Grundbesitz. Er hatte ihr Hoffnungen gemacht, sie zur Frau zu nehmen. Die alte Geschichte. Nachdem er ihr an einem Abend ihre Unschuld in einer Scheune geraubt hatte, hatte er nichts mehr von ihr wissen wollen. Voller Liebeskummer und Scham war sie weggelaufen, und kurz darauf hatte sie bei ihnen die Stellung erhalten.
Da Toni eine Erstgebärende war, zog sich die Geburt hin. Erst bei Tagesanbruch war der Muttermund so weit geöffnet, dass Toni mit dem Pressen beginnen konnte. Maria stopfte ihr zusätzliche Kissen in den Rücken und feuerte Toni mit den Sätzen an, die sie vermutlich bereits Hunderte Male ausgesprochen hatte.
»Du schaffst das. Ich kann den Kopf bereits sehen. Nur noch ein wenig schieben. Ja, so ist es gut.«
Als eine weitere Wehe abgeebbt war, sank Tonis Kopf zurück auf die Kissen. Der Schweiß rann ihr in Strömen über das gerötete Gesicht, das Hemd klebte ihr am Leib.
»Ich kann das nicht mehr«, sagte sie. »Ich halt das nicht mehr aus. Ich will es auch gar nicht haben.«
»Wir meistern das gemeinsam«, ermunterte Maria. »Es ist bald geschafft. Nur noch ein wenig pressen. Ich bin bei dir.«
Die nächste Wehe kam, und Toni presste mit solcher Wucht, dass das Kind regelrecht in Marias Arme rutschte. Es war ein kleines Mädchen mit dunklen Haaren, das sofort zu greinen begann.
»Herzlich willkommen, kleines Fräulein«, sagte Maria freudig. »Na, das ging jetzt schneller als gedacht.« Sie durchtrennte die Nabelschnur. Der Säugling war äußerst munter und zappelte aufgeregt mit seinen Ärmchen und Beinchen. Aus dem Greinen wurde ein lautstarkes Schimpfen.
»Ist ja gut mein Schätzchen«, tröstete Maria. »Du darfst gleich zu deiner Mama. Da ist es warm und schön.«
Maria wickelte die Kleine in ein Handtuch und wollte sie Toni in die Arme legen.
»Schau nur, was für eine hübsche Tochter du geboren hast«, sagte sie. »Ist sie nicht bezaubernd?«
Doch Toni reagierte ablehnend. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und wandte den Kopf ab. »Ich will sie nicht haben. Nimm sie weg, ich kann sie nicht ansehen.«
Maria bestürzte Tonis heftige Reaktion, und sie wusste im ersten Moment nicht, wie sie auf die heftige Ablehnung reagieren sollte. Sie hielt das greinende Mädchen im Arm, während Toni sich unter Schluchzen zusammenkrümmte.
Von dem Gefühl der Hilflosigkeit erfüllt, benötigte Maria einige Sekunden, um sich wieder in den Griff zu bekommen. Es war eine ganze Weile her, dass sie ein ungewolltes Kind auf die Welt geholt hatte. Sie rief sich die Geburtssituationen aus der Gebäranstalt ins Gedächtnis. Auch dort hatten viele Mütter ähnlich ablehnend reagiert. Es galt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Nichts konnte eine Frau, die gerade ein Kind geboren hatte, weniger gebrauchen als eine überforderte Hebamme, die nicht Herrin der Lage war.
Maria legte das Neugeborene auf das freie Bett, nahm Toni in die Arme und drückte sie an sich.
»Scht«, sagte sie beruhigend. »Scht. Es ist vorbei. Hörst du? Du hast das wunderbar gemacht. Scht, es ist gut. Es ist alles gut.«
»Aber was soll denn jetzt gut sein?«, schluchzte Toni an ihrer Schulter. »Ich hab ein Bankert auf die Welt gebracht, ich bin eine Schande. Bestimmt komm ich für diese Sünde ins Fegefeuer.«
»Das Leben ist niemals eine Sünde«, tröstete Maria. »Red dir das nicht ein. Kein Kind ist falsch, niemals. Wir finden einen Weg, fest versprochen. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um dich und um deine Tochter. Dann schauen wir weiter.«
Tonis Schluchzen ließ jetzt nach. Sie löste sich aus der Umarmung und zog die Nase hoch. Maria reichte ihr ein Taschentuch, und sie schnäuzte kräftig. Dem neugeborenen Mädchen schien es auf dem Nachbarbett nicht zu gefallen. Es weinte lautstark und hatte sich aus seinem Handtuch gestrampelt, die winzigen Händchen waren zu Fäusten geballt.
Tonis Blick fiel auf ihr Kind, in ihrem Blick lag kein Funken von Zuneigung.
»Muss es hierbleiben?«, fragte sie. »Kann es nicht woanders hin?«
»Natürlich kann es das«, antwortete Maria. »Burgi müsste schon auf den Beinen sein. Ich bring sie rasch zu ihr.« Sie musste jetzt besonnen vorgehen. Toni war von ihrer Mutterschaft regelrecht überrollt worden und sollte sich erst einmal beruhigen. Es galt darauf zu hoffen, dass sie ihrer Tochter in einigen Stunden zugewandter sein würde.
Maria nahm das kleine Mädchen in die Arme und verließ das Zimmer. Zum Glück war der Warteraum noch leer, aus Georgs Sprechzimmer waren jedoch Stimmen zu hören.
In der Wohnstube fand Maria Burgi am Tisch vor. An ein Frühstück im Freien war heute nicht zu denken, denn der Himmel war wolkenverhangen, und es regnete in Strömen. Das Gewitter hatte einen Wetterwechsel gebracht.
»Da ist ja das Butzerl«, sagte Burgi und erhob sich. Georg schien sie über die Ereignisse der Nacht bereits in Kenntnis gesetzt zu haben. »Na, das nenn ich mal eine Überraschung. Glaubst echt, sie hat nix von dem Kind gemerkt? Wie kann denn so was sein? Und wir zwei waren so blind. Gerade dir als Hebamme hätte doch was auffallen müssen.« Sie trat näher und betrachtete das Kleine in Marias Armen wohlwollend. »Mei, was für ein liebes G’sichterl, und es schaut gar nicht zerknautscht aus.«
»Ja, sie ist allerliebst«, antwortete Maria. »Ich muss zurück zu Toni, das alles hat sie sehr mitgenommen. Könntest du dich fürs Erste um das kleine Fräulein kümmern? Sie müsste gebadet und angezogen werden. Das wäre mir eine große Hilfe.«
»Aber freilich«, antwortete Burgi. »Um so ein Menschlein kümmere ich mich doch gern.«
Maria übergab ihr behutsam den Säugling.
Sie eilte rasch die Stufen in den ersten Stock hinauf und holte aus Tonis Kammer frische Wäsche und Kleidung. Vorrang hatte jetzt die Geburtsnachsorge. Der Rest würde sich später am Tag hoffentlich irgendwie finden.
Am späten Abend saß Maria mit dem Mädchen im Arm in der nur von einer Stehlampe erhellten Stube auf der Ofenbank und berührte behutsam die winzigen Finger, die ihr ganz wundersam vorkamen. Alles an dem Mädchen kam ihr in diesem Augenblick besonders vor. Ihre sanft geschwungenen Augenbrauen, perfekt symmetrisch, ihre winzigen Wimpern, die bezaubernde Stupsnase und ihre entzückenden Lippen, die im Schlaf leicht zuckten. Maria lächelte, und ein wärmendes Glücksgefühl erfüllte sie, das sie in dieser Form niemals zuvor empfunden hatte. Das war doch verrückt. Sie hielt tagtäglich Neugeborene im Arm und holte sie auf diese Welt. Wieso empfand sie auf einmal auf diese Weise? Vielleicht weil sie sich nichts mehr auf der Welt wünschte, als endlich eine Mama sein zu dürfen, weil dieser Moment ein anderer war, vertraut und innig, erfüllt von einem ganz eigenen Zauber? Sie hatte das Mädchen ganz für sich, als wäre es ihre eigene Tochter. Sie halten, betrachten und lieben dürfen. Ihr eigenes kleines Wunder. Aber das Mädchen war nicht ihre Tochter. Trotzdem kam es ihr plötzlich so vor, als müsste sie dieses zauberhafte Wesen vor der Welt dort draußen beschützen. Vor dem unausweichlichen Schicksal, das ihr als ledig geborenem Kind drohte. Aber das konnte sie nicht. Es gab Regeln, an die sie sich halten mussten. Klare Abläufe, wie in solchen Fällen zu verfahren war. In diesem Moment wünschte sie sich, diese Nacht hätte noch viele Stunden mehr, sie wünschte sich, der neue Tag würde noch etwas länger auf sich warten lassen. Die Zeit anhalten, im Moment verweilen und die Wärme des kleinen Körpers noch etwas länger spüren dürfen. Das wäre so wunderbar.
Ihr Blick wanderte zum Fenster. Draußen stand der Vollmond am Himmel. Sein Anblick erinnerte sie an ein Lied, dass sie stets vor dem Zubettgehen bei Gertie gesungen hatten. Das »Abendlied« von Matthias Claudius. Spontan stimmte sie es an, und während sie leise die erste Strophe sang, begann sie die Kleine in ihrem Arm sanft zu wiegen.
3. Kapitel
7. August 1899
Maria ließ ihren Blick über ihre Ernte schweifen und schob sich eine kastanienbraune Strähne hinters Ohr, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hatte.
»Also in diesem Jahr können wir uns über einen Mangel an Zwetschgen nicht beklagen«, sagte sie. Im letzten Jahr hatten sie wegen des späten Frosts kaum welche ernten können, und die wenigen Vorräte waren schnell aufgebraucht gewesen.
»Zum Glück«, antwortete Burgi, die einen mitgenommenen Eindruck erweckte. Ihre Wangen waren von der Anstrengung gerötet, und auf ihrer Stirn lagen einige Schweißperlen. »Diese Flut an Früchten ist ein Segen. Weißt doch, wie gern ich Zwetschgenmus und Kompott esse. Du hilfst mir doch nachher beim Entsteinen und Einkochen, oder?«
»Wenn kein Kind dazwischenkommt und uns unser Fräulein in Ruhe arbeiten lässt«, antwortete Maria, und ihr Blick wanderte zu dem kleinen Bündel, das im Schatten des Zwetschgenbaums in einem Wäschekorb lag. Burgis Blick fiel ebenfalls auf den schlafenden Säugling, und ein sanftes Lächeln umspielte ihre Lippen.
»Ist schon liab, so ein winziges Menschenkind«, meinte sie. »Und sie ist so ein braves Madl. Schreit ganz wenig und trinkt gut ihre Milch. Es ist ein Jammer, dass ihre Mama sie noch immer keines Blickes würdigt.« Sie stieß einen Seufzer aus.
»Ja, es ist traurig«, stimmte Maria ihr zu. »Nicht einmal einen Namen hat sie ihr bis jetzt gegeben. So langsam wäre es gut, wenn sie sich zu einer Entscheidung durchringen könnte, denn die Kleine muss getauft werden. Aber Toni verleugnet sie regelrecht, ich traue mich gar nicht mehr, mit ihr über das Kind zu reden. Sie will auch noch immer nicht aufstehen, weint viele Stunden am Tag und isst und trinkt kaum etwas. Ich fühle mich so hilflos und weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll. Georg ist ebenfalls ratlos. Toni hat furchtbare Angst vor der Schande und dem Gerede der Leute. Sie schämt sich so sehr.«
»Das würde ich mich an ihrer Stelle vermutlich auch«, antwortete Burgi und stieß einen Seufzer aus. »Es kommt einem Wunder gleich, dass wir die Geburt des Kindes bisher geheim halten konnten.«
»Lange geht das aber nicht mehr«, erwiderte Maria. »Wie du weißt, muss ich als Hebamme jede uneheliche Geburt innerhalb einer Woche beim zuständigen Standesbeamten melden, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn Toni die Kleine nicht versorgen will oder kann, wird die Gemeinde die Fürsorge übernehmen, und sie wird ins Waisenhaus kommen, vermutlich nach Rosenheim, es gibt aktuell kein anderes Findelhaus in der Gegend.«
Marias Blick fiel auf das Neugeborene, sie wurde wehmütig. Das Mädchen erwachte langsam aus seinem Schlaf, und sein Mündchen zuckte, es zog niedliche Grimassen und begann zu schmatzen. Der Gedanke daran, dass dieses entzückende Mädchen alsbald in einer solch lieblosen Einrichtung untergebracht sein würde, brach Maria das Herz. Sie wusste von einer Rosenheimer Hebamme, dass die neue Leiterin des Waisenhauses eine hartherzige Frau war, die zwar strengstens auf Hygiene achtete, jedoch wenig davon hielt, eine innige Beziehung zu ihren Schützlingen aufzubauen. Sie wollte gar nicht daran denken, wie eine solche Person mit der Kleinen umging.
»Da wird jemand wieder munter«, sagte Burgi. »Ich glaub, sie bekommt Hunger. Soll ich sie füttern oder willst du das übernehmen? Das Fläschchen hab ich schon vorbereitet.«
»Ich mach das gern«, erwiderte Maria und nahm das Mädchen aus dem Körbchen. Liebevoll legte sie es sich an die Schulter und stützte das kleine, in eine winzige Häkelmütze gehüllte Köpfchen. Maria erfüllte in diesem Moment ein solch herrliches Glücksgefühl. Es war so wunderbar, sich um das kleine Mädchen zu kümmern und ihm Liebe und Geborgenheit zu schenken. Letzte Nacht hatte sie die Kleine sogar eine Weile in ihr Bett geholt, Georg war zu einem Notfall nach Tannerhut gerufen worden, und sie waren allein gewesen. Sie hatte mit ihr geredet, ihr vorgesungen, ihr beim Schlafen zugesehen und diesen herrlichen Duft eingeatmet, den nur Neugeborene verströmten. Insgeheim hatte sie ihr den Namen Clara gegeben. So sollte ihre eigene Tochter eines Tages heißen. Sie wusste, dass es falsch war, sie sollte professionell bleiben und keine Bindung zu der Kleinen aufbauen. Aber sie konnte nicht anders. Die Sehnsucht nach einem Kind, das sie behüten durfte, war übermächtig. Der Gedanke, dass sie das Mädchen bald einer Fürsorgerin übergeben musste, schmerzte entsetzlich. Aber so waren nun einmal die Regeln.
Auf dem Weg zum Haus blieb Maria stehen, denn ein wohlbekannter Besucher kam des Weges. Es war Max, ihr Freund aus Kindertagen. Maria freute sich, denn sie hatten einander länger nicht gesehen. Er war der Grund dafür gewesen, weshalb sie nach ihrer Hebammenausbildung wieder nach Brannenburg zurückgekehrt war. Ihn hatte die Sorge umgetrieben, dass seine erste Frau Annemarie von Alma im Kindbett falsch behandelt werden und, wie damals viele Frauen, an dem gefürchteten Kindbettfieber sterben könnte. Am Ende war Annemaries Tod während der Geburt Marias härteste Prüfung geworden. Diese Tragödie wirkte bis heute nach, obwohl sie keine Schuld daran gehabt hatte. Manchmal war das Schicksal grausam. Max hatte inzwischen wieder geheiratet und war ein glücklicher Ehemann und Vater von vier entzückenden Kindern. Erst im letzten Frühjahr war zu seinen Mädchen ein Bub hinzugekommen.
»Grüß dich Gott, Maria. Ich war gerade zufällig in der Gegend. Da dachte ich, ich schau mal, wie es euch geht«, sagte er und nahm seinen Filzhut ab. Sein goldblondes Haar war leicht verwuschelt. In den letzten beiden Jahren hatte er leichte Geheimratsecken bekommen, und um seine Augen zeichneten sich erste Falten ab. Er trug ein helles Hemd und eine braune Stoffhose. Sein Blick fiel auf den Säugling in Marias Armen. »Aber wie ich sehe, hast du gerade zu tun. Zu wem gehört denn dieses entzückende Würmchen?«
Maria stieß innerlich einen Seufzer aus. Jetzt war das Ende ihrer Geheimhaltung gekommen, denn Max wollte sie nicht belügen.
»Wie schön, dich zu sehen, Max. Das kleine Fräulein hier ist im Moment unser Sorgenkind. Magst mit reinkommen? Dann erzähle ich dir alles.« Er folgte ihr ins Haus.
In der Wohnstube legte Maria das kleine Mädchen auf die Ofenbank und deckte es liebevoll mit einer Strickdecke zu. Zum Glück verhielt es sich noch ruhig, weshalb sie Max in Ruhe berichten konnte, was vorgefallen war.
»Und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Toni tut mir so leid«, sagte sie abschließend.
»Das alte Lied«, antwortet Max mit ernster Miene. »Wie manche Männer so schäbig sein können, will mir einfach nicht in den Kopf gehen. Das arme Mädchen. Wirst du sie weiter beschäftigen? Was wird jetzt aus dem Kind?«
»Ob Toni bei uns bleiben will, muss sie entscheiden. Ich würde mir nach den Geschehnissen vermutlich eine neue Anstellung suchen«, erwiderte Maria und sank neben dem Säugling auf die Ofenbank. Max setzte sich ihr gegenüber auf die Eckbank. »Sie schaut das Kind nicht einmal an. Es gibt Regeln für solche Fälle. Die Kleine wird ins Waisenhaus nach Rosenheim kommen. Spätestens nächste Woche muss ich die Geburt beim Standesamt melden.«
»Verstehe«, erwiderte Max. »Wenn sich das mit der Geburt rumspricht, könnte es für Toni schwer werden, in der näheren Umgebung eine Anstellung zu bekommen. Kennst ja die Leute. Sündige Frauen sind auf den Höfen nicht gern gesehen.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte Maria. »Und der Vater wird selbstverständlich nicht zur Rechenschaft gezogen. Diese Ungerechtigkeit wird wahrscheinlich niemals aufhören.«
Max nickte mit betretener Miene. Beide schwiegen einen Moment. Der Säugling schmatzte erneut, dieses Mal lauter als zuvor.
»Da hat jemand Hunger«, wusste Max als erfahrener Vater das Geräusch zu deuten.
»Sieht danach aus«, antwortete Maria. »Ich hole rasch ihr Fläschchen.«
Als Maria wenige Augenblicke später mit der Säuglingsflasche zurückkehrte, war Burgi anwesend.
»Mir ist gerade eine Idee gekommen, wie wir der Toni vielleicht helfen könnten«, begann sie sogleich auf Maria einzureden. »Und dem Kindchen auch. Der Gedanke, dass es ins Waisenhaus muss, gefällt mir überhaupt nicht. Wir könnten doch ein bisserl schwindeln. Im Moment wissen nur vier Leute, dass die Toni Mutter geworden ist. Sie selbst hat ja nicht einmal bemerkt, dass sie ein Kind erwartet. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach sagen, dass Clara bei uns vor der Tür ausgesetzt worden ist? Dann bleibt die Toni unbehelligt und muss nicht mit der Schande leben.«
Überrascht schauten Max und Maria sie an. Max war der Erste, der seine Sprache wiederfand.
»Also schlecht finde ich die Idee nicht«, erwiderte er. »Damit wäre Toni aus dem Schneider.«
»Das könnte tatsächlich funktionieren«, antwortete Maria zögerlich. »Aber die Lüge ändert nichts an der Tatsache, dass die Kleine ins Waisenhaus muss. Findelkinder werden ebenso behandelt wie ledig geborene.«
»Das ist natürlich ärgerlich«, räumte Burgi enttäuscht ein. »Daran hab ich nicht gedacht.«
»Aber immerhin für Toni wäre es eine gute Lösung«, erwiderte Maria. »Sie würde problemlos anderswo eine Anstellung erhalten. Bei uns wird sie bestimmt nicht mehr bleiben wollen. Es bleibt zu hoffen, dass sie aus der Sache lernt und sich nicht wieder in eine solch prekäre Lage bringt.«
Maria kam in diesem Moment ihre beste Freundin Evi in den Sinn. Auch sie hatte sich bereits vor der Hochzeit ihrem Verlobten hingegeben. Wenige Wochen vor der geplanten Eheschließung war er bei einem Unfall verstorben. Nach der Hochzeit wäre alles gut gewesen, niemand hätte sich mehr Gedanken über das genaue Zeugungsdatum gemacht. Aber durch seinen Tod hatte sich alles verändert, und Evi war so verzweifelt gewesen, dass sie zu einer Engelmacherin gegangen war. Die unsachgemäße Abtreibung hatte sie das Leben gekostet. Maria trauerte bis heute schwer um ihre Freundin, und der Gedanke, dass sie noch hier wäre, wenn sie nur besser auf sie achtgegeben hätte, würde sie bis an ihr Lebensende verfolgen. Und da half es auch nichts, dass sie es am Ende geschafft hatte, der Engelmacherin das Handwerk zu legen.
»Ja, für die Toni wäre es ein Segen«, meinte Burgi und setzte sich neben Maria auf die Ofenbank. »Aber für das arme Kindchen muss es doch eine andere Lösung geben.«
»Und wenn wir die Kleine erst einmal in deiner Obhut belassen?«, schlug Max vor. »Ich könnte mich dafür einsetzen. Bürgermeister bin ich zwar nicht mehr, aber ich kann mit unserem Standesbeamten reden. Der Beppo ist mir eh noch einen Gefallen schuldig.«
»Das wäre wunderbar«, antwortete Maria freudig, und ihr Blick fiel auf Clara. Das Mädchen hatte jetzt die Augen geöffnet, und aus dem Schmatzen wurde ein Greinen. Maria wurde es in diesem Moment ganz warm ums Herz, und ein zuvor nie gekanntes Glücksgefühl flutete ihren Körper. Clara könnte bei ihr bleiben, sie müsste sie nicht hergeben. Und vielleicht wäre es nicht nur vorübergehend, sondern für immer. Ihr größter Wunsch schien gerade in Erfüllung zu gehen, und sie würde noch viele Male das »Abendlied« für sie singen, vielleicht sogar irgendwann einmal mit ihr gemeinsam. Was für ein wunderbarer Gedanke das doch war. Die Tatsache, dass sie Clara nicht geboren hatte, war in diesem Moment unwichtig. Vor lauter Aufregung begannen ihre Hände zu zittern.
Georg betrat mit seiner Arzttasche die Stube. »Was wäre wunderbar?«
Maria erklärte ihm ihre Idee.
»Das klingt tatsächlich nach einer guten Lösung«, antwortete er. »So ein Kindchen im Haus ist ja immer ein Segen.« Er sah Maria direkt in die Augen, und sie wusste, was er nicht laut aussprach, aber sicherlich dachte. Unser sehnlichster Wunsch, Eltern sein zu dürfen, geht in Erfüllung. Marias Herz tat in diesem Moment einen Satz vor Glück.
»Mei, was für eine Freud«, sagte Burgi mit strahlenden Augen. »Und vielleicht darf das Butzerl sogar für immer bei uns bleiben«, sprach sie Marias geheime Hoffnung laut aus.
»Das wäre wunderschön, und du als liebevolle Ersatzoma wärst uns sehr willkommen, schließlich hab ich weiterhin meine Verpflichtungen als Hebamme«, antwortete sie und ging zu dem Säugling, der inzwischen zu greinen begonnen hatte. Sanft nahm sie das Mädchen in den Arm, setzte sich und begann, es zu füttern. Meine Clara, dachte sie und betrachtete das herzige Gesichtchen voller Zuneigung. Ich werde deine Mama, sagte sie zu der Kleinen in Gedanken. Und ich pass gut auf dich auf, auch wenn ich dich nicht geboren hab. Fest versprochen.
»Wir müssen unsere Idee aber noch mit Toni besprechen«, gab Georg zu bedenken. »Am Ende will sie nicht, dass die Kleine hierbleibt. Sie ist die Mutter.«
»Die ihr Kind nicht einmal anschaut und die ganze Zeit am Heulen ist«, erwiderte Burgi. »Sie wird froh darüber sein, dass wir eine Lösung gefunden haben und sie noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen ist.«
»Am besten wird es sein, wenn ich mit ihr spreche«, sagte Maria. »Ich sehe es wie Burgi. Sie wird erleichtert sein. Gleich nachher, wenn das kleine Fräulein satt ist, geh ich zu ihr.«
Eine halbe Stunde später betrat Maria die Dienstbotenkammer unter dem Dach. Die Luft war stickig, alle Fenster waren geschlossen. Toni lag halb zugedeckt seitlich im Bett und starrte auf den Dielenboden. Ihre roten Locken waren verwuschelt, sie sah blass aus, und ihre Augen waren umschattet.
»Ich dachte, ich schau mal nach dir. Etwas frische Luft könnte nicht schaden.« Sie öffnete das Fenster und setzte sich zu Toni auf die Bettkante. »Wie geht es dir?« Behutsam strich Maria ihr eine ihrer roten Locken aus der Stirn.
Toni reagierte nicht, sie starrte weiterhin auf den Fußboden.
Marias Blick fiel auf das Tablett auf dem Tisch. Toni hatte ihr Frühstück nicht angerührt. Auf dem Nachttisch stand ein halb volles Glas Wasser. Immerhin nahm sie etwas Flüssigkeit zu sich.
»Ich komme nicht nur, um dich zu fragen, wie es dir geht«, sagte Maria. »Ich wollte dir eine Lösung für dein Problem anbieten.«
Jetzt wandte Toni den Kopf und sah Maria an.
Maria berichtete, was sie eben in der Küche besprochen hatten. Dass das Mädchen vielleicht für immer auf dem Dammerhof bleiben könnte, ließ sie für den Anfang weg.
»Niemand würde erfahren, dass ich ein Kind geboren hab«, fasste Toni zusammen und setzte sich auf.
»Wenn du es keinem sagst«, antwortete Maria. »Du könntest normal weiterleben, anderswo in Stellung gehen oder bei uns bleiben.«
»Das klingt nach einer guten Lösung«, antwortete Toni, Erleichterung spiegelte sich in ihrem Gesicht wider. »Und es mach euch wirklich nichts aus, für mich zu lügen?«, hakte sie nach.
»Gewiss nicht«, antwortete Maria. »Ich bin mir sicher, in diesem Fall drückt der Herrgott auch ein Auge zu. Es ist ja für eine gute Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er möchte, dass du dein Leben lang wegen dieses einen Fehltritts leidest.«
Toni nickte zögerlich und trank von ihrem Wasser.
»Ich glaub, es ist besser für mich, wenn ich aus Brannenburg weggehe. Irgendwohin, wo mich keiner kennt. Hier würd mich das alles andauernd verfolgen.«
»Verständlich«, antwortete Maria. »Aber wenn du magst, kannst du gerne noch bis zum Ende der Wochenbettzeit bleiben, und wir kümmern uns um dich. Du musst erst mal wieder zu Kräften kommen.«
»Und was wird aus dem Kind?«, fragte Toni zu Marias Erstaunen. Damit, dass sich Toni nach dem Verbleib ihrer Tochter erkundigen würde, hatte Maria nicht gerechnet, so ablehnend und fast schon feindselig, wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten hatte.
»Max redet mit den Standesbeamten und versucht zu erreichen, dass das Mädchen vorerst hierbleiben kann und nicht ins Waisenhaus nach Rosenheim muss«, antwortete Maria.
»Du willst sie also behalten«, erwiderte Toni. »Wärst dann wie ihre Mutter, oder?«
»Wenn du das akzeptieren würdest, dann gerne. Du hast sicher mitbekommen, dass Georg und ich uns schon länger Nachwuchs wünschen und es einfach nicht klappen will.«
Toni nickte und fragte: »Hast du schon einen Namen?«
»Den hätte ich tatsächlich«, antwortete Maria. Tonis Nachhaken sorgte dafür, dass sie sich unwohl fühlte. Plötzlich kam es ihr so vor, als würde sie sich etwas nehmen, was ihr nicht zustand. »Ich würde sie Clara taufen lassen. Aber nur, wenn dir der Name auch gefällt.«
»Er ist wunderschön«, erwiderte Toni, und in ihren Augen schimmerten nun Tränen. »Mir tut das alles unendlich leid. Das musst du mir glauben. Ich hab die Schwangerschaft einfach nicht bemerkt. Ich komm mir so dumm vor. Es ist lieb von euch, dass ihr mir so helft’s. Anderswo würden sie mich als Hure verjagen. Ich hab das gar nicht verdient.«
Tränen kullerten ihr über die Wangen, und sie schluchzte auf. Maria zog Toni liebevoll in die Arme und streichelte ihr beruhigend über den Rücken. Das ungute Gefühl von eben verschwand wieder.