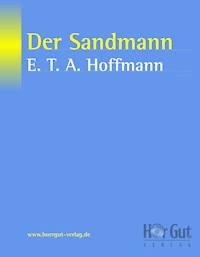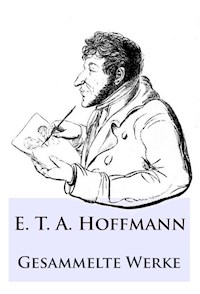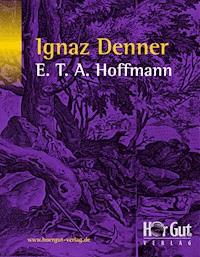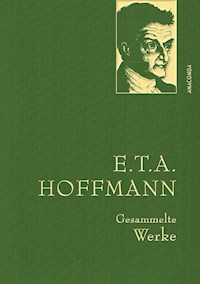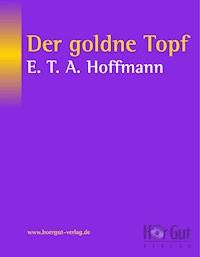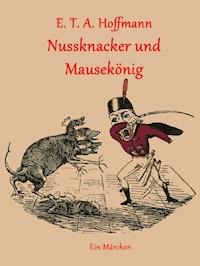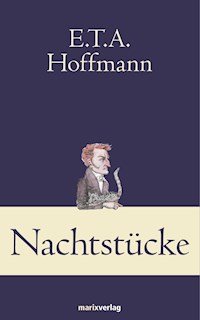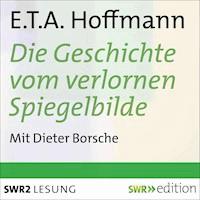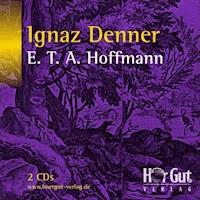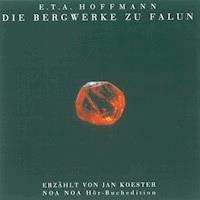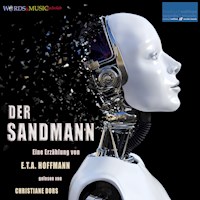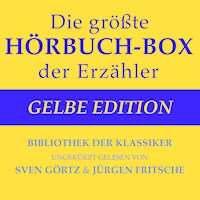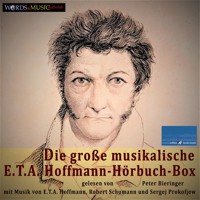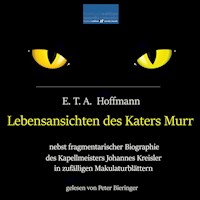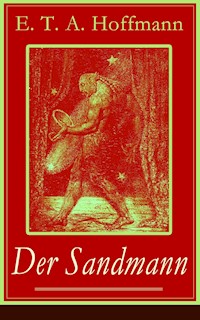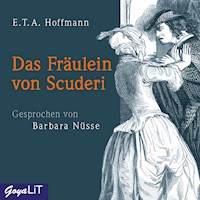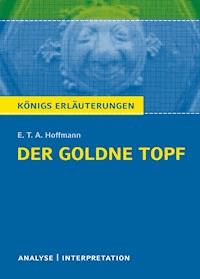Die Bergwerke zu Falun von E.T.A. Hoffmann, Der Runenberg, Des Lebens Überfluss von Ludwig Tieck - Textanalyse und Interpretation E-Book
E.T.A. Hoffmann
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bange, C
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Königs Erläuterungen
- Sprache: Deutsch
Spare Zeitund verzichte auf lästige Recherche!
In diesem Doppel-Band zu Tieck, Ludwig und E.T.A. Hoffmann,Der Runenberg; Des Lebens Überfluss, Die Berwerge zu Falun findest dualles, was du zurVorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Maturabenötigst –ohne das Buch komplett gelesen zu haben.
Alle wichtigen Infoszur Interpretation sowohlkurz(Kapitelzusammenfassungen) als auchausführlichund klar strukturiert.
Inhalt:
- Schnellübersicht
- Autor: Leben und Werk
- ausführliche Inhaltsangabe
- Aufbau
- Personenkonstellationen
- Sachliche und sprachliche Erläuterungen
- Stil und Sprache
- Interpretationsansätze
- 6 Abituraufgaben mit Musterlösungen
NEU:exemplarische Schlüsselszenenanalysen
NEU:Lernskizzen zur schnellen Wiederholung
Layout:
- Randspalten mit Schlüsselbegriffen
- übersichtliche Schaubilder
NEU:vierfarbiges Layout
In Die Bergwerke zu Falun von E.T.A. Hoffmann gerät der junge Seemann Elis Fröbom unter den Einfluss eines mysteriösen Bergwerksdirektors und wird von der düsteren Faszination der Unterwelt ergriffen. Er opfert seine Liebe und sein Leben der Suche nach dem geheimnisvollen Reichtum der Berge, wobei er schließlich in den Tiefen des Bergwerks verschwindet und erst viele Jahre später als mumifizierte Leiche gefunden wird.
In Der Runenberg von Ludwig Tieck wird der junge Jäger Christian von einer geheimnisvollen Begegnung in den Bergen verzaubert und kann die Anziehungskraft des Übernatürlichen nicht abschütteln. Schließlich verlässt er seine Familie und verschwindet in den Bergen, getrieben von einem unstillbaren Verlangen nach dem Runenberg, das sein Leben zerstört.
In Des Lebens Überfluss von Ludwig Tieck wird die Geschichte eines reichen Mannes erzählt, der trotz seines Wohlstands und Überflusses an materiellen Gütern unglücklich und unerfüllt bleibt. Am Ende erkennt er, dass wahrer Reichtum nicht im Besitz von Dingen liegt, sondern in der inneren Zufriedenheit und der Fähigkeit, das Leben mit Maß und Sinn zu genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN
Band 502
Textanalyse und Interpretation zu
E. T. A. Hoffmann
Die Bergwerke zu Falun
Ludwig Tieck
Die Bergwerke zu FalunDes Lebens Überfluss
Thomas Möbius
Alle erforderlichen Infos zur Analyse und Interpretation plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen
Zitierte Ausgaben:Hoffmann, E. T. A.: Die Bergwerke zu Falun. Der Artushof. Erzählungen. Nachwort und Anmerkungen von Claudia Liebrand. Stuttgart: Reclam, 2023 (RUB Nr. 14078). Zitatverweise sind mit R gekennzeichnet.Hoffmann, E. T. A.: Die Bergwerke zu Falun. Der Artushof. Husum/Nordsee: Hamburger Lesehefte, 2025 (Heft 124). Zitatverweise sind mit HL gekennzeichnet.Tieck, Ludwig: Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Märchen. Stuttgart: Reclam, 2025 (RUB Nr. 14693). Zitatverweise sind mit R gekennzeichnet.Tieck, Ludwig: Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Märchen. Husum/Nordsee: Hamburger Lesehefte, 2021 (Heft 228). Zitatverweise sind mit HL gekennzeichnet.Tieck, Ludwig: Des Lebens Überfluss. Novelle. Nachwort und Anmerkungen von Christian Schmitt. Stuttgart: Reclam 2023 (RUB Nr. 19629) Zitatverweise sind mit R gekennzeichnet.Tieck, Ludwig: Des Lebens Überfluss. Novelle. Husum/Nordsee: Hamburger Lesehefte, 1958 (Heft 59). Zitatverweise sind mit HL gekennzeichnet.
Über die Autorin dieser Erläuterung: Magret Möckel, geboren 1952 in Lindau an der Schlei (Schleswig-Holstein), Studium der Germanistik und Anglistik an der Universität in Hamburg. Seit 1979 Lehrerin für Deutsch und Englisch, erst an einem Gymnasium in Vechta, dann in Friesoythe, ab 2003 an der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg. Ihr Unterrichtsschwerpunkt lag auf dem Deutschunterricht in der Oberstufe. Frau Möckel leitete viele Jahre lang die Fachgruppe Deutsch an der Graf-Anton-Günther-Schule und war Mitglied der Kommission zur Erstellung der zentralen Abituraufgaben im Fach Deutsch.
1. Auflage 2025
978-3-8044-7108-5
© 2025 by Bange Verlag GmbH, Am Graben 2, 96142 [email protected] – www.bange-verlag.de Alle Rechte vorbehalten, darunter fällt auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG! Titelabbildung: Marcel Kohler als Elis Fröbom und Lea Ruckpaul als Anna während einer Probe zum Schauspiel Das Bergwerk von Falun von Hugo von Hofmannsthal im Salzburger Landestheater 2021 © picture alliance / BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com
Hinweise zur Bedienung
Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.
Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).
Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.
Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Webadressen nach Erscheinen dieses ePubs gegebenenfalls nicht mehr aufrufbar sind!
Inhaltsverzeichnis
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Ludwig Tieck/E. T. A. Hoffmann: Leben und Werk
2.1 Biografie
Ludwig Tieck
E. T. A. Hoffmann
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Bezeichnung, Motive, Autor:innen
Frühromantik
Hochromantik
Spätromantik
Historischer Kontext
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert (1797)
E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann (1816)
E. T. A. Hoffmann: Der goldne Topf (1814, überarb. 1819)
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
Ludwig Tieck: Der Runenberg (1804)
Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss (1839)
E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun (1819)
3.2 Inhaltsangabe
Ludwig Tieck: Der Runenberg
Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss
E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun
3.3 Aufbau
Ludwig Tieck: Der Runenberg
Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss
E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Christian und Elisabeth (Der Runenberg)
Christian
Elisabeth
Heinrich und Clara (und Christine) (Des Lebens Überfluss)
Heinrich
Clara
Christine
Elis und Ulla (Die Bergwerke zu Falun)
Elis Fröbom
Ulla
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
Medialer Kontext: Erzählsammlungen
Ludwig Tieck: Phantasus
E. T. A. Hoffmann: Die Serapionsbrüder
Gattungskontext: Novellen
Ästhetischer Kontext: Romantische Ironie
Ludwig Tieck
E. T. A. Hoffmann
3.6 Stil und Sprache
Romantische Schreibweisen
Ludwig Tieck: Der Runenberg
Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss
E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun
3.7 Interpretationsansätze
Männer und Frauen, Künstler und Philister
Selbstreferenz in romantischer Literatur
Ludwig Tieck: Der Runenberg
Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss
E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun
Illusion: Traum – Identität – Wirklichkeit
Romantisches Erzählen im Vergleich mit Texten des 20. und 21. Jahrhunderts
Patrick Süskind: Das Parfum (1985, Roman)
Tonio Schachinger: Echtzeitalter (2023, Roman)
Die Matrix-Tetralogie (Filme, 1999, 2003, 2004 u. 2021)
David Lynchs Mulholland Drive (Film, 2001)
Fragenkatalog zum Austausch über die Texte
3.8 Schlüsselstellenanalysen
4. Rezeptionsgeschichte
5. Materialien
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1 ***
Aufgabe 2 **
Aufgabe 3 ***
Aufgabe 4 **
Aufgabe 5 **
Aufgabe 6 ***
Lernskizzen und Schaubilder
Literatur
Zitierte Ausgaben
Weitere Primärliteratur
Sekundärliteratur
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
Damit sich die Leser:innen in diesem Band schnell zurechtfinden und das für sie Interessante gleich entdecken, hier eine kurze Übersicht.
Ludwig Tieck (1773–1853) hat alle Phasen der Romantik mitgestaltet und gilt heute als einer der kreativsten und vielseitigsten Schriftsteller seiner Zeit. Er machte sich zudem als Übersetzer (von Werken Shakespeares, Cervantes’ u. a.) sowie als Vorleser einen Namen. Der Runenberg ist Teil einer Erzählsammlung (Phantasus, 1812, Erstveröffentlichung 1804). Die 1837 entstandene Novelle Des Lebens Überfluss markiert schon einen Übergang in die Epoche des Realismus.
E. T. A. Hoffmann (1776–1822) war ein begabter Jurist und Künstler (Schriftsteller, Musiker, Maler), der vor allem als Vertreter der Schwarzen Romantik in die Literaturgeschichte einging. Die Bergwerke zu Falun entstammen der Erzählsammlung Die Serapionsbrüder (1819–21). Neben der Darstellung des Fantastischen, Unheimlichen und Wunderbaren ist Hoffmann auch durch die Komik, Satire und Sozialkritik seiner Werke bekanntgeworden. Hoffmann hat Einfluss auf zahlreiche europäische und amerikanische Künstler gehabt.
Die Zeit der Romantik überschneidet sich mit der der Klassik. Im Gegensatz zu den Vertretern der Klassik, die Vernunft und Ideale der Antike aufgriffen, waren die Romantiker an der Welt der Gefühle, der Entwicklung des Individuums, an Fantasie und dem Wunderbaren interessiert. Sie lehnten Alltagsmenschen (Philister) und deren Leben ab, propagierten dagegen den Blick in verborgene Welten.
Aufgrund der großen Fülle literarischer Werke von Tieck und Hoffmann wird in Kapitel 2.3 dieser Erläuterung nur eine kleine Auswahl vorgestellt, die exemplarische Bedeutung hat.
Entstehung und Quellen:
Quellen für die Entstehung der hier erläuterten Texte sind zum Teil Freundschaften und Gespräche der Romantiker über philosophische und poetologische Fragen. In Abgrenzung zur vernunftbetonten Klassik geht es den Romantikern um Gefühlswelten und die Auslotung der Schwellen und Übergänge zwischen realer und fantastischer Welt.
Eine Wanderung Tiecks mit seinem Freund Wilhelm Heinrich Wackenroder hat einen intensiven Eindruck für die Entstehung des Runenberg hinterlassen.
Dieser Text wiederum wird inhaltlich und stilistisch prägend für Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun, ein Text, der auf der Grundlage eines realen Geschehens (das Auffinden eines konservierten Bergmanns in einer Faluner Mine) entsteht.
Ausgangspunkte der ironischen Novelle Des Lebens Überfluss sind Tiecks Gespür für eine veränderte Zeitströmung, sein großer Schatz an literarischem Wissen sowie eine rückblickende, selbstreferenzielle Betrachtung der früheren romantischen Phase.
Inhalte:
Inhaltlich geht es in den Märchen- bzw. Bergwerkserzählungen von Tieck und Hoffmann um das Scheitern des Lebensweges eines jungen Mannes. Beide Hauptfiguren leben nach einer faszinierenden erotischen Erscheinung (auf nächtlicher Wanderung bzw. im Traum) mit der Runenfrau bzw. der Bergkönigin in Zerrissenheit und Sehnsucht. Ihnen misslingt langfristig die Anpassung an ein bürgerliches Leben und die Liebe zu einer realen Frau. Sie führen ein Leben im Zwiespalt und enden im Wahn. Es geht um den Konflikt zwischen normativ geregeltem Lebens- und Arbeitsalltag mit Familie und Sicherheiten und einem unbestimmten, abenteuerlichen, gefährlichen Leben im Gebirge, in unbedingter Hingabe an ein übernatürliches erotisches Ideal. Dies kann auch als Bild für das Leben eines Künstlers gesehen werden.
In Tiecks Des Lebens Überfluss wird eine Experimentieranordnung vorgestellt, in der ein völlig isoliert lebendes Paar auch noch die letzte Verbindung zur Außenwelt, eine Treppe, kappt und verheizt. Heinrich und Clara leben bis zur märchenhaften Rettung am Schluss in poetischer Verklärung ihrer Lage.
Personen:
Die Hauptfiguren der Bergwerks-Erzählungen sind zunächst Christian (bei Tieck) und Elis (bei Hoffmann), die voller Sehnsüchte und von geheimnisvollen Kräften getrieben sind. Die weiblichen Figuren Elisabeth (Tieck) und Ulla (Hoffmann) verblassen neben den übernatürlich schönen und verlockenden Frauengestalten aus Bergruine bzw. Bergwerk. Tiecks Christian endet als Eremit im Gebirge, Hoffmanns Elis findet den Tod im Gestein und wird dort fünfzig Jahre lang konserviert.
Heinrich und Clara in Des Lebens Überfluss sind dagegen ein idealisiertes Liebespaar, sie sind in der Welt der Bücher und der Poesie zu Hause.
Alle Personen sind mehrdeutig gestaltet und lassen sich unter unterschiedlichen Aspekten charakterisieren (s. Kapitel 3.4 dieser Erläuterung).
Sachliche Erläuterungen:
Das Kapitel 3.5 dieser Erläuterung nimmt verschiedene inhaltliche Themen auf. Das ist zum einen der jeweilige Kontext der beiden Bergwerks-Erzählungen bzw. Märchennovellen in besonderen Sammelbänden. Das ist zum anderen die romantische Ironie, mit der man sich auseinandersetzen muss, um beispielsweise Des Lebens Überfluss richtig einordnen zu können. Dieser Text ist als Beispiel für die in der Romantik besonders beliebte Textsorte „Novelle“ prägend für die spätere literarische Tradition.
Stil und Sprache:
In Kapitel 3.6 dieser Erläuterung wird das typisch Romantische der Erzählweisen und des Stils der drei Texte erläutert und an Beispielen veranschaulicht. Durch das Nebeneinander unterschiedlicher Perspektiven und Erzählformen, durch Kontraste, Synästhesien, intertextuelle Referenzen, Metaphern und Allegorien werden eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten eröffnet.
Interpretationsansätze:
In Kapitel 3.7 dieser Erläuterung werden die drei männlichen Hauptfiguren miteinander verglichen und ihre Konflikte dargelegt. Während die beiden jungen Männer in Der Runenberg und Die Bergwerke zu Falun ihren Weg zwischen konträren Welten finden müssen und dabei scheitern, lebt Heinrich in Des Lebens Überfluss mit seiner Frau Clara isoliert und in poetischen Welten.
Alle Texte können als Auseinandersetzung einer autonomen Künstlerexistenz mit den Anforderungen einer rational-bürgerlichen Welt gesehen werden.
In welcher Hinsicht die Texte ein Schreiben über Schreiben (Selbstreferenz) darstellen, wird im Detail dargelegt.
Es folgt eine moderne Betrachtung der drei Erzählungen unter der Frage nach der Verlässlichkeit der Wahrnehmung von Realität und Täuschung. Die Träume, Erscheinungen und fantastischen Welten der romantischen Texte werden in Bezug gesetzt zur zeitgenössischen medialen und digitalen Welt. Dies geschieht unter der Frage nach der Unterscheidbarkeit von Fakt und Fiktion, von Manipulation und Einfluss.
Danach werden Analogien zwischen den Texten der Romantik und der Postmoderne bzw. Gegenwartsliteratur hergestellt. Dies nimmt Aspekte wie Stilpluralität, Doppelcodierung, Verknüpfung von Realitätsebenen mit fiktionalen Welten u. v. m. in den Blick.
Im erweiterten Textbegriff wird anhand der Filmreihe Matrix gezeigt, mit welcher Komplexität romantische Themen und Fragestellungen in modernen Filmen aufgegriffen werden, so z. B. wie Schwellen zwischen Welten geschaffen und überschritten werden. David Lynchs Film Mulholland Drive (2001) wird als Beispiel für Selbstreferenz in Filmen herangezogen. Den Abschluss bildet ein Katalog unterschiedlicher Fragen, die ausgehend von den romantischen Texten Diskussionen über Aspekte der Gegenwart auslösen können. (Dieses Kapitel wird als Ergänzung zum Download angeboten.)
2. Ludwig Tieck/E. T. A. Hoffmann: Leben und Werk
2.1 Biografie
Ludwig Tieck
Ludwig Tieck
(1773–1853) © picture alliance / imageBROKER | bilwissedition
Jahr
Ort
Ereignis
Alter
1773
Berlin
Ludwig Tieck wird am 31. Mai in Berlin als Sohn des Seilermeisters Johann Ludwig Tieck und seiner Ehefrau Anna Sophie Tieck, geb. Berukin, geboren. Er hatte eine jüngere Schwester, Sophie (1775–1833), und einen jüngeren Bruder, Friedrich (1776–1851).
1782–1792
Berlin
Besuch des humanistischen Friedrich-Werderschen Gymnasiums in Berlin, Freundschaft mit Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798), 1792 Abitur.
9–19
1792
Halle (Saale)
Tieck schreibt sich in Halle für das Studium der ev. Theologie ein, widmet sich aber fast ausschließlich der Literatur, Altertumswissenschaft und Philosophie. Im Juli Fußwanderung durch den Harz, die für den Stadtmenschen Tieck zu einem überwältigenden Naturerlebnis wird. Die Eindrücke der wildromantischen Landschaft finden später Eingang in den Blonden Eckbert.
19
1792/1793
Göttingen
Wechsel an die Göttinger Universität.
19/20
1793
Erlangen Fränkische Schweiz, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth
Mit Wackenroder gemeinsames Sommersemester in Erlangen. Sie wandern durch die Fränkische Schweiz, besuchen Nürnberg, Bamberg und Schloss Pommersfelden, unternehmen auch eine Wanderung nach Bayreuth und ins Fichtelgebirge.
20
1793/1794
Göttingen
Wintersemester in Göttingen, Studienabbruch.
20/21
1794
Berlin
Rückkehr nach Berlin. Entschluss, freier Schriftsteller zu werden.
21
1796
Berlin
Tieck bringt die ironische Lebensbeschreibung Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abentheuerlichkeiten und den Briefroman Die Geschichte des Herrn William Lovell zum Abschluss. Im Frühjahr Verlobung mit der Pastorentochter Amalie Alberti (1769–1837).
23
1797
Berlin
Unter Pseudonym veröffentlicht Tieck die Volksmährchen, darunter Der blonde Eckbert. Die in Zusammenarbeit mit Wackenroder entstandenen Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders erscheinen.
24
1798
Hamburg
In Hamburg Vermählung mit Amalie Alberti. Der Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderungen erscheint.
25
1799
Berlin Jena Weimar
Geburt der Tochter Dorothea. Umzug nach Jena, wo Tieck auf den Kreis der Jenaer Frühromantiker trifft: die Brüder Friedrich (1772–1829) und August Wilhelm Schlegel (1767–1845), Novalis (eigentlich Friedrich von Hardenberg, 1772–1801), Clemens Brentano (1778–1842) sowie die Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854). Er lernt auch Johann Wolfgang Goethe (1749–1832), den er in den folgenden Jahren mehrmals in Weimar besuchen wird, und Friedrich Schiller (1759–1805) kennen.
26
1800
Die Schauspiele Leben und Tod der heiligen Genoveva und Die verkehrte Welt erscheinen.
27
1801
Dresden
Umzug nach Dresden.
28
1802
Oder (heute polnisch: Cybinka)
Geburt der Tochter Agnes (1802–1880).Der Runenberg entsteht. Beginn der langjährigen Liebesbeziehung zu Henriette von Finckenstein.
29
1804
Der Runenberg erscheint.
31
1804–1806
Rom
Reise nach Rom. Tieck besucht mehrfach die Vatikanische Bibliothek, wo er altdeutsche Schriften ausfindig machen will. Reisegedichte eines Kranken.
31–33
1808–1810
Wien München Ziebingen
Nach Aufenthalten in Wien, München und einem Kuraufenthalt in Baden-Baden kehrt Tieck nach Ziebingen zurück.
35–37
1812–1816
Herausgabe des Phantasus (bis 1816; dreibändig), einer Sammlung früherer Märchen, Erzählungen, Novellen und Schauspiele. Auch Der blonde Eckbert und Der Runenberg sind in überarbeiteter Fassung enthalten.
39–43
1819–1842
Dresden
Umzug nach Dresden. Seine Geliebte Henriette zieht mit um und wird Teil des tieckschen Haushalts. Umfangreiche schriftstellerische Tätigkeiten, auch als Herausgeber sehr produktiv. 1837 Tod der Ehefrau.1837 entsteht Des Lebens Überfluss und erscheint 1839. Tieck macht als Vorleser aus klassischen Werken der Weltliteratur von sich reden, er wird zur Dresdener Berühmtheit. 1841 Tod der Tochter Dorothea, die u. a. als Übersetzerin aus dem Englischen und Spanischen bei der Schlegel-Tieck-Übersetzung von Shakespeare mitwirkt.
46–69
1842
Berlin
Tieck wird 1841 von König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, 1842 endgültiger Umzug nach Berlin. Während des Umzugs nach Berlin ereilt Tieck ein erster Schlaganfall. Er erhält vom König eine Pension, einen Sekretär und einen Diener.
69
1853
Berlin
Tieck stirbt am 28. April kurz vor seinem 80. Geburtstag.
79
E. T. A. Hoffmann
E. T. A. Hoffmann
(1776-1822)© picture alliance / akg-images
Jahr
Ort
Ereignis
Alter
1776
Königsberg
Geburt von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann am 24. Januar. Vater: Christoph Ludwig Hoffmann (Hofgerichts-Advokat in Königsberg), Mutter: Lovisa Albertina geb. Doerffer, ein älterer Bruder (ein weiterer starb früh).
1778
Trennung der Eltern, Mutter zieht zur verwitweten Mutter, lebt dort mit drei weiteren Geschwistern (zwei Tanten, ein Onkel).
2
1779
Die jüngste der Tanten Hoffmanns stirbt mit 24 Jahren an Pocken (Carlotta Wilhemine Doerffer).
3
1781/82
Königsberg
Besuch der deutsch-reformierten Burgschule. Hoffmann lernt Violinspiel, beginnt Klassiker und Kant zu lesen, erhält Unterricht beim Maler Saemann.
5/6
1787
Beginn der Freundschaft mit dem Schulkameraden Theodor Gottlieb von Hippel (Sohn eines Schriftstellers, 1775–1843).
10
1790/91
Musikunterricht bei Organisten der Domkirche in Königsberg.
14
1792
Königsberg
Beginn des Jura-Studiums an der Königsberger Universität.
16
1793
Dorothea Hatt (27 Jahre alt, verheiratet, Mutter von fünf Kindern) wird Hoffmanns Klavierschülerin und später Geliebte, wohnt mit Mann und Familie im doerfferschen Haus.
17
1795
Beschäftigung mit Mozart, erstes Gemälde gemalt. Erstes juristisches Examen, Hoffmann wird „Auskultator“ (Gerichtsbeisitzer) beim Obergericht Königsberg.
19
1796
Glogau
Begegnung mit Maler Alois Molinary. Versetzung an das Oberamtsgericht in Glogau (Südpreußen), lebt bei Onkel Ludwig Doerffer (mit Ehefrau und Sängerin Sophie Henriette und drei Kindern). Tod der Mutter.Cornaro (Roman) wird vom Verlag abgelehnt.
20
1798
Glogau
Trennung von Dora, Verlobung mit der Cousine Wilhelmine (Minna) Doerffer, zweites juristisches Examen. Versetzung an das Kammergericht in Berlin. Reise ins Riesengebirge, Böhmen, Dresden, danach Weiterbildung in Musik und Malerei.
22
Berlin
Trennung von Dora, Verlobung mit der Cousine Wilhelmine (Minna) Doerffer, zweites juristisches Examen. Versetzung an das Kammergericht in Berlin. Reise ins Riesengebirge, Böhmen, Dresden, danach Weiterbildung in Musik und Malerei.
Dresden
Trennung von Dora, Verlobung mit der Cousine Wilhelmine (Minna) Doerffer, zweites juristisches Examen. Versetzung an das Kammergericht in Berlin. Reise ins Riesengebirge, Böhmen, Dresden, danach Weiterbildung in Musik und Malerei.
1800
Berlin Posen
Drittes juristisches Examen. Reise mit Hippel (Berlin, Potsdam, Dresden, Dessau), wird Assessor in Posen. Kompositionen.
24
1802
Plock
Strafversetzung wegen einer Karikatur-Affäre. Auflösung der Verlobung mit Minna Doerffer, Heirat mit der Polin Maria Thekla Michalina (Mischa) Rorer-Trzynska.
26
1804
Warschau
Ernennung zum Regierungsrat in Warschau. Beginn der Freundschaft mit Eduard Hitzig (1780–1847). Singspiel Die lustigen Musikanten und Sinfonie in Es-Dur, Hoffmann wandelt seinen dritten Vornamen in Amadeus um (Hommage an Mozart).
28
1805
Warschau
Geburt der Tochter Cäcilie (gest. 1807).
29
1806
Warschau
Ende von Hoffmanns beamteter Tätigkeit in der Justiz, nachdem das Gericht nach dem Einmarsch der Franzosen seine Arbeit einstellt und die preußischen Behörden aufgelöst werden.
30
1807
Berlin
Frau und Tochter ziehen nach Posen, Hoffmann versucht vergeblich eine Künstlerkarriere in Berlin. Tod der Tochter.
31
1808
Bamberg
Kapellmeister am Bamberger Theater, Verlust der Stellung nach Monaten.
32
1809/10
Bamberg
Ritter Gluck, Lebensansichten des Katers Murr (Roman), Der Goldene Topf. Hoffmann ist Direktionsgehilfe, Dramaturg und Dekorationsmaler am Theater. Freundschaft mit dem Arzt Dr. Adalbert Friedrich Marcus (1753–1816), Liebe zu seiner fünfzehnjährigen Gesangsschülerin Julia Mark (1796–1865).
33/34
1811
Bamberg
Skandal wegen Hoffmanns unerwiderter Liebe zu Julia.
35
1812
Würzburg
Hoffmann verlässt das Bamberger Theater, Reise nach Würzburg. Hochzeit Julia Marks mit einem Hamburger Kaufmannssohn.
36
1813
Dresden, Leipzig
Musikdirektor in Joseph Secondas in Dresden und Leipzig auftretender Operngesellschaft.
37
1814
Berlin
Entlassung aus dem Theater, Rückkehr zum Staatsdienst am Kammergericht.
38
1814/15
Berlin
Erzählband Fantasiestücke in Callot’s Manier, Elixiere des Teufels (Roman).
39
1816
Berlin
Ernennung zum Rat am Kammergericht, Uraufführung Undine (Oper). Freundschaft mit K. W. Contessa, F. de La Motte Fouqué, C. Brentano, A. von Chamisso, L. Devrient. Zensur und Disziplinarverfahren. Der Erzählband Nachtstücke (2 Bde.) erscheint.
40
1818
Berlin
Beginn der Erkrankung.
42
1819–21
Berlin
Prinzessin Brambilla, Klein Zaches, genannt Zinnober sowie Die Serapionsbrüder (Sammlung von Erzählungen und Märchen, darin: Die Bergwerke zu Falun).
43
1822
Berlin
Disziplinarverfahren wegen der Erzählung Meister Floh. Fortschreitende Lähmung, Tod am 25. Juni durch Atemlähmung.
46
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Zusammenfassung
Die Epoche der Romantik entstand als Reaktion auf Literatur und Denken der Aufklärung und Weimarer Klassik.
Die Vertreter:innen der Romantik idealisierten die Zeit des Mittelalters und werteten Fantasie, Unbewusstes und Fantastisches gegenüber dem Verstand auf.
Neben männlichen Vertretern der Romantik wie Friedrich Schlegel, Novalis oder Ludwig Tieck gab es auch zahlreiche bedeutende Frauen der Romantik wie Dorothea Schlegel, Caroline Böhmer Schlegel-Schelling oder Bettina von Arnim.
Die Romantiker entdeckten und sammelten Volkslieder und -märchen und schrieben u. a. Kunstmärchen, Schauerromane und Kriminalgeschichten.
Die Romantik lässt sich in Früh-, Hoch- und Spätromantik einteilen.
Wichtigste Schauplätze waren Jena, Berlin, Heidelberg, Wien, München und Dresden.
Bezeichnung, Motive, Autor:innen
Die Epoche der Romantik entwickelt sich nahezu zeitgleich mit der der Weimarer Klassik, die vor allem durch Goethe und Schiller geprägt ist und auch mit diesen endet. Trotz aller Unterschiede sollte man nicht nur das Gegensätzliche der beiden literarischen Strömungen suchen, sondern auch das gegenseitige Interesse, die Überschneidungen, Beeinflussungen und Fortentwicklungen. Während sich die Klassik an der Zeit der Antike orientiert, setzt die Romantik auf das christliche Mittelalter als Referenzepoche.
Die Bezeichnung Romantik verweist einerseits auf die romanische Volkssprache, die sich in Volksdichtungen wie Liedern und Märchen niederschlägt. Andererseits bezeichnet der Begriff das Romanhafte, ein Gegenentwurf zu den Idealen der Klassik. „Romantisch“ steht für „wundervoll“, „fantasievoll“, „unwirklich“, das Gefühl Ansprechende. Im Gegensatz zur heutigen Verwendung sind allerdings nicht Kitsch oder Geschmacklosigkeit mit dem Begriff verbunden. Aus dem Englischen kommt zudem die Bezeichnung „romantic", mit der das „Überspannte und Irrationale des galanten Barockromans“[1] gekennzeichnet wird. „Das Ungeordnete, Chaotische, Träumerische und Gefühlte war nun das neue Welt- und Kunstgefühl“[2].
Im Gegensatz zum aufklärerischen Vernunftdenken und zu den ästhetischen Idealen der Weimarer, die der antiken Klassik entnommen wurden, beschäftigen sich die Romantiker mit dem Gegenteil: dem Unbewussten, der Seele, dem Gefühl, Traum und Wahn, mit den Grenzbereichen von Wirklichkeit und Irrealem, mit dem Fantastischem. Neben dem großen Interesse der Romantiker an Volksdichtungen und mündlichen Erzähltexten (Lieder, Märchen, Sagen) wird verstärkt europäische Literatur gelesen. Das schlägt sich unter anderem nieder in der Fülle von Übersetzungen von Shakespeare sowie italienischer und spanischer Literatur. Gerade Ludwig Tieck, teilweise unter Mithilfe seiner sprachbegabten und gut ausgebildeten Tochter Dorothea (1799–1841), hat hier einen maßgeblichen Anteil. Auch der große Zulauf zu den Vorleseabenden Tiecks in Dresden macht dieses Interesse deutlich. Es sind die unterschiedlichen poetischen und philosophischen Welten, die in geselligen Kreisen von Intellektuellen, Schriftstellern, Künstlern, Philosophen und Naturwissenschaftlern (z. B. der Jenaer Kreis um die Gebrüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel) diskutiert werden.
Bemerkenswert ist dabei die bedeutende Rolle der Frauen in der Romantik, z. B. Caroline Böhmer Schlegel-Schelling (1763–1809), Karoline von Günderode (1780–1806), Bettina von Arnim (1785–1859), Sophie Mereau (1770–1806), Dorothea Schlegel (1763–1839). In der Romantik wirken Frauen erstmals als nahezu gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen in diesen Zirkeln mit und treten auch als Autorinnen und Kritikerinnen in Erscheinung. Es gibt einige Städte (Jena, Heidelberg, Berlin, aber auch Wien, München und Dresden), die schwerpunktmäßig mit romantischen Kreisen verknüpft werden. Dies liegt an den Wohn- und Arbeitsorten der Personen, die sich in literarisch-intellektueller Atmosphäre treffen.
Die Literaturgeschichte unterscheidet zwischen Früh-, Hoch- und Spätromantik. Gerade Ludwig Tieck hat alle Strömungen der Zeit kreativ mitgestaltet und andere Künstler:innen beeinflusst. Ihm ist deshalb in früheren Zeiten vorgeworfen worden, er ordne sich der Mode und dem Zeitgeist unter, entwickle keinen typischen Stil. Heute ist man eher von der Vielfalt seiner schriftstellerischen Ergebnisse angetan und erkennt die Komplexität seines poetischen Werkes.
Frühromantik
Maßgeblichen Einfluss auf die Romantiker hat neben dem Philosophen und Kant-Schüler Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854), der an der Universität in Jena lehrt und u. a. mit seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) und der Abhandlung Von der Weltseele (1798) die romantische Philosophie begründet. Sein Thema ist die Einheit von Natur und Geist. Natur ist lebendige Urkraft und unendliche Tätigkeit.
„Die Kunst ist für ihn das Gebiet, in dem Welt und Ich, Reales und Ideales, unbewusstes und bewusstes Wirken der Natur in vollendeter Harmonie erscheinen. Auf theoretischem Gebiet kann diese Harmonie nicht erkannt werden. Man kann das Geheimnis des Einsseins von Geist und Natur höchstens in ‚intellektueller Anschauung‘ ahnend, fühlend (intuitiv) erfassen.“[3]
Mit dieser Idee wird der romantische Künstler herausgefordert. Für ihn ist die mit den Sinnen wahrgenommene Wirklichkeit nur Schein, dahinter liegt aber die wahre Welt verborgen, die mit Gefühl und Fantasie erschlossen werden kann. Das gilt auch für den Blick in das Innere des Menschen. Im Gegensatz zum klassischen Denken, das durch Formstrenge, Klarheit, Ausgewogenheit und Maß geprägt ist, sind die Romantiker voller Sehnsucht und Unruhe. Die Suche nach einem „goldenen Zeitalter“ lenkt ihren verklärten Blick auf das Mittelalter, das ihnen weniger verstörend scheint als die Gegenwart. Subjektivität, Individualität, Fantasie, Vielfalt und das Wunderbare sind ihre Kernbegriffe. Der Künstler hat die Aufgabe, durch sein ästhetisches Weltverständnis und seine Fantasie sich den Seinszusammenhängen anzunähern. Keinesfalls darf er sich in seinem Selbstverständnis durch Alltag, Ehe und bürgerliche Zwänge einengen lassen. So ist er häufig Außenseiter, ein einsamer Autor, der in der Welt der Literatur und Künste lebt.
Typisch für die Zeit sind Zusammenarbeit, gegenseitige Ergänzung und Vielfalt der künstlerischen Konzepte. Es herrscht ein regelmäßiger Austausch und Briefverkehr. Weitere wichtige (und früh verstorbene) Schriftsteller dieser Phase sind u. a. Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798) und Novalis (Pseudonym für Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, 1772–1801).
Hochromantik
Berlin und Heidelberg sind Ausgangspunkte der Weiterentwicklung. Angesichts der politischen Situation (Napoleon, preußische Niederlage bei der Schlacht von Jena und Auerstedt, Auflösung des Deutschen Reiches und Bildung des Rheinbundes) soll der zunehmenden Verunsicherung etwas entgegengesetzt werden. So lässt sich das große Interesse an nationaler Tradition und volkstümlicher Erzählprosa erklären.
Clemens Brentano sammelt alte deutsche Lieder und veröffentlicht sie zusammen mit seinem Freund Achim von Arnim unter dem Titel Des Knaben Wunderhorn (1805–1808). Die Gebrüder Grimm (Jacob Grimm, 1785–1863, Wilhelm Grimm, 1786–1859) geben eine Sammlung deutscher Märchen und Sagen heraus (Kinder- und Hausmärchen, auch Grimms Märchen genannt, 1812–1858; Deutsche Sagen, 1816–1818). Sie gelten als Gründungsväter der Germanistik, da sie sich wissenschaftlich mit der Entwicklung der deutschen Literatur, Sprache und Grammatik beschäftigen und bis heute von Bedeutung sind.
Der mehrfachbegabte Dichter, Maler, Musiker und Jurist E. T. A. Hoffmann