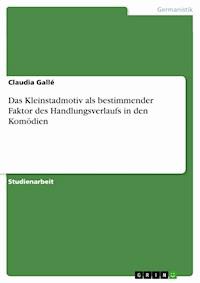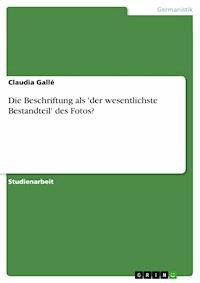
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,3, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Haupsteminar Intermedalität, Sprache: Deutsch, Abstract: Walter Benjamin sieht in der Fotografie ein wirkungsvolles sozialrevoltionäres Kampfmittel und greift damit eine Entwicklungslinie auf, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Für ihn bildet bei dieser Verwendung der Fotografie die Beschriftung und das Bild eine Einheit, deren Bedeutungsgehalt nur von beiden Medien in Kombination in dieser Vehemenz vermittelt werden kann. Mit seiner Frage, ob „die Beschriftung nicht zum wesentlichsten Bestandteil der Aufnahme werde [...]“ , d.h. zum maßgeblichen informationsvermittelnden Bestandteil, deutet er eine Hierarchie innerhalb der beiden Medien Foto und Text für den Bereich der politischen Agitation an, die es zu überprüfen gilt. Dies möchte ich anhand von zwei deutschen Werken tun, Kurt Tucholskys Deutschland, Deutschland über alles und Bertold Brechts Kriegsfibel. Beides sind wichtige Beispiele der linken Agitation vor, beziehungweise während des 2.Weltkrieges und bedienen sich der Kombination von Foto und Text als literarische Form. Ich werde auf Kurt Tucholskys Verhältnis zur Fotografie als politisches Medium recht detailiert eingehen, da es zum Verständnis der Entstehung und der Struktur von Deutschland, Deutschland über alles wichtig ist. Mein Hauptaugenmerk ruht dabei auf dem Verhältnis von Foto und Text und dessen Hierarchisierung im Sinne von Benjamin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 2
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft
Wintersemester 2001/2002 Hauptseminar: Intermedialität
Thema der Hausarbeit: Untersuchung der Bedeutung von Bildtextierungen für die Gesamtaussage von Foto-Text-Einheiten in politischer Literatur anhand von Kurt Tucholskys `Deutschland Deutschland über alles` und Bertold Brechts `Kriegsfibel`
Fächerkombination: AVL (10), Theaterwissenschaft (10), allg. u. mittl. Geschichte (10)
Die Beschriftung als „der wesentlichste Bestandteil“ des Fotos?
Kurt Tucholskys Deutschland, Deutschland über alles und Bertold Brechts Kriegsfibel
eingereicht von:
Claudia Gallé
Page 4
Vorbemerkung
InDas Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit(1936) bezeichnet Walter Benjamin Fotografien als „Beweisstücke im historischen Prozeß“, die „eine Rezeption in bestimmten Sinne“ erfordern. Er weist hier auf zwei wichtige Aspekte des Fotos hin, nämlich seinen Dokumentcharakter1und das Problem seiner Rezeption. Der Betrachter eines Fotos wird im Gegensatz zum Betrachter eines Bildes mit einer Realität konfrontiert, die, so wie er sie vor sich sieht, existiert hat, oder wenigstens wird dieser Eindruck erweckt. Dieses Phänomen desςaa été2berührt den Betrachter auf andere Weise als zum Beispiel ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, daß noch in einer Art „freischwebender Kontemplation“3betrachtet werden konnte. Zu ihnen muß ein bestimmter Weg gefunden werden.4Dieser Zugang zur Fotografie führt nach Benjamin über dessen Textierung. Der visuelle Informationsgehalt muß durch einen verbalen ergänzt werden. Benjamin beschreibt dieses Phänomen in seinerKleinen Geschichte der Photographie:„Bei der Photografie aber begegnet man etwas Neuem und Sonderbarem: in j enem Fischweib aus New Haven, das mit so lässig verführerischer Scham zu Boden blickt, bleibt etwas, [...], was nicht zum Schweigen zu bringen ist, ungebärdig nach dem Namen derer verlangend, die da gelebt hat, [...]“5Das Foto „schweigt“ nicht, es „spricht“ und es verlangt nach einem „Namen“. Benjamin konstatiert: „In ihnen [den Fotgrafien] ist die Beschriftung zum ersten Mal obligat geworden.“6
Was Benjamin hier scheinbar für alle Fotografien als obligat bezeichnet, trifft wohl nicht allgemein zu7. In einem Bereich ist seine Diagnose aber ganz sicher gültig und an ihn dachte er wohl auch nicht zuletzt bei ihrer Formulierung: den Bereich der politischen Propaganda. Er selbst verweist auf diese Verwendungsmöglichkeit von Fotografien, wenn er von ihrer „verborgenen politischen Bedeutung“8spricht. Bereits
1Der nicht unproblematisch ist, da Verfälschungen durch gestellte Fotos und Fotomontage möglich sind.
2Roland Barthes:La Chambre claire: Notes sur la photographie.Paris 1980, S.120.
3alle bisherigen Zitate aus Walter Benjamin:Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.in:Gesammelte SchriftenBd. I.2, Frankfurt/M. 1974, S.485.
4„[...] er fühlt: zu ihnen muß er einen bestimmten Weg suchen.“ ebd.
5Walter Benjamin:Kleine Geschichte der Photographie.in:Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2.Frankfurt/.M. 1966, S.229-247. hier: S.231.
6Benjamin,Das Kunstwerk,S.485.
7vgl. die Verwendung von Fotografien in den Werken der Futuristen, Dadaisten und Surrealisten, z. B. in André Bretons RomanNadia(1922). Erwin Koppen:Literatur und Fotografie: über Geschichte und Thematik einer Medienentdeckung.Stuttgart 1987, S. 110ff.
8ebd.