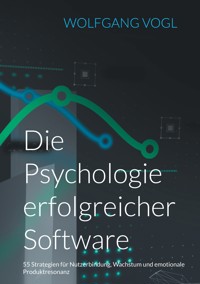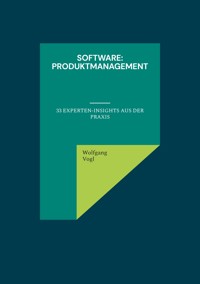Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Warum scheitern so viele Software-Innovationen, obwohl die Ideen brillant sind? Und warum schaffen es nur wenige Unternehmen, aus Innovationen nachhaltigen Geschäftserfolg zu machen? Dieses Buch zeigt, wie sich die Erfolgswahrscheinlichkeit von Software-Innovationen systematisch bewerten lässt. Es verbindet fundiertes Prozessmanagement mit bewährten Methoden des Innovationsmanagements, insbesondere dem Stage-Gate-System von Robert G. Cooper, und erweitert diese durch die Balanced Scorecard. Schritt für Schritt führt Wolfgang Vogl durch die entscheidenden Phasen des Innovationsprozesses: von der Ideengenerierung über den Geschäftsplan bis hin zu Test, Validierung und Markteinführung. Im Mittelpunkt steht dabei die Phase 2 des Stage-Gate-Prozesses, in der der Businessplan entsteht und über "Top oder Flop" entschieden wird. Hier entwickelt der Autor ein praxisnahes Bewertungsverfahren: eine speziell für Software-Innovationen angepasste Balanced Scorecard. Leserinnen und Leser erhalten damit ein praxistaugliches Instrument, das technologische Machbarkeit, Marktattraktivität, Wirtschaftlichkeit und strategische Passung in einem integrierten Bewertungsrahmen verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
2 Prozessmanagement
2.1 Definition
2.2 Einordnung in die Entscheidungsebenen
2.3 Prozess-Architektur
2.4 Prozessanalyse und -modellierung
2.5 Prozessdurchführung und Controlling
2.6 Prozessoptimierung
3 Innovationsmanagement mit dem Stage-Gate-System
3.1 Kritische Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement
3.2 Ziele eines systematischen Innovationsprozesses
3.3 Der Stage-Gate-Prozess
3.4 Zusammenfassung des Stage-Gate-Prozesses
4 Die Balanced Scorecard
4.1 Aktuelle Herausforderungen für Unternehmen
4.2 Die Balanced Scorecard, ein geeignetes Managementsystem
4.3 Was ist die Balanced Scorecard?
4.4 Die einzelnen Elemente der Balanced Scorecard
4.5 Einführung einer Balanced Scorecard
4.6 Zusammenfassung zur Balanced Scorecard
5 Entwicklung einer BSC für die Bewertung von Phase 2 (Geschäftsplan) im Innovationsmanagement nach dem Stage-Gate-System
5.1 Spezielle Balanced Scorecard für die Bewertung von Software-Innovationen
5.2 Erkenntnisse aus der Entwicklung eines ausgewogenen Bewertungsverfahrens mit Hilfe der BSC
5.3 Kritische Beurteilung und Fazit
6 Schlussbetrachtung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Über den Autor
1 Einleitung
Aus dem Titel und Vorwort ergibt sich eine klare Struktur für den Aufbau der vorliegenden Ausführungen.
Abb. 4: Struktur und Aufbau der Ausführungen
Innovationsmanagement bzw. der Innovationsprozess ist, wie der Name schon sagt, im Grunde zunächst einmal ein, wenn auch komplexer Unternehmensprozess. Das heißt, es macht Sinn, sich im Vorfeld mit der Materie des Prozessmanagement an sich zu beschäftigen. Wie ist es aufgebaut, wo ist es einzuordnen und was gibt es zu beachten? Damit haben wir bereits die Basis für die darauf folgende Analyse des Stage-Gate-Systems gelegt. Denn diese spezielle, oft eingesetzte Vorgehensweise im Innovationsmanagement ist ebenfalls prozessorientiert aufgebaut. Im Laufe dieser Untersuchungen treffen wir dann auf die einzelnen Phasen (Stages) und ihrer Tore (Gates) zur Bewertung am Ende der jeweiligen Teilprozesse des in 5 Phasen unterteilten Stage-Gate-Prozesses. Damit fehlt uns nur noch eine geeignete Bewertungsmethode zur Begutachtung der Qualität der Durchführung und der Ergebnisse dieser Teilprozesse. Hier versuchen wir einen neuen Ansatz, diese Bewertung mit Hilfe einer Balanced Scorecard (BSC) durchzuführen. Dazu ist es wiederum notwendig, sich intensiver mit der Balanced Scorecard zu beschäftigen.
Mit dem Prozessmanagement im Allgemeinen, dem Stage-Gate-Prozess für Innovationen im Besonderen und der Balanced Scorecard als Methode zur ganzheitlichen Betrachtung und Bewertung von einzelnen Phasen bzw. Teilprozessen, haben wir nun alle Werkzeuge, um eine Systematik für eine konkrete Begutachtung aufzustellen. Im Innovationsmanagement ist die Erstellung eines aussagekräftigen Geschäftsplanes als Ergebnis der Tätigkeiten der Phase 2 einer der wichtigsten Meilensteine im Innovationsprozess. Hier wird der Grundstein für Top oder Flop eines Neuheiten-Projektes gelegt. Umso wichtiger ist an dieser Stelle ein strenges Auswahltribunal. Ein bereichsübergreifendes Bewertungsverfahren muss hier eine möglichst zuverlässige Empfehlungsbasis liefern, um eine Entscheidung für den Eintritt in die nächste Phase der, meist kostspieligen Entwicklung, zu ermöglichen.
Für den praktischen Einsatz benötigt man eine auf das anvisierte Anwendungsgebiet jeweils angepasste Balanced Scorecard. Im Rahmen dieser Arbeit entwickeln wir deshalb eine spezielle BSC für die Bewertung von Software-Innovationen. An einem exemplarischen Beispiel - der Beurteilung einer eGovernment Softwarelösung - soll dann die Anwendbarkeit überprüft werden. In einem abschließenden Fazit, ist schließlich kritisch zu beurteilen, ob sich die Balanced Scorecard als integratives Bewertungsverfahren für die Begutachtung von Innovationen eignet. Eine Schlussbetrachtung rundet die gewonnenen Erkenntnisse ab. Beginnen wir aber zunächst mit dem ersten Baustein, dem Prozessmanagement.
2 Prozessmanagement
Im Vorwort wurde bereits implizit immer wieder die prozessorientierte Vorgehensweise im Innovationsmanagement unterstellt. Begriffe wie Stage-Gate-Prozess, Innovationsprozess, Prozessphasen oder auch parallele Prozessabwicklung zeigen deutlich, dass das Grundgerüst des Innovationsmanagements ein, auf die speziellen Anforderungen angepasstes, Prozessmanagement ist. Es ist deshalb notwendig sich zunächst mit den grundsätzlichen Wesen, Eigenschaften und Strukturen von Prozessen auseinander zu setzen.
2.1 Definition
„Ein Prozess ist eine zielgerichtete, zeitlich-logische Abfolge von Aufgaben, die arbeitsteilig von mehreren Organisationen oder Organisationseinheiten unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie ausgeführt werden können. Er dient der Erstellung von Leistungen entsprechend den vorgegebenen, aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Prozesszielen. Ein Prozess kann formal auf unterschiedlichen Detaillierungsebenen und aus mehreren Sichten beschrieben werden. Ein maximaler Detaillierungsgrad der Beschreibung ist dann erreicht, wenn die ausgewiesenen Aufgaben je in einem Zug von einem Mitarbeiter ohne Wechsel des Arbeitsplatzes ausgeführt werden können“ [Gada 02, S. 24]. Des Weiteren ist er durch die Merkmale:
wiederholt ablaufende Tätigkeit
messbarer Input
messbarer Output sowie
möglichst messbare Wertschöpfung
gekennzeichnet. Ein Prozess ist somit eine Folge von zwangsläufig aufeinander aufbauenden Tätigkeiten (Unterprozesse), die Eingaben (Inputs) in Ergebnisse (Outputs) umwandeln. Ein Prozess setzt sich im Regelfall aus mehreren Unterprozessen zusammen. Der Input eines Prozesses sind Informationen, Daten, Dienstleistungen, Produkte u. ä., die für die Tätigkeiten erforderlich sind. Der Output einer Tätigkeit sind ebenfalls Informationen, Daten etc., die entweder im gleichen und/oder in einem anderen Prozess weiterverarbeitet werden.
Darüber hinaus können Prozesse in physische Prozesse und Informationsprozesse eingeteilt werden. Im Bereich des Innovationsmanagement sind vor allem die Informationsprozesse von Bedeutung [BGHS 02, Kap. 12.08, S. 2].
2.2 Einordnung in die Entscheidungsebenen
Wie wir später noch sehen werden, ist die Definition von Prozessen im Allgemeinen und im Besonderen bei Geschäfts- und Innovationsprozessen über die Unternehmensstrategie, bei Verwendung der Methode der Balanced Scorecard, im Bereich der ‚internen Perspektive’ angesiedelt. Somit sind sie unterhalb der strategischen, im Bereich der taktischen Planung einzustufen. In Abbildung 5wird deutlich, dass die Definition von Geschäftsprozessen in allen Bereichen - Bedeutung für das Unternehmen, Planungshorizont, Aggregationsgrad und Managementebene - eine ‚mittlere’ Position einnimmt. Nichtsdestotrotz ist genau diese Position als Bindeglied von der Strategie zur täglichen operativen Umsetzung und somit für den Gesamterfolg eines Unternehmens enorm wichtig.
Abb. 5: Kennzeichnung von Entscheidungsebenen
Quelle: In Anlehnung an Günther/Tempelmeier, Produktion und Logistik, S. 25
2.3 Prozess-Architektur
Betrachten wir uns den Geschäftsprozess genauer (Abbildung 6), so stellen wir fest, dass die Architektur von Prozessen ebenfalls wieder in mehrere Ebenen unterteilt ist. Im Sinne eines Regelkreises gilt es die Effektivität und Effizienz der Prozesse ständig zu verbessern. Das Geschäftsprozess-Management übernimmt diese Aufgabe, indem es die Unternehmensprozesse, zu denen auch der Innovationsprozess gehört, transparent macht und einer kontinuierlichen Verbesserung unterzieht. Die Prozessvorgaben entstehen dabei aus den originären Geschäftszielen, wie sie über die Strategielandkarte definiert wurden. Daraus leiten sich die für den Erfolg wichtigen Prozesse ab (Effektivität: Machen wir die richtigen Dinge). Über die Analyse und Planung bzw. Modellierung der Prozesse werden diese von der strategischen auf die operative Ebene überführt. Die Praxis zeigt dann unter zu Hilfenahme von Überwachung und Regelung, ob die Prozesse optimal funktionieren (Effizienz: Machen wir die Dinge richtig). Basis für die letztendliche Optimierung im Sinne eines KVP Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bildet die Leistungsebene mit den daraus gewonnen Messgrößen und Kennzahlen.
Abb. 6: Prozess-Architektur
Quelle: Bernhard/Blomer/Bonn, Strategisches IT-Management, S. 94
2.4 Prozessanalyse und -modellierung
Eine der wichtigsten Schritte bei der Entwicklung und/oder Verbesserung eines prozessorientierten Managementsystems, ist die Beschreibung der im Unternehmen ablaufenden Prozesse.
2.4.1 Prozesse mit Hebelwirkung
Sicherlich wäre es wünschenswert, möglichst alle im Unternehmen vorhandenen Prozesse über ein Geschäftsprozess-Management zu bearbeiten. In der Praxis ist dies leider aufgrund der Fülle von Prozessen nicht mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren. Das Controlling ist hier in Zusammenarbeit mit dem Prozessmanagement gefordert die Schlüsselprozesse zu identifizieren, die das beste Aufwands-/Ertragsverhältnis aufweisen.
Um die Geschäftsprozesse zu identifizieren und aufzuzeichnen, ist die Erstellung eines Prozessdiagramms sinnvoll. Dieses spiegelt die maßgeblichen Prozesse wider. Ist das Diagramm erstellt, geht es darum, die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Geschäftsprozesse einer Überprüfung unterzogen werden. Da, wie schon erwähnt, eine simultane Neugestaltung aller Geschäftsprozesse für kein Unternehmen möglich ist, sind zuerst die Geschäftsprozesse ihrer Bedeutung nach, für die Erfüllung der Kundenanforderungen und der unternehmensstrategischen Ziele zu klassifizieren.
Abb. 7: Kategorien von Prozessen
Quelle: Nowak, Das innovative Unternehmen, Kapitel 12.08/S. 2
Die Kriterien zur Bewertung der Geschäftsprozesse sind Fehlfunktionen, Prozessbedeutung, Machbarkeit und Erfolgschancen. Sind die Geschäftsprozesse nach diesen Kriterien beurteilt, ergeben sich vier Kategorien von Prozessen (Abbildung 7):
Schlüsselprozesse, Kernprozesse
Prozesse mit Hebelwirkung
Opportunistische Prozesse
Unterstützende Prozesse
Bei der Neugestaltung der Prozesse wird zunächst mit den Schlüsselprozessen begonnen. Beispiele für Schlüsselprozesse sind Auftragsabwicklung oder eben auch die Produktentwicklung, in die das Innovationsmanagement mit eingebunden ist. Durch permanentes Messen an Weltklasse-Unternehmen (Benchmarking) soll sichergestellt werden, dass der Prozess optimal auf den Kunden und die Technologieentwicklungen ausgerichtet ist. Durch die genaue Kenntnis der wesentlichen Kosten-, Zeit-, und Qualitätshebel kann er in der Folge immer weiter verbessert werden [BGHS 02, Kap. 12.08, S. 2].
2.4.2 Prozesse detaillieren und abgrenzen
Um Prozesse abzugrenzen, ist eine detaillierte Prozessanalyse aller zu betrachtender Unternehmensprozesse (z.B. Produktentwicklungs- und Innovationsprozess) notwendig. Der Ausgangspunkt für die Prozessanalyse ist das Gesamtprozessmodell des Unternehmens. Hier ist eine Definition des jeweiligen Prozessanfangs (z.B. Ideeneinreichung im Innovationsmanagement) bzw. Auslösers und des Prozessendes mit seinen Ergebnissen (z.B. Prämienzahlung an Ideengeber) zu ermitteln. Komplexe Prozesse lassen sich leichter erarbeiten, wenn sie in mehrere Teilprozesse bzw. Unterprozesse (Abbildung 8) zerlegt werden. Diese sind wiederum auf die einzelnen Tätigkeiten herunterzubrechen. Somit können Schritt für Schritt alle den Prozess beschreibenden Informationen erarbeitet werden. Diese Aufgabe wird am besten durch die jeweiligen Prozessbeteiligten selbst vorgenommen. Sie kann in Form von Prozess-Aufnahmeformularen, Prozessworkshops und/oder Softwarewerkzeugen zur Prozessanalyse (z.B. ARIS von der IDS Scheer AG) erfolgen.
Der Detaillierungsgrad bzw. die Anzahl der Prozessebenen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere von [MüTh 01, S. 124]:
der Aufgabenstellung bzw. den Anforderungen
dem zu erwartenden Risiko und den Auswirkungen bei einem nicht oder schlecht funktionierenden Prozess
der Komplexität des Prozesses und der Prozessketten
der Qualität bzw. der Störungshäufigkeit im Prozess
der Qualifikation der Mitarbeiter/-innen
den Abhängigkeiten und der Schnittstellenproblematik und
der zu schaffenden Transparenz
Abb. 8: Detaillierung von Prozessen im Innovationsmanagement
Quelle: Eigene Darstellung
Bei der Schnittstellenuntersuchung ist es wichtig herauszufinden, was der zu betrachtende Prozess von den vorgeschalteten Prozessen benötigt, bzw. was die nachgeschalteten Prozesse von dem Betrachteten benötigen. Schnittstellen zeigen wichtige Abhängigkeiten zwischen den Prozessen und müssen daher eindeutig und ausreichend beschrieben werden.
2.4.3 Ist-Aufnahmen der Prozesse
Eine Ist-Aufnahme der Unternehmensprozesse ist in den meisten Projekten unabdingbar, da eine aktuelle Dokumentation der Prozesse in vielen Fällen nicht vorhanden ist. Dies hilft auch den Untersuchungsbereich abzugrenzen und zu strukturieren [Gada 02, S. 18]. Bei dieser Gelegenheit können die Ergebnisse auch gleich in ein Managementhandbuch überführt werden, welches regelmäßig zu aktualisieren ist.
Folgende Kernfragen sollten bei der Prozessanalyse beantwortet werden, um den Prozess hinlänglich zu beschreiben:
Was ist der Anstoß des Prozesses?
Was sind die Auslöser (Inputs) des Prozesses?
Wie wird der Prozess abgewickelt (Tätigkeiten)?
Welche begleitenden Dokumente sind bei der Durchführung relevant?
Wer mit wem (Mitwirkung, Verantwortlichkeiten)?
Was sind die Ergebnisse (Outputs) des Prozesses?
Welche Prozessziele sind festgelegt?
Wann und wie wird die Leistungsfähigkeit gemessen (Soll-Ist-Vergleich), visualisiert und bewertet (Kennzahl)?
Wie wird der Prozess wirksam verbessert bzw. Korrekturmaßnahmen festgelegt und überwacht?
Wie ist das Vorgehen bzw. sind die Verantwortlichkeiten bei Störungen oder Änderungen?
Und nicht zuletzt, wer ist insgesamt verantwortlich für den Prozess?
2.4.4 Prozessverantwortliche ernennen
Ein wichtiger Grundsatz des Prozessmanagement ist, dass es für jeden Unternehmensprozess einen Verantwortlichen geben muss. Der Prozessverantwortliche sollte sich durch strategische Fähigkeiten auszeichnen, um Veränderungen des Umfeldes zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Außerdem sollte er Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz besitzen, um mit den Prozessbeteiligten Entscheidungen herbeiführen zu können.
Für Prozesse die nur innerhalb eines Bereiches (Abteilung) ablaufen, stellt die Auswahl eines Prozessverantwortlichen meist kein Problem dar. Der jeweilige Bereichs- bzw. Abteilungsleiter ist in diesem Falle automatisch der Prozessbesitzer. Schwieriger ist es - und das ist normalerweise häufig der Fall - einen Prozessverantwortlichen für Prozesse zu finden, die sich über mehrere Bereiche erstrecken. Dies trifft im Extremen auf den Innovationsprozess zu, der sich im Prinzip - von Phase zu Phase unterschiedlich -, in der Summe über alle Unternehmensbereiche erstreckt.