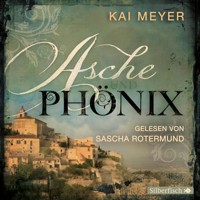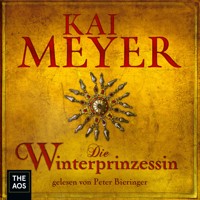9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geheimnisse des Graphischen Viertels
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Kai Meyer führt uns zurück in die Gassen der Bücherstadt Leipzig, in das verlorene Graphische Viertel und in ein Labyrinth aus Literatur und Schatten. Sankt Petersburg, 1917. Der junge Bibliothekar Artur flieht vor den Schergen der Revolution, im Gepäck ein Manuskript, das ihn retten soll – und die Leben vieler anderer bedroht. Sein Ziel ist Leipzig, die Stadt der Bücher. Im legendären Graphischen Viertel will er seine große Liebe Mara wiedersehen, die dem Sohn eines reichen Verlegers versprochen ist. Cote d'Azur, 1928. Das Mädchen Liette findet auf dem Dachboden des Luxushotels Château Trois Grâces die vergessenen Reisekisten russischer Familien, die während der Revolution ermordet wurden. Darin entdeckt sie ein altes, mit einem Schloss gesichertes Buch. Dreißig Jahre später beauftragt Liette, mittlerweile Direktorin des Hotels, den Gentleman-Ganoven Thomas Jansen, mehr über die ehemalige Besitzerin des Buchs herauszufinden – eine Russin namens Mara. Die Spur führt zu einem Bibliothekar, der vor Jahren nach Leipzig kam, zu einer verlassenen Villa am Meer und der geheimnisvollen Bibliothek im Nebel. Wie schon in seinem Erfolgsroman »Die Bücher, der Junge und die Nacht« beschwört Kai Meyer die Magie der Bücher und präsentiert eine faszinierende Melange aus Familiensaga, Kriminalroman, Liebesgeschichte und Abenteuer. Lesen Sie auch die anderen Teile der historischen Roman-Reihe »Die Geheimnisse des Graphischen Viertels«. Alle Teile sind unabhängig voneinander lesbar. - Die Bücher, der Junge und die Nacht - Das Haus der Bücher und Schatten - Das Antiquariat am alten Friedhof
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kai Meyer
Die Bibliothek im Nebel
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sankt Petersburg, 1917. Der junge Bibliothekar Artur flieht vor den Schergen der Revolution, im Gepäck ein Manuskript, das ihn retten soll – und die Leben vieler anderer bedroht. Sein Ziel ist Leipzig, die Stadt der Bücher. Im legendären Graphischen Viertel will er seine große Liebe Mara wiedersehen, die dem Sohn eines reichen Verlegers versprochen ist.
Cote d’Azur, 1928. Das Mädchen Liette findet auf dem Dachboden des Luxushotels Château Trois Grâces die vergessenen Reisekisten russischer Familien, die während der Revolution ermordet wurden. Darin entdeckt sie ein altes, mit einem Schloss gesichertes Buch.
Dreißig Jahre später beauftragt Liette, mittlerweile Direktorin des Hotels, den Gentleman-Ganoven Thomas Jansen, mehr über die ehemalige Besitzerin des Buchs herauszufinden – eine Russin namens Mara. Die Spur führt zu einem Bibliothekar, der vor Jahren aus Russland nach Leipzig kam, zu einer verlassenen Villa am Meer und der geheimnisvollen Bibliothek im Nebel.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
1
1917
Ich spürte Mara im ganzen Haus, obwohl sie schon lange fort war. Fühlte ihre Anwesenheit in den hohen Gängen wie einen Luftzug, sah ihren Umriss im Faltenwurf der Brokatvorhänge, hörte ihre Schritte in den barocken Sälen und auf der Freitreppe aus Marmor.
Doch nirgends war sie mir so nah wie in der Bibliothek meines Onkels, ein Spuk im Labyrinth der Bücher.
Manchmal, wenn ich an den Regalen entlangging, glaubte ich sie auf der anderen Seite zu sehen, ein Huschen hinter den Reihen, ein Tänzeln im aufgewirbelten Staub, ein Schatten auf den ledernen Buchrücken. Dann wünschte ich mir, ich könnte ihre Stimme hören, ihr Atmen, das leise, kluge Lachen.
Aber Geister lachen nie, auch nicht die der Lebenden.
Keiner wird das hier lesen. Sobald ich meine Niederschrift beendet habe, werde ich die Blätter verbrennen. Dann wird es sein, als ob die Flammen die Vergangenheit verzehren – den Schmerz, die Schuld und auch das Schöne –, und ich werde freier atmen können, klarer denken, vielleicht wieder schlafen, ohne in den Träumen zurückzukehren, in das kalte Palais am Katharinenkanal, nach Sankt Petersburg im Februar 1917.
Atemlos kam ich an jenem Tag aus der Kaiserlichen Bibliothek nach Hause. Ich hatte meinen Spind im Raum der Jungbibliothekare ausgeräumt und ein paar meiner Lieblingsbücher eingesteckt, um sie in Sicherheit zu bringen, für den Fall, dass jemand Feuer legte. Petersburg – das seit ein paar Jahren offiziell Petrograd hieß, aber auf der Straße kaum so genannt wurde – versank unaufhaltsam im Chaos. Auf den Newa-Brücken brannten die Barrikaden der Bauern und Arbeiter, der Zar hatte das Kriegsrecht ausgerufen. Manche munkelten von einem Schießbefehl an das Militär. Dabei sollten es schon bald die Soldaten sein, die sich gegen Nikolaus II. erheben und ihn zur Abdankung zwingen würden.
Doch bis dahin, pure Anarchie.
Am Newski-Prospekt zogen die protestierenden Massen mit Parolen und Knüppeln umher, mal hierhin, mal dorthin, sodass man sich fragte, wohin sie wohl das Land steuern wollten, wenn sie nicht mal ihren Märschen eine Richtung geben konnten. Gefährlicher als sie waren die Plünderer und jene, die allein auf Zerstörung aus waren. Auf meinem Weg zurück zum Kanal hatte ich einen großen Bogen um sie alle gemacht, und als ich erschöpft das Palais betrat – wie meistens durch den Dienstboteneingang, weil meine Tante das hasste –, dachte ich naiv, ich hätte das Schlimmste hinter mir.
Da hatte ich noch nicht Ofeliyas Rollstuhl gesehen, der mit zertretenen Speichen auf der Seite lag. Und das Blut im großen Salon.
Von beidem ahnte ich nichts, als ich die Freitreppe im Foyer hinauflief, durch die Gemäldegalerie zur Hausbibliothek meines Onkels. Sie war in einem Saal im Westflügel unterbracht, in den man Regalwände nach einem unergründlichen Muster eingezogen hatte, bis er aussah wie einer der Irrgärten, in denen weiße Mäuse nach einem Ausgang suchen. Die Maus war in diesem Fall ich, denn seit mein Onkel Alexej Michailowitsch Kalinin mir die Verantwortung für seine Sammlung übertragen hatte, irrte auch ich durch diese Wildnis aus entlegenen Themengebieten und unkartografierten Bücherbergen. Weil er mir die Ausbildung in der Kaiserlichen Bibliothek ermöglichte, war er der Ansicht, dass ich meine Freizeit mit dem Sortieren und Katalogisieren seiner eigenen Bände verbringen sollte.
Nicht, dass es mir etwas ausmachte. Manche Menschen sind für die Bücher gemacht, und nur die Ahnungslosen glauben, es sei umgekehrt.
Ich legte den Stapel, den ich mitgebracht hatte, auf den Arbeitstisch zwischen den Fenstern und schob einen der Vorhänge ein kleines Stück beiseite. Auf der Straße zog ein tobender Mob vorüber. Viele Männer trugen Möbelstücke und Gemälde in goldenen Rahmen, andere Stehlampen und Stapel gefalteter Bettwäsche, zwei gar eine leere Kinderwiege. Sie mussten eines der anderen Herrschaftshäuser am Kanal geplündert haben, vielleicht die Villa der Sidorows. Wiktoria Sidorowa hatte erst vor wenigen Wochen entbunden.
Im Nachhinein wundere ich mich, dass ich mir kaum Sorgen um uns machte. Diese Menschen da draußen mochten durch verlassene Häuser randalieren, aber gewiss doch solche meiden, in denen es Zeugen gab. Schließlich war ich zu Hause, und irgendwo musste auch die Dienerschaft sein, dazu mein Onkel, meine Tante, natürlich meine Cousine Ofeliya. So dachte ich damals, Narr, der ich war, und es verrät viel über die Blauäugigkeit, mit der ich die Welt durch Bibliotheksfenster betrachtete.
Der Himmel hatte sich zugezogen, es sah nach starkem Regen aus. Vielleicht würden sich die Horden der Unzufriedenen bald von selbst auflösen, zurückgeschwemmt in ihre Viertel, in denen es tagsüber nach nasser Wäsche und Kohlsuppe roch und in den Nächten nach Schnaps und Erbrochenem.
Gerade nahm ich das oberste Buch vom Stapel, eine russische Ausgabe des Kalevala, die mir besonders am Herzen lag, als ein lautes Pochen erklang. Ein Netz von Rohren verbreitete es im ganzen Haus, erst recht, wenn man den Türklopfer wie einen Hammer benutzte. Oder wie einen Rammbock.
Ich warf einen erneuten Blick aus dem Fenster. Der Pulk der Plünderer war weitergezogen, mehr als einer oder zwei von ihnen konnten nicht am Portal sein. Keiner der Dienstboten machte Anstalten, die Tür zu öffnen – sicher fürchteten sie um ihr Leben –, also machte ich mich auf den Weg: an den Gemälden vorbei, die Treppe hinab, durch die Weite der Eingangshalle. Vom Leben in einem Palast träumt man nur, bis man selbst in einem wohnt. Kaum ein Tag, an dem ich mich nicht fortwünschte, in ein einsames Holzhaus in den Wäldern Kareliens, hinaus aus diesem Gemäuer der langen Wege, zugigen Fluchten und ungeheizten Säle.
Ich blickte durchs Guckloch, erkannte die breite Nase und das rote Haar und riss die Tür auf. »Falls du es auf Tischdecken abgesehen hast oder das Tafelsilber –«
»Artur!« Spiridon drängte sich atemlos an mir vorbei in die Eingangshalle. »Du musst weg von hier! Sofort!« Er trug ein gestreiftes Hemd und eine Lederjacke, wohl in dem Bestreben, wie einer der rebellischen Matrosen aus Kronstadt auszusehen, die mit den aufständischen Landarbeitern durch die Straßen zogen.
Ich drückte das Portal hinter ihm ins Schloss und nutzte den Moment, um mich zu sammeln. Ich kann nicht sagen, warum es das Auftauchen meines Freundes war, das mich aufrüttelte – ich hatte ja selbst gesehen, was draußen los war –, aber da war etwas in seinem Tonfall, das weit alarmierender war als sein poltriger Auftritt. Innerlich wurde mir eiskalt, und ein Zittern lief durch meine Beine. »Was ist passiert?«
Ungläubig starrte er mich an. »Du weißt es nicht?«
»Nun sag schon.«
Er schaute sich hastig in der Halle um. Erst einen Herzschlag später begriff ich, dass er diesmal nicht die wertvollen Bilder und Teppiche taxierte, sondern die anderen Hausbewohner suchte. Da fragte auch ich mich zum ersten Mal ernsthaft, wo eigentlich alle steckten.
Ofeliya musste wie immer in ihrem Zimmer sein – sie mochte den neuen Aufzug nicht, aber noch weit mehr hasste sie es, wenn die Diener sie aus dem Rollstuhl hoben und die Treppen hinabtrugen wie ein Kind. Sie war zweiundzwanzig, genauso alt wie ich, und es sprach Bände, dass Tante Xenia sie nach dem Unfall nicht ins Erdgeschoss umquartiert hatte. Stattdessen hatte sie Ofeliya jahrelang zugemutet, sich tragen zu lassen, bis sie ihr Zimmer im ersten Stock kaum noch verließ. Dass Onkel Alexej vor ein paar Monaten den modernen Gitteraufzug hatte einbauen lassen, änderte daran nicht das Geringste. Ofeliya blieb am liebsten allein und lebte nur auf, wenn ich vorbeikam, um ihr neue Bücher zu bringen.
Wo Xenia gerade steckte, vermochte ich nicht zu sagen, aber Alexej würde wohl im Arbeitszimmer sein, vielleicht auch im Rauchersalon, wo er eine seiner schrecklichen Havannas paffte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er in Anbetracht der Szenen auf den Straßen zum Verlag gefahren war. Mein Onkel saß die Dinge gern aus, ganz gleich, ob es sich um das Unglück seiner Tochter oder den Aufstand der russischen Bauern handelte.
»Sie waren hier, als du weg warst«, sagte Spiridon mit tiefernstem Blick. »Die Geheimpolizei war bei euch im Haus.«
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. »Hier?«
»Die Schweine von der Ochrana haben die Diener nach Hause geschickt, und dann haben sie sich deine Familie vorgenommen.«
Vielleicht hatte er ein falsches Gerücht aufgeschnappt. Es wurde viel geredet in diesen Tagen, stündlich machten neue Hiobsbotschaften die Runde. Doch Spiridon packte mich hart an den Schultern und machte dabei ein Gesicht, mit dem man guten Freunden beibringt, dass ihr bisheriges Leben vorüber ist.
»Wir müssen von hier verschwinden«, sagte er beschwörend. »Nicht in fünf Minuten, nicht in einer, sondern jetzt gleich!«
Mir wurde schwindelig, aber ich riss mich von ihm los, warf mich wortlos herum und rannte die Freitreppe hinauf.
»Artur!«, rief er mir hinterher. »Es ist zu spät!«
Ich hörte nicht auf ihn, nahm immer zwei Stufen auf einmal, erreichte den ersten Stock und bog in den Korridor, an dessen Ende Ofeliyas Zimmer lag.
Schon von Weitem sah ich, dass die Tür weit offen stand. Der Läufer auf dem Gang hatte Wellen geschlagen. Die Hausmädchen hatten Anweisung, die Teppiche stets glatt zu ziehen, damit sie kein Hindernis für Ofeliyas Rollstuhl darstellten.
Spiridons Schritte polterten die Stufen herauf, weit hinter mir in einer besseren Welt, in der die grausame Gewissheit kaum eine Ahnung gewesen war. »Artur, warte!«
Ich nahm den vertrauten Geruch ihres Zimmers wahr, noch ehe ich hineinstürmte, das leichte Parfüm, das sie immer benutzte, obwohl niemand außer mir zu ihr kam. Wie vom Schlag getroffen, blieb ich stehen. Der Rollstuhl lag umgeworfen vor ihrem Bett, in einem Meer aus Spiegelscherben. Einige der Bücher, die ich ihr letzte Woche mitgebracht hatte, waren über den Boden verstreut, als hätte sie jemand in maßloser Wut durch den Raum geschleudert. Wahrscheinlich derselbe, der ohne jeden Sinn auf das Rad des Rollstuhls eingetreten hatte. Gebrochene Speichen stachen in alle Richtungen.
Spiridon kam im Türrahmen zum Stehen. »Du kannst nichts für sie tun. Du weißt, was es bedeutet, wenn die Ochrana einen mitnimmt.« Er schien es nicht zu wagen, mir erneut eine Hand auf die Schulter zu legen oder auch nur in meine Reichweite zu kommen. »Sie sind alle drei tot.«
Ich drehte mich um, sah, wie er zusammenfuhr, als mein Blick den seinen kreuzte, dann drängte ich mich an ihm vorbei und lief zurück nach unten.
Im Salon fand ich Blut. Es waren nur wenige Spritzer, aber ich konnte mir vorstellen, dass sie von Hieben mit einem Schlagring stammten. Die Geheimpolizisten mussten Onkel Alexej, vielleicht auch Tante Xenia, damit bearbeitet haben. Doch vor allem dachte ich: Bitte nicht Ofeliya!
Spiridon, der einen halben Kopf größer war als ich und weit schneller, wenn es darauf ankam, tauchte neben mir auf. »Als ich davon gehört habe, bin ich sofort hergerannt!« Spiridon hörte oft solche Dinge, weil er die nötigen Verbindungen besaß und mit der Fälscherwerkstatt unter seinem Laden selbst jeden Tag Gefahr lief, in den Folterkellern und Kopfschusskammern der Ochrana zu landen. »Es heißt, man hätte eine Lieferung mit ein paar Hundert Büchern aus Deutschland abgefangen, die dein Onkel dort hat drucken lassen. Irgendeine umstürzlerische Kampfschrift.«
»Mein Onkel ist doch kein Feind des Zaren!«, brüllte ich ihn an, als wäre das alles seine Schuld.
»Wenn die Ochrana ihn dafür hält, dann ist er jetzt einer.«
»Aber –«
Erneut ergriff er meinen Oberarm, und als ich mich losreißen wollte, gab er nicht nach. »Hör jetzt auf! Sie sind seit mindestens einer Stunde fort. Das heißt, dass es vorbei ist. Es tut mir leid, aber du weißt das so gut wie ich. Selbst wenn sie deinen Onkel noch ein wenig am Leben lassen, um ihn zu verhören, ist sein Todesurteil sicher. Und die Frauen …« Er musste den Satz nicht beenden, denn so ging es eben zu in den letzten Tagen der Zarenherrschaft. Gegner wurden ohne Gerichtsverhandlung exekutiert, ganze Familien ausgelöscht, nur auf den Verdacht hin, sie könnten mit Verschwörern im Bunde sein.
Kopfschüttelnd wollte ich abermals widersprechen, aber aus meiner Kehle kam nur Krächzen.
»Sie werden wiederkommen, um auch dich zu holen«, sagte Spiridon eindringlich. »Wer mit Büchern zu tun hat, ist doppelt verdächtig. Aber noch vor den Polizisten werden die Plünderer auftauchen, sobald sich draußen rumgesprochen hat, dass die Kalinins fort sind. Ich weiß nicht, ob du lieber ihnen oder der Ochrana in die Hände fallen willst.«
»Ich kann doch nicht so tun, als sei Ofeliya tot, ohne Gewissheit zu haben!«, widersprach ich.
»Du hast Gewissheit. Haben wir beide. Weil wir es dutzendfach über andere gehört haben, die sie abgeholt haben. Du kannst nicht einfach zur Polizei gehen und nachfragen. Aber ich versprech dir, dass ich mich umhöre.« Er zog mich mit sich, doch schon nach wenigen Schritten blieb ich stehen.
»Was ist jetzt wieder?«, fragte er scharf.
Ich konnte es ihm nicht erklären. Am liebsten wollte ich hinauf in das Zimmer laufen, in dem Mara bis vor drei Jahren gelebt hatte, um mich zu überzeugen, dass sie – nein, die Erinnerung an sie – dort in Sicherheit war. Dass keine Plünderer ihrer Präsenz im Haus etwas anhaben konnten.
Spiridon legte die Stirn in Falten. »Mara«, sagte er nur.
In einem unbedachten Augenblick hatte ich ihm erzählt, dass die Erinnerung an sie mich wie ein Gespenst verfolgte. Vielleicht in mehr als einem Augenblick. Vielleicht ein paarmal zu oft.
»Es ist nur –«, begann ich.
»Mara ist nicht mehr hier«, fiel er mir ins Wort. »Sie ist in Deutschland. Und du wirst bald bei ihr sein.«
Ich starrte ihn an. »Was?«
»Komm mit, und ich erklär’s dir. Aber nicht hier.«
Mein Widerstand fiel in sich zusammen, aber da war noch etwas, das ich auf keinen Fall hierlassen würde. »Warte.«
Wieder die Treppen hinauf, zurück in die Bibliothek. Spiridon kam hinterher, ganz sicher wütend, aber diesmal ohne Widerspruch. Von der Tür aus sah er zu, wie ich das Buch vom Stapel nahm – die russische Übersetzung des Kalevala, das finnische Nationalepos mit den Heldenliedern Kareliens. Dann lief ich an ihm vorbei in mein Zimmer und zog aus einer Schublade eine Malerpalette mit getrockneten Farben. Beides, das Buch und die Palette, steckte ich in meine alte Schultasche aus Leder.
»War’s das endlich?«, fragte Spiridon.
Ich nickte und rannte mit ihm nach unten, folgte ihm durch die Küche zur Dienstbotentür, hinaus auf die Gasse hinter dem Palais, dann durch die regennasse Kälte, fort vom Katharinenkanal und seinen makellosen Fassaden, tiefer in Spiridons Welt der kohledunstigen Hinterhöfe, knarrenden Falltüren und Kellerverstecke.
Wir hielten erst wieder an, als wir seinen Laden erreichten, gut zwanzig Minuten später. Das winzige Geschäft lag in einer Gasse hinter dem Heumarkt, eingepfercht zwischen einem jüdischen Schuster und einem Bestatter, der gerüchteweise nicht nur Leichen begrub, sondern alles, was für immer verschwinden sollte.
Spiridon verkaufte Kuriositäten und Antiquitäten, die allesamt aus der berühmten Wunderkammer Peters des Großen stammten. Jedenfalls behauptete er das mit unerschütterlicher Ernsthaftigkeit. Dass sein Laden in einer Gegend lag, in der besonders viele Zarenhasser lebten, war nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. So sehr die Menschen sich den Sturz der Romanows wünschten, so gern schwelgten sie in Erinnerungen an alte Zeiten, die sie selbst nie erlebt hatten, schmückten ihre Quartiere mit Porträts toter Herrscher und Gemälden von Palästen in Schneelandschaften. Spiridon machte passable Geschäfte mit all diesem Nepp, verdiente aber den Großteil seiner Kopeken mit Fälschungen von Dokumenten und Urkunden.
Er schloss den Laden auf und schob mich hinein. Der Februar war mild für Petersburger Verhältnisse, es gab mehr Regen als Schnee, aber erst jetzt wurde mir klar, dass meine Kleidung völlig ungeeignet war für eine Flucht. Meine Jacke taugte für einen Spaziergang durch die Stadt, aber ganz sicher nicht darüber hinaus. Der Ofen verbreitete angenehme Wärme, ein Zeichen dafür, dass Spiridon tatsächlich Hals über Kopf aufgebrochen war, nicht mal das Geschlossen-Schild an der Tür hatte er umgedreht.
»In den Keller.« Er deutete auf die schmale Treppe an der Rückwand, halb verdeckt von einem Regal mit ausgestopften Tieren, chinesischen Blumenvasen, orientalischen Schnitzereien und ein paar Gläsern, in denen Nasen, Ohren und Finger schwammen. Peter der Große hatte einen ausgefallenen Geschmack gehabt. Dabei war noch gar nicht die Rede von dem Rosenkranz aus Glasaugen. Oder dem Vogelkäfig, in dem sich nackte Tänzerinnen aus Porzellan drehten, sobald man eine Kurbel betätigte. Erst recht nicht von dem Damensattel, der Ausbuchtungen an ungewöhnlichen Stellen hatte. Alles authentisch, behauptete Spiridon, wenn man ihn auf solche Geschmacksverirrungen ansprach, obwohl ich sicher war, dass er den Großteil in Hinterhofwerkstätten des Viertels herstellen ließ, nach eigenen Entwürfen, denn das Fälschen lag ihm im Blut.
Im Lagerraum am Ende der Treppe gab es eine geheime Tür, und als er sie öffnete, kam der Durchgang zur Werkstatt zum Vorschein. Darin befanden sich ein großer Tisch mit allerlei Papierstapeln, Stempeln, Tintenfässern und Federn, außerdem fünf Schreibmaschinen. Schwierige Arbeiten erledigte Spiridon an einem Pult mit erhöhtem Hocker.
»Setz dich.« Er deutete auf einen Schemel neben dem Tisch.
»Ich bleib lieber stehen.«
Er schloss die Geheimtür hinter uns, nahm eine Flasche Wodka und ein Glas aus einer Schublade und stellte beides auf den Tisch. »Trink was.«
»Deshalb bin ich nicht hier.«
»Du hast gerade deine Familie verloren. Auch wenn du keine allzu große Liebe für Alexej Michailowitsch und Xenia Wladimirowna gehegt hast, wird dich das Ganze mitnehmen. Wenn nicht jetzt, dann schon bald. Also trink lieber.«
Ich rührte die Flasche nicht an. »Ich kann nicht glauben, dass sie Ofeliya etwas antun. Sie ist gelähmt, verdammt!« Mir zog sich die Kehle zu. Rasch rieb ich mir mit dem Handrücken über die Augen.
Spiridon füllte das Glas und drückte es mir in die Hand. »Der ist nicht schlecht. Und er hilft.«
Diesmal gab ich nach. Ich schmeckte nicht mal, was ich trank. Es hätte Wasser sein können oder Pferdepisse. Schon beim dritten Schluck wurde ich ruhiger.
»Du musst die Stadt verlassen«, sagte er noch einmal. »Und ich weiß auch, auf welchem Weg.«
»Ich kann nicht einfach weglaufen.«
»Weglaufen ist das Einzige, was du tun kannst. Andernfalls stirbst du, genau wie Ofeliya und ihre Eltern. Du bist Bibliothekar, ein Intellektueller, das macht dich verdächtig. Aber vor allem verwaltest du die Privatbibliothek deines Onkels, und wenn sie dort auch nur ein, zwei anrüchige Bücher entdecken, reicht das. Und sie werden was finden, das tun sie immer.«
Ofeliyas Gesicht tanzte zwischen blutroten Glutpunkten hinter meinen Augenlidern. Meine Cousine war einmal eine vielversprechende Ballerina gewesen, mit Auftritten auf den größten Bühnen der Stadt, bis das Rad einer Droschke ihre Beine zertrümmert hatte. Als meine Tante mich vor neun Jahren ins Haus geholt hatte – nach dem Tod meiner Mutter, ihrer Schwester –, war Ofeliya noch ein Mädchen voller Lebenslust und Ehrgeiz gewesen. Der Unfall hatte ihre Zukunft zerstört, ihre Hoffnungen und Träume. Und was davon übrig geblieben war, hatte ihr jetzt die Ochrana genommen.
Der Gedanke, dass die Geheimpolizei sie verschleppt und in einem ihrer Verhörräume erdrosselt hatte, war so erschütternd, dass ich ihn von mir wies wie einen unheilvollen Brief, dessen Annahme man verweigert, wohl wissend, dass der Inhalt einen früher oder später einholt.
»Da liegt ein Schiff im Hafen«, sagte Spiridon. »Die Saltan. Sie ist bis unters Deck voll mit Flüchtlingen, die ins Deutsche Reich und nach Frankreich gebracht werden. Wohlhabende Familien, deutschstämmige Geschäftsleute mit gewissen Verbindungen, reiches Patriziergesindel. Alle aus diesem oder jenem Grund auf der Abschussliste.«
»Dann wird man das Schiff versenken«, sagte ich überzeugt. »Es wird nicht mal die offene See erreichen.«
»Doch, wird es. Weil ein paar der Leute an Bord jeden bestochen haben, der eine Kanone bedienen kann. Und ihre Befehlshaber noch dazu. Ein paar hohe Militärs sind neuerdings Besitzer prächtiger Paläste, mit Brief und Siegel und allem Drum und Dran. Das ist der Preis, den man zahlt, wenn einem keine Wahl mehr bleibt.«
»Ich hab nichts, mit dem ich irgendwen bestechen könnte.«
»Was glaubst du, wer für die meisten von denen falsche Papiere angefertigt hat?«, fragte er.
»Und?«
»Dafür haben sie mir einen Platz auf der Saltan reserviert.«
»Gute Reise.«
»Nur dass nicht ich an Bord gehe, sondern du.«
»Red keinen Unsinn.«
Er zog eine Schublade auf und nahm einen Umschlag heraus. »Das sind die Dokumente, die ich damals für Mara und dich gemacht habe.«
Salz in eine alte Wunde, die nie ganz verheilt war. Im Winter 1913, vor über drei Jahren, hatte ich den Plan gefasst, gemeinsam mit Mara das Land zu verlassen. Ich hatte Spiridon gebeten, Papiere für uns beide zu fälschen. Aber dann hatte sich das Ganze als große Torheit erwiesen. Weder ich noch Spiridon – Gott segne ihn dafür – hatten die Papiere jemals wieder erwähnt. Bis zum heutigen Tag.
»Nimm sie«, sagte er. »Vielleicht wirst du sie gar nicht brauchen, weil man euch nicht kontrolliert. Aber falls doch, hast du sie dabei. Und wenn du nach Leipzig kommst und Mara findest, könnt ihr damit nach Amerika gehen oder sonst wohin.«
Ich wusste, dass er das nur sagte, um mich aufzumuntern. Mara würde nirgends mit mir hingehen. Die Erinnerung an sie mochte mir auf Schritt und Tritt folgen, doch die wahre Mara aus Fleisch und Blut hatte sich damals für ein besseres Leben entschieden.
»Du hast mir stundenlang von den Briefen erzählt, die sie dir geschrieben hat«, fuhr Spiridon fort. »Über Leipzig, die Stadt der Bücher, mit all den Tausenden und Abertausenden von Verlagen, Buchhandlungen und Antiquariaten. Selbst wenn du sie dort nicht findest, klingt das nach einem Ort wie für dich gemacht.«
»Wir sind im Krieg mit Deutschland«, erinnerte ich ihn.
»Deutschland ist voller Russen, die nach 1905 dorthin immigriert sind. Laut deinen Papieren« – er wedelte mit dem Umschlag – »war dein Vater Deutscher.«
»Mein Vater war ein –«
»Spielt keine Rolle«, sagte er. »Wenn du dich nicht allzu dämlich anstellst, halten sie dich vielleicht nicht für einen Spion, und dann kannst du gehen, wohin du willst. An der Front fallen auch die deutschen Männer in Scharen, also werden sie in ihrer Bücherstadt Bibliothekare brauchen. Und du sprichst ihre Sprache fließend.«
Mein Onkel hatte Ofeliya, Mara und mich auf die Petrischule geschickt, die Deutsche Schule von Petersburg. Bis zum Ausbruch des Krieges war Deutschland Russlands wichtigster Handelspartner gewesen, und noch immer war der Warenverkehr nicht gänzlich versiegt. Hinzu kamen enge Blutsverwandtschaften. Die Zarin, weite Teile des Adels und des Beamtentums waren deutscher Abstammung, unter Bildungsbürgern war die Sprache weitverbreitet. Gerade deshalb brodelte seit Jahren in den ärmeren Schichten ein Hass auf alles Deutsche. Viele glaubten selbst jetzt noch, mitten im Krieg, die Regierung sei von Deutschen unterwandert, der Zar erhalte Befehle vom Kaiser, und die teutonische Elite verdiene gut daran, das gemeine Volk auf den Schlachtfeldern zu verheizen.
»Ich hab nicht mal vernünftige Kleidung«, sagte ich.
»Wir finden irgendwas von mir. Das genügt für die Überfahrt.«
Ich musterte ihn eindringlich. »Warum tust du das?«
»Wir sind Freunde.«
»Die bringen dich um, wenn sie’s rausfinden.«
»Die bringen mich auch um, wenn sie diese Werkstatt finden.« Er grinste breit. »Aber dazu wird es nicht kommen. Die Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Wenn erst die Bolschewisten an der Macht sind, kräht kein Hahn mehr nach jemandem wie mir.«
»Seit wann bist du Bolschewist?«
»Ich bin das, was gerade nötig ist, um am Leben zu bleiben.« Er deutete mit einem Nicken auf die falschen Stempel und Vordrucke. »Ich mach das hier seit Jahren. Ich weiß, wie man Ärger loswird. Und du verstehst halt was davon, Bücher von einem Platz zum anderen zu tragen. Dafür muss man sich nicht schämen.«
»Vielen Dank.«
Spiridon lächelte. »Überhaupt trifft sich das ganz gut, weil du mir dann gleich einen Gefallen tun kannst.«
»Was für einen Gefallen?«
Er drückte mir den Umschlag mit den Dokumenten in die Hand, griff noch einmal in die Schublade und zog eine flache Pappschachtel hervor. Sie war mit einer Kordel umschnürt und mit einem roten Siegel gesichert.
»Nimm das hier mit«, sagte er.
»Was ist da drin?«
»Ein Buch. Jedenfalls soll mal eins draus werden.«
Ich nahm die Schachtel entgegen und schüttelte sie behutsam. Ein Papierstapel rutschte darin hin und her, kaum kleiner als die Verpackung. »Deine Memoiren?«
»Bring das nach Leipzig«, erwiderte er. »Dort wird man es veröffentlichen, hier bei uns ist es zu gefährlich.«
Argwöhnisch klopfte ich auf den Deckel. »Ist das so ein Pamphlet wie das, das sie meinem Onkel untergeschoben haben?«
»So was in der Art, ja.«
»Und ich soll das über die Grenze bringen?«
»Übers Meer. Das ist ein Unterschied. Und in Deutschland wird es niemanden kümmern.«
»Wer hat das geschrieben?«
»Leute, die bald sehr einflussreich sein werden.«
»Revolutionäre.«
»Wenn du so willst.« Er nickte. »In Leipzig ist es sicher, es wird dort gesetzt und gedruckt. Du gibst es einem Mann namens Iwan Iwanowitsch Petrow. Das ist alles. Danach hörst du nie wieder davon.«
Obwohl sich in meinem Kopf alles drehte und mich das volle Bewusstsein meines Verlusts jeden Augenblick einholen musste, war ich doch klar genug, um zu wittern, dass diese ganze Sache zum Himmel stank. »Wer genau zahlt für diese Überfahrt? Und warum bringst du das hier nicht selbst nach Deutschland?«
Spiridons Miene war ernst, zeigte aber keine Spur von Hinterlist. »Vielleicht hätte ich das sogar, wenn du nicht viel dringender von hier verschwinden müsstest als ich. Diese Schachtel wird dir das Leben retten. Und mir übrigens auch, wenn alles nach Plan läuft, das Buch gedruckt wird und diese Leute an die Macht kommen.«
»Das ist Bockmist, Spiridon! Es gibt hundert Wege, so ein Manuskript aus dem Land zu schmuggeln.«
»Sollen sie es vielleicht mit der Post schicken? Es ist Krieg, das hast du ja ganz richtig festgestellt. Und du hast gerade erlebt, was passiert, wenn sie so was an der Grenze abfangen. Die verfolgen es zurück, die Ochrana taucht auf, und dann geht es nicht nur mir an den Kragen, sondern auch Leuten, die wirklich was verändern könnten.«
Ich schüttelte die Schachtel heftiger. »Was genau steht da drin?«
»Ich hab’s nicht gelesen.«
»Nicht mal den Titel?«
»Die Pläne der Ewigen. Genügt das?« Er deutete auf eine Uhr, die an der Werkstattwand tickte. »Die Zeit drängt. Das Schiff legt bald ab.«
Ich traf eine Entscheidung. »Das Schiff fährt ohne mich.«
Seine Augen blitzten wutentbrannt auf. »Hast du den Verstand verloren?«
»Ich muss Gewissheit haben, dass Ofeliya nicht mehr lebt.« Ich knallte die Schachtel so fest auf den Tisch, dass die Stempel in ihrem Halter klapperten. »Vorher kann ich hier nicht weg. Und falls sie noch lebt, muss ich sie irgendwie da rausholen.«
»Sie ist tot, Artur!«
»Das werde ich dann rausfinden.« Ich wandte mich zum Gehen, die Ledertasche mit meinen letzten Besitztümern fest unter die Achsel geklemmt. Das Kalevala. Und die Farbpalette, die Mara mir damals zum Abschied geschenkt hatte.
»Wer bedeutet dir mehr?«, fragte Spiridon, als ich an ihm vorbeitrat. »Mara oder Ofeliya? Wen von beiden möchtest du wiedersehen?«
Ich wirbelte zornig herum. »Meinst du das ernst?«
Ein scharfer Geruch erinnerte mich an den Farblöser, den Mara beim Malen ihrer rätselhaften Selbstporträts benutzt hatte. Vielleicht war eines der Gefäße umgefallen, als ich die Schachtel auf den Tisch geschlagen hatte. Spiridon benutzte alle möglichen Chemikalien, um seinen Dokumenten künstliche Patina zu verleihen.
»Ofeliya lebt nicht mehr«, sagte er in einem Tonfall, der so gnadenlos war wie die Häscher der Ochrana. »Mara dagegen ist wohlauf, und sie ist in Leipzig. Du bist ein Dummkopf, wenn du das nicht begreifst.«
Ich wollte etwas erwidern, erfüllt von Stolz und empörter Selbstgerechtigkeit, doch dann drehte ich mich nur mit einem Kopfschütteln um und ging zur Tür. Sicher meinte er es gut. Aber ich war verwirrt, und ich trauerte, und beides führte zu einem Gemütszustand, dem mit Vernunft nicht beizukommen war.
Als ich die Hand nach dem Türgriff ausstreckte, packte Spiridon mich von hinten. »Tut mir leid«, sagte er leise.
Ich schrie wütend auf, als er mir ein Tuch aufs Gesicht presste. Scharfer Gestank stieg mir in die Nase. Röchelnd versuchte ich, mit der Tasche nach ihm zu schlagen, doch da legte sich schon ein Schleier über meine Sinne, flirrend von Farben und nicht einmal unangenehm, weil er mich an Maras Palette erinnerte.
Ich spürte noch, wie meine Knie nachgaben, während Spiridon mich festhielt, und ich dachte, wie zuvorkommend das von ihm war, weil er doch alle Hände voll zu tun hatte. Ein Kribbeln schoss meinen Hals empor, und als es meine Kehle erreichte, versanken die Farbpunkte in Schwärze wie Kieselsteine in einem dunklen Teich, und ich selbst stürzte hinterher, verlor sie aus den Augen und war bald ganz von Finsternis umgeben.
2
Das Erwachen war viel schlimmer als mein Taumel in die Bewusstlosigkeit. Man hat davon gelesen und glaubt es zu kennen: Die Dunkelheit teilt sich wie Vorhänge, man steigt gemächlich empor, nimmt wie im Halbschlaf dieses und jenes wahr, reibt sich die Augen und ist wieder bei Sinnen.
Alles Unfug.
In Wahrheit gibt es keine Vorhänge, man entschwebt auch keinem wohligen Schlummer. Die Wirklichkeit bricht mit brutaler Gewalt über einen herein, und in meinem Fall war es eine, die ich niemandem wünsche. Abgesehen von Spiridon. Ihm sogar sehr.
Da waren Stimmen von Erwachsenen und klägliches Kindergeschrei, ein seltsames Halblicht voller Umrisse und verschwommener Gesichter, ein Geruch wie in einer Hundehütte, dazu ein tiefes, rhythmisches Wummern, das mich mehr beunruhigte als das Durcheinander ringsum. Denn auf wundersame Weise wusste ich trotz aller Benommenheit, was das Geräusch bedeutete.
Als Nächstes nahm ich wahr, dass jemand an mir zerrte. Nein, nicht an mir – an meiner Jacke. Irgendwer versuchte, sie mir auszuziehen. Dabei war es nicht mal meine Jacke. Die hier hatte ein dickes Futter aus Fell, was vermutlich der Grund war, warum der andere es darauf abgesehen hatte.
Ich brachte ein protestierendes Keuchen zustande, stieß die Hände flach gegen einen Menschen und sah jemanden zurückstolpern und davonhuschen. Schwankend richtete ich den Oberkörper auf. Das war keine gute Idee, denn etwas schien von innen gegen meine Stirn zu stoßen, eine Kugel, die durch meinen Schädel rollte wie durch einen Roulettekessel.
Ein niedriger Raum voller Menschen. Männer und Frauen saßen auf dem Boden, meist in kleinen Gruppen, dazu viele Kinder jeden Alters. Es gab zwei runde Spiegel, die sich bei näherem Hinsehen als nachtschwarze Bullaugen entpuppten, und ein paar Kojen, auf denen sich sitzende Menschen aneinanderdrängten. Schlafen würde darauf wohl keiner, ganz sicher nicht im Liegen.
Falls – außer dem Jackendieb – jemand Notiz davon nahm, dass ich aufgewacht war, so verbargen sie alle es hinter Mienen, in denen sich Trauer und Fassungslosigkeit die Waage hielten. Manche weinten, andere starrten schicksalsergeben ins Leere. Die meisten waren gut gekleidet, als hätten sie sich auf diese Reise gründlich vorbereitet. Auch ich war mit dem Nötigsten versorgt worden. Meine Sachen rochen nach Spiridons Laden, nach staubigen Schränken und Siegelwachs. Am liebsten hätte ich sie mir vom Leib gerissen, aus Wut über das, was er mir angetan hatte.
Wahrscheinlich hatte er mir das Leben gerettet, aber ich war noch nicht bereit, das zu akzeptieren. Zumal dieses Schiff kein sicherer Ort war. Wenn alle Kabinen aussahen wie diese hier, dann war der Kahn hoffnungslos überladen, und wir steuerten hinaus auf eine Ostsee, in deren Tiefen ein gnadenloser U-Boot-Krieg tobte. Selbst ich, der ich mein Lebtag keinen Fuß auf ein Deck gesetzt hatte, wusste, dass die Unterseeflotte der Deutschen keinen Unterschied machte zwischen zivilen Dampfern und Marinekreuzern.
Ich tastete umher und fand einen Lederkoffer, an dem mein Kopf gelehnt hatte. Auch deshalb tat mein Nacken so weh. Mühsam zog ich ihn hinter mir hervor, öffnete die beiden Schnallen und klappte vorsichtig den Deckel nach oben, nur ein kleines Stück, damit keiner der anderen hineinsehen konnte. In Anbetracht der Enge war das zum Scheitern verurteilt, aber ich erwartete auch nicht, dass im Koffer Goldschmuck und Geldbündel lagen – oder irgendetwas, das jemanden hier hätte interessieren können. Andererseits hatte man meine Jacke stehlen wollen. Die Regeln von Anstand und Zivilisation waren in unserer Heimat zurückgeblieben.
Unter dem Deckel lagen ein brauner Wollpullover und eine Wechselhose, die mir mit Sicherheit zu groß war. Dazu ein Stoffbeutel, in dem ein Stück Seife, eine Schachtel Zahnpulver und eine hölzerne Zahnbürste steckten; hoffentlich kein gebrauchtes Stück aus Spiridons Laden. Darunter lag die versiegelte Pappschachtel mit dem Manuskript, hinter der Kordel klemmte ein gefaltetes Papier. Als ich die Schachtel ein wenig anhob, entdeckte ich am Grund des Koffers mein Exemplar des Kalevala und Maras bunte Farbpalette.
Mit einem Aufatmen zog ich den Zettel hervor und las, was Spiridon in seiner schönen Fälscherhandschrift geschrieben hatte.
Ich wünsche dir eine gute Reise, stand da, als wäre ich zu einer Wochenendfahrt auf einem Wolgadampfer aufgebrochen. Die wichtigsten Dinge hast du bestimmt schon im Koffer gefunden. Unter dem Stoff im Deckel ist ein Armeemesser befestigt, das du hoffentlich nicht brauchen wirst. Bring die Schachtel ungeöffnet zu Iwan Iwanowitsch Petrow nach Leipzig. Ich hoffe, dass du findest, was du suchst. Dein Freund (der wirklich dein Freund ist, auch wenn du daran gerade zweifelst) S.
Das Messer war da, die Scheide mit ein paar Tropfen Leim am Deckel befestigt. Ich überlegte, es unter meine Jacke zu stecken, aber das hätten alle mitangesehen, und ich wollte kein Misstrauen wecken. Ohnehin schien hier jeder jeden zu belauern, und das nicht ohne Grund. Wir alle waren mit dem Wissen aufgewachsen, dass Augen und Ohren der Geheimpolizei allgegenwärtig waren. Man musste nicht krankhaft misstrauisch sein, um sie auch hier zu vermuten. Jeder war ein potenzieller Spion.
Ich klappte den Kofferdeckel zu, schloss die Schnallen und kämpfte mich unsicher auf die Beine. Das Schiff und ich, wir schwankten beide, aber ich packte den Koffer und ging mit Schlagseite zur offenen Kabinentür, zwischen den Menschen am Boden hindurch, die alle zu mir aufblickten, als täte ich etwas ganz und gar Unbegreifliches.
»Frische Luft«, murmelte ich im Ton einer Entschuldigung, als ich einer Frau mit Kleinkind auswich, und sofort sagte jemand: »Verboten.« Ich muss ziemlich begriffsstutzig dreingeschaut haben, denn der Mann fügte hinzu: »Keiner von uns darf an Deck.«
Ich nickte ihm zu, als hätte ich verstanden, trat aber trotzdem hinaus auf den Gang und sah rechts und links weitere Türen, die meisten offen. Auch hier draußen hielten sich Menschen auf, einige tuschelten, andere lehnten stumm an den Wänden und starrten mich an.
Ich fand eine Treppe, die aufwärts führte. Niemand hielt mich auf, als ich die Eisenstufen emporstieg, in einer fremden Felljacke und mit einem Koffer, der nicht mir gehörte. Auf einer Reise, die nicht meine war. Die Nachwirkungen des Betäubungsmittels waren noch nicht völlig verflogen, und so kam mir die Treppe viel länger vor, als sie tatsächlich war, so als stiege ich vom Grund des Meeres auf, durch einen Turm aus gestapelten Schiffswracks, der von dort unten bis zur Oberfläche reichte. Es roch nach Maschinenöl und den Körpern vieler Menschen, obwohl jetzt keine mehr um mich waren. Ich war allein auf der Treppe, und für einen Augenblick dachte ich wirklich, sie nähme kein Ende, bis ich an eine Metalltür kam. Als ich benommen zurückblickte, waren da nicht mehr als fünfzehn Stufen.
Ich rechnete damit, dass der Ausgang verschlossen war, um das Menschenvieh in seinen Pferchen zu halten, doch die Klinke klemmte nur für einen Moment. Eiskalte Seeluft drang mir entgegen. Draußen herrschte Düsternis, vereinzelte Lampen glühten milchig in einem dichten Nebel, der sogar das Stampfen der Motoren und das Meeresrauschen dämpfte. Alle Lichter waren kurz über dem Boden hinter der geschlossenen Reling angebracht.
Ich drückte die Tür hinter mir zu, atmete tief durch und blickte mich um. Das Deck entlang der Reling war verlassen. Zwischen klobigen Aufbauten befanden sich Schneisen, zu dunkel, um darin Einzelheiten zu erkennen. Abgesehen von den kleinen Lampen, die kaum zur Orientierung genügten, gab es keine Beleuchtung. Die Saltan wollte nicht schon aus der Ferne von feindlichen Schiffen erspäht werden. Unvermittelt stellte ich mir vor, wie der Nebel aufriss und der Bug eines deutschen Schlachtschiffes auf uns zukam, doppelt so hoch wie der Dampfer, und fortan wurde ich das Bild nicht mehr los.
Ich trat an die Reling, stellte den Koffer ab und legte beide Hände auf das eisige Geländer. Handschuhe besaß ich nicht, aber die schmerzhafte Kälte tat mir gut, vertrieb meine Müdigkeit und half, ein paar klare Gedanken zu fassen. Damit kehrte die Trauer um Ofeliya zurück, auch um meinen Onkel und meine Tante, obgleich ich nie große Zuneigung für die beiden verspürt hatte. Auf seine Weise hatte Alexej es gut mit mir gemeint. Xenia hingegen hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie eine Last in mir sah, die sie nur aus verwandtschaftlicher Verantwortung erduldete.
Ich nahm die Hände von der Reling und hob den Koffer auf. Langsam ging ich ein paar Schritte, näherte mich einer der dunklen Schneisen zwischen den Aufbauten und hörte von dort plötzlich Laute, ein leises Stöhnen und Stoßen, das Klatschen von Fleisch auf Fleisch.
»Nicht da lang«, raunte eine Männerstimme links von mir im Nebel. »Da treiben es zwei im Stehen. Weiter hinten ist noch ein Paar. Unten sind zu viele Menschen, und sie kennen das Schiff noch nicht gut genug, um die warmen Verstecke zu finden.«
Ich versuchte, zu erkennen, wer da gesprochen hatte, aber ich sah nur einen breitschultrigen Umriss, geisterhaft im wabernden Dunst.
»Sie tun es aus Verzweiflung«, sagte der Mann, »nicht aus Leidenschaft.« Dann trat er zurück in die Nebelschwaden und wurde wieder eins mit ihnen.
Ein wenig konsterniert drehte ich mich um und ging in die andere Richtung, fort von den beiden in der Schneise und hoffentlich nicht geradewegs zu den anderen, von denen der Mann gesprochen hatte. Ich war sicher, dass alle an Bord mit Ängsten zu kämpfen hatten, und jeder bewältigte sie auf seine Weise. Trotzdem war ich heilfroh, allein zu sein und nur Verantwortung für mich selbst zu tragen.
Weiter vorn erkannte ich vage eine weitere Gestalt im Nebel, nicht dieselbe wie gerade eben. Eine Silhouette mit Hut und langem Mantel stand an der Reling und blickte hinaus in die Nacht. Eine Zigarette glühte in der Finsternis. Nach mehreren Zügen wurde sie in weitem Bogen hinaus ins Nichts geschleudert. Die Gestalt blieb noch einen Augenblick stehen, dann fuhr sie mit einem Ruck herum und trat zurück ins Schiff.
Mir wurde erst jetzt bewusst, dass ich beim Anblick der Silhouette stehen geblieben war. Da war ein Gefühl von Gefahr gewesen, das von dem Unbekannten ausging. Mir war, als hätte sich der Dunst in mein Inneres vorgetastet, während ich die schwarze Gestalt im Nebel beobachtet hatte. Nun hielt er mein Herz gepackt und ließ nicht mehr los.
»Rauchen verboten«, sagte hinter mir die Männerstimme von vorhin. »Die Deutschen halten Ausschau nach Lichtern. Du willst nicht, dass uns der gute Kaiser Wilhelm wegen einer Zigarette versenkt.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Ich rauche nicht. Ich will nur nicht länger da unten zwischen all den Menschen sein.«
»Irgendwann wirst du wieder runtergehen müssen. Hier draußen frierst du dir die Eier ab.« Er war nicht groß, hatte aber Schultern wie ein Ochse. Sein Haar wucherte wild unter der Matrosenmütze hervor. Wahrscheinlich war er nicht viel älter als ich, höchstens Mitte zwanzig, auch wenn seine grobschlächtigen Züge die Schätzung erschwerten.
»Was ist mit den U-Booten?«, fragte ich. »Sind die nicht viel gefährlicher als die Schiffe?«
Er nickte. »Die sind wie Haifische. Alle denken, dass sie die Maschinen hören, aber ich glaube, sie wittern unsere Angst. Die lockt sie an.«
»Dann wird das hier nicht gut gehen. Weil ich nämlich eine Scheißangst vor ihnen habe.«
Ein Grinsen teilte sein Gesicht, berührte fast die starken Wangenknochen. »Die hab ich auch.«
»Bist du Matrose?«
»Wer weiß. Vielleicht auch nur ein blinder Passagier, der eine Matrosenmütze gestohlen hat. Wie heißt du?«
»Artur«, sagte ich.
»Nur Artur?«
»Genügt das nicht?«
»Von mir aus kannst du dich schöne Wassilissa nennen.« Er hob die Hände, und für eine Sekunde dachte ich, er wollte mich packen. Aber dann schien es sich doch nur um eine Art expressives Schulterzucken zu handeln, was an der enormen Länge seiner Arme liegen mochte; sie reichten fast bis zum Deck, was seinen Bewegungen etwas Linkisches, Unbeholfenes verlieh. Mit seinen Pranken hätte er mich ohne Mühe über die Reling werfen können.
»Was ist in dem Koffer?«
»Alles, was ich noch hab.«
»Dann hoffe ich mal, es sind Diamanten und Saphire, weil er nicht besonders schwer aussieht. Alle anderen, die an Bord gekommen sind, haben ihren halben Hausrat zur Mole geschleppt. Der Kapitän hat Befehl gegeben, fast alles am Hafen zurückzulassen. Und diejenigen, die protestiert haben, mussten dableiben. Gab ja noch genug andere, die mitwollten.«
»Also will er Menschenleben retten, nicht Reisekisten«, sagte ich. »Klingt vernünftig.«
Sein Blick hing noch immer an meinem Koffer. »Du bist ein armer Schlucker.«
»So sieht’s aus. Viel Erfolg also, falls du mich ausrauben willst.«
Der seltsame Matrose lachte leise, dann schaute er sich um, so als fürchtete er, irgendwer könnte uns beobachten. Innerlich war ich noch immer gegen einen Angriff gewappnet und fragte mich, ob ich ihm zuvorkommen sollte. Aber das würde ein schreiend ungerechter Kampf werden.
»Ich wette, da sind Bücher drin«, sagte er.
»Nur eines.«
»Wie heißt es?«
»Kalevala«, antwortete ich. »Das ist –«
»Das Nationalepos der Finnen«, fiel er mir ins Wort. »Uralte Heldenlieder aus Karelien. Ein Arzt namens Elias Lönnrot ist durch die karelischen Dörfer gezogen und hat sie sich von den Alten vorsingen lassen. Später hat er sie nachgedichtet, in seinen eigenen Versen. Man könnte also darüber streiten, wie authentisch sie sind und ob sie wirklich als Nationaldichtung taugen.«
Ich hatte angenommen, dass er bestenfalls Trinklieder aus Hafenkaschemmen kannte, und war beeindruckt. »Ich schätze mal, das bestimmen nicht wir, sondern die Finnen.«
»Besser so. Und nett zu lesen sind sie ja.«
»Nett?«
Wieder stieß er dieses raue Lachen aus. »Sei nicht gleich eingeschnappt, mein Freund. Wenn’s dein Lieblingsbuch ist, will ich’s nicht schlechtmachen.« Er schien einen Augenblick nachzudenken, dann sagte er: »Und falls du dich aufwärmen willst, hätte ich ein Versteck anzubieten.«
»Willst du mir da die Kehle durchschneiden?«
»Nicht, solange du keine finnischen Heldenlieder singst.«
»Mach ich nicht.«
»Ich hab auch Wodka da, gegen die Kälte.«
»Übertreib’s mal nicht mit der Gastfreundschaft.«
»Ist ja nicht meiner. Ich hab ihn dem letzten Trottel gestohlen, der dumm genug war, mir in meine Mörderhöhle zu folgen.«
Widerwillig musste ich grinsen. Zumindest erschien mir seine Mörderhöhle um einiges einladender als die überfüllte Kabine, in der ich mich um einen Platz am Boden streiten musste.
»Eben wollte einer meine Jacke klauen«, sagte ich.
»Die passt mir nicht.« Er schlenkerte mit den langen Armen und klopfte sich selbst auf die Schultern. »Hab aber überlegt, ob ich sie mir zum Schlafen um die Füße wickeln könnte.«
»Wenn du schwörst, deine stinkenden Füße von meiner Jacke fernzuhalten, geh ich mit.«
Er wiegte den Kopf von einer Seite zur anderen, als müsste er nachdenken. Dann schienen seine kleinen Augen im Halbdunkel aufzuglühen. »Also los.«
Ich rührte mich nicht von der Stelle. »Das war kein Schwur.«
»Herrjemine.« Wieder fuchtelte er unbeholfen mit seinen Pranken in der Luft. »Ich schwör’s beim Leben von Jack London. Ist mein Lieblingsautor.«
Ich zog den Koffer ein weniger enger an mich. »Der hat sich im letzten Jahr umgebracht.«
Ihm fiel die Kinnlade runter. »Damit macht man keine Scherze.«
»War auch keiner. Ich geb dir Brief und Siegel darauf, dass er tot ist.«
»Das hab ich nicht gewusst.« Er wirkte ehrlich betroffen, und nun tat er mir fast leid. Die Tatsache, dass er während der Flucht aus dem zaristischen Russland einem Fremden gegenüber einen Autor pries, der überzeugter Sozialist gewesen war, hatte etwas Herzerwärmendes.
»Die Grundlage des Sozialismus ist der Staub der Straße«, zitierte ich einen Satz von London.
»Der Staub der alltäglichen Straße«, verbesserte er mich. »So viel Zeit muss sein.«
Da blieb mir nichts übrig, als nachzugeben. »Du bist ein Bolschewist, der Abenteuerbücher mag. Ich schätze, damit kann ich leben.«
Ein Lächeln ließ sein Gesicht im Nebel aufleuchten. »Dann komm, Artur-mit-dem-Kalevala.« Er deutete auf eine schmale Eisentür mit der Aufschrift Kein Zutritt. »Du musst mir alles erzählen, was du über den Tod des alten Jack weißt. Zeit genug werden wir ja haben.«
Ich folgte ihm ins Schiff, auf eine Treppe, die so schmal war, dass er den Oberkörper leicht drehen musste, um nicht zwischen den rostfleckigen Wänden stecken zu bleiben. »Wie heißt du überhaupt?«, fragte ich auf halbem Weg nach unten.
»Grigori«, sagte er. »Zukünftiger Goldsucher, Schatzgräber, Musketier und Walfänger. Grigori Gomorov, zu deinen Diensten.«
3
1928
Was Liette auf dem Dachboden fand, veränderte alles.
Sie war elf und hatte noch keine Erfahrung mit Momenten, die wie ein Fallbeil auf ein Leben herabkrachen und es entzweischneiden: in die Jahre vor diesem Augenblick und jene danach. Manchmal geschieht der Schnitt auch verstohlen und kaum merklich. Dann schleicht sich das Schicksal wie ein Halsabschneider heran und führt seine Klinge mit der Präzision eines Chirurgenskalpells. Das sind die Einschnitte, die auf den ersten Blick nichts beenden, aber immer etwas Neues beginnen lassen. Wenn wir nach vielen Jahren über die Narbe streichen, spüren wir keinen Schmerz, aber noch immer tiefe Verwunderung darüber, wie es jemals dazu kommen konnte.
Der Augenblick, der Liettes Leben eine andere Richtung gab, kam im Mai des Jahres 1928, in einem menschenleeren Hotel an der Côte d’Azur, auf einem spinnwebenverhangenen Dachboden mit unergründlichen Schatten und den Grabstätten vergessener Gegenstände.
Sie war die Haupttreppe in Rot und Gold hinaufgestiegen, die das Château Trois Grâces wie eine Schlagader durchzog, hatte durch eine der verborgenen Tapetentüren das Labyrinth der Personalgänge betreten und die schmucklosen Steinstufen zum Speicher genommen. Er hatte mehrere Zugänge, einen gar an der Außenseite, durch den mit einem Seilzug Möbelstücke heraufgehievt werden konnten. Derjenige jedoch, den sie benutzt hatte, war schmal und besaß eine Aura der Heimlichkeit, wie gemacht für ein Mädchen auf der Suche nach Beschäftigung, nach Ablenkung von seiner Einsamkeit.
Liettes blaues Kleid war mit Spinnweben überzogen wie ein Baum im Altweibersommer, gepudert vom Staub vergangener Jahrzehnte. Bevor sie die alten Reisekisten mit den unverständlichen Beschriftungen entdeckte, umrundete sie Türme aus gestapelten Stühlen, trotzte dem bösen Blick blasser Ahnenporträts und schlug graue Laken beiseite, um eine Abkürzung unter den Tischen hindurch zu nehmen. Dahinter stellte sie fest, dass es eine Art Pfad von der anderen Seite des Speichers gab, dem sie hätte hierher folgen können; aber das wäre kein Abenteuer gewesen, nicht mal eine Expedition, nur ein Weg, der jedem offen stand.
Schließlich schälte sich eine Pyramide aus dem Staubdunst, ein Berg aus Kisten und Koffern. Liette würde die echten Pyramiden nie zu sehen bekommen, denn ihre Haut vertrug keine Sonne. Da kam ihr das Gebilde auf dem Speicher gerade recht, ein Monument aus Quadern und Rechtecken, das sie erklimmen konnte wie Ägyptologen die alten Pharaonengräber.
Viele der Reisekisten waren bunt beklebt mit den Zeichen zahlreicher Grenzüberquerungen. Die Oberflächen waren angeschlagen und verkratzt vom dutzendfachen Verladen und Stapeln in Zugwaggons und den Laderäumen großer Schiffe. Liette stellte sich vor, dass sie alle schon mit dem Orient-Express und der Bagdadbahn gereist waren, mit majestätischen Luftschiffen und knatternden Propellermaschinen. Jede dieser Kisten mochte den Angriffen von Zulukriegern und Krimtataren getrotzt haben, war mit Säbeln verteidigt und von Banditen geplündert worden. Dann waren sie hier verstaut und vergessen worden, und nun lag es an ihr, Liette Chevalier, jüngste Archäologin, Doktorin, ach was, Professorin der Société française d’archéologie, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften.
Sie schob die Ärmel nach oben, klopfte die Bewohner des Speichers von ihrem Kleid und wappnete sich für die Ersteigung.
Liette wohnte seit vier Wochen im Château Trois Grâces, und es waren sechs weitere geplant, ehe sie zu ihren Eltern nach Paris zurückkehren würde. Das Hotel gehörte zur Hälfte ihnen, aber geführt wurde es von Liettes Onkel Gabriel Chevalier, den ihr Vater einmal einen »verdammten Versager« geschimpft hatte, als er geglaubt hatte, Liette höre nicht zu. Die Chevaliers führten mehrere große Buchhandlungen in der Hauptstadt und ein paar kleinere im Norden, und wäre es nach ihnen gegangen, wäre das Hotel längst verkauft worden. Ein wohltätiger Vorfahr hatte es als Refugium für hungerleidende Schriftsteller errichtet, war mit seinen drei Geliebten eingezogen – denen das Trois Grâces seinen Namen verdankte – und innerhalb weniger Jahre pleitegegangen. Sein Sohn hatte ein Hotel daraus gemacht und es zusammen mit seinen Buchhandlungen an Liettes Vater und dessen Bruder vererbt.
Gabriel sperrte sich gegen einen Verkauf, obgleich das Haus seit Jahren rote Zahlen schrieb. Er sei Hotelier aus Leidenschaft, beteuerte er gern, und tatsächlich sah er mit seinen feinen schwarzen Anzügen und dem federstrichdünnen Oberlippenbart auch aus wie einer. Doch selbst Liette wusste, dass ihr Onkel zu viel Zeit in den Casinos der Côte d’Azur verbrachte, in Cannes und Nizza und Monaco. In der Hauptsaison war das Hotel gut besucht, von September bis April wimmelte es hier von Reichen und Schönen – und von abgebrannten Künstlern, die sich mit Aplomb und großen Gesten von der besseren Gesellschaft aushalten ließen.
Liette war nur zweimal während der Saison hier gewesen, ansonsten in den ruhigen Monaten zwischen April und August, wenn in den meisten Hotels an der französischen Riviera der Betrieb ruhte. Im Sommer galt die Küste als zu heiß, dann zogen die wohlhabenden Nichtstuer an die Promenaden der Normandie, während hier unten Stille einkehrte, die Steinstrände verödeten und auf den Bergstraßen wieder das Blöken der Ziegen das Knattern der Automobile ablöste.
Dass Liette das Frühjahr hier verbrachte, hatte mit ihrer Krankheit zu tun – salzige Seeluft tue ihr gut, hieß es – und mit den Streitereien ihrer Eltern, die eine Weile für sich sein wollten, um ihr Leben zu sortieren. Liette hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie mochte den Süden, auch wenn sie manchmal Mühe hatte, die Menschen zu verstehen. Sie sprachen hier rauer und langsamer als in Paris, fast schwerfällig, und sie rollten das R auf eine Weise, als kämen sie selbst aus fernen Ländern.
Doch solche Fremdheit verblasste angesichts der Exotik von Liettes Dachbodenfund. Vor allem die mysteriösen Beschriftungen auf den Reisekisten ließen ihr keine Ruhe, waren sie doch in Buchstaben verfasst, die sie nicht lesen konnte. Immerhin wusste sie, dass es sich um russische Schrift handelte, denn die sah man noch immer überall an der Küste, an verlassenen Geschäften, auf alten Speisekarten, sogar auf manchen Wegweisern, die zu Hotels und einsamen Buchten führten. Bis zum Großen Krieg waren viele reiche Russen nach Südfrankreich gekommen, um im warmen Mittelmeerklima zu überwintern; viele hatten sogar ihre Dienerschaft mitgebracht. Heute jedoch gab es hier nur noch wenige von ihnen, und sie kamen nicht mehr als Gäste mit tiefen Taschen, sondern verdingten sich als Kellner und Gärtner und Zimmermädchen.
Wie es aussah, war der Kofferberg rund um einen Turm aus Kisten aufgehäuft worden, was ihm die spitze Form verlieh. Liette zog die Schuhe aus und begann ihren Aufstieg. Die Kisten im Kern des Berges erschienen ihr stabiler als die nachgiebigen Lederkoffer rundherum, aber sie vertraute darauf, dass sie selbst leicht genug war und am Ende alles gut gehen würde.
Doch bald gab der erste Koffer nach, ein zweiter platzte unter ihrem Knie auf, und im nächsten Augenblick purzelte sie inmitten von Wäsche und Staub zurück zum Boden. Dort knallte sie auf die Schulterblätter und stieß sich den Hinterkopf. Wütend schrie sie auf, fühlte sich in ihrer Bergsteigerehre gekränkt und rappelte sich gleich wieder auf. Mit finsterer Miene betrachtete sie den Schlamassel.
Mehrere Koffer hatten sich geöffnet, manche der morschen Lederbänder waren gerissen. Allerlei Kleidungsstücke waren herausgefallen, einige noch gefaltet. Darunter waren teure Stoffe, viele in dunklen Farben, von Gold- und Silberfäden durchwirkt. Andere waren weiß wie Gletschereis, das nun in pistengleichen Bahnen die Schräge herabfloss.
Liette überlegte, kurzerhand alles zurückzustopfen, auch wenn es schwerfallen würde, jedes Wäschestück dem richtigen Koffer zuzuordnen. Das stachelte ihre Neugier erst recht an, weil es jetzt keine Entschuldigung mehr gab, nicht in jede Kiste und jeden Koffer zu sehen. Vielleicht konnte sie auch das eine oder andere anprobieren. Vor allem mit ein paar Hüten liebäugelte sie, die aus einer umgestürzten Kiste gefallen waren. Sie waren groß genug, um ihr blasses Gesicht vor der Sonne zu schützen.
Gerade wollte sie sich ans Aufräumen machen, als ein Knirschen erklang. Ein Koffer gab unter der neu verteilten Last nach, dann brachen weitere Teile der Pyramide zusammen. Der Kistenturm im Zentrum geriet ins Schwanken, fiel polternd zur Seite und sorgte endgültig für heilloses Durcheinander. Liette sprang zurück, um nicht unter Gepäckstücken begraben zu werden. Kurz erwog sie, sich aus dem Staub zu machen und so zu tun, als wäre sie nie hier gewesen.
Doch als der Dunst sich setzte, entdeckte sie, was hinter der Pyramide zum Vorschein gekommen war. Dort standen drei, vier weitere Reisekisten und davor, wie der Thron eines vorzeitlichen Königs, ein Rollstuhl.
Er sah zierlich aus, fast kindlich, und Liette dachte, dass es lustig sein musste, durch die verlassenen Flure des Hotels zu fahren und auszuprobieren, wie schnell sie damit um die Ecken biegen konnte. Das Sticheln ihres schlechten Gewissens ignorierte sie, als sie kurzerhand über die Trümmerlandschaft bis zu dem Rollstuhl kletterte. Durch ein Dachfenster fiel ein Lichtstrahl und beschien einen eingenähten Schriftzug auf der Rückenlehne.
Офелия
Sie wusste nicht, was das bedeutete, ob es sich um den Hersteller oder den Besitzer handelte, doch etwas an den fremdartigen Zeichen faszinierte sie. Sie strich mit der Fingerspitze darüber, versuchte, das Wort laut vorzulesen, scheiterte aber schon am zweiten Buchstaben. War das ein D? Ein P? Oder keines von beidem?
Sie versuchte, den Rollstuhl anzuheben, und war überrascht, dass er nicht allzu schwer war. Unter Ächzen und Stöhnen zog sie ihn über das Schlachtfeld aus Koffern und Wäsche, bis er schließlich auf dem schmalen Weg stand, der sich durch die Dachbodenlandschaft zum Ausgang schlängelte.
Ein paar Minuten später bugsierte sie den Stuhl eine Treppe hinunter ins Obergeschoss des Haupttraktes, schob ihn in die Mitte des langen Korridors und ließ sich mit einem erschöpften Seufzen hineinfallen. Die lederne Sitzfläche knirschte und war eher unbequem. Vorsichtig legte sie die Hände um die Speichenräder und schob sich nach vorn.
Es machte weit weniger Spaß, als sie gehofft hatte, und als sie das Ende des ersten Korridors erreichte, begannen ihre Arme wehzutun. Trotzdem manövrierte sie unbeholfen um die Ecke und machte sich bereit für den nächsten langen Gang zwischen den hohen, weißen Zimmertüren.
Vom anderen Ende des Korridors kam ihr mit weiten Schritten ihr Onkel entgegen. Selbst auf diese Entfernung sah sie, dass er missbilligend die Stirn runzelte.
»Wo hast du denn das Ding her?«
»Vom Dachboden.« Kurz überlegte sie, aufzustehen, blieb dann aber sitzen und rollte weiter auf ihn zu, nun schon ein wenig geschickter, wenn auch noch immer quälend langsam. »Du hast gesagt, ich darf da oben spielen.«
»Spielen, ja, aber nicht das alte Gerümpel hier runterschaffen, wo es im Weg steht, bis irgendwer, also ich, es wieder nach oben schleppen muss.«
»Weißt du, wem er mal gehört hat?«
»Der stand hinter den Kisten in der Ecke, oder?«
Sie blieb vor ihm stehen. »Hinter denen mit der russischen Schrift.«
Gabriel roch nach Pomade und süßlichem Rosenwasser. »Manche Familien aus Russland kamen jedes Jahr, ein paar blieben monatelang, und dann war es einfacher, das Gepäck einfach einzulagern, statt es jedes Mal wieder mitzunehmen. Der Rollstuhl hat wohl einer ihrer Töchter gehört.«
»Dann hat sie den Rollstuhl nicht hiergelassen, weil sie wieder laufen konnte?«
Wenn ihr Onkel lächelte, hoben sich die Enden seines schmalen schwarzen Schnurrbarts. Es sah aus, als täte sich ein Spalt zwischen Nase und Oberlippe auf, und aus irgendeinem Grund musste Liette dabei immer an Fische und ihre Kiemenschlitze denken. »Das hier war ein Ersatzrollstuhl. Diese russischen Adeligen und Geschäftsleute hatten viele Dinge doppelt und dreifach, weil sie gar nicht wussten, wohin mit all ihrem Geld.«
»Warum kommen sie heute nicht mehr her?«
Er trat hinter sie, packte die Griffe und drehte den Rollstuhl mit ihr darin um, bis sie wieder zum anderen Ende des Korridors blickte. Dann schob er sie zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war. »In dem Jahr, in dem du geboren bist, 1917, gab es in Russland eine große Revolution. Erst musste der Zar zurücktreten, und ein paar Monate später haben Lenin und seine Leute die Macht übernommen. Die Bolschewisten waren nicht gut auf die Reichen zu sprechen, weil die meisten den Zar unterstützt hatten. Darum haben sie viele von ihnen ins Gefängnis gesteckt.« Er zögerte kurz. »Manchmal auch Schlimmeres.«
»Die haben sie umgebracht?«
Er schob den Rollstuhl um die Ecke in den nächsten langen Flur. Dabei wurde er schneller, wahrscheinlich weil er sie möglichst rasch loswerden wollte. Das war nichts Neues. Nur deshalb hatte er ihr erlaubt, auf dem Dachboden herumzustöbern.
»Haben sie?«, fragte sie, als er keine Antwort gab. »Sie umgebracht?«
»Ich fürchte, ja. Das waren schlimme Zeiten. Hoffen wir mal, dass so was nicht noch mal passiert.« Für sie klang das, als wüsste er viel mehr darüber, hielte es aber für unangebracht, mit einer Elfjährigen darüber zu sprechen.
»Haben die sie erschossen?«
»Wer weiß.«
»Oder aufgehängt?«
»Schon möglich.«
Sie erinnerte sich an etwas, das sie einmal in einem Buch gelesen hatte. »In Frankreich haben sie den Adeligen bei der Revolution die Köpfe abgeschlagen.«
Gabriel seufzte. »Ich glaube, das haben sie in Russland nicht gemacht.«
»Aber so oder so sind jetzt alle tot«, stellte Liette fest, »und das Gepäck auf dem Dachboden brauchen sie nicht mehr.«
Er brachte den Rollstuhl zum Stehen. »So ähnlich sieht es hier an der Küste in einigen Hotels aus. Seit 1917 stehen überall die eingelagerten Kisten mit den Sachen der Russen rum, die niemand mehr abholen wird. Keiner hat so recht gewusst, was damit passieren sollte, also einigten sich alle darauf, das Gepäck zehn Jahre lang nicht anzurühren, für den Fall, dass doch noch jemand auftauchen und Anspruch darauf erheben würde. Erst dann sollten die Koffer geöffnet und die Kleidung der Heilsarmee übergeben werden.«
»Aber es sind jetzt schon elf Jahre, hast du gesagt.«
Er zuckte die Achseln. »Ich hab das Zeug da oben vergessen. Ob zehn, elf oder zwölf Jahre, am Ende macht das keinen Unterschied.«
»Was ist mit den anderen Dingen?«
»Was für andere Dinge?«
Sie klopfte auf die Armstützen des Rollstuhls. »So was wie das hier. Oder Spielzeug. Und Schmuck.«
Sein Schnurrbart zuckte leicht, obwohl er diesmal nicht lächelte. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendwas Wertvolles ist. Teure Kleidung ist das eine, aber die Familienjuwelen haben sie bestimmt nicht hiergelassen.«
»Weil jemand sie stehlen könnte?«
»Bei uns wird nicht gestohlen«, sagte er.
»Dann wären sie hier ja in Sicherheit.«
Er trat hinter sie und begann wieder zu schieben, diesmal mit einem harten Ruck. »Frauen wollen ihren Schmuck gern zeigen. Sie lassen ihn nicht ein Jahr in einer Kiste liegen, schon gar nicht in einem anderen Land, wo sie nicht an ihn rankommen.«
Liette schwieg, bis sie die Tür erreichten, hinter der die Treppe zum Dachboden lag. Sobald Gabriel anhielt, sprang sie aus dem Rollstuhl. »Ich bring ihn wieder hoch«, sagte sie. »So was ist kein Spielzeug. Das war dumm.« Der Gedanke, dass die Besitzerin des Rollstuhls tot sein könnte, ermordet mit all den anderen reichen russischen Familien, ließ sie schaudern.
»Ich mach das schon«, sagte Gabriel. »Das Ding ist viel zu schwer für dich.« Warum hatte sie das Gefühl, dass er nur einen Blick auf die Kisten werfen wollte, die sie gefunden hatte?