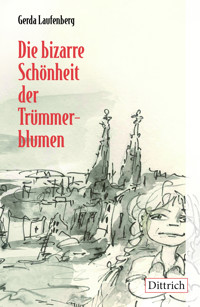
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Kölner Vorort, eine Straße zwischen Schutthalden und Notbehausungen, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier wächst die achtjährige Gerda auf. Inmitten ihrer elf Tanten und der Eltern, die auf eine verstörende Art unerreichbar scheinen, beginnt sie Fragen zu stellen. Fragen, die oft unbeantwortet bleiben. So zieht das unerschrockene Kind seine eigenen Schlüsse aus den Sonderbarkeiten der Erwachsenenwelt. Gerda Laufenberg beschreibt mit sicherer Menschenkenntnis und viel Humor die Unzulänglichkeiten der Charaktere jener Zeit, die sie uns auf liebevolle Weise nahebringt. Mit zahlreichen Illustrationen der Autorin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerda Laufenberg
Die bizarre Schönheit der Trümmerblumen
Gerda Laufenberg
Die bizarre Schönheitder Trümmerblumen
© Dittrich Verlag in der Velbrück GmbH Verlage, 2025
Meckenheimer Str. 47 · 53919 Weilerswist-Metternich
www.dittrich-verlag.de
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-52-0
eISBN 978-3-910732-84-1
Cover-/Innengestaltung: Katharina Jüssen, Weilerswist-Metternich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Trümmerblumen
Der Umzug
Vier Stockwerke
Frau Eschbach
Die Hausbesitzerin
Der Beruf meines Vaters
Der Vater
Die Mutter
Meine Tanten
Was ist eine Schlampe?
Die seltsame Michaela
Der erste Schultag
Das Krippenspiel – oder: Warum Josef Maria nicht küssen darf
Jungs sind mehr wert
Die Flötenlehrerin
Die Schuhe vom Nikolaus
Kein Opernhaus für die Sängerin
Der Weg zum Mount Everest
Mit Tante Berta zum Drachenfels
Der besudelte Hochaltar
Von Römern, Ubiern und roten Funken
Die Schatzsuche
Die besonderen Damen
Der Akkordeonlehrer
Meine erste Heilige Kommunion
Täubchen
Von Würmern, Obst und ewiger Hoffnung
Von der Fähigkeit, im Leben zurechtzukommen
Nachwort
Trümmerblumen
Wir pflückten Blumen auf den Trümmern. Deshalb nannten wir sie Trümmerblumen. Sie hatten dicke, lilafarbene Blütentrauben, schön wie Flieder. Sie wuchsen aus Sträuchern, deren Wurzeln in irgendeinem verschütteten Keller endeten. »Da sind noch Tote drunter!«, behauptete Andi, »die geben guten Dünger!«. Mein Vater sagte, dass sei Quatsch. Alle Toten seien gefunden und begraben worden, in den Trümmern lägen höchstens noch ein paar Ratten. Trotzdem glaubte ich immer, einen Leichengeruch in der Nase zu haben. Ich schenkte meiner Mutter niemals Trümmerblumen. Wir hatten andere Blumen im Garten.
Den süßlichen Leichengeruch kannten wir vom Krematorium hinter dem St. Vinzenz-Hospital. »Da werden die Toten aufbewahrt, die verbrannt werden«, sagte Andi. Wir schlichen heimlich dort herum und schnüffelten. Es war gruselig und schon deshalb auch anrüchig, weil katholische Menschen sich nicht verbrennen lassen durften. Mein Vater sagte, da wäre gar kein Krematorium, in dem Haus werde der Abfall des Krankenhauses verbrannt. Ich habe das für mich behalten.
Wir pflückten Trümmerblumen für niemanden und warfen sie dann fort, sie wuchsen überall und hatten keinen Wert. Aber sie waren unerklärlich schön, hoch oben auf den Trümmerbergen, schwer erreichbar wie Edelweiß.
Einmal habe ich einen Strauß davon Frau Appenwiehr nebenan in den vierten Stock gebracht. Das war, als sie mir erzählte, heute sei ihr 78. Geburtstag. Sie war ganz allein in ihrer Wohnung, saß auf ihrem alten Sofa und träumte vor sich hin. Niemand brachte ihr Blumen. Trümmerblumen hatte sie noch nie gesehen. Bei ihr rochen sie nicht nach Leichen, sie dufteten wie richtige Blumen aus dem Garten.
Der Umzug
Jetzt ist alles vorbei. Jetzt gehört mir nichts mehr. Diese holprige Straße ist nicht mehr meine Straße, das Haus mit der zerschrammten Eingangstür ist nicht mehr mein Haus und die neugierigen Nachbarn werde ich bald nicht mehr sehen. Die Kinder, die sich um den Möbelwagen drängeln, sehen mich schon jetzt an, als würde ich nach Sibirien ziehen oder zumindest nach Bergisch Gladbach, was ja auch im Osten liegt. Wir ziehen nämlich um. Wir ziehen in ein anderes Viertel, ins Agnesviertel. Dass dieses Viertel sich nach einer Frau benennt, die Agnes heißt, genauso wie die dicke Besitzerin vom Kiosk an der Ecke, kommt mir komisch vor. Aber Mutter sagt, das Viertel heißt nach einer Kirche, der Agneskirche, unsere künftige Pfarrei.
Unser Vorort heißt Nippes, und Nippes hat sich von keiner Kirche einen Namen aufdrängen lassen. Aus Nippes wäre das »Marienviertel« geworden, hätten wir uns nach der Kirche Sankt Marien benannt. Aber es gibt noch mehr Kirchen, die Josefkirche und die Bonifatiuskirche. Daraus hätte das »Maria-und-Josefund-Bonifatius-Viertel« werden können. Bei aller Frömmigkeit, so ein Name war den Nippesern dann doch zu umständlich.
Aber Agnesviertel, das hatte einen vornehmen Klang. Jedenfalls wenn meine Mutter davon sprach. Sie tat das in einem Tonfall, der unmissverständlich klarmachte: Wir ziehen in eine bessere Gegend. Ihr Blick wurde träumerisch. »Das kann man mit Nippes gar nicht vergleichen. So nah an der Innenstadt, die Häuser größer und vornehmer, gute Geschäfte, bessere Leute, alles ganz anders …«
Sie schaute sich vorsichtig um und flüsterte mir zu: »Nicht solches Gesocks wie hier.«
Mir hat es in Nippes gut gefallen. Und das »Gesocks«, von dem meine Mutter spricht, damit sind wohl unsere Nachbarn gemeint. Vor allem die von schräg gegenüber. Wenn Mutter aus dem vierten Stock hinausschaut, liegt im Haus gegenüber eine Frau im Fenster, die ihre dicken Arme auf ein Sofakissen drückt. Manchmal kommt ein Mann im Unterhemd dazu, holt sich auch ein Kissen und quetscht sich neben sie. Sie trinken beide aus einer Flasche und lachen oft. Manchmal streiten sie auch. Mutter beobachtet beides mit Verachtung. »Es ist ein Jammer. Die liegen den ganzen Tag im Fenster und tun nix. So ein Volk … Halt dich bitte von denen fern!«
Ich nicke immer brav. Mich von denen fernzuhalten soll heißen: »Spiel nicht mit den Kindern dieser Leute.« Das wäre ein Versprechen, das unmöglich einzuhalten ist. Aber das muss meine Mutter nicht wissen. Sie geht arbeiten und weiß vieles nicht, von dem, was hier abläuft. Unsere Straße ist ein großer Spielplatz, auf dem sich alle Kinder treffen, große und kleine. Auf den Bürgersteigen werden mit Kreide ständig die verschiedenen Varianten von Höppe Kästchen neu gemalt; wir springen rein und verwischen die Zahlen beim Hüpfen. Nach jedem Regenguss muss sowieso alles neu gemalt werden. An die von Granatsplittern zerlöcherten Hauswände malen sich die Jungs Tore für die Bälle, die sie quer über die Straße schießen. Wenn ein Auto vorbeikommt, halten sie inne, aber das kommt selten vor. Ich habe einmal einen Ball mit Schwung in das kleine Fenster des Schusters im Souterrain nebenan gejagt, der mir deswegen eine Ohrfeige verpasste, obwohl das Fensterglas schon vorher kaputt war. Seitdem spiele ich lieber mit Murmeln. Beim Murmelspiel liegt man auf der Erde und versucht, die Kugeln zielgenau in die Löcher rollen zu lassen, die wir in Schuhkartons geschnitten haben. Man kann dabei keine Fensterscheiben zertrümmern, aber wunderschöne Murmeln gewinnen. Leider auch verlieren. Ich hatte mit zehn Murmeln begonnen, die mir mein Vater in dem Spielwarengeschäft an der Ecke gekauft hatte, fünf teure aus Glas und fünf billige aus Ton. Damit spielte ich erfolgreich und erbeutete in kurzer Zeit 26 Murmeln, alle aus Glas und mit leuchtenden Streifen. Erfolgsverwöhnt spielte ich damit weiter, bis ich sie am nächsten Tag alle verlor, weil Fränzchen Kleinschmied mich besiegte. Ich bin fest davon überzeugt, dass er gepfuscht hat. Die Jungs um uns herum schrien bei jedem Wurf und brachten mich völlig durcheinander. Und jetzt klickern in Fränzchens Stoffbeutel meine Kugeln. Ich bezweifle, dass mein Vater mir neue kaufen wird.
Wir Kinder hatten es gut auf der Straße. Am besten hatten es diejenigen, deren Mütter oben auf Kissen im Fenster lagen und das Treiben beobachteten. »Ullalein, häste Kohldampf«? »Jüppchen – willste e Botterram?«
Wenn Ullalein und Jüppchen nickten, flogen in Zeitungspapier gewickelte Butterbrote hinunter. Manchmal durfte ich auch reinbeißen, weil mir keine Brote zugeworfen wurden. Manchmal flog sogar ein Brot für mich herunter. Und von diesen Leuten sollte ich mich fernhalten?
Heute sitze ich vorn auf der Beifahrerbank im Möbelwagen und weiß: dieses schöne Leben nimmt soeben ein Ende. Meine Mutter hat es geschafft, ihre Tochter wird nicht mehr mit diesen Kindern spielen müssen.
Ich versuche, mich auf das neue Viertel zu freuen. Dabei weiß ich genau: wenn meine Mutter es dort toll findet, ist das ein Grund, misstrauisch zu werden. Meine Mutter findet vieles toll, was eigentlich schrecklich ist. Zum Beispiel ihren Chef, der mich immer hochhebt, als sei ich ein Baby. Oder das Ausflugslokal im Königsforst, wo wir sonntags Jägerschnitzel essen. Und dann soll ich spielen gehen mit Kindern, die ich nicht kenne.
Ich bemühe mich, glücklich auszusehen, so wie ein Königskind, das sich freut, in den neugebauten West-Flügel des Schlosses umzuziehen. Ich bin ein neunjähriges Königskind und meine Königinmutter hat beschlossen, das alte Schloss zu verlassen. Es ist unserer nicht mehr würdig, so schäbig wie es ist, ohne Bad, ohne Heizung, überall schräge Wände, unter denen man sich ducken muss, wenn man nicht ständig mit dem Kopf anstoßen will. Und im ganzen Haus der Geruch nach Kohl und Bratkartoffeln. So ist das eben, wenn man unter Gesocks wohnt.
Meine Eltern hatten oft gesagt, dass wir hier nicht bleiben könnten. Mich fragten sie nie. Sie gingen davon aus, dass ich keine andere Meinung haben könnte als sie. Ich ging davon aus, dass wir hier nie wegziehen würden. Mutter hatte zwar bei allen Gelegenheiten immer wieder dramatisch ausgerufen: »Ich muss hier weg, ich halte das nicht aus!«, und dabei die Hände gerungen wie die Frauen im Kino, aber Papa nahm sie in den Arm, murmelte irgendwas Nettes und Mutter kam zurück aus ihrem Stummfilm.
»Aber wofür gehe ich denn arbeiten?« fragte sie mit Tränen in den Augen.
Vater antwortete immer »Ich weiß, Liebes, ich weiß ja ...«
Ich glaube, mein Vater wollte auch nie weg aus Nippes.
Und dann kommt heute Morgen pünktlich um 7 Uhr der Möbelwagen. Transporte Peter Schmitz steht in dicken Buchstaben auf den dreckigen Seitenwänden. Peter Schmitz ist ein Kegelbruder meines Vaters, ein dicker Mann, der immer im Blaumann herumläuft. Der Wagen steht direkt vor unserer Haustür in der Mauenheimer Straße. Man kann in solchen Straßen nicht unauffällig umziehen. Drei Männer sprangen heraus und stolpern jetzt die Treppe zum vierten Stock hinauf. Ich weiß, dass alle Bewohner zuschauen, jeder auf seiner Etage. Sie sehen zu, wie die Männer nach und nach unseren gesamten Hausrat nach unten tragen. Am schwersten zu tragen ist der wuchtige Wohnzimmerschrank.
Er ist ein Ungetüm mit geschnitzten Weintrauben an den Türen, einer Schnapsbar im Mittelteil und gedrechselten Kugelfüßen. »Das ist ein altdeutscher Schrank, das ist was ganz Besonderes«, sagte meine Mutter. Unsere Hausbesitzerin, Frau Derwort, hatte den Stil unseres Schrankes einmal als Gelsenkirchener Barock bezeichnet. Ich finde, das klingt feiner.
Den Möbelträgern ist der Stil des Schrankes egal. Sie fluchen die ganzen vier Stockwerke lang, schieben und zerren und wuchten, und am Ende liegt eine Weintraube abgebrochen im Hausflur. »Mäht nix, dat weedt widder jeklääv! Dat Obst krijje mer widder an et Hänje!«, beruhigt einer der Träger meine Mutter. Die ist fassungslos. Einerseits, weil die geschnitzte Weintraube an ihrem teuren Schrank kein »Obst« ist, andererseits bezweifelt sie, dass sich das Obst nahtlos wieder ankleben lässt. Ich weiß, dass sie bei Peter Schmitz auf Schadenersatz drängen wird. Papa wird das peinlich sein. Aber was soll er machen?
Ich muss die abgebrochene Weintraube in ein Küchentuch packen.
Ich laufe voraus und schaue zu, wie Schrank, Tische und Stühle, Betten, Matratzen, Teppiche und jede Menge Kisten in den Möbelwagen gepackt werden. Die ganze Mauenheimer Straße zählt mit, was wir so an Hausrat besitzen.
»Un der Ofen? Wat maachen’se denn mit dem Ofen?«
»Den brauchen wir nicht mehr«, sagt meine Mutter triumphierend, »wir haben jetzt Heizung!«
Und um noch einen drauf zu setzen ergänzt sie: »Und natürlich ein Bad«.
Ich verkrieche mich auf den Sitz vorn im Möbelwagen. Es ist wunderbar, von so hoch oben auf die Straße zu schauen, aber so richtig genießen kann ich das nicht. Ich weiß nun endgültig, dass ich nicht mehr dazu gehöre.
Ich bin jetzt neun, ich verlasse Nippes und nehme Erinnerungen mit, von denen ich später vielleicht einmal erzähle.
Vier Stockwerke
1950. Köln, Vorort Nippes, Mauenheimer Straße, vierter Stock links.
Ein langer Flur mit einer Toilette hinter einem Holzverschlag, dann nochmal ein kleiner Flur, der in die Küche führt. Dort steht hinten in der Ecke ein weißlackierter Küchenherd mit drei Gaskochstellen, einem Backofen mit Gasflammen und rechts im Ofen ein Bereich, in dem ständig Kohle brennt, damit das Wasser im Kessel darüber immer heiß ist. Die brennende Kohle wird schnell zu Asche, fällt durch ein Gitter ins Aschefach und muss von dem Kind jeden Tag nach unten zur Mülltonne getragen werden. »Eigener Herd ist Goldes wert« steht in geschwungener blauer Schrift auf dem Abschlussblech hinten am Ofen. Wenn ich die Asche nach unten in den Hof bringe – 81 Stufen hinab mit der graubraunen Schlacke – stelle ich mir vor, wie der Ofen zu Gold wird. Ein Blitz, ein Donner, und schon steht da unser eigener Herd in Gold verwandelt. Mit diesem Schatz könnten wir in eine große Parterrewohnung auf der Neußer Straße umziehen, wo die Toilette ganz nah und die Mülltonnen nicht 81 Stufen entfernt sind. Oben im vierten Stock reckt sich ein schwarzes Rohr vom Herd seitlich zu dem Loch in der Wand, das zum Kamin führt. Das Rohr war einmal gebrochen und die Küche voller Rauch. Das hätte mich beinahe das Leben gekostet, sagt mein Vater. Ich schlafe neben dem Herd auf dem alten Sofa und habe von meinem nahenden Tod nichts mitbekommen. Rechts geht’s ins Wohnzimmer mit dem persischen Fransenteppich. Auf ihm stehen wie auf einer Rettungsinsel ein grünes Sofa und zwei Rohrsessel, davor ein Tisch mit Marmorplatte. Die Position dieser Möbel ist irgendwann einmal beschlossen und nie geändert worden. Durch eine Tür geht es weiter ins Schlafzimmer, wo das Bett meiner Eltern vor dem dunklen Kleiderschrank mit den Spiegeln steht. Auf dem Schrank türmen sich Einmachgläser mit Birnen und Kürbis.
»Das, mein Kind«, erklärt mein Vater mit stolzer Stimme, »das ist unser Reich.« Ich nicke brav, obwohl ich nicht weiß, warum er so stolz ist. Aber ich mag ihn, den Mann mit den dünnen Beinen und dem verlegenen Lächeln, wenn er meine Mutter küsst. Ich finde unser Reich ist klein und eng. Und es hat sehr wenige Einwohner. Es wird bewohnt von einem Vater, einer Mutter und einem Kind. Vater ist König, Mutter ist Königin und ich weigere mich, Prinzessin zu sein. Ich bin allein und ich träume von Abenteuern, die nur Prinzen erleben. Aber das sag’ ich nicht. Ich sage überhaupt sehr wenig. Mit wenig sagen kommt man am besten durch in der Welt der Erwachsenen. Es interessiert sie eh nicht, was ich sage.
Also gut, ich bin das Einzelkind vom vierten Stock. Vermutlich das einzige in der ganzen Straße. Ringsherum schreien neugeborene Babys, alle Kinder haben Brüder oder Schwestern, die ihre Kleider und Schulranzen an die jüngeren Geschwister weitergeben. Ich trage neue Kleider, neue Socken und neue Schuhe, allerdings so lange, bis die Nähte platzen und die Schuhe drücken. Mutter stellt dann seufzend fest, dass ich mal wieder viel zu schnell gewachsen bin und dann zerrt sie mich in einen Laden, in dem alle Verkäuferinnen gemeinsam entscheiden, welches Kleid mir am besten steht.
»Worin fühlst du dich denn am wohlsten?« fragt Mutter und ich zucke mit den Schultern. Da liegt so ein kariertes Kleid mit großen Taschen vor mir, viel zu teuer, wie Mutter gleich beim ersten Blick feststellt. Schade. Das wärs gewesen.
Mit meinem ungeliebten neuen Kleid fahren wir nachhause zurück.
»Freust du dich denn gar nicht? Das neue Kleid ist so schön!« Mutter gibt es auf, mich freudig zu stimmen, sie muss zur Arbeit, Vater ist schon lange in seinem Büro und ich kehre allein zurück in mein Reich auf dem Dachboden. Dazu muss ich nur die knarrende Holztreppe vom ersten Flur aus hochklettern. Durch die Dachpfannen sieht man vom Himmel schmale Stücke, zwischen den dunklen Dachbalken spannen sich straff die Wäscheleinen. Alle im Haus steigen dort hinauf, kommen durch unseren ersten Flur, um oben Wäsche aufzuhängen. Das tun sie streng geregelt nach einem Zeitplan, der schwarzgerahmt im Hausflur hängt. Jeder besitzt einen Schlüssel zum ersten Flur. Aber eigentlich gehörte dieser Flur mir, denn hier dirigiere ich Armeen von Kastanienmännchen und alten Bauklötzen. Nur ich darf in diesem Flur ungehindert die Holzdielen mit Kreidestrichen verzieren und ich besitze auch den Schlüssel zur Toilette. Ich bin die Schlossherrin, und ich gestatte dem Volk gnädig, den Schlosshof zu benutzen. Wer mein Reich durchschreitet, hat immer einen Wäschekorb unterm Arm und entschwindet hastig nach oben. Gegen die Treppenbenutzung können wir nichts unternehmen, die Benutzung der Toilette lehnt meine Mutter strikt ab. Dort liegen unsere Zahnbürsten, ein Kamm und Vaters Rasierpinsel, Gegenstände, die niemand sehen muss. Mein Vater sicherte den Zugang zum zweiten Flur, indem er von innen einen riesigen Riegel anbrachte, den wir hinter uns zuschieben. Nachts schiebt er ihn mehrmals wieder auf, weil er zur Toilette muss. »Dass du abends auch immer so viel Bier trinken musst ...«
Die ärgerliche Stimme meiner Mutter höre ich vom Küchensofa aus.
Habe ich schon etwas über Nippes gesagt? Ich weiß, der Name klingt komisch. Aber klingt Zollstock nicht viel komischer? Ein Kollege meines Vaters wohnt da, und ein anderer in Sülz. Klingt doch alles viel komischer als Nippes.
Nippes ist ein nördlicher Vorort Kölns, nicht nahe am Rhein und auch nicht nahe am Dom, aber nahe an den Ausbesserungswerken der Bahn und dem Betriebsgelände der Gummifabrik Clouth. Die Häuser wurden um 1900 gebaut. Auf der Hausruine gegenüber kann man das nachlesen: »Am guten Alten in T… halten – Erba…1904« steht in Stein gehauen über dem Eingang. Die Inschrift ist zerfetzt von Granatsplittern und überhaupt ist von dem guten alten Haus nicht viel übriggeblieben. Unsere Hauswand hat auch viele Löcher, aber drinnen kann man noch wohnen. Wir haben vier Stockwerke, ein Dachgeschoss, tiefe dunkle Keller für Kohlen und eine Teppichstange im Hinterhof. »Mietshäuser für Arbeiter eben«, sagt Mutter und rümpft die Nase. Kein Bad, keine Heizung, die Toiletten auf der Treppe, für mehrere Parteien. Das genügte den Arbeiterfamilien. Hauptsache, der Weg zur Arbeit war kurz.
Vor dem Krieg war überhaupt alles besser, sagt Frau Derwort, unsere Hausbesitzerin, die nur selten mit uns spricht. Nach dem Krieg sah die Welt anders aus und man musste sich anpassen. Auch räumlich. Man rückte näher zusammen, unfreiwillig. Flüchtlinge kamen aus dem Osten, die sprachen komisch und fielen auf. Einige Frauen aus der Straße hatten ihre Männer aus der Gefangenschaft zurückerhalten, mürrische Kerle, die an Leib und Seele beschädigt waren und sich wunderten über die Kinder in ihrer Wohnung. Sie haben in diesem neuen Leben keinen richtigen Platz mehr. Deshalb glauben sie, einarmig oder einbeinig auf den Tisch des Hauses schlagen zu müssen, damit die alte Ordnung wieder einkehre. Sie schlagen auf mit Sand geputzte Holztische, die die Frauen aus den Trümmern gerettet und repariert hatten, aber das ist den Männern egal. Sie schlagen mit der Faust oder dem Armstumpf, entladen ihren Frust und schweigen über vergangene Zeiten.
Einige arbeiten bei der Bahn oder beim Clouth. Die meisten arbeiten nicht.
Unser Haus bildet eine Ausnahme. Nur mein Vater arbeitet beim Clouth, sonst niemand. Im Erdgeschoss links wohnt eine alte keifende Dame zusammen mit einem keifenden Spitz. Sie ist Kriegerwitwe und verfüttert ihre Rente an sich und den Hund. Auf der rechten Seite wohnt ein depressiver Kriegsversehrter, der ab und zu auf den Hof rennt und mit seinen Krücken gegen die Hauswand schlägt. Etwa einmal im Monat begeht er Selbstmord, aber er wird immer gerettet, was er ärgerlich geschehen lässt.
Im ersten Stock wohnt die Hausbesitzerin, Frau Derwort, deren Mann nicht ihr Mann ist, wie mir meine Mutter mit starrem Blick zu erklären versuchte. »Er heißt Herr Pfeil«, schärfte sie mir ein, »grüß ihn bitte mit seinem richtigen Namen!« Ich schmettere ihm trotzdem immer ein lautes »GUTEN TACH HERR DERWORT« entgegen. Er nimmt es mit irritiertem Lächeln hin. Ich bin nicht frech, ich bin nur streng katholisch. Und deshalb weiß ich: Wenn im katholischen Nippes ein Mann und eine Frau zusammenwohnen, dann tragen sie den gleichen Namen, immer. Amen.
Auf der anderen Etagenseite wohnt ein Fräulein, das Geigenunterricht gibt. Zu ihr kommen auffallend viele junge Männer, die Geige lernen wollen. Ich bekomme im vierten Stock nicht so viel mit vom Quietschen der Instrumente, aber Frau Derwort leidet entsetzlich darunter. Dass sie von einer Kündigung absieht, liegt an Herrn Pfeil, der die junge Dame ab und zu auffordert, in der Wohnung seiner Frau, die nicht seine Frau ist, ein kleines Privatkonzert zu geben. Dazu lädt er noch den Juwelier von der Neußer Straße und den Apotheker vom Wilhelmsplatz ein, die selber irgendwelche Streichinstrumente spielen, aber nie mitbringen. Stattdessen bringen sie ihre Gattinnen mit. Alle hören dem Fräulein und ihrem Geigenspiel hingerissen zu, so dass Frau Derwort die ständig angedrohte Kündigung nie ausspricht.
Im zweiten Stock wohnt links Frau Neubauer mit zwei Töchtern. Es sind wohlerzogene, fast erwachsene Mädchen von vierzehn oder fünfzehn Jahren, die ich nicht leiden kann, weil sie immer saubere Kleider tragen, bei der Begrüßung einen richtigen Knicks machen und nie mit hängenden Strümpfen herumlaufen. Selbstverständlich rutschen sie auch nicht das Treppengeländer herunter, aber ich wohne schließlich zwei Stockwerke höher als diese Zicken, und mein Weg nach unten ist viel länger. Wenn Frau Neubauer mich heransausen sieht, streckt sie den Arm aus, als wolle sie mich festhalten, zuckt aber immer im letzten Moment zurück. »Beim nächsten Mal kriege ich dich!« höre ich sie noch unten im Hauseingang zetern. Sie wird mich niemals kriegen.
Frau Neubauer geht nachmittags mit ihren Töchtern durch Nippes spazieren, kauft ihnen Langnese-Eispüppchen und führt sie Freitagsabends in den ›Goldenen Kappes‹ auf der Neußer Straße. Da essen sie ›Halven Hahn‹ und Heringsstipp. Meinem Vater hat sie verraten, wie gern sie einmal eingeladen werden würde zu dem Hauskonzert der Vermieterin. »Dat is ne andere Welt bei denen ..., dat is Kultur, de bessere Gesellschaft eben!« Und dann kommt ihr Standardsatz: »Ach ja, wenn mein Mann noch lebte ...«
Immer, wenn sie Herrn Pfeil auf der Treppe begegnet, versucht sie ihn in ein Gespräch über Musik zu verwickeln. »Ach Herr Pfeil, Sie wissen ja janit, wie sehr ich Mozart liebe! Mozart und die Kleine Nachtmusik – zauberhaft ...«
Herr Pfeil hat es dann immer eilig.





























