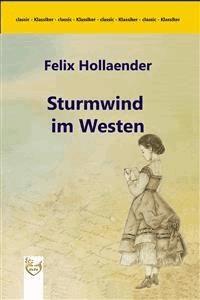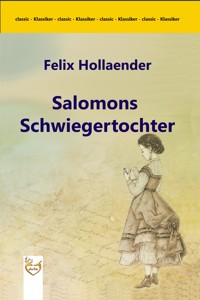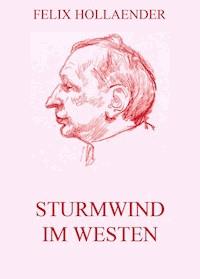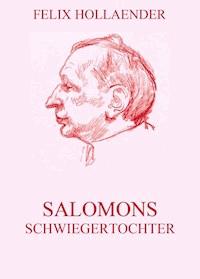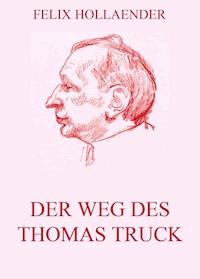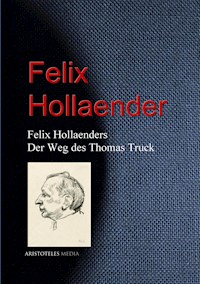Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felix Holländer zeigt in diesem Ich-Roman alle Vorzüge seiner nervösen Gestaltungskunst: eine bestrickende Leichtigkeit des Eindringens in seelische Zustände, stets fesselnde Dialogführung und eine Gruppierung von Umständen, die der Handlung immer wieder neue Stränge zuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Briefe des Fräulein Brandt
Felix Hollaender
Inhalt:
Die Briefe des Fräulein Brandt
Iserbaude, 7. Juni 1914.
11. Juni.
13. Juni.
14. Juni.
16. Juni.
Am Abend desselben Tages.
Zwei Tage darauf.
Zwei Tage später.
Am Nachmittag.
Am Abend desselben Tages.
22. Juni.
24. Juni.
25. Juni.
Ein paar Stunden darauf.
28 Juni.
29. Juni.
Eine Stunde später.
30. Juni.
1. Juli.
Am Abend.
3. Juli.
Nachts.
Am nächsten Morgen.
Eine Stunde später.
Am Nachmittag.
4. Juli.
9. Juli.
11. Juli.
14. Juli.
Zwei Tage später.
19. Juli.
24. Juli.
25. Juli.
26. Juli.
In der Nacht des 26. Juli.
Am folgenden Morgen.
28. Juli, vormittags.
Am Nachmittag.
Am Abend.
Am Morgen.
Drei Tage später.
Mehrere Tage später.
Anfang August.
Am 11. Tage nach unserer Flucht.
18. August.
Am folgenden Tage.
Eine Woche später.
Die Briefe des Fräulein Brandt, F. Hollaender
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849642860
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Die Briefe des Fräulein Brandt
Iserbaude, 7. Juni 1914.
Liebes Herz!
Beim Abschied hast Du mir halb und halb das Wort abgenommen, Dir über alles zu berichten. Halb und halb sage ich, denn ein ganzes Wort, das ein anständiger Mensch unbedingt einlösen muß, konnte ich Dir nicht geben. Kann wohl überhaupt niemand, der noch eine Spur von Schamgefühl in sich hat. Lache um des Himmels willen nicht, wenn ich schon bei den ersten Zeilen stolpere und zu philosophieren beginne. Denn wird die Frage gestellt: alles oder nichts, so sage ich, ohne mich zu besinnen: nichts. Und zwar, weil man ohne einen Rest, der einem allein gehört, nicht vor sich und Gott bestehen kann. Mag sein, daß es Menschen gibt, zu jeder Stunde bereit, sich bis aufs Hemd zu entkleiden. Und wie sollte ich gerade jetzt, da bei mir und den Meinen die Dinge bis zu einem, oder sage: ich nicht richtiger, bis zu dem kritischen Punkte gediehen sind, jene Mitteilsamkeit aufbringen, wie Du von mir gefordert hast. Ich mache Dir beileibe nicht den Vorwurf der Neugier, weiß, daß Deine Freundschaft und Neigung zu mir selbstlos ist. Du meinst, es müßte mich in meinem Widerspruchsvollen Zustand erleichtern, einem gleichgestimmten Wesen mein Herz auszuschütten. Und darin magst Du recht haben. Denn ich fühle mich in dieser großen Abgeschiedenheit noch einsamer, weil Vaters und, Mutters sorgenvolle Blicke beständig auf mir ruhen, weil ich ihre unausgesprochenen Forderungen beständig höre, und weil ich zu stolz bin, diese Selbstdemütigung meiner Eltern zu ertragen. Vater, der immer gewohnt ist zu befehlen, stößt bei mir auf einen Widerstand, der ihn erbittert. Dabei möchte er sich eher die Zunge abbeißen, als daß er mir ein Wort sagte. Und Mutter, ach Mutter ist jammervoll, hat immer Wasser in den Augen und begreift mich nicht, versteht oder will nicht verstehen, siehst Du, liebes Kind, nun muß ich mitten im Satze abbrechen. Familienintimitäten soll man nicht auspacken. So etwas ist immer unsauber. Also mit dem Herzausschütten ist es vorbei. Es geht einfach nicht. Willst Du Wetterberichte haben, gut. Und bin Dir doch für die Anregung dankbar. Bis aufs I-Tüpfelchen will ich berichten, und hätte es keinen anderen Sinn als den, mich durch eine reinliche Auseinandersetzung zu erleichtern. Nur werden diese Briefe niemals befördert werden. Schreiberin wird sie zu guter Letzt in ein Bündel schnüren und in die unterste Lade schließen. »Nach meinem Tod« zu verbrennen« usw.
Der Wetterbericht vom 4. Juni lautet: Wir sind bei verhängtem Himmel angekommen. Alles undurchsichtbar, in undurchdringlichen Nebel gehüllt. Die Baude ist leer, und wir sind die einzigen Gäste: Vater, Mutter, Christine und ich. Erst im nächsten Monat beginnt hier die Saison. In drei, vier Tagen kommen die Jungen und mit ihnen Leutnant von Borck. Gott stehe mir in dieser gefährlichen Einsamkeit, in der alles zur Entladung drängt, bei. Amen!
11. Juni.
Die Baude hat sich bevölkert. Ein Finanzrat von Wehlen aus Berlin und ein Kreisphysikus Wernicke aus Görlitz, beides ältere Herren und Junggesellen, sind eingetroffen. Da Papa den Finanzrat von Berlin her flüchtig kannte, und dieser wiederum mit dem Physikus gut Freund ist, so dauerte es nicht lange, und die Herren waren uns vorgestellt. Der Finanzrat ist hager und glatt rasiert, ausgesprochener Büromensch mit weltmännischen Allüren. Der Kreisphysikus ist untersetzt, stämmig, hat einen Knebelbart und trägt eine Hornbrille. Nach dem Abendbrot sitzen sie mit uns an einem Tisch, bis sie sich mit Papa absondern, rauchen, politisieren oder spielen, das letztere hat sie Papa, wohl besonders nahe gebracht. Mama und Christine pflegen dann ihre Handarbeiten, ich irgendeinen Schmöker hervorzuholen.
Da beide Knaben sich bewogen fühlten, mir abwechselnd den Hof zu machen, hat es zwischen mir und Mama wieder eine: jener sattsam bekannten Auseinandersetzungen gegeben.
Mama: Ein Wesen wie du gibt es nicht ein zweites Mal.
Ich (ernsthaft zustimmend): Jedes Exemplar existiert eben nur einmal. Es ist eine faule Beobachtung, daß ein Ei dem anderen gleicht.
Mama überhörte meinen Einwurf. Selbst in dieser Einöde haben deine Augen keine Ruhe. Laß diese Herren zufrieden, wenn ich bitten darf!
Sage es gefälligst ihnen, mich gelüstet es nicht, ihren Frieden zu stören.
Mama: Deine Augen brennen, sobald eine Mannsperson in der Nähe ist. Von wem hast du das nur? Von Papa und mir gewiß nicht.
Nein, von euch in keinem Falle. Vielleicht ist Tante Marie im Spiele. (Du erinnerst Dich, Tante Marie ist der dunkle Fleck in unserer Familie.)
Mama schreckt auf: Ich verbitte mir derartige anzügliche Redensarten. Anstatt mit alten Herren zu kokettieren, fährt: sie fort, wäre es entschieden angemessener ...
Ich erhebe mich und gehe meiner Wege. Leutnant von Borck ist an der Reihe. Mama spricht seinen Namen nicht aus, aber man braucht nicht findig zu sein, um ihre dunklen Andeutungen zu erraten. Anfang und Ende ihrer Träume ist Leutnant Borck. Wenn ich eine Spur von Neigung zu ihm hätte, Mama und Papa würden sie mit ihren Wünschen im Keime ersticken. Aber ich empfinde nichts für ihn. Er ist ein guter Junge und anständiger Mensch. Basta, was geht mich das an! Ach meine Liebe, es geht mich viel mehr, an, als Du ahnst. Ich bin sozusagen der Rettungsanker, der ausgeworfen, das Opferlamm, das geschlachtet werden soll. Und obendrein sind Mama und Papa der Überzeugung, daß ihre Rettung mein Glück ist. Sie sprechen nicht darüber. Papa ist viel zu stolz, um mir auch nur mit einem Worte zuzureden, geschweige, denn mich zu bitten, aber ich sehe es ihren stummen Mienen an, und Mamas vorwurfsvolles Gesicht reizt mich auf.
Ihre stillen Leidenszüge erbittern mich. Jedes Märtyrertum, das zur Schau getragen wird, hat für mich etwas Peinvolles. Ich weiß, das ist anmaßend, unduldsam, ein Mangel an kindlichem Gefühl und Ehrfurcht gegen diejenigen, die einem das Leben geschenkt, geschenkt, wer lacht da? aber meinethalben dies zugegeben, und dennoch, ich kann nicht anders. Ich frage mich vergebens, wie ist es möglich, daß ein Mann von der unbestechlichen Art meines Vaters, von seiner eisernen Pflichttreue und sauberen Denkweise es mir zumuten kann, daß ich meinen Leib wegwerfe. Denn darauf, läuft es hinaus, ich soll meinen Leib wegwerfen. Habe ich ein Recht dazu? Gibt es nicht, muß es nicht in der Welt Menschen geben, für den Gott diesen Leib geschaffen hat? Lassen wir doch alle Zimperlichkeit beiseite! Wenn Mann und Weib eine Einheit, eine wirkliche Einheit, ein Ganzes bilden sollen, so müssen die Teile zueinander passen; denn es ist viehische Stümperei, zwei X-Beliebige zusammenzukoppeln. Die leiseste Divergenz ist von Übel. Der Mann, der mir zugehört von Gotteswegen, ist da, ich habe auf ihn zu warten. Auf das Warten kommt es an. Lieber einen grauen Zopf bekommen, als sich vor der Zeit wegwerfen. Wenn Vater und Mutter von mir fordern würden, ich solle mir die Hände für sie wund arbeiten, Holz hacken, oder Steine für sie klopfen, es wäre dreimal ihr gutes Recht. Und niemals könnte ich ihnen damit die Liebe vergelten mit der sie mich von Kindesbeinen an umgeben haben. Nur meinen Leib sollen sie beiseite lassen. Mutter begreife ich noch eher. Sie läuft wie eine verängstete Henne umher, die für ihre Brut fürchtet. Vaters, der Jungen und Christinens Zukunft hängen von meiner Entscheidung ab. Da verlohnt es der Mühe, sich den Kuppelpelz zu verdienen. Punktum! Streusand darauf! Vorläufig sind Borck und die Jungen noch nicht da. Gott ist gnädig. Gott gibt mir eine Galgenfrist. Und oben auf dem Kamm ist die Sonne durchgebrochen, und unsere Baude hebt sich mit ihrem steinernen Fundament und ihrer verwitterten Holztäfelung von den finsteren Bergen, dem dunklen Waldrücken und der weithin gestreckten grünen Wiese wunderbar ab. Hier oben ist Freiheit. Ich ziehe mit tiefem Behagen die würzige Bergluft ein, ich möchte meine Brust weiten, alle meine Sinne öffnen und klaren Herzens meine Entscheidung treffen.
13. Juni.
Diese Misere eines bürgerlichen Offiziersdaseins wird trotz allem, was darüber in der Öffentlichkeit verlautet, von den wenigsten geahnt. Vater, der als Oberst Karriere gemacht hat, ist ein typisches Beispiel dafür. Sohn eines armen Landpastors, hat er von klein auf den leidenschaftlichen Wunsch, Soldat zu werden. Vater und Mutter sparen sich den Bissen vom Munde ab, und so setzte er es durch. Hätte vielleicht die Hand davongelassen, wenn er in die Zukunft hätte schauen können. Leidenszeiten, Entbehrungen über Entbehrungen, Zurücksetzung und Demütigungen, aber meines Vaters eiserner Wille, gepaart mit einer Befähigung, die weit über den Durchschnitt geht, setzt sich durch. Als Oberleutnant verliebt er sich in die Tochter des Generals von Rhön. Die Mitgift besteht in einer bescheidenen Ausstattung und bescheidenem Zuschuß. Jedoch die Zukunft sieht nicht mehr so finster aus. Der General gilt nicht als reicher, aber leidlich vermögender Mann, und sein Einfluß schützt den Vater vor ungerechter Behandlung, er wird ziemlich früh zum Hauptmann befördert und erregt als Militärschriftsteller von gründlichstem Wissen und angeborener Begabung die Aufmerksamkeit der maßgebenden Kreise.
Papa und Mama passen scheinbar ausgezeichnet zueinander, d. h. sie sieht zu ihm empor, sie fügt sich demütig seinem Willen.
Die beiden Jungen kommen zur Welt, und wenn man auch auf Zwillinge nicht eingerichtet war, im Hause herrscht eitel Glück. Vielleicht dachte Papa damals, er hätte es geschafft. Prosit die Mahlzeit!
Der General von Rhön stirbt und hinterläßt Schulden, keine unmäßigen Summen, aber immerhin Schulden. Papa muß dafür eintreten. Und Jahre der Entbehrungen kommen, und auf die Zwillinge folgen Bruder Gottfried, ich und Christine. Manches liebe Mal ist mir Papa wie ein Märtyrer erschienen. Er beißt die Zähne aufeinander, er läßt sich nicht unterkriegen. Der Dienst geht ihm über alles. Er ist mit Leib und Seele Soldat. Aber zu Hause wird gehungert, für die Jungen gespart, die in die Kadettenanstalt kommen. Es steht von Anfang an fest, daß sie Offiziere werden. Widerspruch von ihnen wird nicht geduldet. Gottfried hat sich im Innern gegen den Soldatenberuf aufgelehnt. Man hat ihn nicht gefragt. Das Leben im Hause ist ein Hungerleben. Die Jungen brauchen eines Tages Zuschuß, und jeder Groschen muß gespart werden. Die Gebundenheit des Offiziersdaseins ist mir in vielen Stunden hassenswerter erschienen als die meisten anderen Gebundenheiten des Lebens. Ich darf derartige Gedanken nicht aussprechen, Papa würde es nicht ertragen. Als ich einmal Mama gegenüber eine Andeutung wagte, macht sie ein tödlich erschrockenes Gesicht, sah mich mit ihren großen, leeren Augen so hilflos an, daß ich nicht weiterreden konnte.
Papa macht Karriere, wird Major, Oberstleutnant, Oberst; die Jungen haben ihre Epauletten.
Soweit es dringend notwendig ist, repräsentieren wir. Man muß nach außen hin eine gesellschaftliche Stellung wahren. Papa schreibt halbe Nächte hindurch, um ein paar lumpige hundert Mark hinzuzuverdienen; die militärischen Zeitschriften und die Verleger militärischer Werke zahlen oft lächerliche Honorare. Man sollte diese Burschen aufhängen.
Ich möchte zum Haushalt beitragen und in fremden Sprachen unterrichten. Papa hat mir gehörig die Leviten gelesen: die Tochter eines Oberst, ob ich bei Troste wäre. Ich habe ihn selten so unwirsch, so verdrossen gesehen. Es reicht, solange er da und aufrecht ist. Sich bescheiden, aus Großstadtgenüsse, Putz, Tand, Prassereien verzichten lernen ist für eine Offizierstochter selbstverständlich; kein Wort ist darüber zu verlieren. Aus der Königlichen Bibliothek bekommt man Bücher ohne Entgelt, Herz, was begehrst du noch mehr!
Die arme Mama nimmt es tragischer als ich.
Daß es in den meisten Fällen nicht einmal reicht, um die Fähnchen für den Offiziersball aufzubringen, schmerzt sie mehr, als sie laut werden läßt. Ich lache sie aus. Aber mein jüngeres Schwesterchen denkt in punkto Offiziersball anders als ich. Das liebe Ding hungert nach dem Leben und dem Versorger.
Und nun kommt das Entsetzliche: Bruder Rolf, der eine von den Zwillingsbrüdern, hat Schulden gemacht, unsinnige Schulden, sage und schreibe gegen zehntausend Mark. Er hat sich Hals über Kopf in ein gewisses Frauenzimmer verliebt, das ihn hochgenommen hat, und dann ist er den Krawattenmachern in die Hände geraten. Die alte, klägliche Geschichte. In unserem Falle nur besonders fatal, weil es nicht auszudenken ist, wie ein Mensch, der von Jugend an unser glänzendes Elend mit angesehen, Vaters übermenschlichen Kampf mit erlebt hat, so wenig Selbstzucht besitzen konnte. Ich habe es ihm ins Gesicht gesagt, daß er ein Dieb ist, der fremde Gelder unterschlagen hat. Ich kann an seine verzerrten Züge nicht zurückdenken. Er machte eine so üble Figur, daß ich mich abwenden mußte. Wenn Mutter nicht gewesen wäre, er hätte sich eine Kugel durch den Kopf geschossen. Schließlich hatte ich die dankbare Aufgabe, ihm begreiflich zu machen, daß die Kugel für ihn zu schade sei. Denn diese Kugel würde nicht nur sein elendes Dasein, sondern auch Vaters Zukunft vernichten, ganz abgesehen davon, daß Vater nichts übriggeblieben wäre, als noch mit seiner lumpigen Pension für die Schulden des Herrn Kavaliers einzutreten.
Ich schreibe dies nieder und spüre deutlich, wie gouvernantenhaft-moralisch man an der Umgebung wird, in der ich aufgewachsen bin. Ein blutjunger Mensch verliebt sich, kommt in einen Rausch, ist trunken vor Glück, verliert Haltung und Besinnung ... mein Gott, ist denn das vor der Ewigkeit ein solches Verbrechen, daß man sich angewidert von ihm abwendet? Philister über dir!
Herr v. L. darf sich neben seiner Frau drei Mätressen halten, niemand zieht ihn deswegen zur Verantwortung, und mein armer Bruder kommt wegen seiner kleinen Tänzerin in Teufels Küche. Der kleine Racker wollte es gut haben, sonst war mit ihm nichts anzufangen, und meinen Bruder riß es in den Wirbel des Lebens. Alle zurückgedrängte Lebensgier brach plötzlich auf, keine Hemmungen mehr, nur Durst, entsetzlicher Durst.
Alles verstehen und nichts verzeihen, sagte Professor R. C. vor Jahr und Tag. Klingt gut und ist von infamer hundsföttischer Grausamkeit!
Mein Brüderchen, ich würde auf die zehntausend Mark spucken, zumal ich mir schon hundertmal die Frage gestellt habe: wer hat ein Recht auf Besitz, weshalb gehören die leuchtenden Steine und mattgrauen Perlen der Fürstin Wittgenstein und nicht mir? (Wobei ich notabene mir niemals Perlen und Steine ersehnt habe.) Ich würde die die mageren Arme und runden Beine deiner Tänzerin von Herzen gönnen, wenn es nicht auf Kosten des armen Papas ginge, auf Kosten einer Lebensführung, die auf den Grundpfeilern eherner Pflichttreue aufgebaut wurde.
Und insoweit fühle ich mich als Soldatenkind, daß ich vor diesem Preußentum, wie es in der Person meines Vaters verkörpert ist, unbedingte Ehrfurcht habe. Begleiterscheinungen, so widrig sie sein können, müssen mit in den Kauf genommen werden.
Papa hat für Rolfs Schulden gutgesagt. Wie er sie begleichen soll, ist ihm ein Rätsel, über dessen Lösung er in schlaflosen Nächten schlohweiß geworden ist.
Müßte man nicht darüber lachen, wenn es nicht zum Heulen wäre, daß zehn braune Lappen das Schicksal einer Familie bestimmen sollen? Wird man es nicht einmal als einen vorsintflutlichen Zustand ansehen, daß seelische Leiden durch den Mangel an Vermögen entstehen und andererseits wie ein Wechsel ausgelöst werden können?
Papas Ehre ist durch den Leichtsinn und die Lebensfreude eines jungen Menschen gefährdet, seine Karriere steht auf dem Spiel, seine Gesundheit ist erschüttert.
Oberstabsarzt Dorn hat darauf bestanden, daß Papa Urlaub nimmt. »Wenn Sie sich dem Dienst erhalten wollen, so folgen Sie meinem Rat; ich stehe sonst für nichts ein.«
So ernsthaften Drängens hatte es bedurft, ehe Papa nachgab. Er steht vor der Generalsecke. Die Situation ist kritisch. Wenn man ihn mit nur einigermaßen gerechter Begründung vor dem Avancement abschieben kann, so wird man es aus mehr als einem Grunde tun.
Papa kennt den Rummel; er weiß, wie es gemacht wird. Er wehrt sich mit allen Kräften dagegen. Nicht nur, weil seine wirtschaftliche Existenz durch die Beförderung gesicherter wird, nein – und das ist für ihn ausschlaggebend –, weil er fest davon durchdrungen ist, daß sein Verbleiben im Dienst einen Gewinn für die Armee bedeutet, daß er auf Grund seiner überlegenen Fähigkeit einen gerechten Anspruch hat, höher zu steigen.
Bei Mama liegt die Sache anders. Papas Abschied würde sie tatsächlich zerbrechen. Der Traum ihres Lebens ist: Papa muß General, muß Exzellenz werden und zum mindesten den persönlichen Adel erhalten. An diese Vorstellung hat sie sich wie an eine fixe Idee die letzten zehn Jahre geklammert. Sie will es partout ihren adelsstolzen Verwandten beweisen, daß sie recht gehabt hat, als sie dem bürgerlichen Oberleutnant ins Ehebett folgte. Und um dieser Schrulle willen muß Papa befördert werden, oder ihr Lebensglück geht in Scherben.
Arme Mama! Wenn es nicht aus dem Kirchenbuch und dem Standesamtsregister untrüglich und urkundlich hervorginge, daß du mich neun Monate getragen und zur Welt gebracht hast, ich würde es ableugnen, so im wesentlichen sind wir aus anderem Holz geschnitten.
Mir kommen derartige Kalküls so lächerlich vor, daß sie nicht einmal in einem Kanarienvogelgehirn Raum haben dürften. Was geht mich der armselige Bettel von Stand und Titel an? Was schiert mich eine Verwandtschaft, die ihre Achtung von dem Grade der Beförderung abhängig macht! Mein Hochmut wehrt sich dagegen, daß ein dritter mich überhaupt erhöhen oder erniedrigen kann. Ich selbst erniedrige mich vor Gott und dem Genie, das Gottes teilhaftig und ein Beweis seiner Existenz ist. Aber vor den Menschen der Ebene mich beugen, nie und nimmermehr!
Genug für heute! Ich grüße Dich, meine liebste Freundin. Ich schütte Dir mein Herz aus, obschon ich weiß, daß diese Blätter Dich nie erreichen werden. Aber es ist mir ein leiser Trost in meinen Nöten, daß ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann, mich zur Rechenschaft vor mir selbst nötigt. Tauge ich nichts im Dasein, so will ich wenigstens den Prozeß, der hier oben in den Bergen sich abspielt und letzten Endes mein Prozeß wird, mit unbedingter Ehrlichkeit buchen.
14. Juni.
Aller Augen sind spannungsvoll auf mich gerichtet. Leutnant von Borck hat mir geschrieben, Mama hat den Brief aufgefangen und mir übergeben. Ich stecke ihn achtlos in meine Handtasche und unterhalte mich mit ihr und Christinen von gleichgültigen Dingen.
»Möchtest du den Brief nicht wenigstens öffnen?« fragt Mama und ihre Stimme klingt vor Erregung hart und trocken.
»Nein,« sage ich, »das eilt nicht«, denn ihr Ton reizt mich, fordert meinen Widerspruch heraus.
»Der Brief ist von Borck, wir kennen seine Handschrift, was zierst du dich also?«
»Verzeihe! Einen Augenblick! Ist der Brief an Mama, an dich, oder an mich gerichtet? Nun gut, er ist an mich adressiert. Ich bin nicht neugierig. Ich werde ihn vor dem Schlafengehen lesen.«
Christine lacht gellend auf, und ich verlasse die beiden.
Ich gehe in mein Zimmer und riegle hinter mir zu. Ich fühle, wie mir die Tränen aus den Augen stürzen. Weshalb bin ich gegen Mama so grausam? Weshalb begreife ich sie nicht aus ihrem Wesen heraus und verlange von ihr Dinge, die außerhalb ihrer Art sind? Liegt darin nicht eine Anmaßung ohnegleichen?
Langsam öffne ich Leutnant Borcks Brief. Er schreibt in großen, ungelenken, beinahe kindlichen Schriftzügen. Er kann vor drei Wochen nicht bei uns sein. Kurz vor der Ernte hat er seinen Inspektor an die Luft setzen müssen, Veruntreuungen usw. Bevor nicht Ersatz da ist, muß er selbst zugreifen. Aber er sehnt sich nach Ruhe, hofft uns alle bei guter Gesundheit anzutreffen, freut sich insbesondere auf mich.
Ich lese den Brief noch einmal und spüre, daß mich ein unangenehmes Empfinden beschleicht. Sei es, daß ich gegen ihn voreingenommen bin, sei es, daß tatsächlich zwischen den Zeilen eine Art von Anmaßung und Selbstsicherheit liegt, die mich erregt. Reichtum erzeugt eine Atmosphäre, die mir widerwärtig ist, ein Selbstbewußtsein, das ich ablehne. Etwas Gönnerhaftes klingt aus seinen Worten, ein Durchdrungensein, daß er das Glück in unser Haus bringt, daß ich voll Seligkeit in seine weitgeöffneten Arme fliegen werde. Er ist der Gebende, wir, also auch ich, die Empfangenden. Ein bißchen Demut unsererseits ist am Platz. Es kommt nicht alle Tage vor, daß ein reicher Herr einem armen Mädchen die Hand bietet. Das wird einem, ohne daß es eigentlich recht ausgesprochen wird, doch ziemlich unverblümt unter die Nase gerieben. Was geht mich sein Inspektor an? Was kümmert es mich, daß ein Rittergut von 10 000 Morgen dem Besitzer Mühe und Plage schafft.
So wenigstens lese ich seinen Brief. Indessen, Herr Leutnant, Sie irren. So weit sind wir noch nicht. Vertraulichkeiten lehne ich ab. Und vielleicht ist es ein kleiner Irrtum Ihrerseits, daß jede Ware käuflich ist. Ich für mein Teil stehe außerhalb Ihres Kurses.
Als ich wieder aus dem Zimmer trete, eilt mir Mama mit bekümmertem Gesicht entgegen. Sie hat seit einiger Zeit eine Art von Leichenbittermiene je nach Bedarf parat, die mich zur Verzweiflung bringt. Und war ich fünf Minuten vorher noch bereit, ihr mein ungezogenes Benehmen abzubitten, so werde ich bei ihrem Anblick wieder störrisch und verschlossen. So hart, so unkindlich es klingt: die Mama hat kein Verständnis für mich, sie geht fremd an mir vorbei, ihr fehlt es an Takt, mein Inneres aufzuschließen.
Zuweilen stelle ich an mich die bange Frage, ob ich meinem Kinde gegenüber auch einmal so unbegabt sein werde. Mütter müssen um ihre Töchter werben. Es ist unbillig, von vornherein Vertrauen zu fordern, oder gar auf dem Schein der Dankbarkeit zu bestehen. Von Gehorsam will ich gar nicht reden. Denn es ist doch würdelos, zwischen Eltern und Kindern einen Zustand wie den zwischen Herr und Diener schaffen zu wollen.
Ich werde ganz gewiß meinem Kinde mit Ehrfurcht gegenübertreten. Ich werde mich erinnern, wie Mama mit ihrer Pädagogik sich mir entfremdet, mit ihrer Neugier mich beleidigt hat.
Werde ich je in die Lage kommen, Erinnerungen solcher Art aufzufrischen? Spiele ich vielleicht unter der Schwelle meines Bewußtseins doch schon mit dem Gedanken, Leutnant Borcks Frau zu werden, mit ihm auf sein Rittergut zu ziehen, und die Familie zu retten?
Nein, ich kann nicht, kann mich nicht hingeben, ohne zu wollen, ohne zu begehren. Das Gericht esse ein anderer, ich nicht. Ich komme nicht darüber hinweg, daß ich wie eine Ware gekauft, verkauft werden soll. Der Kaufpreis beträgt in preußisch Kurant zehntausend Mark; ich bezahle die Liebesnächte meines Bruders. Nein, ich zahle nicht. Es ist eine tolle Zumutung, daß ich mit meinem Leib und meinem Leben fremde Rechnung begleichen soll. Das geht über Elternrecht und Kindespflicht hinaus.
Mama fragt, was Herr von Borck geschrieben hat, und ich antworte voller Schadenfreude, er sei unabkömmlich, sein Inspektor sei ihm durchgebrannt.
Mamas Züge sind von einem hektischen Rot überflammt. Sie will etwas erwidern, aber sie verschluckt sich, als ob eine Fischgräte ihr in die Kehle geraten wäre. Ich will ihr helfen, aber sie wehrt lautlos ab und wendet mir den Rücken.
Einen Augenblick stehe ich betroffen da, finde ich mich selbst nicht mehr zurecht. Ich kann nicht anders. Man ist, wie man ist. Und der Vorsatz und Wille zur Güte ist schon an und für sich irrsinnig. Er schließt eine Freiheit des Handelns in sich ein, die nicht existiert. Als ob es in meiner Macht stünde, den Atem zehn Minuten anzuhalten! Wir werden bewegt, ein Etwas treibt uns ... So, jeder Antrieb von innen hört also auf? Entwicklung und Aufstieg sind Wahnideen? Und Dämonen jagen uns? Wie kommt es denn, daß wir innere Stimmen hören, daß wir jeder schmutzigen Handlung uns schämen, daß in uns ein Schaltwerk ist, das mit erstaunlicher Präzision unsere Entgleisung signalisiert?
Ach, ich rühre an Dinge, mit denen die Gescheitesten im Lande nicht fertig geworden sind. Ich lebe, strebe, bin und kenne weder meinen Anfang, noch ahne ich mein Ende. Wo ist meine Freiheit, wo meine Gebundenheit ...?
16. Juni.
Die Sonne hat die Berge durchglüht, und ich liege auf der Wiese und blicke in den klaren Äther. Ringsum tiefe Stille, ein Losgelöstsein von allem Weltlichen, von allen Begierden, ein wunschloser Zustand, in dem man sich eins fühlt mit dem All, wieder aufgenommen in die große Vaterschaft, beschattet von dem Heiligen Geist. Und alles ist so kristallklar, so Natur, so ganz enträtselt, daß einem die Komplikationen des Daseins als eine unbegreifliche Gedankenflucht erscheinen, als ein wüster Traum, der nur in unserer kranken, erregten Phantasie sein Erdreich hat.
Wir klammern uns an fixe Ideen, weil wir uns selbst verloren haben. Der rechte Weg liegt vor uns, aber wir verbinden uns die Augen, um ihn nicht zu sehen. Unser Geblüt ist schwer, und unser Gemüt ist krank. Hilfe, ein Arzt wird gesucht!
Papa hat einen Irrendoktor gekannt, zu dem ein Kollege sagte: Lieber Freund, ich glaube, Sie sind auch nicht normal. Worauf jener prompt erwiderte: Stimmt, aber haben Sie überhaupt jemals einen normalen Menschen gesehen? Etwas verrückt sind wir mehr oder minder alle.
Aber wenn wir ver-rückt sind – man achte auf den ursprünglichen Sinn des Wortes –, dann muß es doch eine Möglichkeit geben, seinen alten Standpunkt wieder zu gewinnen, Ebenso wie ich einen Gegenstand fortrücken und ihn wieder auf seinen alten Platz setzen kann, muß es auch in meinem Vermögen liegen, in meine Einfalt und Ursprünglichkeit zurückzukehren. Vielleicht haben wir zu viel dummes Zeug in uns aufgenommen, zu viel gelernt, und das ganze Kunststück bestünde darin, wieder zu vergessen, den unnützen Ballast fortzuwerfen, um wieder leicht und frei zu werden. Mehr Diätetik statt Ästhetik.
Ach, ich bin meinem Allempfinden wieder entrückt, ich grüble, ich starre auf die grünen Nadelbäume, auf die grüne Matte, auf die dunklen, bewaldeten Berge mit den abgeholzten Flächen, die goldbraun in der Sonne funkeln. Und mein Blick fällt in das weite Tal, in dem die Menschen ihre niedrigen Häuser, ihre kleinen Gefängnisse gebaut haben. Und durch die weite Ebene schlängeln sich wie weiße Adern die schmalen, gewundenen Wege. Herrgott, zeige mir den rechten Weg, den ich gehen muß. Abseits von den dunklen, schmutzigen Gassen führt eine freie, gerade Straße zur Höhe. Ich habe den Weg verloren, hilf ihn mir finden!
Am Abend desselben Tages.
Wir sitzen alle um den Sofatisch am äußersten Ende des Saales. Die Azetylenflammen sind entzündet und durchfluten mit ihrem gelben, hellen Licht den großen Baudensaal mit der braunen, hölzernen, von Balken durchquerten Decke. Der Wirt ist Förster von Beruf. Die drei Gaskronen sind aus Geweihen kunstvoll von ihm gefertigt, und Geweihe, große und kleine, schmücken überall die Wände.
Wirt und Wirtin sind jung. »Ich habe die Geweihe an die Wand geschlagen, damit das Weib mir keine Hörner aufsetzt. Wer ein Jäger ist, baut rechtzeitig vor und traut keinem Wilde.«
Der Wirt lacht und legt die schwere Hand auf die Schulter der zarten Frau.
Ich glaube, mit Zeigefinger und Daumen würde er ihr die Kehle abschnüren, wenn sie sich zu mucksen getraute. Herr und Hörige! Und da steht die geladene Flinte. Wehe dem, der in sein Gehege einbricht!
Ein leichter Schauder überkommt mich. Ich habe zur Magd nicht die geringste Veranlagung und wäre dennoch elend, wenn ich nicht meinen Herrn fände.
Leutnant von Borck mag sich hüten, der Kaufpreis könnte ihm hoch zu stehen kommen. Ich fürchte, mit zehn braunen Lappen ist es nicht getan.
Alles, was eine Frau in ihrem Schade,! wälzt, ist abgeschmacktes schales Zeug. Ich darf von mir sagen, ich habe niemals an die sogenannte Emanzipation der Frauen geglaubt, an die Arbeit ihrer Hände: ja, an die ihres Hirns: nein.