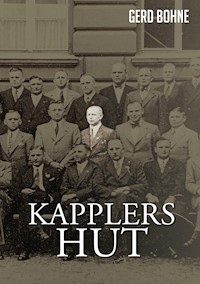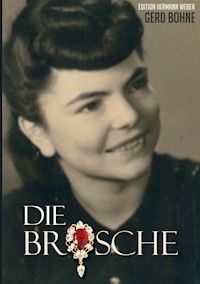
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Erlebnisse des Hermann Weber
- Sprache: Deutsch
Fast 60 Jahre nach Kriegsende taucht völlig unerwartet im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Deutschland ein verschollen geglaubtes Schmuckstück auf. Der Fundort ist ungewöhnlich: Es steckt in der Kleidung eines Mannes, der tot am Ufer der Elbe gefunden wird. Doch wer ist der Mann und wie gelangte er in den Besitz der Brosche? Die Spur führt ans Kriegsende im Frühjahr 1945 und in das Archiv der Gestapoleitstelle Prag. Sie führt zu Verbrechen, die bis in die Gegenwart wirken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Personenregister
Prolog
09.08.2005, Decin/Tschechien
Es braut sich etwas zusammen
26.06.2005, Vormittag, Jerichow
26.06.2005, Nachmittag, Usti nad Labem
27.06.2005, Mittag, Chur/Schweiz
24.07.2005, Vormittag, Jerichow
25.07.2005, Vormittag, Burgdorf/Hannover
02.08.2005, Vormittag, Magdeburg, Rasthof Börde
03.08.2005, Später Nachmittag, Usti n. L.
05.08.2005, Vormittag, Jerichow
08.08.2005, Vormittag, Jerichow
Der Sog entwickelt sich
11.08.2005
Vormittag, Königstein, Sächsische Schweiz,
Abend, Dresden, Gerichtsmedizin
Abend, Dresden, Polizeipräsidium
Später Abend, Dresden, Polizeipräsidium
12.08.2005
Vormittag, Burgdorf/Hannover
Vormittag, Kriminalpolizei, Usti n. L./Aussig
Früher Nachmittag, Kriminalpolizei, Usti n. L.
Nachmittag, Usti n. L., Plattenbau Na Teraza
Früher Abend, Usti n. L., Na Teraza
Abend, Usti n. L., Na Teraza
Anfang Juni 2005, Prag, Hotel Duo
13.08.2005
9.00 Uhr, Usti n. L.
10.00 Uhr, Usti n. L.
Mittag, Prag
Nachmittag, Usti n. L.
15.08.2005
10.30 Uhr, Usti n. L., Polizeiabschnitt Na Teraza
13.00 Uhr, Usti n. L.
14.45 Uhr, Melnik
15.45 Uhr, Most/Brüx, Tagebau Armada
18.30 Uhr, Melnik
21.15 Uhr, Prag, Rechtsmedizin
16.08.2005
Morgen, Usti n. L., Polizeipräsidium
Vormittag, Usti n. L., Sparkasse
Nachmittag, Prag
17.08.2005
Vormittag, Usti n. L., Polizeipräsidium
Nachmittag, Prag, Innenministerium
Rückblende 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit
Szene 3 28.05.1957, 9.00 Uhr, Padua/Italien
Nachmittag, Prag, Innenministerium
19.08.2005
Vormittag Usti n. L., Polizeipräsidium
Mittag, Usti n. L., Polizeipräsidium
Rückblende 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit
Szene 1 24.10.1944, Gardone, Villa Fiardolino
Szene 2 24.10.1944, Gardone, Villa Fiardolino
23.08.2005
Früher Nachmittag, Prag, Vinohradsky
29.08.2005
Morgen, Usti n. L., Mordkommission
Vormittag, Usti n. L., Polizeipräsidium
02.09.2005
Nachmittag, Usti n. L., Polizeipräsidium
Rückblende 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit
27.10.1944, Szene 4 23.00 Uhr, Meran (Südtirol)
28.10.1944, Szene 5 05.30 Uhr, Gardone, Villa Fiardolino
03.09.2005
Vormittag, Dresden, Polizeipräsidium
Vormittag, Usti n. L., Polizeipräsidium
04.09.2005
Vormittag, Usti n. L., Polizeipräsidium Mordkommission
Später Vormittag, Usti n. L., Mordkommission
Mittag, Usti n. L., Mordkommission
Nachmittag, Prag, Hotel Duo Raum Vjesnik
Früher Abend, Prag, Hotel Duo
18.45 Uhr, Prag, Parkplatz Hotel Duo
04.10.2005
Mittag, Dresden, Heidefriedhof
06.10.2005
Mittag, Burgdorf/Hannover
Der Sog entwickelt sich
Szene 1 August 2003, Stendal, Plattenbau
Szene 2 Ende August 2003, Stendal, Hotel Schwarzer Adler
Szene 3 Juni 2005, Lulea, Nordschweden
15.11.2005
Morgen, München, Literaturarchiv Monacensia
Rückblende 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit
Szene 6 25.4.1945, 9.00 Uhr Gardone, Villa Mirabella
05.12.2005
Mittag, Stendal
10.01.2006
Morgen, Prag, Geheimes Staatsarchiv des Innern
12.01.2006
Vormittag, Rovagnate, Lombardei, Italien
28.01.2006
Prag, Innenministerium
Danksagung
Abkürzungsverzeichnis
Der Autor
Personenregister
Hermann Weber, Deutscher Projektentwickler und Hobbyhistoriker
Rosa Cigara, Tschechische Rechtsanwältin mit aufregender Familiengeschichte
Egon Watepfuhl, nach Tschechien emigrierter deutscher Finanzfachmann
Marta Blinkova, Watepfuhls tschechische Partnerin mit stark entwickelten Eigeninteressen
Gundolf Wernicke, Deutscher Unternehmer, hofft auf Hilfe von Watepfuhl
Reinhard Möckel, Kontaktmann von Watepfuhl und Freund von Wernicke
Dr. Remy Wöhler, Schweizer Jurist und Finanzfachmann
Urs Bertoli, Schweizer Finanzfachmann
Horst Liebscher, Deutscher Vermittler, Kontaktmann von Watepfuhl
Zlatka Blinkova, Martas Mutter
Pavel Slansky, Tschechischer Unternehmer
Nguyen Van To, Vietnamesischer Unternehmer, Inhaber einer Schneiderei
Petr Novak, Unternehmer, Tscheche, Eigentümer eines Hotels in Prag
Rudolf Rothgänger, Deutscher, alter Herr mit Vergangenheit in Prag und Lissabon
Ricardo Calabresi, Italiener, alter Herr, ehemaliges Mitglied der 52. Garibaldi-Brigade
Die Ermittler:
Prof. Dr. Johannes Bröcker, Leiter der Rechtsmedizin Dresden
Stefan Mettner, Kriminalhauptkommissar Dresden
Max Rotenborn, Kriminalhauptkommissar Dresden
Peter Schönfeld, Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Sachsen
Petros Papadopoulos, genannt „Papa“, Tschechischer Oberkommissar griechischen Ursprungs, Fachmann für Organisierte Kriminalität,
Adam Kratochvil, Oberrat der Tschechischen Kriminalpolizei
Petr Bouzek, Oberkommissar der Kriminalpolizei Usti/ Aussig
Pavel Cerny, Oberkommissar der Kriminalpolizei Usti/ Aussig
Nikola Veselova, Oberassistentin der Kriminalpolizei Usti/ Aussig
Oldrich Vlasov, Oberkommissar, Leiter der Spurensicherung Prag
Milena Markova, Kommissarin, Mitarbeiterin Spurensicherung
Personen der Zeitgeschichte:
Benito Mussolini, „Duce“, Führer des faschistischen Italiens
Clara Petacci, genannt „Claretta“, Geliebte von Benito Mussolini
Donna Rachele Mussolini, Ehefrau von Benito Mussolini, Mutter seiner Kinder
Herbert Kappler, SS- Obersturmbannführer, Chef des Sicherheitsdienstes SD in Rom
Franz Spögler, SS-Untersturmführer, persönliche Ordonanz für Claretta Petacci
Aldo Gasperini, Fahrer von Benito Mussolini
Dante Gorreri, Senator, Mitglied der Kommunistischen
Partei Italiens, ehemaliger Kommandeur der 52. Garibal-di-Brigade
Prolog
09.08.2005, Decin/Tschechien
Die Elbe hatte sich nach tagelangen schweren Regenfällen in ein reißendes Gewässer verwandelt. Am westlichen Ufer konnte man die Bahnstrecke zwischen Prag und Dresden, die sich über viele Kilometer direkt am Fluss entlang zog, im Wasserdunst nur erahnen.
Zwei Männer fuhren auf der gerade noch befahrbaren Nationalstraße zwischen dem nordböhmischen Decin und dem sächsischen Bad Schandau am Ostufer der Elbe Richtung Grenze.
Sie hatten sich im Wetterchaos des 9. August in dieser frühen Nachmittagsstunde auf den Weg gemacht. Ihr Kombi vom Typ Skoda Octavia trug an beiden Seiten die Aufschrift Hasici, das tschechische Wort für Feuerwehr.
Die Insassen trugen Regenschutzjacken des Feuerwehr-Rettungskorps. So bestand für einen Beobachter keinerlei Anlass, an den lauteren Absichten der etwa fünfund dreißig und fünfzig Jahre alten Männer zu zweifeln.
Die Straßensperre am Marktplatz von Decin ließen sie ohne Probleme hinter sich, das Fahrzeug und die Jacken wirkten wie ein Passierschein. Kein Mensch kam auf die Idee, eine Durchsuchung des Autos und des Kofferraums vorzunehmen.
Der jüngere der beiden Männer sah missbilligend aus dem Autofenster.
„Ein absolutes Mistwetter, der Regen steht aber so richtig in den Bergen drin. Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür.“
„So soll es sein. Für uns eine hervorragende Gelegenheit unseren Auftrag sauber zu erledigen, mein Lieber.“
Sie passierten eine verlassene deutsche Kirche und den Elbhafen mit seinen Lagerhäusern, Schrotthaufen und Kränen. Einige Binnenschiffe lagen angedockt am Kai, der Ladebetrieb war wegen der Unwetterwarnungen eingestellt worden.
Ihr Ziel lag etwa zwei Kilometer vom Hafen entfernt links an einem Hang direkt an der Elbe. Es handelte sich um ein Einfamilienhaus, von dem nur Giebel und Dach das Niveau der ansteigenden Straße überragten. Eine rote Leuchtreklame mit Herzchen und der Name Na Venusa ließen keine Zweifel darüber aufkommen, wie das Objekt genutzt wurde.
Vor einigen Jahren hatte der ältere der beiden diese Strecke schon einmal genommen, um das rege Treiben im Grenzgebiet zu Deutschland selbst in Augenschein zu nehmen. Er hatte damals die Straße verlassen und war einen kurzen, schmalen Weg entlang zu einem asphaltierten Parkplatz direkt am Gebäude etwa fünf Meter oberhalb des Flusses gefahren.
Hier stellte er sein Fahrzeug ab, warf einen kurzen Blick auf die Elbe und betätigte die Klingel an der Eingangstür. Kurze Momente später spürte er förmlich den Blick durch den Türspion und es öffnete sich eine Klappe in der Tür. Hell blondiertes Haar und ein grellrot geschminkter Mund wurden sichtbar.
Ein kurzer prüfender Blick auf den Besucher und er durfte in eine Art Vorraum eintreten. Ein reiferes Semester mit wogendem Busen führte ihn durch einen kleinen Flur in ein rechts abgehendes Zimmer. In diesem Raum befand sich eine schön verspiegelte Bar samt Barmann, das Ambiente jedenfalls machte einen gepflegten und angenehmen Eindruck.
„Was können wir für dich tun, mein Schatz?“, flüsterte ihm die üppige Blondine ins Ohr.
„Ich hätte gern ein wenig Entspannung“, antwortete er grinsend, „ein wenig spezieller als die schnellen 08/15-Nummern. Ich bevorzuge junge, sehr junge Damen, wenn wir uns verstehen.“
Die Blondine lächelte ihn an. „Ich denke, dass wir deinen Wunsch erfüllen können, mein Schatz.“ Zum Barmann gewandt sagte sie: „Hol die Hühner herunter!“
Kurze Augenblicke später standen drei blutjunge Sinti- oder Roma Mädchen vor ihm, die er lüstern beäugte.
Zwei der Mädchen, vermutlich nicht älter als zehn oder zwölf Jahre, waren ihm in den nächsten zwei Stunden für kleines Geld in einem der Séparées zu Diensten.
Diesem ersten Besuch folgten viele weitere, denn das Personal des Na Venusa erfüllte seine speziellen Bedürfnisse. Er hatte eine Vorliebe für südländisch aussehende Mädchen. Die Mädchen stammten zwar überwiegend aus Moldawien oder aus Südosteuropa und waren der Landessprache nicht mächtig, aber das focht ihn nicht an.
Er fuhr nicht zum Reden nach Decin. Das Telefon klingelte nach seinem ersten Besuch in regelmäßigen Abständen und man informierte ihn, immer wenn ein Wechsel beim Servicepersonal erfolgt war.
Heute aber hatte er schon weit vor seiner erwarteten Ankunft ein Telefongespräch mit dem Na Venusa geführt.
„Was kann ich für Sie tun?“, hatte sich der Barmann gemeldet.
„Wir sind jetzt unterwegs. Sorge wie abgesprochen dafür, dass die Mädels für ein paar Stunden zu einem kleinen Betriebsausflug verschwinden. Wir werden in ungefähr einer Stunde am Haus sein und möchten dann niemanden mehr sehen. Haben wir uns verstanden?“
„Okay, okay, alles klar!“
Sein Boss hatte den Barmann auf diesen Anruf vorbereitet. Er legte den Hörer auf, stürmte die Treppe hinauf und riss jede der vier Türen zu den Zimmern auf. Sein unmissverständlicher Kommandoton duldete schon durch seine Intonation keinen Widerspruch. „Dawai, Dawai!“
Diese gebellten Kommandos waren für die zwei blutjungen Moldawierinnen und die beiden rumänischen Sinti-Mädchen so unzweideutig, dass sie ein paar Sachen griffen und mit schnellen Schritten halbnackt die Treppe hinunterliefen. Der Barmann stand am Fuß der Treppe und deutete Schläge an, wenn das Verlassen des Na Venusa nicht rasch über die Bühne gehen würde. Die Mädchen rannten durch den Regen zu einem Skoda Octavia mit abgedunkelten Fenstern. Die Türen waren zum Einstieg schon geöffnet. Nachdem alles zur Abfahrt bereit war, setzte sich der Octavia sofort in Bewegung und verließ mit quietschen Reifen die unwirtliche Stätte in Richtung Teplice.
Etwa vierzig Minuten später traf der Kombi mit den beiden Männern am nun leeren Etablissement ein. Auf den letzten Kilometern waren ihnen Einsatzfahrzeuge mit deutschen Kennzeichen entgegengekommen. Es war keineswegs ungewöhnlich, dass sich Fahrzeuge mit Angehörigen paramilitärischer Einheiten aus Deutschland und Tschechien in den Grenzgebieten aufhielten. In Krisenzeiten wie dieser waren grenzüberschreitende gemeinsame Hilfeleistungen an der Tagesordnung, sogar die Bürokratie sah davon ab, dass sich Angehörige des anderen Staates erst eine formale Bewilligung für ihren Einsatz beschaffen mussten.
Den beiden Männern in Uniformjacken der tschechischen Feuerwehr waren diese Formalitäten völlig egal. Der Ältere bedauerte es allerdings zutiefst, dass es bei diesem Besuch nur darum ging, sich der Fracht im Gepäckraum des Skoda zu entledigen. Keine Chance, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Der Jüngere am Steuer bugsierte das Fahrzeug geschickt mit dem Heck bis einen Meter vor die Abbruchkante zur Elbe. Sie öffneten die Heckklappe, ließen die Abdeckung des Kofferraums zurückschnappen und entnahmen der Ladefläche einen ungefähr zwei Meter langen, in dunkelgraue Plastikplanen eingewickelten Gegenstand. Die Plastikplanen schlotterten um das Objekt, sollten offensichtlich nur die Neugier möglicher Beobachter irreführen. Aber auch ein ungeübter Zeuge hätte blitzschnell erkennen können, dass es sich dabei um einen menschlichen Korpus handelte.
Die Männer gingen ausgesprochen ruhig und gelassen zu Werke. Sie waren sich sicher, unbeobachtet zu agieren.
Weit und breit keine Besiedlung, die Elbe floss auf einer Strecke von mehr als zwei Kilometern durch eine kleine Schlucht und der Einschnitt hatte an dieser Stelle den Namen Elbe Canyon erhalten.
Der Ältere gab ein leises Kommando und schon schulterten sie das bewegungslose menschliche Paket, trugen es an den Rand des Felsvorsprungs und entledigten sich mit einem weiteren Kommando ihrer Fracht. Das Paket fiel taumelnd etwa fünf Meter tief in die reißende Elbe.
Es war fast so, als ob sich der Fluss über den neuen Fraß, der ihm übergeben worden war, freute. Die Elbe sog den verpackten Körper auf, wirbelte ihn unter Wasser wie ein Spielzeug herum und fing bereits auf den ersten Metern an, die Verpackung zu zerlegen. Das dunkelgraue Paket tauchte noch ein oder zwei Mal aus den gurgelnden Wellen auf und verschwand danach auf Nimmerwiedersehen in Richtung Deutschland.
Die Männer stiegen wieder in ihren Wagen und passierten die Kontrollen bei der Ausfahrt aus den Hochwassergebieten ebenso ungestört wie sie hineingekommen waren. Ihr Ziel war ein entlegener, halb verfallener Dreiseithof, ein Relikt aus der Zeit der deutschen Besiedlung dieser Gegend.
Die Männer übergossen das Fahrzeug mit Benzin und warfen die Uniformjacken des Zivilschutzes auf den Rücksitz des Fahrzeugs, um auch diese Spur zu vernichten. Vor dem verfallenen Hof wartete bereits ein unauffälliger VW-Golf mit tschechischem Kennzeichen, der die beiden nach erledigter Arbeit aufnahm und mit ihnen in Richtung Prag davonfuhr.
Die Elbe vergnügte sich unterdessen mit dem ihr anvertrauten Paket, schleuderte es hin und her, tauchte es unter, ließ es wieder auftauchen, verpasste ihm den einen oder anderen Stoß; es war als ob der Fluss wissen wollte, was sich in diesem merkwürdigen Bündel verbarg.
Als der erste Riss in der Plastikumhüllung, erst ganz fein und dann immer größer, entstanden war, gab es kein Halten mehr für das Element.
Der sorgsam verpackte Leichnam wurde im wilden Spiel des reißenden Flusses fast vollständig von seiner Plastikhaut befreit und zum Vorschein kam ein in einen feinen dunkelblauen Anzug mit passender Weste, weißen Hemd und Krawatte gewandeter, etwa fünfzigjähriger, männlicher Körper. Die tosende Jagd ging weiter und führte dazu, dass dem Toten durch herumrasende Baumstämme und Paletten die Extremitäten an mehreren Stellen zerschmettert wurden. Der Körper verfing sich in einem Geflecht aus Zäunen, Ästen und Möbeln an einer Brücke, wurde am Brustkorb von einem mitgerissenen Motorrad schwer getroffen. Ein Geschoss in Form eines Kantholzes traf ihn schwer am Schädel. Als sich die Blockade an dem Brückenpfeiler auf wundersame, zufällige Weise auflöste, schien es, als ob der Fluss nun genug mit dem Körper gespielt hatte.
Eine der Verwirbelungen führte dazu, dass der Leichnam aus dem reißenden Strudel entkam und in die ruhigeren Uferbereiche getrieben wurde. Hier wurde er von einer folgenden Flutwelle aufgenommen und noch einige hundert Meter am Uferbereich entlang, mitgetragen, bis er sich endgültig in einem Gewirr von Ästen verhedderte.
Es braut sich etwas zusammen
26.06.2005, Vormittag,
Jerichow
Egon Watepfuhl hatte das sichere Gespür des Raubtieres für naive Zeitgenossen. Ein gefundenes Fressen waren Hilfe suchende aus Ostdeutschland, in der Regel selbständige Unternehmer mit wenig Kapital vor der Brust. Sein Spannemann Reinhard Möckel aus dem früheren Bezirk Magdeburg hatte beste Kontakte, besonders in der Baubranche, in der es nach der Wende viele Gründungen kleiner und mittelständischer Unternehmen gegeben hatte. Möckel sprach ihre Sprache und hatte wahre Wunderdinge von dem Finanzgenie mit besten Kontakten in Tschechien erzählt.
Hermann Weber kannte diesen Typ Unternehmer aus dem ehemals sozialistischen deutschen Osten. Mit einem großen Schwung in die Selbständigkeit gestartet, zumeist wenig kapitalisiert und vom Goodwill der Banken abhängig, das waren typische Charakteristika für diese mutigen Menschen. Hermann hatte vielen von ihnen als Gründungsberater bei den ersten Schritten in den Kapitalismus geholfen, bis man der Meinung war, auf seine Dienste verzichten zu können.
Mit der Zeit entspann sich um Hermann Weber, den Gründungsberater, ein großes Netzwerk von vielen Kontakten, in dem auch irgendwann Reinhard Möckel auftauchte. Damit entstand der Kontakt Hermanns zu dem vermeintlichen allwissenden Finanzgenie Egon Watepfuhl.
Watepfuhl profitierte von der restriktiver werdenden Kreditvergabe der ostdeutschen Banken, die den kleinen Selbständigen oft genug damit drohten, den Hahn zuzudrehen und die Betriebe vom Zufluss frischen Geldes abzuschneiden.
Hermann wurde neugierig auf die Angebote, die Watepfuhl zu präsentieren hatte und hörte sich dessen Prahlereien mit immer größerem Erstaunen an. Es eröffnete sich eine Welt des großen Geldes, von der Hermann bisher allenfalls gerüchteweise gehört hatte. Er erledigte für Watepfuhl gelegentlich kleinere Freundschaftsdienste in Deutschland und fuhr irgendwann relativ regelmäßig ins tschechische Usti nad Labem.
Dort traf er immer wieder auf hoffnungsfrohe ehemalige DDR-Bürger, die sich von Watepfuhl die Lösung ihrer finanziellen Probleme erhofften und auch bereit waren, die Provisionen für die Tätigkeit des Finanzgenies vorab in bar zu bezahlen.
Hermann Weber kamen diese Kunden vor wie die gutgläubigen Weihnachtsgänse, die dem Fuchs ihren Kopf in den Rachen legten, voller Vertrauen, dass dieser nicht zubeißen und sich den Leckerbissen entgehen lassen würde.
Es waren beileibe nicht alle mit grenzenloser Naivität geschlagen, die meisten rochen den Braten recht schnell, aber es gab auch die Ausnahmen, die ihr persönliches Desaster erlebten. Hermann konnte nicht behaupten, dass ihm diese Leute sonderlich leidtaten. Sie ließen wirklich jede Vorsichtsregel in ihrem geschäftlichen Gebaren außer Acht.
Einer dieser Bittsteller, genauso herablassend wurden sie von Watepfuhl behandelt, war der Elektroingenieur Gundolf Wernicke, eine stattliche Erscheinung, etwa einen Meter fünfundachtzig groß, einhundertfünfzig Kilo schwer, dadurch recht schwerfällig in seinen Bewegungen, die kranzförmigen Haare an den Seiten über die Ohren gekämmt, so gut wie immer mit einer Anglerweste bekleidet.
Wernicke hatte eine Vision. Er war Eigentümer eines großen Grundstücks in der Region Magdeburg, ostelbisch gelegen, das über ein großes bekanntes Vorkommen an hochwertigem Ton verfügte. Auf dem Gelände war schon seit Urzeiten eine Ziegelei beheimatet, die aufgrund der Qualität des Tones sehr hochwertige Ziegel produzieren konnte. Wernicke war ein durch und durch gutmütiger Mensch, der allem und jedem grundsätzlich erst einmal Vertrauen entgegenbrachte, insbesondere seinem vermeintlichen Freund Reinhard Möckel. Grenzenloses Vertrauen und grenzenloser Größenwahn waren zwei Antipoden, die sich in dieser Freundschaft nicht abstießen, sondern anzogen.
Möckel malte seinem Kumpel Wernicke ein großflächiges Gemälde einer Ziegelproduktion im großen Stil, nicht so kleinteilig wie bis dato. Wenn Reinhard Möckel von einer Sache wirklich Ahnung hatte, dann war es die Organisation von Produktionsabläufen in Betrieben der Baustoffindustrie, wie Ziegeleien, Kieswerke oder der Gewinnung von Zuschlagsstoffen für die Zementproduktion. Und so spannen die beiden vermeintlichen Freunde ihre Zukunftspläne und errechneten astronomische Investitionssummen von mehr als einhundertzwanzig Millionen Euro.
Das Gute an dieser Liaison war, dass Möckel neben dem technischen Sachverstand auch noch das Finanzierungskonzept einbringen konnte. Es war alles kein Problem, Egon Watepfuhl und sein Netzwerk schienen der Schlüssel zur allgemeinen Glückseligkeit zu sein.
Es war kein Problem, kurzfristig einen Termin mit Watepfuhl zu bekommen und so machten sich Möckel und Wernicke gemeinsam auf den Weg ins ferne Usti, genossen auf dem Weg dorthin die Freuden, die offenherzig am Fahrbahnrand angeboten wurden. Wernicke hatte sein großes Herz ganz weit geöffnet und spendierte seinem Kumpel Möckel ein Mittagessen im tschechischen Grenzort Dubi. In den Restaurants des Ortes an der Europastraße 55 gab es eine lukullische Besonderheit, den Bedürfnissen der Durchreisenden nach Schnelligkeit und Flexibilität angepasst. Zum Schnitzel mit Knödeln konnte man sich zum Dessert eine der Damen an der Theke aussuchen, die auf Barhockern sitzend, die Beine übereinandergeschlagen, ihre Reize den gierigen Blicken der Männer präsentierten.
Wernicke wusste um den Notstand seines Kumpels Möckel in dieser Richtung. Er hatte ein ums andere Mal den Klagen seines Freundes gelauscht, wenn dieser über seine Ehefrau geklagt hatte. Sie überragte ihren Mann um Haupteslänge und Wernicke konnte sich lebhaft vorstellen, dass Frau Möckel ihrem Ehemann bei unbotmäßigem Verhalten ab und an eine Tracht Prügel verabreichte. Eine Begebenheit im Hause der Eheleute Möckel war ihm besonders in Erinnerung geblieben.
Er hatte an der Haustür geklingelt und die Frau des Hauses hatte ihm geöffnet, eine imposante, vollbusige Erscheinung, nicht unbedingt schön, aber selbstbewusst.
Sie ermöglichte ihm einen Blick in den Wohnbereich, wo er seinen Freund im Hintergrund stehen sehen konnte, der ängstlich zur Tür schaute, um zu sehen, wer zu Besuch kam. Möckel hatte nichts weiter an als eine Feinrippgarnitur aus Unterhemd und kurzer, weiter Unterhose, die seinen Schritt nur sehr spärlich verhüllte, trug weiße Tennissocken und machte eine erbärmliche Figur.
Die Frau des Hauses sagte nur: „Schauen Sie sich diesen Typen an, Herr Wernicke!“ Sie deutete auf ihren Mann.
„Was für eine Memme. Endlich sieht einmal jemand, was für eine Pfeife dieser Gernegroß ist. Aber ich weiß, wie man diesem Bürschchen umgehen muss.“ Sie machte eine schlagende Bewegung mit ihrer offenen Handfläche.
Ihrem Angetrauten blaffte sie zu an: „Du gehst jetzt hoch und ziehst dich an …“
An Wernicke gewandt flötete sie: „Kann ich Ihnen etwas anbieten, Herr Wernicke?“
„Nein, danke“, antwortete er, „ich wollte mit Ihrem Mann nur kurz absprechen, wie wir unsere Fahrt zu den Tschechen organisieren.“
Frau Möckel machte ein ärgerliches Gesicht. „Ja, ja die Tschechen.“ Sie machte eine kurze Pause. „Sie brauchen mir nichts zu erzählen, Herr Wernicke. Der geile Bock will doch nur wieder nur mit den Zigeunerweibern an der Grenze herumhuren.“
„Ich werde schon auf ihn aufpassen.“
Frau Möckel zog ihre Augenbraue ein wenig hoch, als sie diese Worte Wernickes vernahm. Man sah ihr förmlich an, was sie dachte: Alles, wirklich alles traute sie den Kerlen zu, nur nicht, dass sie sich bei sich bietender Gelegenheit und fern der Heimat zu Kostverächtern wurden.
Auch nicht diesem braven Herrn Wernicke.
Auf der Fahrt nach Dubi war das Eheleben des Herrn Möckel tatsächlich Thema zwischen den beiden Männern gewesen und so lag es für Wernicke in der Tat auf der Hand, ein gutes Werk für einen Kumpel zu tun. Reinhard Möckel ließ sich erwartungsgemäß nicht lange bitten, er nahm die Einladung zum kostenlosen Sex schnell und gern an und verschwand mit seiner Auserwählten in einem der Hinterzimmer des Restaurants.
Wernicke hatte eine der wohl moldawischen oder rumänischen Frauen einen Augenblick zu lange und zu geil angeschaut, sodass diese dies zum Anlass nahm, zu seinem Tisch zu kommen, ihn an die Hand zu nehmen und ihn ebenso wie seinen Kumpel in ein Séparée im hinteren Teil des Etablissements zu führen, wo sie ihn gekonnt und professionell mit dem Mund befriedigte.
Etwa zwanzig Minuten später saß Wernicke wieder an seinem Tisch, an dem auch Möckel einige Minuten später entspannt grinsend auftauchte. Beide bestellten sich noch einen Kaffee, verließen dann fröhlich Zoten reißend dieses vermeintliche Restaurant im gastfreundlichen Dubi und machten sich auf den Weg entlang des Erzgebirgskamms ins 25 Kilometer entfernte Usti, wo das gefräßige Raubtier Watepfuhl auf sein nichtsahnendes Opfer wartete.
Wernicke empfand erst einmal Misstrauen, als er das Ambiente des Plattenbaus sah, in dem das Finanzgenie residierte. Aber sein Freund Möckel hatte wahre Wunderdinge über die Möglichkeiten erzählt, die Egon Watepfuhl seinen Kunden über sein internationales Netzwerk bieten könnte. Selbst ein Finanzierungsvolumen von mehr als einhundert Millionen Euro schien den Herrn nicht zu schocken, er warf mit noch viel größeren Zahlen um sich, die Wernicke beinahe von einem Schwindelanfall in den nächsten trieben. Hier im unscheinbaren, verschlafenen Usti, von dem er vorher noch nie etwas gehört hatte, schien tatsächlich jemand zu leben, der nonchalant alle vermeintlichen Probleme aus der Welt räumen konnte und für alles eine einfache Lösung zu haben schien.
Wernicke wurde auch nicht misstrauisch, als die Rede auf die Gebühren kam, die ein derartiges Volumen auslösen würde.
Alle Alarmglocken waren bei ihm ausgeschaltet, die Hinweise auf fällige Zahlungen bei Unterschrift unter den Vermittlungsvertrag für die Finanzierung waren von Watepfuhl geschickt in weitere Suaden über die in Aussicht stehende gloriose gemeinsame Zukunft verpackt.
Wernicke sah keinen Anlass an den Worten Egons, man war inzwischen auch zum Du übergegangen, zu zweifeln. Auch das Verhalten seines Freundes Möckel, der nur an den Lippen Watepfuhls zu hängen schien, sendete keine Signale für ein sich zusammenbrauendes Unheil. Egon hatte sich per Fax einen Vertragsentwurf von seinen schweizerischen Partnern schicken lassen, er war gut auf den Besuch vorbereitet, wollte die Anfrage zu einem Abschluss bringen. Hier war wirklich eine goldene, aber dumme Gans in seine Fänge geraten. Egon Watepfuhl legte den Vertragsentwurf zur Unterschrift vor Wernicke auf den Wohnzimmertisch und deutete auf eine freie Stelle auf dem Papier. „Gundolf, du musst hier unterschreiben.“
Wernicke nahm den Vertrag in die Hand. „Einen Moment noch“, sagte er und schaute auf den Vertrag, „ich will wissen, was ich unterschreibe.“
Watepfuhl wurde nervös, fing mit seinem rechten Bein an zu zittern. „Gibt es denn irgendwelche Probleme?
Ich habe doch alles ausführlich erklärt.“
Wernicke sah ihn an. „Das schon“, sagte er nachdenklich, „aber dieser Vertrag ist in englischer Sprache abgefasst und ich spreche kein Englisch.“
Jetzt schaltete sich Möckel ein.
„Gundolf“, sagte er und schaute zwischen den beiden Männern hin und her. „Egon hat wirklich umfassend erklärt, wie dieses Geschäft laufen kann. Ich sehe keinen Grund, warum du diesen Vertrag nicht unterschreiben willst.“
„Davon kann doch keine Rede sein, Reinhard“, erwiderte Wernicke, „natürlich will ich unterschreiben.“ Er wirkte jetzt kleinlaut, „aber mir wäre wohler, wenn ich den Inhalt dieses Vermittlungsvertrages verstehen würde.“
„Hast ja recht, Gundolf“, warf Egon nun ein, nahm sich den Vertrag und sagte: „Ich werde ihn für dich übersetzen.“ Er fing an, die vermeintlichen Details des Papiers zu erläutern. Beide, Möckel wie Wernicke, konnten Egon Watepfuhl zwar inhaltlich folgen, aber nicht beurteilen, ob das, was als vermeintliche Übersetzung präsentiert wurde, auch tatsächlich in dem Entwurf enthalten war.
Und so kam, was kommen musste, die Naivität feierte ein Hochamt und Wernicke nahm sich den bereitliegenden Stift und unterzeichnete den Vermittlungsvertrag für die Beschaffung einer Finanzierungssumme von einhundert Millionen Euro zuzüglich Vermittlerprovisionen.
Die Beschaffung der einhundert Millionen war an hohe Auflagen gebunden, die von Watepfuhl wohlweislich nur zum Teil übersetzt worden waren, denn ein Blinder hätte erkennen können, dass selbst einfachste Formfehler zur Ablehnung des Finanzierungsantrages führen würden. Die Vermittlungsprovision von ungefähr einhunderttausend Euro war dagegen, ohne dass irgendeine Gegenleistung erbracht worden wäre, sofort fällig. Das Risiko lag allein bei Wernicke und der hatte keine Ahnung, was nun folgen sollte.
„Gundolf“, begann Egon Watepfuhl, „wir haben noch nicht besprochen, wie wir das ganze Verfahren bis zur Auszahlung der Finanzierung in Gang bekommen können.“ Er räusperte sich ein wenig verlegen. „Es sind circa einhunderttausend sofort fällig. Die brauchen wir, um alle eingeschalteten Makler ins Laufen zu bringen.“
Kurze Pause. „Hast du das Geld?“
Wernicke glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Er schluckte einige Male und schnappte hörbar nach Luft.
„So viel Bargeld habe ich natürlich nicht. Was kann man denn da machen?“
Jetzt konnte Möckel einen konstruktiven Beitrag zu diesem Geschäft beisteuern. „Verkauf doch deinen Caterpillar! Wir haben doch eh einen neuen Maschinenbestand in das Finanzvolumen eingerechnet.“
Wernicke schaute ihn entgeistert an. „Und wie soll ich dann ab sofort meine Ziegel verladen?“
Watepfuhl schaltete sich ein. „Gundolf, du kannst von jetzt an großflächig denken. Wir werden das Kind schon schaukeln.“
Möckel stand Egon in Sachen Optimismus nicht nach.
„Genau, recht hast du Egon. Dieser Caterpillar ist ein gesuchtes Modell und bringt bestimmt seine fünfzigtausend.
Ich habe da einen guten Händler im Raum Stendal an der Hand, der faire Preise zahlt.“
Man merkte, dass das Tempo und die sich abzeichnenden weitreichenden Entscheidungen Wernicke überforderten.
„Wir reden aber nicht von sofort fälligen fünfzigtausend Euro, sondern von einhunderttausend!“ Wernicke klang schon fast ein wenig verzweifelt ob seiner eigenen Courage.
Möckel nahm wieder das Wort auf. „Du hast doch deinen alten, eingeführten Betrieb! Jeder Banker im Jerichower Land, besonders die von der Sparkasse, kennt doch den Wert deiner langfristigen Abbaurechte.“ Mit der Inbrunst der Überzeugung setzte er hinzu: „Die geben dir bestimmt Geld.“
Von Wernicke kam keine Antwort zu diesen Höhenflügen mehr, ihm war klar geworden, dass er im Falle eines Falles der war, an dem alles, vor allen Dingen die unangenehmen Seiten dieses Geschäftes, hängenbleiben würden.
Ihm fiel der Spruch des Fußballers Andreas Brehme ein, der angesichts eines richtig schlecht verlaufenen Spiels den schon legendären Spruch geprägt hatte: „Haste Scheiße an den Füßen, haste Scheiße an den Füßen!“
Nachdenklich drängte er Möckel zum Aufbruch.
„Komm, lass uns fahren.“
Zu Watepfuhl sagte er: „Ich melde mich kurzfristig, wenn das Bargeld zur Verfügung steht.“
Ihm standen die pure Angst und Unsicherheit über die weitere Entwicklung förmlich ins Gesicht geschrieben. Die gigantischen Ausmaße dessen, was er mit seinem vermeintlichen Freund Möckel erst ersonnen und nun in die Wege geleitet hatte, waren für ihn an diesem ereignisreichen Tage zu viel.
Hatte auf der Hinfahrt noch lautstarke Euphorie im Auto geherrscht, so fiel auf der Rückfahrt nach Magdeburg kaum ein Wort zwischen den beiden Fahrzeuginsassen. Die Fahrt zog sich zäh wie Kaugummi durch die Dunkelheit des Erzgebirges und Wernicke war froh, als er Möckel bei dessen Ehegespons abgeliefert hatte.
Sein Adrenalinspiegel war noch so hoch, dass an Schlafen in dieser Nacht nicht zu denken war. Erst in den frühen Morgenstunden fand er für kurze Zeit die Ruhe, um sich wenigstens ein bisschen von der anstrengenden Reise zu entspannen. Wenn er geahnt hätte, dass jetzt der Stress und die Belastung erst richtig anfangen würden, wäre an Schlaf überhaupt nicht zu denken gewesen.
26.06.2005, Nachmittag,
Usti nad Labem
Nach einigen Stunden Ruhe stand Reinhard Möckel schon sehr zeitig vor dem Einfamilienhaus Gundolf Wernickes und konnte es gar nicht abwarten, bis er die technische Dokumentation über den zu verkaufenden Caterpillar in die Hände bekam. Mit diesen Unterlagen machte er sich auf den Weg zu dem Stendaler Maschinenhändler, dem er diese Maschine per Handschlag für fünfzigtausend Euro in bar verkaufte. Die Vollmacht für den Verkauf galt, da man sich ja gut kannte, als erteilt. Man kannte sich so gut, dass Möckel sich sicher fühlte, als er den Verkaufserlös bar auf den Tisch des Wernickeschen Hauses zählte, der sich auf wundersame Weise auf fünfundvierzigtausend reduziert hatte.
Wernicke war immer noch tief resigniert, ob des Verlaufs des gestrigen Tages, er hatte sich selbst nicht wiedererkannt, man hatte ihn förmlich überrollt und er hatte jegliche Vorsichtsmaßregeln außer Acht gelassen.
„Fünfundvierzig, ich dachte, der Verkauf bringt fünfzigtausend Euro. Du hast von fairen Preisen gesprochen, die angeblich von deinem Händler gezahlt werden.“
Möckel wand sich, vielleicht hatte er auch ein schlechtes Gewissen und die fünftausend brannten förmlich in seiner Tasche, aber er konnte sie jetzt nicht auf den Tisch zählen, sonst wäre der Betrug offensichtlich.
„Na ja, wie das eben so ist, wenn man dringend Bargeld braucht, die nutzen das schamlos aus.“
Wernicke fühlte sich schon wieder wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange, das durch Hypnose bis zur völligen Bewegungslosigkeit paralysiert wurde.
Aber jetzt half alles nichts mehr. Die Dinge waren am Laufen und er musste sehen, dass er persönlich schnellstmöglich wieder aus diesem geschäftlichen Dilemma, das ihn mental völlig überforderte, herauskam.
Die Lösung lag im Think big, das von Leuten wie Watepfuhl zum Mantra erhoben worden war. Schaffte er es, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, so wären Personalkosten für einen Geschäftsführer, der ihn im Alltagsgeschäft entlasten würde, das geringste Übel. Er sagte zu Möckel: „Habe eben mit mehr gerechnet für das Maschinchen, hatte noch wenig Betriebsstunden. Da macht jemand ein richtiges Schnäppchen.“
Möckel stand ihm gegenüber, blickte wie ein begossener Pudel zu Boden und schwieg betreten.
„Reinhard, ich werde heute Morgen mit meinem Banker sprechen, damit er den Dispositionsrahmen für das Konto der Ziegelei kurzfristig erhöht, sodass ich über die restlichen sechzigtausend für die Kreditkosten verfügen kann.“
Möckel hörte das mehr als erleichtert, denn so gut kannte er Wernicke, dass er begriff, in welcher Zwickmühle sich der Kumpel seit seiner Unterschrift in Usti befand.
Wernicke war nicht mehr wiederzuerkennen. Aschfahle Gesichtshaut, nervöses Hantieren, zerfahrene Bewegungen, rote Ohren. Wernicke zeigte alle Symptome von mentaler Überforderung, keine Spur mehr von der ruhigen, anderen Menschen sehr zugewandten Persönlichkeit. Wernicke war in seinen Grundfesten erschüttert, hatte dies auch wohl erkannt und sah jetzt keinen Ausweg mehr aus der Bredouille, in die er sich durch seine Unterschrift unter den Vertrag selbst manövriert hatte.
Gegen Mittag kam der für Möckel erlösende Anruf Wernickes.
„Reinhard, die Bank hat einer Erhöhung meines Kreditrahmens ohne großes Zögern zugestimmt, sie wollten nicht einmal wissen, wofür ich das Geld benötige. Die zu Gunsten der Sparkasse eingetragenen Sicherheiten sind wohl mehr als ausreichend.“
Wernicke hatte eine neue Leichtigkeit in seiner Stimme, die von Möckel auch wahrgenommen wurde.
„Hast du etwas anderes erwartet, Gundolf?“, fragte er leicht flapsig nach.
Möckel versuchte, mit dieser Reaktion ersten aufkommenden Spannungen ein wenig die Spitze zu nehmen, denn wenn das Ding nicht laufen würde, wäre er, Reinhard Möckel, derjenige, der vor Ort jederzeit greifbar war. Ihm war klar, dass er unmittelbar und körperlich für einen Misserfolg verantwortlich gemacht werden würde. Möckel musste sich eingestehen, dass auch er eine schlaflose Nacht gehabt hatte, so ganz traute er dem großen Zampano Watepfuhl auch nicht mehr über den Weg.
Nun waren aber die verpflichtenden Unterschriften geleistet und es musste ein Weg gefunden werden, wie das viele Bargeld von Deutschland in die Schweiz transferiert werden sollte. Gleichzeitig mussten die Interessen des Herrn in Usti berücksichtigt werden.
Sie hatten bei ihrem Gespräch in Usti alle Varianten durchgespielt. Normale Überweisungen waren laut Egon Watepfuhl viel zu zeitaufwändig und man stieß die Behörden, besonders die tschechischen, unnötig auf dieses Geschäft, wenn Bargeld in diesen Größenordnungen eingezahlt und abgewickelt werden würde.
Watepfuhl hatte zugesagt: „Ich garantiere mit meinem guten Namen in der Finanzwelt dafür …“, er spreizte sich in diesem Augenblick wieder auf seine unnachahmliche Art, „dass das Geld seriös an seine Adressaten in der Schweiz gelangt, die für die Abwicklung des Kreditantrages direkt und persönlich zuständig sind.“
Wernickes Instinkte waren in diesem Augenblick für einen kurzen Moment aufgeblitzt, als er die sich zum Schlitz verengenden Augen Watepfuhls bemerkte. Solche Blicke kannte er. Im Gesicht seines Gegenübers war die blanke Gier zu erkennen und die Bereitschaft alles, wirklich alles, zu tun, um an diesen Fleischtopf heranzukommen. Es war eine Missstimmung aufgekommen, als Wernicke sagte: „Reinhard und ich bringen das Geld direkt in die Schweiz!“
Watepfuhl war erbost. „Traust du mir nicht, Gundolf?“, zischte er seinen neuen Partner an.
„Egon, davon kann keine Rede sein. Ich danke dir für dein Angebot, den Transport zu übernehmen, aber ich möchte meine Partner in der Schweiz selber kennenlernen und das Bargeld direkt übergeben.“
Er schaute Watepfuhl an. „Ich denke, dass du das verstehst.“
Man sah Watepfuhl förmlich an, wie es in seinem Hirn ratterte, sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich zusehends, aber was sollte er machen, wie sollte er gegen den Wunsch argumentieren, dass der, der die Musik bezahlte, die Musiker kennenlernen wollte. Möckel kannte Watepfuhl gut genug, um zu sehen, dass Watepfuhl offenbar die Felle davonschwammen und dieser seinen vermeintlichen Freunden in der Schweiz nicht für fünf Pfennig über den Weg traute. Watepfuhl hatte Angst, dass mit ihm das Gleiche geschehen würde, was er samt und sonders mit vermeintlichen Partnern getan hatte. Wenn sich eine Gelegenheit bot, hatte Watepfuhl keinerlei Skrupel, Menschen, die ihm voller Vertrauen entgegengetreten waren, zu umgehen und zu versuchen, Geschäfte ohne unnötige Mitesser zu realisieren. Besonders gut waren die, die man ohne eigene Mühe und Hirnschmalz einfach so abgreifen und als die eigenen präsentieren konnte.
Watepfuhl befürchtete übrigens zu recht, dass ihm Ähnliches mit seinen Kollegen in der Schweiz widerfahren würde, wenn Wernicke und Möckel direkt dort hinführen. Seinen Anteil an der Provision würde er dann niemals sehen. Er hatte schon häufiger einschlägige Erfahrungen dieser Art gemacht.
27.06.2005, Mittag,
Chur/Schweiz
Die beiden Ostdeutschen Wernicke und Möckel machten sich am frühen Morgen auf den Weg von Magdeburg nach Chur in der Schweiz, eine mehr als achthundert Kilometer lange Fahrt quer durch Deutschland. Sie freuten sich beim Überqueren der alten innerdeutschen Grenze im fränkischen Hirschberg wieder einmal über die gewonnene Reisefreiheit, danach schwiegen sie für einige Minuten. Wernicke musste daran denken, dass die Freiheiten, die das neue System allen geboten hatte, auch die Freiheit zu scheitern bot, es krähte kein Hahn mehr danach, wenn man ein Geschäft in den Sand setzte. Er kannte genug Beispiele, wie besonders im ostdeutschen Baubereich Imperien wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, die bei den ersten Schwierigkeiten, nur auf tönernen Füßen stehend, ins Schwanken kamen, zusammenkrachten, um dann sang- und klanglos von der Bildfläche zu verschwinden.
Oft genug wurde ein Bankrott auch noch von der Häme und teilweise dem blankem Hass der vorher von Neid angefressenen Nachbarn und vermeintlichen Freunden begleitet. Bankrott konnte gleichbedeutend mit sozialer Ächtung sein, die Nattern, die man an seinem Busen genährt hatte, wurden zu den ärgsten Feinden. Diese Gedanken verfolgten Wernicke eine geraume Zeit und Möckel merkte seinem Reisebegleiter an, dass er schwerwiegende Überlegungen anstellte. So fuhren sie Stunde um Stunde, ohne dass einer der beiden das Gespräch auf das lenkte, was nun in der Schweiz folgen sollte.
Das Bargeld hatte Wernicke in einem neu erworbenen dunkelbraunen Aktenkoffer in einer Papiertüte verstaut und den Koffer unter den Beifahrersitz geschoben. Bei jedem Stopp entnahm er den Koffer aus dem vermeintlichen Versteck, schloss mit einer Handschelle sein linkes Handgelenk und den Koffer zusammen, sodass kein Zufallsräuber auch nur annähernd die Chance hatte, ihm das Geld zu entreißen.
Sie passierten die Grenze zur Schweiz vom österreichischen Bundesland Vorarlberg kommend, wurden von den schweizerischen Zollbeamten durchgewunken, ganz so, als ob diese wussten, dass sich ein armer ahnungsloser Tropf auf den Weg in die Schweiz gemacht hatte, um dort sein sauer verdientes Bargeld zur weiteren Verwendung abzuliefern, nach dem Motto: „Gebt uns euer Geld und wir zeigen euch, wie man damit lebt!“
Wernicke und Möckel hatten keinen Blick für die Schönheiten, die die Kantonalhauptstadt Chur und die Graubündner Umgebung ihren Besuchern boten. Sie wurden von ihrem Navigationssystem in ein Parkhaus in der Nähe des Rätischen Museums gelotst, passierten dann zu Fuß die Martinskirche und erreichten gegen 13 Uhr das Gebäude in der Oberen Gasse Nummer 17, in dem sich die Kanzlei des Dr. Remi Wöhler befand, der laut Aussagen Watepfuhls von nun an für die Abwicklung der geplanten Einhundert-Millionen-Finanzierung zuständig sein würde. Ein Kanzleischild am Eingang wies Wöhler als Notar und Treuhänder aus, was Wernicke beruhigte.
Es schien sich alles zu richten und seine Befürchtungen schienen grundlos gewesen zu sein.
Die Räume der Kanzlei befanden sich im dritten Stock des Gebäudes und beide Herren aus Deutschland wurden von einer freundlichen Dame mittleren Alters an der Tür in Empfang genommen und in einen Besprechungsraum geleitet.
„Nehmen Sie bitte Platz“, sie deutete auf die Tischgruppe, „Herr Dr. Wöhler wird gleich zu Ihnen kommen.“
Wenige Momente später öffnete sich eine Seitentür, ein etwa achtzigjähriger drahtiger Mann kam in den Raum, ging direkt zu Wernicke und reichte diesem die Hand
„Herr Wernicke, nehme ich an? Mein Name ist Wöhler, Dr. Remi Wöhler.“ Er wandte sich an Möckel. „Und Sie werden Herr Möckel sein? Herr Watepfuhl hat angekündigt, dass Sie Herrn Wernicke begleiten würden.“
Die beiden Deutschen waren vom Tempo des alten Herrn überrascht.
„Hat man Ihnen nach dieser langen Fahrt noch nichts angeboten? Kaffee, Schokolade oder Wasser?“
Die Tür öffnete sich und herein kam ein braungebrannter, grauhaariger, etwa fünfzigjähriger Mann, elegant gekleidet, er wurde von Wöhler vorgestellt.
„Das ist Herr Urs Bertoli, Ihr direkter Ansprechpartner in meinem Büro für die Abwicklung Ihrer Finanzierung.“
Bertoli, Möckel und Wernicke schüttelten sich die Hände. Nachdem die Höflichkeiten ebenso wie die Visitenkarten ausgetauscht und die Erfrischungen gebracht waren, sagte Wöhler: „Meine Herren, lassen Sie uns nun das Geschäft zum Abschluss bringen.“ Er legte dabei die Faxkopie des von Wernicke unterschriebenen Vermittlungsauftrages auf den Tisch und schickte sich an, die zweite Unterschrift zu leisten. Er blickte noch einmal auf Wernicke.
„Ich kann doch davon ausgehen, dass Sie, Herr Wernicke“, Wöhler deutete auf den Koffer, „die vereinbarte Summe für die Vermittlungstätigkeit mit sich führen?“
Wernicke nickte nur kurz und im gleichen Augenblick setzte der alte Herr seine Unterschrift neben die von Wernicke auf das Schriftstück.
„Nun kommen wir zum Finanziellen. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit unseres Büros sind zweierlei Dinge. Sie müssen eng mit Herrn Bertoli kooperieren, wenn der etwas einfordert, muss das kurzfristig erledigt werden und zweitens müssen wir auf Zahlung der Vermittlungsprovision vorab bestehen, da verschiedene Personen in diesen Prozess eingebunden sind, die, ohne dass wir sie bezahlen, nicht in unserem Sinne tätig werden.“
Wöhler zwinkerte den beiden Ostdeutschen zu. „Sie verstehen doch sicherlich, was ich meine?“
Wernicke legte den Aktenkoffer vor sich auf den Tisch, öffnete ihn, holte die Papiertüte mit den einhunderttausend Euro heraus, legte sie vor sich auf den Tisch, schaute noch einmal wehmütig auf das Geld und schob die Tüte dann zum ihm gegenüber sitzenden Wöhler.
„Ich halte meine Zusagen ein, Dr. Wöhler“, sagte er ostentativ, „ich hoffe, das können wir am Ende des Tages auch von Ihnen sagen!“
Wöhler schaute erstaunt auf Wernicke und reagierte dann ganz professionell. Er beorderte per Telefon einen Mitarbeiter der Kanzlei zu sich in den Besprechungsraum, übergab diesem, nachdem er eine von Wernicke vorbereitete Empfangsbestätigung für die Summe unterschrieben hatte, das Bargeld. Der Mitarbeiter verschwand und es dauerte nur etwa fünf Minuten, bis das Telefon klingelte und der Betrag bestätigt wurde. In diesen fünf Minuten hing eine ungute Mischung aus Misstrauen und Irritation im Raum, die verhinderte, dass selbst ein oberflächliches Gespräch zustande kam.
Bertoli sagte nun: „Wir müssen noch einige Formalien klären. Ich brauche noch weitere Unterschriften von Ihnen, damit ich in Ihrem Sinne tätig werden kann.“
Bertoli legte einige Formblätter auf den Besprechungstisch, auf denen die Stellen, an denen unterschrieben werden musste, bereits markiert waren. Wernicke brauchte nur einen kurzen Blick auf die Formulare zu werfen, um festzustellen: „Die sind ja wieder nur in Englisch abgefasst. Ich spreche kein Englisch, ja, wenn es Russisch wäre …“ Er hatte nicht erwartet, dass einer der Herren auf diesen Scherz reagierte und so war es auch.
„Englisch ist die Geschäftssprache der internationalen Banken und bei einer derartigen Finanzierungssumme müssen wir uns an die Regeln halten, Herr Wernicke“, entgegnete Bertoli.
„Geben Sie schon den Stift her“, sagte Wernicke, „ich will die Sache zu Ende bringen.“
Als Bertoli ihm den Stift reichte, griff er unwirsch danach, unterschrieb jedes der ihm vorgelegten Formulare, von denen er nicht eines verstand, warf einen bitterbösen Blick auf den völlig hilflos dastehenden Möckel und ließ sich dann in seinem Sessel nach hinten fallen, so als ob er endlich eine große Last los war. Was er in diesem Moment vielleicht diffus ahnte, wurde wenige Tage später zur Gewissheit.
24.07.2005, Vormittag,
Jerichow
Über Wochen liefen Wernickes Nachfragen nach dem Stand der Bearbeitung ins Leere. Mal war Bertoli nicht zu erreichen oder auf einer wichtigen Auslandsreise oder es wurden neue Bestätigungen und Belege nachgefordert, die stets in englischer Sprache gehalten waren, somit von vereidigten Dolmetschern gegen zusätzliche Gebühren übersetzt werden mussten. Wöhler war nur auf ausdrückliches Drängen Wernickes ans Telefon zu bekommen, er verwies darauf, dass die Abwicklung nun in den Händen des Herrn Bertoli liegen würde.
Über diese vergeblichen Versuche an konkrete Informationen über seinen Finanzierungsantrag zu kommen, vergingen fast drei Wochen und erst eine massiv vorgetragene Drohung sich wieder auf den Weg in die Schweiz zu machen und nicht eher zu gehen, bevor eine Klärung erreicht sei, führte dazu, dass Bertoli ihn zurückrief.
„Herr Wernicke, wir sind leider damit konfrontiert, dass die finanzierende Bank zwar ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hat – diese erfreuliche Nachricht wollte ich Ihnen nicht vorenthalten – diese Bank benötigt aber noch einmal einen umfänglichen Datensatz für den Kreditantrag. Es ist nur ein bankinternes Dokument, wir benötigen keine beglaubigte Übersetzung.“
Wernicke hatte sich schon mehrfach über die zusätzlichen Kosten bei Bertoli beschwert und so war der Schweizer froh, diese Nachricht übermitteln zu können.
„Ich schicke Ihnen diesen noch heute per Post zu …“
Wernicke fragte nur lakonisch: „Wieder in englischer Sprache?“
„Leider wieder in englischer Sprache“, antwortete Bertoli und hakte nach, „Haben Sie denn in Ihrem Umfeld niemanden, der Ihnen mit dem Übersetzen helfen kann?“
Zwei Tage nach diesem Gespräch mit der Kanzlei in Chur traf ein Expresspaket in den Betriebsräumen der Ziegelei ein. Der Absender war eine für Wernicke bisher unbekannte Firma namens Medea AG mit Firmensitz im ebenfalls schweizerischen Zug ein.
Wernicke fühlte sich wie paralysiert, als er das Paket öffnete und ein kurzes Anschreiben Bertolis darin fand, in dem der ihm erklärte, dass dieses Papier als finale Anforderung vor der Auszahlung der einhundert Millionen noch dringend benötigt wurde. Vor Wernicke lag ein siebzigseitiger Formularsatz, in englischer Sprache gehalten, der den massigen Menschen für eine geraume Weile in sich zusammenfallen ließ. Was sollte er nur tun, er war mit den Nerven völlig am Ende?
Reinhard Möckel stand ebenso hilflos vor diesem Packen Papier, erinnerte sich aber in diesem Augenblick daran, dass Hermann Weber als Wessi und erfahrener Kaufmann wohl in der Lage sein würde, dieses Konvolut zu übersetzen und Wernicke verständlich zu machen.
25.07.2005, Vormittag,
Burgdorf/Hannover
So ganz genau konnte sich Hermann Weber an den Zeitpunkt nicht mehr erinnern, an dem er Egon Watepfuhl kennenlernte. Selbst aus seinen komplexen Akten und Tagebüchern war das konkrete Datum nicht hundertprozentig rekonstruierbar. Es musste irgendwann kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein.
Egon Watepfuhl wurde ihm auf jeden Fall als der große Zampano verkauft, der für jedes finanzielle Problem eine Lösung anbieten konnte. Allerbeste Verbindungen in die Finanzmetropolen dieser Welt wurden ihm attestiert.
Zu dem Zeitpunkt pfiff Hermann finanziell aus dem letzten Loch, seine verschiedenen Unternehmen warfen nicht die Summen ab, die er für seinen Unterhalt und den seiner Kinder benötigte. Die Banken hatten ihm den Geldhahn weitestgehend zugedreht, es kam kein frisches Geld in den Kreislauf, er musste nach jedem Strohhalm greifen, der sich als mögliche Rettung vor dem Bankrott abzeichnete.
Begonnen hatte die Liaison mit Watepfuhl bei einem Treffen mit einem vermeintlichen Manager eines deutschen Baukonzerns. Dieser hatte auf eine der Kooperationsanzeigen auf einer der Plattformen des sich damals rasant entwickelnden Internets geantwortet, die Partnerschaften bei Projekten im Umweltschutz anbot. Besonderes Interesse zeigte er an Hermanns Kontakten nach Osteuropa. Bei ihrem ersten Treffen auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Braunschweig überreichte er ihm seine Visitenkarte, die ihn als verantwortlichen Mitarbeiter eines auch im Umweltschutz tätigen deutschen Baukonzerns auswies. Visitenkarten, das musste Hermann im Verlauf der dann folgenden Monate und Jahre begreifen, waren Teil eines betrügerischen, hochstaplerischen Systems, täuschten Wichtigkeit von Personen vor, die sich bei näherer Betrachtung als Windeier herausstellten.
Dieser vermeintliche Baumanager namens Franz Krol führte Hermann in eine Scheinwelt ein, die der Normalsterbliche allenfalls dann am Rande mitbekam, wenn ihm irgendwelche nigerianischen oder sonstige afrikanischen Ganoven vermeintliche Erbschaften oder finanzielle Transaktionen in schwindelerregender Höhe exklusiv anboten. Diese von ihrer Höhe her irrsinnigen Geschäfte sollten ihn nun für eine geraume Zeit beschäftigen, ihm die Bekanntschaft von bestenfalls halbseidenen Personen einbringen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass er mit keinem normalen Menschen mehr über seine Arbeit sprechen konnte.
Einer dieser Normalos hätte Hermann womöglich mit der Frage aller Fragen in diesem Geschäft konfrontiert:
Warum landen derartige Finanzangebote ausgerechnet auf deinem Tisch? Eine Antwort, ja eine Antwort hätte er schuldig bleiben müssen, es gab keine! Alle Alarmglocken hätten klingeln müssen.
Diese Scheinwelt war beileibe nicht hierarchiefrei, es gab die vermeintlichen Macher und ihre Netzwerke, die wiederum ein Heer von Akquisiteuren, ihre sogenannten Spannemänner, laufen hatten, die ihnen die Kunden und Geschäftsideen lieferten. Alle nährte nur die Hoffnung auf ein Stück vom großen Kuchen. Frauen hatte er in diesem Geschäft allenfalls als Mahnerinnen kennen gelernt.
Eine von ihm sehr geschätzte Dame, Michaela Harnick aus Regensburg, eine der Mahnerinnen, hatte ihre Rolle einmal so beschrieben: „Ich sitze am Rand der Buddelkiste und sehe zu, wie die Jungs sich mit Dreck bewerfen.“
Im Prinzip funktionierte das Ganze nach dem altbekannten Schneeballsystem. Die Spannemänner grasten ihren Bekanntenkreis ab, in der Regel wie sie kleine Selbständige. Allen gemeinsam war das Problem, dass die Banken ihre Taschen zugenäht hatten und keine Kredite mehr ausreichten. Diese Lücken zu schließen, gaben Menschen wie Egon Watepfuhl vor.
Sein Handlanger, ein gutgläubiger, ein ebenso naiver wie bestens vernetzter Mensch aus Magdeburg, tauchte irgendwann im Dunstkreis der Gespräche zwischen Hermann und diesem hochstapelnden vermeintlichen Baumanager auf, grinste freundlich und stellte sich vor:
„Mein Name ist Möckel, Reinhard Möckel.“
„Freut mich“, antwortete Hermann höflich, blickte aber erstaunt auf diesen Menschen, der ihm seine rechte Hand hinhielt. Der feste, schwielige Händedruck zeigte Hermann, dass er es mit einem Mann zu tun hatte, für den schwere körperliche Arbeit kein Fremdwort war. Der Händedruck war es aber nicht, der sein Erstaunen auslöste, sondern der ausgesprochen freundliche Blick, mit dem Möckel ihn während der Begrüßung betrachtete.
Allerdings gab es ein Problem, Hermann war sich nicht ganz sicher, in welches der Augen seines Gegenübers er schauen sollte. Sie waren beileibe nicht synchron, sondern schienen jedes für sich eine andere Blickrichtung zu haben.
Hermann hatte den Namen nicht richtig verstanden.
„Wie war bitte nochmal Ihr Name?“
„Reinhard Möckel, aber am besten ist es, wir duzen uns gleich. Wir werden wohl demnächst öfter miteinander zu tun haben.“
Möckel grinste ihm offen ins Gesicht.
Krol und Möckel fabulierten über große Geschäfte, Geld drehen, Bankgarantien cashen. Auffällig war, dass Möckel, sofern er etwas zum Gespräch beitrug und keine Zoten von sich gab, sich immer wieder mit Blicken bei Krol rückversicherte, ob diesem die Aussage auch gepasst hatte. Zwischen den beiden war klar, wer Koch und wer Kellner war.
Deutlich war auch, dass Möckel kein feinsinniger Mensch war, er war eher ein Mann für die derben Sprüche, der von der praktischen Arbeit mehr hielt, als davon, sich stundenlang an irgendwelchen Konferenztischen aufzuhalten. Hermann konnte wenig zum Gespräch beitragen, die Summen, über die diskutiert wurde ließen ihn eher schwindelig werden.
Es schien, als ob er den Zugang zu Aladins Wunderlampe gefunden hatte, er brauchte den Dschinn nur aus der Flasche zu lassen und alle finanziellen Probleme würden der Vergangenheit angehören. Einen Haken konnte Hermann nicht erkennen, warum sollte er sich nicht auf diese Herren einlassen, solange er kein Geld auf den Tisch legen musste.
So wurde Hermann, ohne es richtig zu realisieren, zum Handlanger, dessen einzige Funktion darin bestand, seinen Freundes-, Bekannten- und Geschäftspartnerkreis für fragwürdige und windige Finanzgeschäfte zu öffnen.
Hermann dachte an diesem Abend an die Zeit um die Jahrtausendwende zurück und bemerkte das eine oder andere Mal bei sich ein fröstelndes Schütteln, wenn er an die Akteure dachte.
Persönliche Beziehungen oder gar Freundschaften waren in diesem Netzwerk der Gier nicht vorgesehen.
Das Geschäftsprinzip war eigentlich ganz einfach: Unternehmern, in der Regel deutscher Nationalität, wurden Finanzierungen versprochen, die finanzielle Engpässe mit einem Schlag lösen würden. Bei diesen sogenannten Geschäften wurde die Provision der Vermittler zu Beginn der Verhandlungen fällig und ohnehin schon klammen Menschen zusätzlich aus der Tasche gezogen. In der Regel war es dann nach Zahlung der Provision so, dass irgendwelche vermeintliche Formfehler oder angeblich fehlende Unterlagen dazu führten, dass die Finanzierungszusagen vermeintlicher internationaler Kreditinstitute und Finanzierungsinstitutionen ausblieben. Die Vermittlungsprovision war durch Vertrag aber fällig gestellt und ausgezahlt worden, für den Kreditnehmer also verloren.
Während der Gespräche mit Krol und Möckel wurde von diesen immer wieder auf einen Menschen hingewiesen, der auf den Stein der Weisen gestoßen und der große Zampano mit den allerbesten Kontakten war: Egon Watepfuhl.
Dieser Name wurde nur mit gesenkter Stimme und hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen, es war der Geheimtipp schlechthin. Jeder, der diesen Namen in den Mund nehmen konnte, gehörte zum Inner Circle der vermeintlichen Durchblickprofis.
Der Name Watepfuhl stand für die Lösung verschiedener Gordischer Knoten. Egon Watepfuhl hatte in diesem Reigen von schmierigen Halunken einen klaren Vorteil, der allerdings erst auf den zweiten Blick zu erkennen war. Er lebte in der Tschechischen Republik und damit fernab von allen wichtigen Zentren der Finanzwirtschaft.
Dieser Standort war Mitte der neunziger Jahre so exotisch, dass man bei gutem Willen und ohne Misstrauen geneigt war, auch den phantastischsten Geschäftsangeboten Glauben zu schenken. Wer hatte noch nicht von den Geschäften der russischen Oligarchen gehört, von den Unsummen, die bei der Auflösung der staatseigenen Kombinate in private Taschen geflossen sein sollten und wieder reinvestiert werden mussten. Alles war möglich, so suggerierten es die Gerüchte, die zwischen den Spannemännern kursierten und die bei jeder neuen Variante, die kolportiert wurde, zusätzlich aufgeblasen wurden. Je mehr einer der Dienstboten zu einem Gerücht beitragen konnte, desto höher wurde seine Kompetenz in dieser Ansammlung von Wolkenkuckucksheimen eingestuft.
Umso lauter dann auch der Knall und das folgende Gelächter, wenn eine vollmundig produzierte Blase geplatzt war.
Egon Watepfuhl hatte in der nebulösen Exotik, die Geschäfte im ehemaligen Ostblock umgab, einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Finanzjongleuren, die in Prag und Umgebung ihr Unwesen trieben: Er sprach Deutsch und hatte vermeintlich gute Kontakte zu deutschen Geschäftsleuten.