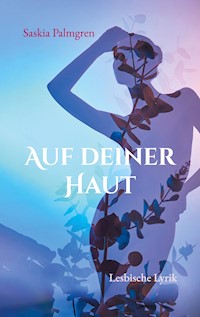Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sapphos Träume
- Sprache: Deutsch
Die Marketingspezialistin Dana Meinhardt lernt in ihrer neuen Position in einem Klinikverbund durch Zufall die wesentlich ältere Chirurgin Simone von Olden kennen, und ist sofort fasziniert: Die unterkühlte und zurückhaltende, sehr arrivierte Ärztin macht auf sie einen gigantischen Eindruck. Schon bald kann sie diese näher kennenlernen, und über die spontane Lösung eines Kommunikationsproblems hinaus beginnen die Frauen sich regelmäßig zu treffen. Auch die Chirurgin scheint ganz aufzublühen in der neuen, beginnenden zarten Freundschaft, aber als sich Dana Meinhardt dazu hinreißen lässt, sich Simone von Olden zu offenbaren, ist diese geschockt und reagiert verletzt, zieht sich völlig zurück und will nichts mehr von Dana wissen. Zuneigung und Ablehnung, Werben und Begehren müssen sich zahlreichen Hindernissen stellen, um schließlich in einer erfüllten Beziehung aufzugehen. Dieser Roman ist eine Hommage an die "Late Bloomers", also reife Frauen, die sich erst in der zweiten Lebenshälfte bewusst werden, sich zu Frauen hingezogen zu fühlen. Die spannungsreiche Entwicklung zeichnet realistische Erfahrungen nach und macht deutlich, wie kostbar Freundschaft und Liebe in unserer Zeit sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein lesbischer Roman …
… über die Liebe
und das Erkennen und Erwachen
einer Late-Bloomerin
Es war genau ein Jahr, dass ich nun schon als promovierte Medienwissenschaftlerin zur Pressesprecherin und Marketingbeauftragten des kleinen Klinikverbundes in der herrlichen Mittelgebirgslandschaft bestellt worden, und meiner Tätigkeit in Gänze verpflichtet war.
Meine Aufgaben waren vielfältig und sicherlich anspruchsvoll, aber nicht unerfüllbar, und außer den alltäglichen Routinen der zahlreichen Pressetermine, Anfragen und der Vorbereitung der Messen und anderer öffentlicher Darstellungen waren es gegenwärtig vor allem die neuen Internetauftritte für unsere Krankenhäuser und die angeschlossenen ambulanten Praxen, die mich beschäftigten.
Ich pflegte mittags oft die Kantine aufzusuchen, und an einigen Tagen fiel mir eine schlanke, fast zierliche Frau auf, die in ihrem Wesen etwas sehr Interessantes hatte:
Sie war in etwa so groß wie ich und kerzengerade, mit einer unglaublich kühlen, zurückhaltenden, fast versachlichten Ausstrahlung.
Sie musste um die fünfzig Jahre alt sein, vielleicht etwas älter.
Wenn sie in ihrem blendend weißen Kittel, den sie stets über der ohnehin reinweißen Arztkleidung trug, am Tresen stand und interessiert auf die Auslagen blickte, bemerkte man einen konzentrierten Blick, der sich aus dem Gesicht in Richtung des Gegenübers entfaltete.
Dieser Blick war durchdringend, und sie stach unter all den jungen Ärztinnen, die sich eher unbeschwert und lachend in die Reihen drängten, so außerordentlich hervor, dass man sofort einen Unterschied spürte, der mich in besonderer Weise einnahm, faszinierte und bewegte:
Diese Frau sah aus wie eine aus alten Filmen resultierende klassische Wissenschaftlerin, eine Institutsleiterin, eine Ärztin par excellence, wie man sie im wirklichen Leben eigentlich kaum noch vorfindet.
Sie hatte zugleich etwas Versachlichtes, Zurückhaltendes, fast Unterkühltes, Unnahbares, Herbes an sich, was sie distanziert erschienen ließ, und die gegerbte Haut ihres schlanken und schmalen Gesichtes ließ keine emotionalen Äußerungen zu.
Ich war Anfang vierzig und von dieser Frau unglaublich beeindruckt, was ich auch ganz ungestört wahrnehmen konnte, denn sie blickte bei den Besuchen in der Kantine stets nur – halb fragend, halb unschlüssig suchend, sich dann auch rasch entscheidend – in die unter Glasflächen appetitlich präsentierten und geschmackvoll angebotenen Speisen, um sich dann mit ihrem Tablett zu anderen Ärzten – ebenfalls alle in klinisches Weiß gekleidet – zu setzen.
Dort nahm sie, ganz in den Gesprächen mit den ärztlichen Kollegen befindlich, die Mahlzeit ein, und erhob sich dann mit der Gruppe wieder, um in ihrer kerzengeraden Erscheinung gemeinsam mit den Kollegen die Kantine wieder zu verlassen.
Mich sah sie überhaupt nicht, und dies war auch nicht ungewöhnlich, denn sie war ganz in sich versunken, und nur der suchende Blick auf die tagesaktuellen kulinarischen Köstlichkeiten verriet einen Hauch scheinbarer Zeitverschwendung in dem ansonsten offenbar sehr entschlossenen, festen Habitus, den sie an den Tag legte.
Der Ritus war immer gleich: Der Kreis der anderen Ärzte, der sich entweder schon gebildet hatte oder um sie herum formierte, bestand zumeist aus jungen, großen und fast schon als stämmig anzusehenden Männern, die in ihren lauten Äußerungen über verschiedene medizinische Untersuchungen vertieft das Essen konsumierten, meist recht schnell, um dann gemeinsam mit der Älteren – eben jener interessanten Ärztin – wieder zu enteilen.
Für mich als still Beobachtende war die Szenerie stets gleich, und man merkte, dass die Ärztin die sichere Routine ihres Handelns genoss und sich in dieser schützenden Umgebung wohlfühlte:
Zuweilen saß sie als Ältere mit dem Rücken, ein anderes Mal mit ihrem Blick in Richtung der hohen Fenster und vom sonstigen Publikum abgewandt; jedoch niemals an der Stirnseite, die ja den privilegierten Platz darstellte.
Es gelang mir nach einiger Zeit – sie war auch nicht täglich zur gleichen Zeit zu Tisch, sondern es geschah nur vereinzelt, dass ich ihrer ansichtig wurde – endlich herauszufinden, wie sie hieß:
Die aufgedruckten Namen waren nur aus allernächster Nähe zu ersehen, und dies war mir als zumeist erst nach ihr in die Kantine Kommende zutiefst verborgen, ja nahezu verwehrt, denn ich konnte mich unmöglich auf- und zu ihr vordrängen.
Umso erfreuter war ich, als ich einmal neben ihr stand und sie sich leicht zu mir neigte – allerdings nur, um beim Servicepersonal zu erfragen, ob das Dessert auch ohne Soße erhältlich wäre, und dann sogleich wieder auf ihr Tablett zu schauen, das Geld herauszuholen und wortlos zu bezahlen.
Nun aber hatte ich endlich ihren Namen erfasst, und er schien mir wie Balsam zu klingen: „Simone von Olden“.
Darunter stand: „Klinik für Chirurgie“, dann der Name unseres Krankenhauses. Sie war also Chirurgin, und die anderen Kollegen, wie ich dann später sah, entweder ebenfalls Chirurgen, oder – in der benachbarten Disziplin – Unfallchirurgen bzw. Orthopäden.
Man muss dazu wissen, dass der Unterschied zwischen der (allgemeinen) Chirurgie und der Unfallchirurgie ein minimaler war:
Die erstere behandelte alles, was fleischliche Organe betrifft, und die Unfallchirurgie bzw.
Orthopädie alles das, was mit Knochen und Gelenken zu tun hatte.
Ich durchkämmte das Internet und wurde außer auf unseren eigenen Seiten nicht weiter fündig: Ein Foto war nicht hinterlegt, aber dafür einmal ein Artikel, als ausländische Ärzte in der Klinik zu Besuch waren und sich zwei davon entschieden hatten, bei uns eine Facharztausbildung zu absolvieren.
Wir waren zudem akademisches Lehrkrankenhaus, worüber ein anderer Artikel zu finden war, aber leider – auch nach intensiver Suche – nichts weiter zu dieser interessanten Chirurgin.
Ich kleidete mich – wie üblich – in der geschäftlich schlichten Eleganz, also mit bevorzugt schlank geschnittenen Hosenanzügen, leicht ausgeschnittenen weißen Shirts, einer jeweils zum Anzug passenden Perlenkette und einer schönen, aber ebenfalls schlicht gehaltenen Armbanduhr und Chelsea-Boots mit Blockabsatz, die die jeweiligen Hosen auch fließend-fallend erschienen ließen.
Dazu muss ich erwähnen, dass ich selbst leider nicht wie diese kerzengerade stehende und sich bewegende, fast schon kataleptisch „eingefrorene“ Frau mit herber und versach-lichter, vollendet schlanker, fast knabenhafter Figur wirken konnte.
Bei mir waren – vielfach zum Amüsement mancher Männer und interessanterweise in dieser Gegend Ostdeutschlands eher selten vorkommend – viel weibliche Rundungen ausgeprägt und dazu eine große Brust, die ich in Sport-BHs unterbrachte und die mit den ausgeschnittenen schlichten und körpernahen T-Shirts, die ich statt aufwendig zu pflegender Blusen bevorzugte, vorteilhaft wirkten. Meine Haare waren in einem einfachen schlichten Cut der Zwanziger Jahre, ganz ähnlich einem graduierten Bob, frisiert, und da ich leichte Wellen besaß, die sich wippend um den kurzrasierten Genickansatz legten, war das eine alltagstaugliche, weil leicht pflegbare Frisur, die sich nahezu von selbst legte.
Sie – Frau von Olden – hatte sehr feines, hellblondes und in Wellen fallendes Haar, das am Kopf eng anlag.
Es war sehr kurz geschnitten und zumeist hinter das Ohr gelegt, so dass es nicht in das Gesicht fiel. Sie verwandte offenbar auch nicht viel Zeit für das Haar, sondern es diente mehr oder minder als Bedeckung des Kopfes, aber weniger als Schmuck, dem sie erhöhte Aufmerksamkeit widmen müsse.
Man sah, dass sie sich den Diensten verschrieb und ganz für das Krankenhaus lebte.
Ich verwandte nicht viel Arbeit in die Suche oder Überlegung einer etwaigen Begegnung, denn dazu fehlte auch mir die Zeit: Eine neue Marketing-Strategie band mich in einer weiteren Aufgabe, nun eine öffentliche Veranstaltungsreihe für die Bevölkerung vorzubereiten, bei der zu medizinischen Themen verschiedene Referenten eingeladen wurden.
Neben der gesamten organisatorischen Vorbereitung waren es auch die Inhalte, die mit den Medizinern abzustimmen waren, und hierbei kamen im ersten Jahr diejenigen Bereiche in Frage, die über zu wenig Auslastung klagten: Kinder -und Jugendmedizin, Entbindung, Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Der Bereich der Chirurgie, dem die Ärztin zugehörig war, kam deshalb zunächst nicht in der Planung vor, denn Darmverschlüsse, Gallenblasen und vieles mehr mussten sowieso operiert werden. Nach der Festlegung und Absprache der Themen, Termine und Referenten hatte ich meinen Urlaub nehmen dürfen und war deshalb eine Woche nicht im Hause.
Ich brauchte die Zeit, um mich von den anstrengenden Abstimmungen im Hause, der Pressearbeit, Kommunikation und den vielen Hunderten Aktivitäten, die in meinen Bereich fielen, zu erholen und neue Kraft zu schöpfen.
Als ich wieder aus dem Urlaub zurückkehrte, war aus dem frühlingshaften Wetter ein herrlicher Frühsommer geworden, und ich riss das Fenster meines Büros auf, um die erquickende Morgenluft einzulassen.
Während ich die Mails sichtete, die Liste der eingegangenen Telefonate abrief und mich mit den bevorstehenden Terminen befasste, drang ein lautes Rufen an mein Ohr.
Ich horchte zunächst auf, weil ich nicht einordnen konnte, ob es von den Bauarbeiten der Straße kam oder aus einer der anderen Richtungen, und vertiefte mich dann doch wieder in meine Arbeit.
Immer wieder jedoch hörte ich, wie jemand rief: „Hallo. Hallo!“, und dann schon etwas lauter: „Warum kommt denn keiner?“, und wieder: „Hallo, warum kümmert sich niemand um mich?“, und ich bemerkte nun auch endlich, woher das Rufen kam:
Es drang aus einem der benachbarten Bettenhäuser unseres Krankenhauses, direkt neben dem Gebäude, das die OP-Säle beheimatete. Ich sandte die Auszubildende aus der Geschäftsführung, die nur zwei Zimmer weiter befindlich war, auf ihrem Gang in das Hauptgebäude zum Postverteiler im Hause, um doch einmal herauszufinden, woher das Rufen kam.
Es kam tatsächlich – wie schon vermutet – aus einem der Patientenzimmer, und zwar aus der zweiten Etage.
Ich beschloss, mich selbst auf den Weg zu machen und begab mich in das hier angeschlossene Haus, fuhr mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage und erfragte bei der diensthabenden Schwester, ob es richtig sei, dass aus einem der Patientenzimmer Rufe nach außen schallten – dies nähme ich nun schon seit einer halben Stunde wahr. Ich bat zugleich um Verzeihung, einfach so zur Station zu kommen, und fragte, ob ich mich dem Rufenden vorstellen und ein Gespräch mit dem Patienten führen dürfe.
Die Schwester empfing mich mit einem Lächeln und sagte mir mit einem tiefen Seufzen: „Ja, aber natürlich, bitte gehen Sie gern zu ihm, er liegt im Zimmer fünf.“
Und sie fügte hinzu: „Aber, das wissen Sie sicherlich nicht: Er ruft nicht erst seit einer halben Stunde, sondern schon fünf ganze Tage.“
„Ach Gott“, sagte ich, „das ist ja furchtbar!“
Ich beeilte mich, gleich noch teilnahmsvoll hinzuzufügen:
„Ich kenne die Personalsituation natürlich und weiß, dass Sie voll ausgelastet sind.“
Sie nickte und fügte hinzu: „Gehen Sie ruhig hinein, wir schicken Ihnen die Stationsärztin nach.“
Eine andere Schwester klappte die Tür auf, und ich atmete kurz durch und ging zu dem Patienten, der bei geöffnetem Fenster in seinem Bett lag, mich anschaute und gerade zu einem weiteren Rufen ansetzen wollte.
Ich begrüßte ihn und sagte etwas lauter, da er schon etwas älter schien:
„Guten Tag, mein Herr, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche – mein Name ist Meinhardt, ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie rufen ja so laut, das hört man bis in die Geschäftsführung.
Was haben Sie denn, die Station kümmert sich doch ausgezeichnet um Sie?“
Der Patient verstummt daraufhin ganz plötzlich und schaut mich mit seinen großen Augen, die aus dem faltigen, herben und schon von viel Lebenserfahrung gezeichneten Gesicht blicken, unsicher und unschlüssig an.
Ich komme allerdings nicht dazu, weiter zu sprechen oder zu fragen, denn auf einmal steht neben mir eine etwa gleichgroße, gertenschlanke Frau in weißer Arztkleidung, schaut mich durchdringend an und fragt mich mit fester und entschlossener Stimme, mir intensiv in die Augen blickend:
„Guten Tag, darf ich fragen, wer Sie sind und was Sie hier auf meiner Station machen?“.
Ich muss mich rasch fassen, ohne mich zu verlieren, denn jene Frau war die schon besagte Chirurgin, die mich nun – nicht ganz ohne eine gewisse kritische Distanz – mustert und herausfordernd auf meine Antwort wartet, woraufhin ich ihr entgegne:
„Verzeihung, Frau von Olden, dass ich hier einfach so in Ihren Bereich eindringe.
Wie Sie sicherlich wissen, bin ich seit etwas mehr als einem Jahr Pressesprecherin und Marketingbeauftragte, und als solches für die Außenwirkung des Hauses zuständig.“
Sie mustert mich noch intensiver, und ihre strahlend-blauen Augen scheinen mich zu durchdringen. Ich sage daraufhin lächelnd, und mit einer gewissen Überzeugung:
„Wenn Sie erlauben, würde ich gern kurz mit dem Patienten ein Gespräch führen – aber natürlich nur, sofern Sie nichts dagegen hätten und die medizinische Indikation es auch zulässt.“
Ich mache eine bedeutungsvolle Pause und schaue sie erwartungsvoll an, während sie mich weiterhin kritisch, aber mit einem Lächeln von der Seite mustert.
Nun tritt sie noch näher heran, strahlt mir ins Gesicht und sagt mit leicht geneigtem Kopf:
„Ich weiß natürlich, wer Sie sind, und der arme Patient, den Sie hier sehen, ist ein bedauernswerter Fall, bei dem Sie nicht mehr viel tun können. Senile Demenz – wenn Sie wissen, was das ist. Er wird heute Abend nicht mehr wissen, wer Sie waren, aber Sie können es gern versuchen.“
Ich lächle sie einmal mehr charmant an und frage sie, die sie immer noch neben mir steht, ganz offen: „Ist er bereits operiert worden bzw. können Sie etwas zur Behandlung sagen?“, woraufhin sie ernst entgegnet:
„Ja, ihm wurden – allerdings nicht von uns – beide Beine amputiert, er steht unter Betreuung und kommt aus dem Pflegeheim. Man hat ihn aufgrund einer entzündlichen Erkrankung zu uns geschickt, und wir müssen ihn noch ein paar Tage zur Behandlung behalten, aber er ruft unablässig und wir können ihn auch nicht unaufhörlich sedieren.“
Leise fügt sie noch hinzu. „Er möchte natürlich, dass sich unentwegt jemand mit ihm beschäftigt, aber das können wir unmöglich leisten.“
Ich nicke stumm und betroffen. Dann wende ich mich unverzüglich dem Patienten zu, der längst nicht mehr ruft, sondern ganz still ist und uns beide anschaut.
Er hatte die ganze Zeit über schweigend-interessiert unserem Gespräch gelauscht, und so frage ich ihn ganz offen: „Wie heißen Sie?
Und was kann ich für Sie tun?“
Er denkt kurz nach und sagt dann bitter:
„Ach, wissen Sie, ich fühle mich ganz elend.
Ich kann nichts tun und niemand kümmert sich um mich.“
Ich schaue kurz zur Chirurgin, die im Raum geblieben ist, kerzengerade und fast ein wenig herausfordernd neben mir steht und aufmerksam unseren Dialog verfolgt, und sage dann zu ihm:
„Ich bin jetzt hier, was möchten Sie denn haben? Bitte äußern Sie einen Wunsch, und wenn es in unserer Macht steht, dann wird er Ihnen sofort erfüllt. Also – was können wir für Sie tun, mein Herr?“
Die Ärztin will mich auf meine gefährliche Frage, die eine Vielzahl von Wünschen des Patienten nach sich ziehen könnte, aufmerksam machen und streckt ihren Arm in meine Richtung, den ich jedoch sanft ergreife, dabei den Blick nicht vom Patienten lassend, und spreche mit ruhiger Stimme zu ihm: „Sehen Sie, das Team von Frau Dr. von Olden wird alles tun, damit Sie wieder gesund unser Krankenhaus verlassen können.“
Ich spüre den durchdringend auf mir ruhenden Blick von Frau von Olden, die gespannt und schweigend wartet – eine unendliche Stille ist jetzt im Raum.
Der Patient schaut mich wieder ganz sanft an, und ich füge hinzu: „Und wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann sagen Sie es einfach Frau Dr. von Olden, einverstanden?
Sie ruft mich dann über ihr Personal an, ja?“
Nun ist es die Chirurgin, die mich verwundert und leicht amüsiert anschaut, und ich frage sie gleich, ohne eine Bemerkung von ihr abzuwarten: „Sagen Sie, Frau von Olden, ich möchte Ihnen natürlich nicht noch zusätzliche Arbeit bereiten, aber der Patient ist hier einzeln untergebracht – können wir ihm nicht eine TV- und Fernsehkarte zukommen lassen? Ich würde diese gern erwerben, aber bitte auf meine Rechnung, und ihm zur Verfügung stellen.“ Und ich ergänze noch:
„Es ist doch mitunter sehr einsam und wir können sonst kaum etwas für ihn tun.“
Der Patient setzt sogleich wieder zum Rufen an, und ich frage die Ärztin nach seinem Namen, um ihm dann mitzuteilen:
„Herr Müller, wir haben uns gerade etwas für Sie überlegt: Sie bekommen von uns eine Karte für den schönen Fernseher, den Sie nutzen können.
Ich lasse Ihnen für das Telefon auch meine Durchwahl auf dieser Karte zu Ihrer Verfügung hier. Wenn Sie etwas benötigen, rufen Sie mich einfach über den Hausapparat an.
Und wenn Sie einverstanden sind, komme ich Sie morgen wieder besuchen, um zu sehen, wie es Ihnen geht, ja?“
Nun nickt der Patient ganz freundlich, legt sich ganz brav nieder und deckt sich bis zum Hals mit der leichten Sommerdecke zu.
Die Chirurgin lächelt unwillkürlich und sagt zu mir – fast ein wenig spöttisch:
„Sie wissen aber, worauf Sie sich jetzt einlassen, oder?“, und ich entgegne ihr aufrichtig und ganz ernsthaft – so, als ob ich eine Angehörige des Patienten wäre: