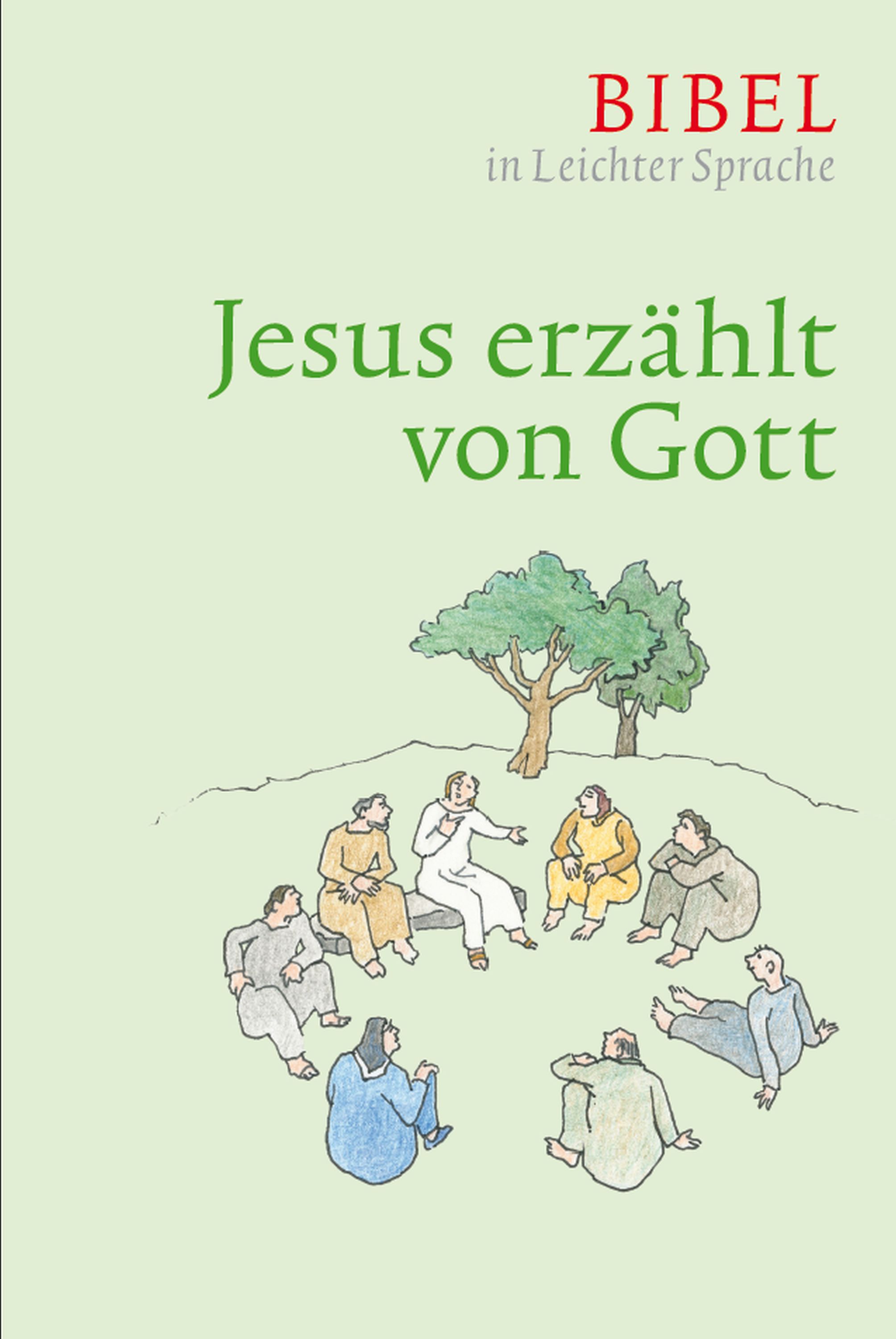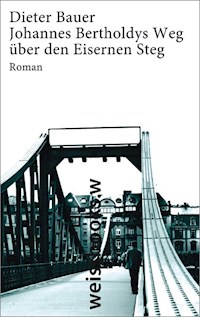Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weissbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten aus der Kindheit und Jugend sind, wenn sie gut erzählt werden, zauberhaft und grenzen oft ans Wunderbare. Eine polnische Weihnachtsgans, eine Tante und ihr Offizier, die erste Liebe, ein Mann namens Wien, Madame Blanche und ein echter Degas … Die "Wurzeln und Flügel", die – so Goethe – Kinder von ihren Eltern bekommen sollten, führen Bauer, der sich gegen die Schriftstellerei und für ein Leben als Geschäftsmann entscheiden musste, in den Jahren des Wirtschaftswunders bis nach Hongkong und Moskau. Und immer noch ist er, auch dann, das Kind, das staunen kann. Und das erzählt. Seine Geschichten sind warmherzig, humorvoll und einfühlsam. Und wären sie nicht wahr, hätte man sie erfinden müsssen. Denn: "Mit einer Kindheit voll Liebe", hat schon Jean Paul notiert, "kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten." Von Baden-Baden nach Lemberg, von Frankfurt nach Hongkong und Moskau. Bezaubernde Erzählungen eines Gentleman aus einer alten, anderen Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
weissbooks.w
Impressum
Dieter Bauer
Die Dame mit den Bernsteinaugen
und andere Erzählungen
© Weissbooks GmbH Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten
Konzept Design
Gottschalk+Ash Int’l
Satz
Publikations Atelier, Dreieich
Umschlaggestaltung
Julia Borgwardt, borgwardt design
Foto Dieter Bauer
© Michael Utz
Erste Auflage 2017
ISBN 978-3-86337-136-4
weissbooks.com
Dieter Bauer
Die Dame mit denBernsteinaugen
und andere Erzählungen
Die Dame mit denBernsteinaugen
Inhalt
Als der Krieg an der Haustür klingelte
Ludwigas polnische Weihnachtsgans
Ich bin der Wien
Dagmar
Meine Tante, die Generalin
Hindenburgs letzte Liebe
Mein Freund Tartarin aus Tarascon
Les Flageolets de Madame Blanche
Requiem für mein Hotel
Rendez-vous à Moscou
Die Dame mit den Bernsteinaugen
Als der Krieg an der Haustür klingelte
Warum haben wir Kinder nie »Frieden« gespielt? Kriegsspiele und Spielzeug, das uns die Kinderwelt zur Soldatenwelt werden ließ, waren in allen Gärten und Spielzimmern zu Hause. Schlachten zu schlagen, war für die meisten Jungen wichtiger als andere Rollenspiele. Das war auch bei uns so, auch wenn mein Vater, der als junger Mann, gerade Abiturient, in den Ersten Weltkrieg gezogen war, wenig mitteilsam war, fragten wir ihn nach seinen Erlebnissen in dieser Zeit.
»Die Hölle war es,« sagte er, wenn wir wissen wollten, wie es war.
Nur ein Spiel war uns wichtiger, bei dem wir in die Rolle unseres Vaters als Anwalt schlüpften. An Regentagen und im Winter, wenn die »Schlachten« wegen des Wetters ausfielen, führten wir Prozesse, schrieben Schriftsätze, stritten vor Gericht, sprachen als Richter Urteile. Da alle Freunde und Nachbarskinder das Spielzimmer und unseren weitläufigen Garten mit uns teilten, waren zeitweise vier bis fünf Kanzleien tätig, bei großem Andrang mit Assessor und Kanzleileiter ausgestattet. Letzterer war der Einstieg für neu Hinzugekommene, die noch keinerlei juristische Erfahrung besaßen. Die Rolle des Richters wechselte von Zeit zu Zeit, sie war nur von wenigen begehrt, setzte sie doch ein würdevolles Verhalten voraus. Als Anwalt konnte man mehr aus sich herausgehen, scharfer Worte Klinge kreuzen und durch eigene Initiative dem Geschehen eine unvermutete Wendung geben. Denn als Tatsache galt das, was die kleinen Anwälte erfanden und als Erste in die Welt gesetzt hatten. Angeklagte, Beschuldigte, Ehebrecher, Straftäter und Zeugen existierten nur auf dem Papier, denn keiner wollte diese Rollen übernehmen. Das vereinfachte den Ablauf der Prozesse erheblich.
Prozessbeteiligte wurden namentlich den Akten der Anwaltskanzlei meines Vaters entliehen, ebenso die Prozessgründe, wobei unsere besondere Vorliebe den Ehescheidungen galt. Einige von uns hatten sich auf Kapitalverbrechen spezialisiert, einen Fachbereich, der meine Schwester und mich weniger interessierte, seit wir eine despektierliche Bemerkung unseres Vaters über die »Herren Kollegen Strafverteidiger« gehört hatten.
Die anwaltliche Korrespondenz und die Anklageschriften wurden auf Geschäftspapier geschrieben, das von Konkursen übrig geblieben war, die durch die Kanzlei unseres Vaters abgewickelt worden waren. Vater stellte auch Locher, Aktendeckel mit Schnurheftung, ausgediente Stempel, Büroklammern und sonstiges Büromaterial zur Verfügung. Meine Eltern genossen es, zusammen mit Freunden abends im Wohnzimmer das Ergebnis unserer juristischen Tätigkeit zu lesen, was wir natürlich wussten, dieses aber nie zu erkennen gaben. Es gab unserem Spiel eine besondere Bedeutung, die auch nicht durch gelegentliche Lachsalven beeinträchtigt wurde, die wir, noch hellwach, zur Schlafenszeit in unserem Zimmer vernahmen.
Neben dem juristischen Schlechtwetterprogramm war der große Garten unsere kleine Welt. Wie groß er war, kann ich noch heute nachvollziehen, wenn ich an dem inzwischen stillgelegten und zum Konzertsaal erweiterten Bahnhof in Baden-Baden vorbeifahre und gleich danach auf der rechten Seite der Lange-Straße das Geschäftshaus sehe, das den größten Teil unseres ehemaligen Gartens einnimmt. In meiner Erinnerung steht dort noch immer die uralte Eiche, deren Stamm von sechs oder sieben Kindern kaum umfangen werden konnte. Der Stadt größter Magnolienbaum stand vor unserem Hauseingang. Er entfaltete im Frühjahr eine herrliche weiß-rosa Blütenpracht und stank zeitweise furchtbar. Die breitgewachsene Eibe war unser Kletterbaum, der neben dem Gartenhaus stand, das uns als Zuflucht bei schlechtem Wetter diente. Im nicht minder großen Nutzgarten standen viele Obstbäume, darunter eine Quitte, die alle anderen überragte, Holunderbüsche, deren Blüten jedes Jahr zu einem »Sekt« verarbeitet wurde und den wir Kinder trinken durften.
Der Gemüse- und Obstgarten war so reich bemessen, dass wir, ohne zu fragen, Radieschen, Karotten, Beeren und das Obst der Bäume ernten und essen durften. Und als Krönung unserer Vesperpausen gab es ab und zu ein »Fünfereis« von Knebels Eiswagen, der am Ende des Gartens stand, auf dem Trottoir – wie ein Gehsteig im Badischen hieß –, das die Fußgänger zum Bahnhof brachte. Knebels kleiner Kiosk, der nur in der warmen Jahreszeit geöffnet war, hatte für uns Kinder eine enorme Anziehungskraft. Dort gab es neben dem in der ganzen Stadt berühmten Eis auch andere Köstlichkeiten, wie rote und grüne Zuckerstangen, violette Veilchenpastillen, schwarze Lakritzrollen, genannt »Bärendreck«, Brausepulver in knalligen Farben, das nicht etwa in einem Glas Wasser aufgelöst, sondern von der Handinnenfläche genussvoll abgeleckt wurde, knusprige Waffeln und vieles mehr.
Da die meisten von uns kein oder kaum Taschengeld erhielten, war ein Einkauf bei Knebels nur möglich, wenn man sich durch Hilfe im Haushalt oder Garten einige Groschen verdient hatte. Mit fünf Pfennigen hatte man bereits eine große Auswahl, mit zehn Pfennigen galt man als wohlhabend und ein Fünfziger gar reichte aus, um einen halben Tag den Jahrmarkt zu besuchen.
Meine Haupteinnahmequelle hatte den Vorteil eines regelmäßigen Geldeinganges, denn jeden Samstagnachmittag hatte ich die Aufgabe, den Hof zwischen Hauptgebäude und Nebenhaus gegen ein Honorar von zehn Pfennigen zu kehren. Unsere Nanni, heimlicher Chef der Familie, Haushälterin, Spielkameradin und Beichttante in einem, war es von ihrem kleinen Heimatdorf im Kraichgau gewohnt, dass an diesem Tag die Straßen gespritzt und gefegt wurden. Sie sah nicht ein, warum es in der berühmten Kurstadt Baden-Baden anders sein sollte.
Um diese wunderbare Aufgabe beneideten mich alle Kinder. Da der Boden des recht großen Hofes keinen Asphaltbelag hatte, sondern einen festgestampften Schotterboden, bedeckt mit einem Gemisch aus Sand und Erde, musste zuerst ausgiebig gespritzt werden, damit die Staubwolken beim Fegen in Grenzen gehalten werden konnten. Sodann führte ich den breiten Besen so, dass die Borsten ein Schachbrett- oder ein Fischgrätmuster in den weichen, feuchten Belag zeichneten. Gelegentlich wurde meine künstlerische Tätigkeit durch die Reifenspur eines einfahrenden Autos oder des Fahrrades meines großen Bruders beeinträchtigt, was ich aber sofort unter Protestgebrüll durch entsprechende Besenführung korrigierte. Von dieser Tätigkeit war ich, nicht nur aus finanziellen Gründen, so begeistert, dass ich die unvermeidbare Frage der Erwachsenen, was ich einmal werden wolle, zum Schrecken meiner Eltern mit »Straßenfeger« beantwortete.
Dieser Innenhof und das ihn begrenzende Rückgebäude hatten aber noch andere wichtige Funktionen in unserer Kinderwelt. Der Hof diente auch als Exerzierplatz, Fußballfeld und als Versuchsgelände, auf dem alle Kinder Rad fahren lernten. Für Letzteres stand ein altes, abgelegtes, kleines Rad meines Bruders zur Verfügung, das durch den Einbau eines festgeklemmten starken Kartons, der die Felgen des Hinterrades streifte, das alte Klappergestell zur aufheulenden Rennmaschine werden ließ.
Vom Rückgebäude muß noch berichtet werden, spielte es doch im Jahre 1938, von dem ich erzähle, eine ganz besondere Rolle. Damals war ich sieben Jahre alt. An die Zeit davor kann ich mich heute nur einzelner Ereignisse erinnern. Das Jahr 1938, das letzte Jahr im Frieden, für viele bereits ein Jahr ohne Frieden, erlebte ich offenbar sehr bewusst, sodass die Erinnerung lebendig geblieben ist – wenn ich mich auch bisweilen frage, ob sie nach so vielen Jahres dem Geschehen nicht manches hinzufügt, was die Tatsachen zwar nicht verzerrt, aber doch nach meinen Wünschen und Träumen ausschmückt.
Das Rückgebäude hatte den Namen »Gesindehaus«, was mich zur Frage trieb, ob es einst für Gesindel vorgesehen gewesen sei. Mir wurde versichert, dass es nicht so war. Im ersten Stock des Gesindehauses wohnten vielmehr die Hausangestellten, Diener, Kutscher, Zofen und die Köchin. Das Haupthaus sei ein »hochherrschaftliches« gewesen. Auf meine Zusatzfrage, was unter »hochherrschaftlich« zu verstehen sei, erhielt ich sehr unterschiedliche Antworten. Meine Mutter sagte, dies sei ein nicht mehr zeitgemäßer Ausdruck, unsere Nanni meinte dagegen, meine Eltern seien ihre Herrschaft, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte, war Nanni für uns Kinder doch ein normales Mitglied der Familie.
Im Erdgeschoss des zweiflügeligen Hofgebäudes signalisierten zwei große Holztore die Einfahrt zu den Kutschenremisen, von denen eine als Garage für den Wagen meines Vaters genutzt wurde, die andere war immer verschlossen. Sie zu betreten, war uns Kindern wegen angeblicher Baufälligkeit streng untersagt. Der Stall, in dem vier Pferde Platz hatten, wurde von Eisspezialist Knebel als Lager genutzt. Ab und zu vergaß Herr Knebel, die Stalltür zuzuschließen, was uns dazu verführte, aus einem Holzkasten ein paar Waffeln mitgehen zu lassen. Wir betrachteten diesen Mundraub als moralisch vertretbar – bis wir erwischt wurden. Vater appellierte an unser juristisches Verantwortungsgefühl und veranlasste uns, Schadensersatz aus unserem Taschengeld zu bezahlen. Dagegen war wenig zu sagen.
Das erste Stockwerk durften wir nicht betreten, da angeblich die Decken verfault und die Balken nicht mehr tragfähig waren. Eines Tages kam der Dachdecker, um das Dach notdürftig zu reparieren, durch das es auf unser immer sehr gepflegtes Auto regnete, das unserem Vater sehr am Herzen lag. Der Hauseigentümer sprach seit Jahren davon, das ganze Hinterhaus abzureißen und zweckmäßige Garagen zu bauen. Mein Vater war von Autos, zumal den neuesten Modellen, fasziniert, was uns mindestens einmal im Jahr einen Modellwechsel bescherte. Dieser nahm nicht immer auf die von der Familie benötigte Zahl der Sitzplätze Rücksicht. Aber ein zu klein geratener Wagen, vor allem der Sportwagen des Jahres 1938, war ein willkommener Anlass, nach relativ kurzer Nutzung nach einem neuen Fahrzeug Ausschau zu halten.
Der Dachdecker bat uns Kinder nach getaner Arbeit, den Schlüssel zur Eingangstür des Gesindehauses bei Nanni abzugeben, was wir auch taten, nicht ohne zuvor das Schloss wieder aufgeschlossen zu haben. Wir wollten zwei Tage warten, um feststellen zu können, ob die Tür zu dem geheimnisvollen ersten Stock offen bliebe.
Für unseren ersten Besuch hatten wir eine Taschenlampe und Kerzen organisiert, denn die Fensterläden dieser Räume waren immer geschlossen. Einer stand Schmiere und sollte mit einer Trillerpfeife drohende Gefahr ankündigen. Langsam tasteten wir uns die alte Holztreppe hinauf. Sie ächzte und quietschte nicht nur, weil sie alt war. Sie hatte wohl auch lange nicht das Gewicht der Treppensteiger zu tragen gehabt und stöhnte unter der ungewohnten Last. Im Licht unserer Lampen erkannten wir tatsächlich das große Loch in der Decke über der stets verschlossenen Remise. Wenn wir in die hinteren Räume gelangen wollten, musste dieser Abgrund überwunden werden.
Die Verschwörer zogen sich zur Beratung in das Gartenhaus zurück. Was uns fehlte, waren Bretter und Bohlen. Was uns aber vor allem fehlte, war ein Plan. Ohne den ging, so war die allgemeine Erkenntnis, gar nichts. Was Wunder, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen Tag und Nacht an nichts anderes als den Plan dachten, seine Vorteile, seine Nachteile und Gefahren diskutierten, wobei sich eine unauffällige Materialbeschaffung als der schwierigste Teil der Ausführung herausstellte. Schließlich kam einer auf den grandiosen Gedanken, wir sollten unsere Eltern um Zustimmung bitten, am besten über den Weg einer Vorinformation von Nanni, für den Bau einer Gartenhütte von Onkel Arthur, dem Sägewerksbesitzer, Abfallbretter und Balken zu besorgen.
Die Idee wurde beifällig aufgenommen, die erste Lieferung kam an und erwies sich als nicht ausreichend, da nicht nur zum Schein eine Hütte erbaut werden musste, sondern auch genügend Material übrig bleiben sollte, um eine tragfähige Konstruktion im Gesindehaus zu errichten. Als die Nachbestellung kam, gab es den ersten Streit: Wer gehörte zur offiziellen Baukolonne, wer zur geheimen. An Arbeitern gab es keinen Mangel, hatte sich doch der Plan unter den Kindern der Nachbarschaft herumgesprochen. Alle, die dabei sein wollten, mussten schwören, dicht zu halten. Nachdem die Vorarbeiter der beiden Kolonnen aufgrund von Körpergröße und Kraft bestimmt waren, einigte man sich auf ein Auslosungsverfahren, das jeden Tag neu erfolgen sollte. Die damit verbundenen Diskussionen verminderten die effektive Arbeitszeit, das Abenteuer »Gesindehaus« beschäftigte uns auf Monate.
Die Konstruktion des Steges über das Deckenloch erwies sich schwieriger als gedacht. Einmal krachte die ganze Balkenlage herunter und machte einen solchen Lärm, dass wir dachten, unser Abenteuer fände ein vorzeitiges Ende. Fluchtartig verließen wir das Haus, stießen zur Baukolonne der Gartenhütte und rissen ohne weitere Erklärungen unter deren lautem Protest die ganze Konstruktion ein, um unangenehmen Fragen nach der Ursache des Lärms eine Erklärung geben zu können. Nachdem den Mitverschworenen die Ursache unserer Zerstörungswut klar geworden war, beschlossen wir, bei einem eventuellen weiteren Zeitverzug unseres geheimen Brückenbauwerkes die Alibihütte erneut einstürzen zu lassen.
Endlich war es so weit: Der Steg hielt und einer nach dem anderen kroch vorsichtig ans andere Ufer. Es war kaum etwas zu sehen, denn die Petroleumlampe, die wir uns inzwischen besorgt hatten und welche die ausgebrannte Taschenlampe ersetzten musste, beleuchtete nur notdürftig das Kriechgestell. Erst als alle drüben waren und der letzte die Lampe mitgebracht hatte, betraten wir den nächsten Raum. Wir standen in einer Küche. Die Kacheln über dem Ausgussbecken waren abgefallen, in allen Ecken des Raumes hingen gewaltige, verstaubte Spinnennetze. Der große Holztisch in der Mitte des Raumes hatte nur noch drei Beine. Am meisten beeindruckte uns aber der riesige, eiserne Küchenherd mit zwei Backröhren und einem Wasserschiff. Die Feuerungstüren des Herdes standen auf, eine war halb abgerissen. Die ganze Brennkammer war angefüllt mit zerrissenen Papierstücken, die Herdringe fehlten und aus den kreisrunden Öffnungen der Herdplatte quoll die Papierflut heraus. Es sah aus, als wäre einer im letzten Moment daran gehindert worden, mit einem Streichholz das Papier anzuzünden.
Da der Raum sonst leer war, keine Geräte oder sonst Nützliches gefunden wurde, griffen wir mit den Händen in die Papiermenge, legten sie auf den staubigen Küchentisch, um im Schein der Lampe zu sehen, um was es sich handelte. Es waren in kleine Schnitzel zerrissene Briefe von verschiedener Handschrift, Tinte und Papiersorte, Rechnungen, Zeitungsausschnitte, Tapetenreste, die uns, richtig zusammengesetzt, Wichtiges über die Bewohner des alten Hauses erzählen konnten. Ein Stück einer alten Zeitung zeigte das Datum 10. Juni 1878. Wir waren platt, denn der Tag unseres sensationellen Fundes war der 10. Juni 1938. Wenn das keine Bedeutung hatte! Sechzig Jahre waren seitdem vergangen, für uns damals eine unvorstellbar lange Zeit.
In den folgenden Wochen waren wir mit nichts anderem beschäftigt, als zu versuchen, die unzähligen Papierschnitzel zu lesbaren Dokumenten zusammenzusetzen, was uns nur in einem Fall fast vollständig gelang. Und das war der Sensationsfund: Ein auf hellblauem Papier mit violetter Tinte geschriebener Liebesbrief aus der Feder einer offensichtlich sehr adeligen Dame, was aus der kleinen Krone am oberen Rand des Papiers zu schließen war. Was uns erstaunte, war die Anrede, mit der sie ihren Geliebten ansprach. Sie sagte nicht einmal »Du« zu ihm.
Dieser Brief gab Anlass zu vielfältigen Spekulationen über die Bewohner des Hauses, die auch nach mehreren Wochen keinen Abschluss fanden. War die Dame etwa verheiratet, natürlich nicht mit dem Empfänger des Briefes? Oder sollte mit seiner beabsichtigten Vernichtung ein Beweisstück unterschlagen werden? Wie ging wohl die ganze Affäre aus? Wie kam das Schriftstück in die Hand von Domestiken, lag etwa ein Erpressungsversuch vor? Wir beschlossen, den ganzen Fall in den kommenden Wintermonaten der Bearbeitung unserer Anwaltskanzlei zuzuführen.
Die ersten sechs Monate dieses Jahres 1938 waren für uns Kinder so reich an Freude, Glück, Überraschungen, dass wir gar nicht glauben wollten, ein möglicher Krieg könnte alles verändern. Die Erwachsenen aber sprachen von der Sudetenkrise und mein Vater schickte uns drei Kinder zusammen mit Nanni auf die Insel Reichenau im Bodensee, damit wir – wie er wohl dachte – bei Ausbruch eines Krieges schneller in der Schweiz, der Heimat meiner Mutter, wären. Diese wohl eher euphorische Einschätzung der Aufnahmebereitschaft unseres südlichen Nachbarn wurde nicht auf die Probe gestellt oder, besser gesagt, noch nicht auf die Probe gestellt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass das Wort »Krieg« eine neue Bedeutung bekam. Aus »Spiel« wurde Bedrohung. Und als dann das Nachgeben westlicher Staatsmänner gegenüber dem machtbesessenen Führer die scheinbare Absicherung des Friedens brachte, atmeten alle Erwachsenen auf, und ich begriff zum ersten Mal die Bedeutung des Wortes »Frieden«.
Nun konnte unser englischer Onkel, Nowell Watson, uns – wie vorgesehen – besuchen. Als er im Herbst nach Baden-Baden kam, war auch er überzeugt, der Frieden in Europa sei für lange Zeit gesichert. »Herr Hitler wird geben in Zukunft Acht« sagte er in seinem für uns Kinder lustigen Deutsch, das wir in Satzstellung und Tonart nachmachten, wenn einer in unseren Spielen die Rolle eines reichen Engländers übernahm. Nur unsere Mutter sagte, dass diese Jahre ohne Krieg nicht für alle Menschen Frieden brächten.
Wie recht sie hatte, erfuhr ich im November desselben Jahres. Ich ging, wie an jedem Werktag, morgens zu meiner Volksschule. Es war nicht wie an einem gewöhnlichen Tag. Die Menschen liefen aufgeregt herum, und ich sah viele Männer in Uniformen. Irgend etwas musste geschehen sein. Als ich auf den Leopoldsplatz kam, bemerkte ich die große Rauchwolke. Alle liefen in diese Richtung, ich schloss mich an. Die Menschen riefen sich zu: »Die Synagoge brennt!« Ich wußte nicht, was das bedeutete. Aber ein Brand ist allemal sehenswert, sagte ich mir.
Ich folgte den anderen bis zur Einmündung der Stephanienstraße in die Sophienallee und bereits am Fuße der steil ansteigenden Straße sah man das Feuer. Die gegenüberliegende Straßenmauer war ein idealer Platz zum Zuschauen, und ich war fasziniert von den hohen Flammen, die aus den Fenstern schlugen und bereits das Dachgebälk erfasst hatten. Ein so großes Feuer hatte ich noch nie gesehen. Männer in braunen und schwarzen Uniformen sprangen schreiend umher, trugen Gegenstände aus dem brennenden Haus und machten ebenso wenig wie die anwesende Feuerwehr die geringste Anstrengung, den Brand zu bekämpfen. Das war irritierend, passte nicht zusammen. Die Erwachsenen, die um mich herum standen und die ich fragte, was hier geschähe, blieben entweder stumm oder sagten »Recht geschieht es ihnen«, womit ich auch nichts anfangen konnte. Schließlich sagte ein alter Herr zu mir: »Geh nach Hause, heute fällt die Schule aus.«
Ich wartete noch eine Weile, konnte mich vom Anblick der Flammen nicht losreißen, ebenso wie einige Mitschüler, die inzwischen ebenfalls eingetroffenen waren. Dieses Feuer schien ein einmaliges Ereignis zu sein. Und alle bewegte die Frage, warum nicht gelöscht werde. Ein Kamerad beantwortete sie mit dem Satz: »Das ist doch der Tempel der Juden. Und die werden heute gejagt.« Ich wußte damals noch nicht, dass das Wort »Jude« offensichtlich mehr bedeutete als die Zugehörigkeit zu einer Religion, und die jetzt brennende Synagoge hatte ich immer für eine Kirche gehalten.
Verwirrt machte ich mich auf den Heimweg. In der Lange-Straße sah ich beschmierte Schaufenster und zum ersten Mal den Davidstern, den ich einige Jahre später in Polen wiedererkennen sollte. Auch hier war die Straße voll von aufgeregten Menschen, viele in Uniform. Ich bekam Angst und lief rasch die Straße hinunter in Richtung unseres Hauses.
Da bog gegenüber dem Hotel »Badischer Hof«, in dem immer unser englischer Onkel Nowell übernachtete, eine Kolonne von etwa 25 bis 30 Männern in die Lange-Straße ein, eskortiert von brüllenden SA- und SS-Leuten, die ab und zu mit Fäusten und Stöcken auf die Männer einschlugen, mit ihren schwarzen Stiefeln nach ihnen traten. Vor und hinter der Kolonne marschierten Polizisten, als wollten sie eine gewisse staatliche Ordnung in das Geschehen bringen wollten.. Sie drehten sich nicht um und überließen die Kolonne, alte und junge Menschen, den Schlägern.
In der ersten Reihe der Gefangenen lief ein großer, aufrecht gehender Mann, der mit einem langen schwarzen Mantel bekleidet war. Den Hut hielt er, wie alle anderen auch, in der Hand. Auf dem Brustteil seines Mantels sah ich einige Orden, darunter das »Eiserne Kreuz Erster Klasse« und das silberne Verwundetenabzeichen des Ersten Weltkriegs. Den Mann kannte ich. Es war der Rechtsanwalt Dr. Hauser, ein Kollege meines Vaters, der früher oft in unserer Wohnung war, den ich allerdings schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Vater hatte uns erzählt, Dr. Hauser habe als Hauptmann in der kaiserlichen Armee gedient und sei mehrfach ausgezeichnet worden.
Als die Kolonne an mir vorbeikam, holte einer der braunen Schläger mit dem Stock aus und schlug Dr. Hauser auf den Rücken. »Du kannst noch mehr kriegen, du Hauptmann«, brüllte er. Hauser blickte sich um und sah ihm ins Gesicht. Sein Peiniger wandte sich ab.
Verstört rannte ich nach Hause, berichtete alles, was ich gesehen und gehört hatte. »Und den Dr. Hauser haben sie geschlagen, obgleich der das Eiserne Kreuz hat, also ein Held ist«. Meine Eltern versuchten mich zu beruhigen. Ich wüsste heute gern, was sie mir damals sagten, erklärten oder nicht sagten. Nach dem Krieg habe ich meine Mutter gefragt, was die Erwachsenen damals dachten. Sie meinte, die einen hatten Angst zu denken, andere glaubten, es handle sich um ein in Deutschland einmaliges Pogrom, wie es die Juden in Europa schon einige Male getroffen habe, und ein nicht kleiner Teil sprach von einem »Denkzettel«, der den ihnen verhassten Juden verpasst wurde. Heute wissen wir, dass es der erste Denkzettel war, den wir Deutsche verpasst bekamen. Er hatte damals offensichtlich keine Wirkung und nach ein paar Wochen sprach man nicht mehr über dieses Ereignis, das verharmlosend die »Kristallnacht« genannt wurde, als seien damals nur ein paar Glasscheiben zu Bruch gegangen. Tatsächlich zerbrach aber damals der Rechtsstaat.
Die Vorweihnachtszeit mit ihren Vorbereitungen lenkte uns Kinder ab. Wunschzettel mussten geschrieben werden, Geschenke wurden gebastelt, Gedichte auswendig gelernt für den Besuch des Nikolaus’, das Weihnachtsmärchen wurde geprobt.
Als erstes wichtiges Ereignis kam der Nikolaustag. Er war für uns Kinder fast noch aufregender als Weihnachten. Wir durften alle Freunde und Freundinnen einladen, die im Frühjahr und im Sommer mit uns im Garten gespielt hatten. Als der Abend unseren Garten fast vollständig in Dunkelheit getaucht hatte, drückten sich die Nasen vieler Kinder an die Fensterscheiben unseres Wohnraums und des Eßzimmers. Jeder wollte als Erster den Nikolaus sehen, wenn er am Ende des Gartens auftauchte, dort wo im Sommer Knebels Eiswagen stand. Die Ungeduld, mit der er erwartet wurde, ließ seine Laterne aufleuchten, obgleich er noch immer im verschneiten Wald war und unseren Garten noch nicht betreten hatte. Die große bunte Glaslaterne, die er hin und her schwenkte, war sein Erkennungszeichen. In meiner Erinnerung kam er immer in einen verschneiten Garten, am Nikolaustag lag immer Schnee. Davon lasse ich mich auch heute nicht abbringen.
Endlich tauchte er auf. Die Fenster wurden aufgerissen, Begrüßungsrufe wirbelten die Schneeflocken durcheinander, galt es doch, den Nikolaus, von dem auch die Älteren nicht genau wussten, war er echt oder nicht, freundlich willkommen zu heißen. Offensichtlich hatte er jedes Jahr Schwierigkeiten, den Weg durch den Garten zu finden, denn einmal wich er nach links, einmal nach rechts vom Weg ab, ja verirrte sich in den Gemüsegarten, obwohl zwei Dutzend Kinderstimmen ihm mit lauten Zurufen den schnellsten Weg ins Haus zeigten.
Wenn wir ihn die Treppe heraufpoltern hörten, wurde es im Zimmer still. Jedes Jahr waren wir überrascht, wie groß er war und wie tief seine Stimme klang. Er setzte den Sack auf dem Boden ab und ließ sich stöhnend auf das Sofa fallen. Die Rute legte er neben sich auf den Sitz. Dann wurde der Jüngste von uns zu ihm geführt, um sein Gedicht aufzusagen. Dem Gedicht folgten ein Lob, aber auch einige unangenehme Fragen, die erkennen ließen, dass St. Nikolaus über alles Bescheid wusste. Je älter der Befragte, umso bohrender wurden die Fragen, umso tiefer die Stimme des Nikolaus, wenn er seine Erwartung für das nächste Jahr aussprach, dieses zu tun und jenes zu lassen.
Nachdem diese bisweilen hochnotpeinliche Befragung vorüber war, wurde der Sack ausgepackt und jeder erhielt seine Äpfel, Nüsse, Feigen und einen gebackenen Weihnachtsmann mit Augen aus Rosinen, Nasen und Mund aus Mandelkernen, der verdächtig nach Nannis sonntäglichem Hefezopf schmeckte. Wenn Nikolaus sagte, es sei nun an der Zeit zu gehen, weil er ja noch viele Kinder zu besuchen habe, wurde ihm von unserem Vater, dem das Vergnügen über diesen Besuch anzusehen war, ein Gläschen Likör angeboten, zumal es draußen so kalt und windig sei. Aus einem Gläschen wurden zwei, manchmal auch drei, was uns Kindern nur recht war, denn solange er da war, konnten wir zusammenbleiben.
Als er an diesem Abend schließlich aufstand, sich bedankte und seinen Sack schulterte, zur Türe ging, um uns allen Lebewohl zu sagen, griff er sich plötzlich an den Kopf, als sei ihm etwas eingefallen. »Da war doch noch was. Was war es nur? War da nicht noch eine Sache mit dem Hinterhaus? Fällt euch dazu etwas ein?« Entsetztes Schweigen war die Antwort. Er wusste halt doch alles. Und der Kleinste unter uns, der im Sommer noch zu klein war, um uns auf unserem Abenteuer zu begleiten, antwortete mit der Gegenfrage: »Was ist ein Hinterhaus?«
Nikolaus brummelte in seinen Bart, dann habe er sich wohl geirrt, aber es schien uns, als habe er uns mit dem rechten Auge zugezwinkert. Als er endlich in Nannis Begleitung das Zimmer verlassen hatte, versuchten wir, von diesem heiklen Thema abzulenken, hingen uns wieder zum Fenster hinaus, um Nikolaus auf seinem Weg durch den verschneiten Garten zuzuwinken.
Einige Tage später riefen uns unsere Eltern zum Familienrat zusammen, ein seltenes Ereignis, das wichtigen Beratungen und Entscheidungen vorbehalten war. Nanni wurde natürlich dazugebeten. Bisher waren damit nur gute Nachrichten und aufregend schöne Erlebnisse verbunden gewesen. Dieses Mal aber war die Nachricht niederschmetternd. »Im Sommer nächsten Jahres werden wir in ein anderes Haus umziehen. Wir hielten es für besser, es euch jetzt zu sagen, damit alle wissen, es wird unser letztes Weihnachtsfest in diesem Haus sein.«
Erstaunt, ja fassungslos, blickten wir uns an. Unsere Augen gaben das Entsetzen wieder, das diese Ankündigung bei uns auslöste. Warum nur, fragten sie. Dieses wunderbare Haus mit dem Kamin in unserem Wohnzimmer, der mit seinem Feuer im Winter alle anzog und diesen Raum zum abendlichen Lagerplatz werden ließ. Unser großes Spielzimmer, das auch unsere Freundesschar aufnehmen und mit einigem Möbelrücken zur perfekten Anwaltskanzlei umgewandelt werden konnte. Der Garten, in dem uns jeder Baum, jeder Strauch, jede Unebenheit im Boden vertraut war. Und das Hinterhaus, das wir gerade erobert hatten. Alles das sollte nicht mehr da sein?
Vater und Mutter gaben uns Erklärungen, die wir nicht verstehen wollten. Zum ersten Mal begriffen wir, dass das Haus uns gar nicht gehört, sondern gemietet war. Der Eigentümer wollte im nächsten Jahr das Hinterhaus abreißen, unser Hinterhaus, und die Miete beträchtlich heraufsetzen, insbesondere für die Kanzleiräume. Deshalb müsse man sich, so sagte Vater, nach einem neuen Haus umsehen.
Unser Vorschlag, wir sollten das Haus und seinen Garten einfach kaufen, wurde mit einem Lächeln und der Bemerkung beantwortet, dafür sei nicht ausreichend Geld vorhanden. Das machte uns noch fassungsloser, hatten wir Kinder doch bisher geglaubt, unsere Familie sei, im Vergleich zu den Eltern unserer Freunde und Nachbarn, wohlhabend, wenn nicht gar reich.
Weihnachten ging vorüber, als ob sich nichts geändert hätte. Kinder haben die Gabe, sich von Ereignissen, die nicht unmittelbar bevorstehen, nicht allzu stark beeindrucken zu lassen. Und im kommenden Frühling und Sommer, das wussten wir, war uns der Garten noch sicher. Was wir an Weihnachten nicht ahnten: Es war der letzte Heilige Abend in Frieden.
An der Suche nach dem neuen Haus waren wir nicht beteiligt. Wir hätten wohl jedes verworfen, das uns gezeigt worden wäre. Im Mai war es schließlich so weit. Wir gingen zu Fuß zur Maria-Viktoria-Straße. Der Weg durch die Lichtentaler Allee sollte uns wohl die gute Lage unseres neuen Heims zeigen. Wir waren wenig beeindruckt, wenn ich auch zugeben muss, dass meine spätere Gewohnheit, durch eben diese Allee zur Schule zu gehen und nicht den direkten Weg zu nehmen, vielleicht doch mit meiner ersten Bekanntschaft mit der Maria-Viktoria-Straße 29 zusammenhing.
Was mir sofort gefiel, war der Straßenname. Er klang besser als Lange-Straße, wo wir bisher gewohnt hatten. Die Ortsbesichtigung aber führte zu der ernüchternden Erkenntnis: Das war auch schon alles, was besser war. Der Garten verdiente seinen Namen nicht. Keine zwanzig Meter konnte man rennen. Es gab keinen einzigen Baum, der zum Klettern einlud. Selbst für eine Sandkiste schien der Garten hinter dem Haus keinen Platz zu haben. Und der Vorgarten war nichts anderes als eine bepflanzte Wegführung zur Haustüre. Wir hatten uns vorgenommen, unsere mit Sicherheit zu erwartende Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Um unser Urteil gebeten, sagte meine Schwester nur: »Ein vornehmes Haus.« Das war es in der Tat. Die ganze Straße war gesäumt von jenen klassischen, weißen Villen, die Baden-Baden noch heute prägen. Aber Fußballspielen konnte man auf dieser Straße nicht.
Der Umzug wurde zu einer sonderbaren Mischung aus Wehmut, Trauer und Galgenhumor. Warum hatte mein Vater dazu ausgerechnet den Tag vor seinem Geburtstag ausgesucht? War es wirklich nur sein Wunsch, diesen Tag im neuen Haus zu feiern, auch wenn noch nicht alles perfekt eingerichtet war?
Unerklärlich blieb mir, warum die Erwachsenen meine Hilfe beim Zusammenpacken und Kistentragen nicht haben wollten. Sie hätten sonst doppelte Arbeit, sagten sie. Wie soll das einer verstehen, fragte ich mich. So ging ich nochmals in den Garten, pflückte ein paar Himbeeren, setzte mich an den Sandkasten im Gartenhaus, flog auf der Gartenschaukel durch die Luft und stieg ein letztes Mal die Treppen im alten Hinterhaus hoch. Noch nie hatten wir die Klappläden geöffnet, jetzt tat ich es. Nur mit Mühe und unter gewaltigem Quietschen waren sie zu bewegen. Eine Maus sprang mir vor Schreck über den Fuß, Spinnen liefen aufgeregt Netz rauf, Netz runter. Das ungewohnt helle Licht erlaubte es mir, aufrecht über unseren Steg zu gehen. Nur die Läden in der Küche bekam ich nicht auf. Dennoch sah ich genug um festzustellen, dass die kleinen Papierstücke noch Jahre ausgereicht hätten, um das spannende Puzzle fortzusetzen. Ich musste also auch einige ungelöste Geheimnisse zurücklassen.
Als der Möbelwagen davonfuhr, weinte meine Mutter, was ich noch nie erlebt hatte. Ich kam mir sehr erwachsen vor, als ich sie zu trösten versuchte. Vater fuhr den Fiat aus der Remise, Nanni schloss das Haus ab und alle stiegen ein. Es wurde nicht viel gesprochen auf der Fahrt zum neuen Haus. Nur als mein Bruder fragte, wo denn die Garage für den Wagen sei, sagte mein Vater: »Kein Garten, keine Garage ….«. Und ich fiel ein: »… und kein Hinterhaus!« Großes Gelächter erfüllte den Wagen. Vielleicht war unser Abenteuer im Hinterhaus doch nicht ganz unbemerkt geblieben.
Am Nachmittag und bis in die Nacht hinein wurde ausgepackt, eingeräumt, Möbel hin und her getragen, bis wir schließlich todmüde in die Betten fielen. Nachts klingelte das Telefon. Mein Vater hob nicht ab, ließ es weiterklingeln, bis es dem Fräulein vom Amt zuviel wurde und wieder nächtliche Stille eintrat.
Am Morgen krochen wir, obschon nicht Sonntag war, zu unseren Eltern ins Bett. Wir genossen diese knappe Stunde, in der Vater und Mutter nur für uns da waren. Vater stellte sich wie immer schlafend. Und ihn erst zärtlich, dann aber etwas frecher und robuster zum Aufwachen zu bringen, war eines unserer schönsten Spiele. Wir wurden unterbrochen durch die Glocke an der Haustüre. Sie klang ungewohnt laut. Vater stand auf, ging zur Türe und als er zurückkam, hielt er einen grauen Briefumschlag in der Hand. »Wer war es,« fragte meine Mutter. Vater zögerte und sagte schließlich: »Der Krieg.«