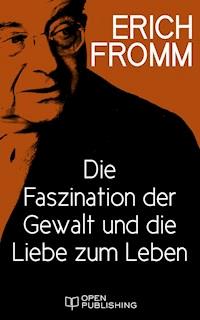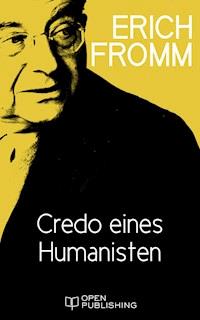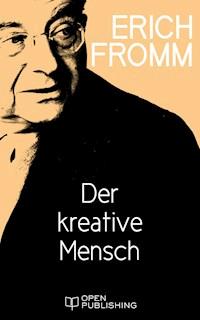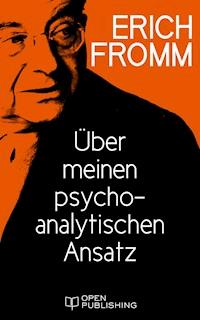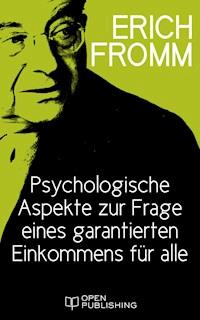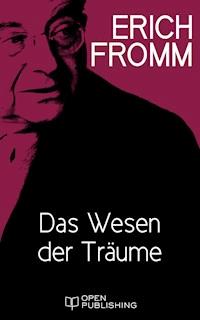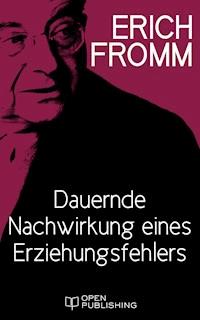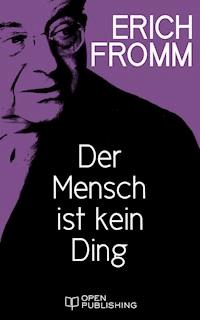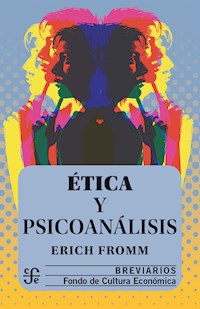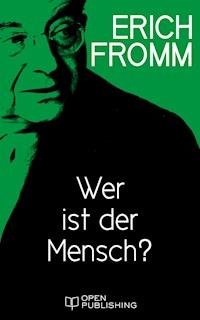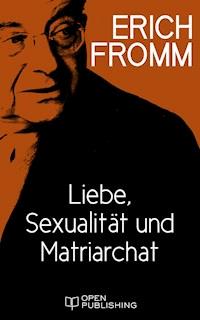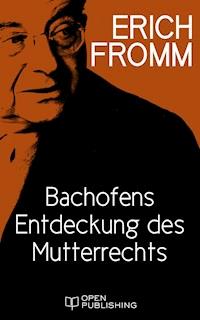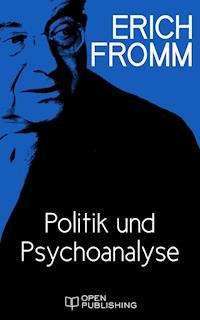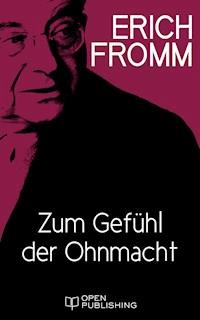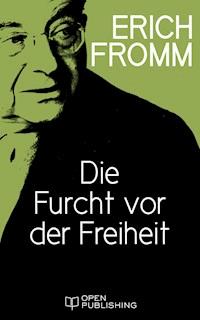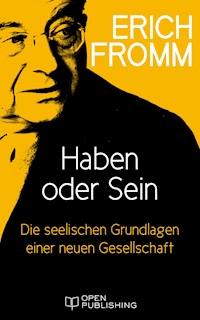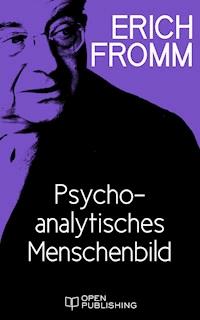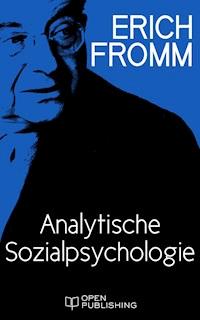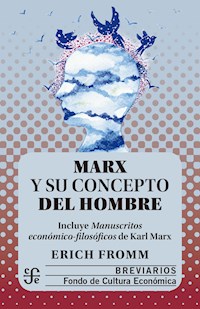3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieser bereits 1937 geschriebene, aber bis 1992 verschollene Aufsatz kann als der für die Theorieentwicklung Fromms wichtigste Beitrag gelten. Nirgends sonst im Werk von Fromm lässt sich so gut nachvollziehen, wie Fromm dazu kam, die Psychoanalyse auf ein anderes theoretisches Fundament zu stellen und an die Stelle des triebtheoretischen ein bezogenheitstheoretisches Paradigma zu setzen. Hier zeigt er detailliert auf, wie sich die Erfordernisse des Wirtschaftens und des sozialen Zusammenlebens in den psychischen Strebungen der betreffenden Menschen widerspiegeln. Für jeden, der Fromms sozial-psychoanalytischen Ansatz kennen lernen will, ist dieser frühe Aufsatz ein „Muss“. Aus dem Inhalt • Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft • Der gesellschaftlich erzeugte Charakter • Die gesellschaftliche Funktion des sozial typischen Charakters • Die Neuformulierung der Triebtheorie auf Grund eines anderen Menschenbildes • Der sozial typische Charakter als Ausdruck der gesellschaftlich geprägten psychischen Struktur des Einzelnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Ähnliche
Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft.Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie
Erich Fromm(1992e [1937])
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk.Aus dem Amerikanischen von Rainer Funk.
Der 1937 entstandene Beitrag Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft. Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie (1992e) wurde erstmals 1992 in deutscher Übersetzung in Band 7 der „Schriften aus dem Nachlass“, der den Titel Gesellschaft und Seele. Sozialpsychologie und psychoanalytische Praxis trägt, beim Beltz Verlag in Weinheim veröffentlicht. Reprint als Heyne Sachbuch 1995 beim Heyne Taschenbuchverlag in München. 1999 fand der Text Aufnahme in Band XI der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag), S. 129-175. – Die Erstpublikation des Beitrags in der von Fromm selbst besorgten englischen Übersetzung unter dem Titel Man’s impulse structure and its relation to culture erfolgte 2010 in: E. Fromm, Beyond Freud: From Individual to Social Psychoanalysis, S. 17-74, bei der American Mental Health Foundation, New York.
Die E-Book-Ausgabe der einzelnen Beiträge dieses Sammelbandes orientiert sich an der Textfassung in Band XI der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, S. 129-175.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1992 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft. Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie
1. Der Irrweg der orthodoxen Psychoanalyse bei der Erklärung gesellschaftlicher Phänomene
a) Die zwei Erklärungsprinzipien bei Freud
b) Das bürgerliche Menschenbild Freuds und Freuds Desinteresse am Charakter der Gesellschaft
c) Kritik der Freudschen Rückführung psychischer Strebungen des Einzelnen und der Gesellschaft auf die Sexualität
2. Die Relevanz der analytischen Sozialpsychologie für die Neuformulierung einzelner Aspekte der psychoanalytischen Theorie
a) Die Neuformulierung des Ödipuskomplexes, des primären Narzissmus und der Psychologie der Frau
b) Die Neuformulierung der Rolle der Familie
c) Die Neuformulierung der Triebtheorie auf Grund eines anderen Menschenbildes
3. Der Unterschied der psychoanalytischen Theorie, aufgezeigt am analen Charakter
a) Es geht um mehr als nur um sexuelle Triebe und deren Abkömmlinge
b) Freuds Beschreibung und Erklärung des analen Charakters
c) Die Beschreibung des analen Charakters aus der Bezogenheit zur Umwelt
d) Die unterschiedliche Erklärung der Charakterbildung und ihre Relevanz für die charakterologische Typenbildung
4. Die Frucht der neuen psychoanalytischen Theorie: Der gesellschaftlich erzeugte Charakter
a) Der sozial typische Charakter als Ausdruck der gesellschaftlich geprägten psychischen Struktur des Einzelnen
b) Die gesellschaftliche Funktion des sozial typischen Charakters
5. Die Bedeutung der Analytischen Sozialpsychologie im Vergleich mit anderen Ansätzen
a) Untersuchungen zum „Geist“ einer Gesellschaft
b) Die Theorie des historischen Materialismus
c) Die am behavior orientierten amerikanischen Anschauungen
Literaturverzeichnis
Der Autor
Der Herausgeber
Impressum
1. Der Irrweg der orthodoxen Psychoanalyse bei der Erklärung gesellschaftlicher Phänomene
a) Die zwei Erklärungsprinzipien bei Freud
Die Sozialpsychologie[1] ist nach zwei Seiten hin ausgerichtet. Auf der einen Seite behandelt sie das Problem, inwiefern die psychische Struktur des Menschen durch gesellschaftliche Faktoren bestimmt ist, auf der anderen Seite, inwiefern die psychische Struktur selbst als beeinflussender und verändernder Faktor im gesellschaftlichen Prozess wirksam wird. Beide Seiten des Problems sind unlösbar miteinander verknüpft. Die psychische Struktur, die wir als wirksam im gesellschaftlichen Prozess erkennen können, ist selbst schon das Produkt dieses Prozesses, und ob wir die eine oder die andere Seite betrachten, die Frage ist nur, welcher Aspekt des Gesamtproblems jeweils im Mittelpunkt unseres Interesses steht.
Mit Hinblick auf das Problem der Bedingtheit der seelischen Struktur durch die Gesellschaft besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen Sozial- und Individual-Psychologie. Ob ein Einzelner oder eine mehr oder weniger große Gruppe Gegenstand der psychologischen Untersuchung ist, macht grundsätzlich keinen Unterschied. Der Einzelne ist in seiner Lebensweise durch die Gesellschaft bestimmt, die Gesellschaft andererseits ist nichts jenseits der Individuen. Freud hat bei aller Zentrierung seines Interesses um das Individuum klar erkannt, dass der Unterschied zwischen Sozialpsychologie und Individualpsychologie nur ein scheinbarer ist. „Die Individualpsychologie“, sagt Freud (1921c, GW 13, S. 73),
ist zwar auf den einzelnen Menschen eingestellt und verfolgt, auf welchen Wegen derselbe die Befriedigung seiner Triebregungen zu erreichen sucht, allein sie kommt dabei nur selten, unter bestimmten Ausnahmebedingungen, in die Lage, von den Beziehungen dieses Einzelnen zu anderen Individuen abzusehen. Im Seelenleben des Einzelnen kommt ganz regelmäßig der andere als Vorbild, als Objekt, als Helfer und als Gegner in Betracht, und die Individualpsychologie ist daher von Anfang an auch gleichzeitig Sozialpsychologie in diesem erweiterten, aber durchaus berechtigten Sinne.
Dieser Auffassung entspricht auch Freuds grundlegende Methode der Erklärung der psychischen Struktur des Individuums. Bei aller grundsätzlichen Berücksichtigung des Einflusses konstitutioneller Faktoren ist das für Freud leitende Prinzip bei der [XI-132] Analyse des Individuums die Entwicklung der Trieb- und Charakterstruktur aus den Schicksalen – speziell den frühkindlichen – zu erklären, die das Individuum im Zusammenstoß mit der Umwelt erleidet. Auf eine kurze Formel gebracht, ist das Prinzip der analytischen Methode: Verständnis der Triebstruktur aus dem Lebensschicksal, das heißt aus den äußeren, auf den Menschen einwirkenden Faktoren.
Bei näherem Zusehen erweist sich aber, dass diese Formel zu allgemein ist und tatsächlich zwei verschiedene Erklärungsprinzipien einschließt, die in der psychoanalytischen Deutung nebeneinander und durcheinander angewandt werden. Das eine hier gemeinte Prinzip besagt folgendes: Der Mensch muss sich, vom Drang nach der Befriedigung seiner Bedürfnisse und speziell seiner sexuellen Bedürfnisse getrieben, mit der Umwelt auseinandersetzen, die ihm teils als Mittel der Befriedigung, teils als die Befriedigung verhindernd, entgegentritt. In diesem Prozess der Auseinandersetzung[2] mit der Außenwelt kommt es zu bestimmten Impulsen und Ängsten, bestimmten freundlichen und feindseligen Einstellungen gegenüber der Außenwelt oder – um es noch anders auszudrücken – zu einer bestimmten Art von Objektbeziehung. Ein Beispiel für dieses Erklärungsprinzip stellt der Ödipuskomplex dar.
Freud geht davon aus, dass das Kind (aus Gründen der Einfachheit spricht er hier nur vom kleinen Jungen) seine sexuellen Wünsche auf seine Mutter richtet. Bei dem Versuch, den seinen Wünschen entsprechenden Impulsen Raum zu geben, gerät er mit seinem Vater in Konflikt, der ihm die Befriedigung seiner Wünsche verbietet und ihm Strafe androht. Diese Erfahrung mit dem verbietenden Vater erzeugt eine bestimmte psychische Reaktion im Kind, eine bestimmte Beziehung zum Vater, nämlich eine des Hasses und der Feindseligkeit. Die gegen den Vater gerichteten feindseligen Impulse stoßen auf dessen Überlegenheit, erzeugen im Jungen Angst und zwingen ihn, diese Impulse zu verdrängen; er unterwirft sich stattdessen dem Vater oder identifiziert sich mit ihm. Feindseligkeit, Unterwerfung, Identifikation sind die Ergebnisse des Zusammenstoßes des von seinen sexuellen Wünschen getriebenen Jungen mit einer bestimmten Außenweltkonstellation. Ganz unabhängig von der Frage, inwieweit die allgemeine Gültigkeit der Annahme eines Ödipuskomplexes gerechtfertigt ist und ob Freuds Annahme stimmt, dass der Ödipuskomplex bereits grundsätzlich eine ererbte Aneignung ist, bleibt es doch eine Tatsache, dass Freud die Intensität und besonderen Qualitäten der Erfahrung des Ödipuskomplexes im Einzelnen den Besonderheiten seiner Lebenserfahrungen zuordnet.
Ganz anders lautet das Erklärungsprinzip, das Freud bei der Erklärung des Zusammenhangs von Triebstruktur und Lebenserfahrungen anwendet. Bei diesem zweiten Prinzip nimmt er an, dass die Außenwelt auf die Sexualität einwirkt und sie in einer ganz bestimmten Weise verändert und dass bestimmte psychische Impulse die unmittelbaren Ergebnisse besonderer Formen der Sexualität sind. Dieses Erklärungsprinzip setzt die Freudsche Libidotheorie voraus. Bei dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass die Sexualität verschiedene Entwicklungsphasen durchläuft. Die orale, anale, die phallische und die genitale Entwicklungsphase sind jeweils an erogenen Zonen orientiert; außerdem zeigen sich – mehr oder weniger an diese erogenen Zonen geknüpft – bestimmte sexuelle Partialtriebe wie Sadismus, Masochismus, Voyeurismus und Exhibitionismus. Völlig unabhängig von den Bedingungen, die eine Außenwelt [XI-133] stellt, durchläuft der Einzelne auf Grund gegebener biologischer Tatsachen alle diese Phasen, bis schließlich die reife genitale Sexualität zum vorherrschenden Trieb wird. Insofern allerdings die Außenwelt teils durch Versagen, teils durch Verwöhnen die verschiedenen Phasen der Sexualität beeinflusst, kommt es in der einen oder anderen Form zu Fixierungen an diese Phasen (obwohl solche Fixierungen nach Freud ausdrücklich auch durch konstitutionelle Stärke oder Schwäche bestimmter erogener Zonen bestimmt sein können). Im Unterschied zur normalen Entwicklung behalten diese Phasen eine ungewöhnliche Stärke und werden zur Quelle für die Entwicklung wichtiger psychischer Impulse – sei es auf dem Wege der Sublimierung, sei es durch Reaktionsbildung. Auf diese Weise erklärt Freud die Existenz so wichtiger Triebe oder Charakterzüge wie Gier, Sparsamkeit, Ehrgeiz, Ordentlichkeit usw.
Mit dem gleichen analytischen Erklärungsprinzip werden auch bestimmte Haltungen und[3] bestimmte Beziehungen zu anderen Menschen erklärt. So werden Sparsamkeit und Geiz als die Sublimierung des Triebes, den Kot zurückzuhalten, verstanden. Eine verächtliche Einstellung zu Menschen wird dadurch erklärt, dass diese Menschen für den Betreffenden unbewusst Kot bedeuten, und die Abscheu, die diesem galt, auf die Menschen übertragen wird. Eine Haltung, die dadurch charakterisiert ist, dass ein Mensch die Einstellung hat, er brauche zur Erreichung seiner Ziele sich nicht anzustrengen, denn das von ihm Gewünschte werde sich ganz plötzlich irgendwann einmal zutragen, wird als Sublimierung der Lust an einer plötzlichen Stuhlentleerung nach einer langen Stuhlzurückhaltung gedeutet.
Der Unterschied zwischen beiden Erklärungsprinzipien liegt auf der Hand. Im einen Fall wird eine psychische Erscheinung als Reaktion des Menschen auf die Umwelt verstanden, die sich der Durchsetzung seiner Bedürfnisse[4] in der einen oder anderen Weise gegenüber verhält. Im anderen Fall wird die psychische Erscheinung [XI-134] unmittelbar aus der Sexualität erklärt; sie ist nicht eine Reaktion auf die Umwelt, sondern ein Ausdruck der durch die Umwelt modifizierten Sexualität.
Eine schematische Skizze[5] soll das Gesagte noch verdeutlichen. Die unter I fallenden Reaktionen werden von Freud als die direkten Abkömmlinge der Sexualität verstanden, die ihrerseits durch Umwelteinflüsse modifiziert wird. Die unter II fallenden Reaktionen sind Objektbeziehungen, die nicht direkte Produkte der Sexualität sind, sondern Reaktionen auf die Umwelt, die im Prozess der Durchsetzung der Triebe entstehen.
Die hier auseinandergehaltenen beiden Erklärungsprinzipien gehen in der psychoanalytischen Literatur durcheinander, ohne dass ihre Verschiedenheit bemerkt wurde. (Auf die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Objektbeziehungen und Sublimierungen und Reaktionsbildungen der genitalen Sexualität habe ich bereits in meinem Beitrag Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie (1932b, GA I, S. 59-77) hingewiesen.) Dies führte zu vielen Unklarheiten, die oft das Verständnis der analytischen Theorie erschwerten. Ein gutes Beispiel für das Durcheinandergehen beider Erklärungsprinzipien liefert der von Freud konzipierte und von anderen, speziell von Abraham und Jones, weitergeführte Begriff des analen Charakters. Freud fand ein häufig wiederkehrendes Syndrom von drei Charakterzügen, nämlich Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn, verknüpft mit bestimmten Erlebnissen in den Vorgängen der Stuhlentleerung und der Reinlichkeitsgewöhnung. Der Eigensinn wird verstanden als eine Reaktion auf die Umwelt, die sich den physiologischen Bedürfnissen des Kindes in einer feindlichen und überstrengen Weise entgegenstellt. Das Erklärungsprinzip hier ist dasselbe, wie wir es oben beim Ödipuskomplex dargestellt haben. Die anale Funktion spielt nur die Rolle, dass an ihr als einem wichtigen Bedürfnis sich die Auseinandersetzung mit der Umwelt in einer bestimmten Weise vollzieht. Die Sparsamkeit hingegen wird als direktes Produkt der Analerotik, genauer gesagt, der Lust am Zurückhalten des Stuhls, angesehen, und nur die Tatsache, dass gerade diese Lust so stark ist, durch Einflüsse der Umwelt erklärt.
Wir begnügen uns an dieser Stelle mit einer Beschreibung dieser zwei Erklärungsprinzipien und wollen zunächst, bevor wir zu einer kritischen Diskussion dieser zwei Prinzipien[6] kommen, eine weitere Abweichung von der Freudschen Theorie darstellen, die für das Problem einer Sozialpsychologie wichtig ist.
b) Das bürgerliche Menschenbild Freuds und Freuds Desinteresse am Charakter der Gesellschaft
Wir sagten bereits, dass Freud die Triebstruktur vom Lebensschicksal her erklärt, dass heißt von den äußeren Einflüssen, die auf den Einzelnen bei der Arbeit einwirken. Diese Aussage muss jedoch entscheidend eingeschränkt werden. In Wirklichkeit trifft sie nur insofern zu, als sie zur Erklärung individueller Unterschiede in der Triebstruktur jener Menschen dient, die Freud in seiner Praxis oder andernorts beobachtete. Fand Freud zum Beispiel einen Patienten, der eine ungewöhnlich starke Angst [XI-135] vor der väterlichen Autorität zeigte, sodann einen anderen, der mit jedem, mit dem er in Kontakt trat, in völlig überzogener Weise zu rivalisieren anfing, dann erklärte Freud diese Unterschiede in der Triebstruktur (zusammen mit einem Verweis auf die Möglichkeit einer konstitutionellen Stärke) mit den individuellen Besonderheiten im Lebensschicksal des Patienten. Im ersten Fall fand er – schematisch gesprochen –, dass der Patient einen sehr strengen Vater gehabt habe, vor dem er sich sehr fürchtete. In einem anderen Fall war ein Geschwister geboren, das bevorzugt wurde und gegen das der Patient eine heftige Rivalität entwickelte. War Freud hingegen nicht an den individuellen Unterschieden seiner Patienten interessiert, sondern hatte er die psychischen Züge im Auge, die – unabhängig von diesen Unterschieden – allen Patienten gemeinsam waren, gab er eigentlich das historische, das heißt das gesellschaftliche Erklärungsprinzip auf und sah in diesen gemeinsamen Zügen die „Natur des Menschen“, wie sie physiologisch und anatomisch konstituiert ist. Mit anderen Worten war also für Freud die Charakterstruktur, wie sie im Allgemeinen für eine Gesellschaft normaler Menschen typisch ist und wie er sie beobachtete, als solche nicht wert, analysiert zu werden; vielmehr war für ihn der bürgerliche Charakter im wesentlichen mit der menschlichen Natur identisch.
Wir möchten uns hier nur mit einigen wichtigen Beispielen für diese These begnügen. Freud betrachtet den Ödipuskomplex als einen grundlegenden Mechanismus für das gesamte innere Leben. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass besondere Modifikationen des Ödipuskomplexes zurückverfolgt werden können auf Besonderheiten im Lebensschicksal; doch hat der moderne Mensch den Ödipuskomplex vererbt bekommen, zumindest nimmt dies Freud hypothetisch an.
Ein anderes Beispiel für den gleichen Erklärungsgrundsatz sind Freuds Ansichten zur Psychologie der Frau. Er nimmt an, dass die Frau auf Grund von anatomischen Unterschieden notwendigerweise Gefühle der Minderwertigkeit, des Hasses und des Neides gegenüber dem Mann – das heißt gegenüber seinen Genitalien – entwickeln muss und dass die weiblichen Minderwertigkeitsgefühle wegen der fehlenden männlichen Sexualorgane notwendige Phänomene sind. „Die Anatomie ist das Schicksal“, sagt Freud (1924d, S. 400), ein Wort Napoleons variierend.
Auch Freuds Verabsolutierung des bürgerlichen Charakters ist ein Beispiel für das gleiche Erklärungsprinzip: Er sieht beim Menschen in erster Linie seinen Narzissmus, das heißt [den Menschen] als grundsätzlich von seinem Mitmenschen und von denen, die ihm fremd sind, isoliert. Nicht einmal hier fragt er nach dem gesellschaftlichen Anteil dieses Phänomens, sondern akzeptiert diesen entfremdeten Menschen, wie er ihn in unserer Gesellschaft vorfindet, als ein notwendiges Ergebnis der menschlichen Natur.
In dieser Hinsicht geht Freud bei seiner Todestriebtheorie sogar noch einen Schritt weiter. Während er – wie er selbst bekennt – zu seiner eigenen Überraschung die Rolle der nicht-sexuellen Aggression