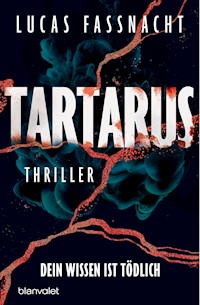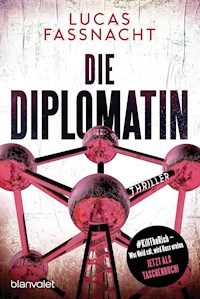
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Neuausgabe von »#KillTheRich – Wer Neid sät, wird Hass ernten«
Die Diplomatin Conrada van Pauli hat eine große Aufgabe vor sich: Ein achtloser Online-Post hat dazu geführt, dass sich die Armen gegen die Reichen erheben. Es kommt zu Unruhen, Demonstrationen und Anschlägen auf der ganzen Welt. Straßenschlachten und Polizeigewalt bestimmen das tägliche Leben – alles dokumentiert unter dem Hashtag KillTheRich. Nun ist es an ihr – zusammen mit dem alternden indischen Starjournalist Bimal Kapoor – einen globalen Bürgerkrieg zu verhindern. Während Conrada nach Brasilien reist, um sich ein Bild der Lage zu machen, verfolgt Bimal eine Spur, die nach Frankreich führt. Doch beide haben sich mächtige Feinde gemacht, die vor nichts zurückschrecken werden ...
Ein komplexer Politthriller, der Sie mit auf eine atemberaubende Hetzjagd um die Welt nimmt – frisch, klug und hervorragend recherchiert!
Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »#KillTheRich. Wer Neid sät, wird Hass ernten« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch:
Die Diplomatin Conrada van Pauli hat eine große Aufgabe vor sich: Ein achtloser Online-Post hat dazu geführt, dass sich die Armen gegen die Reichen erheben. Es kommt zu Unruhen, Demonstrationen und Anschlägen auf der ganzen Welt. Straßenschlachten und Polizeigewalt bestimmen das tägliche Leben – alles dokumentiert unter dem Hashtag KillTheRich. Nun ist es an ihr – zusammen mit dem alternden indischen Starjournalist Bimal Kapoor – einen globalen Bürgerkrieg zu verhindern. Während Conrada nach Brasilien reist, um sich ein Bild der Lage zu machen, verfolgt Bimal eine Spur, die nach Frankreich führt. Doch beide haben sich mächtige Feinde gemacht, die vor nichts zurückschrecken werden ...
Autor:
Lucas Fassnacht wurde 1988 in Dieburg geboren; zurzeit wohnt er in Nürnberg, nachdem er in Erlangen Altgriechisch, Germanistik und Linguistik studiert hat. Neben seiner Arbeit als Autor gibt Fassnacht Workshops für Kreatives Schreiben. Er veranstaltet regelmäßig Literatur-Shows in Nürnberg und Erlangen. Von März bis November 2015 leitete er eine Poetry-Slam-Werkstatt mit Mittelschülerinnen und -schülern der Nürnberger Südstadt, welche mit der Kamera begleitet wurde. Der entstandene Dokumentarfilm »Südstadthelden« wurde 2018 fertiggestellt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
LUCASFASSNACHT
DIE DIPLOMATIN
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Buch ist ein Roman und kein Tatsachenbericht. Das Beschriebene hat sich so nicht ereignet. Trotz der vom Autor in künstlerischer Freiheit gewählten fiktiven Handlungsabläufe mögen im Einzelfall Anklänge an Verhaltensweisen lebender oder verstorbener Personen oder an öffentlich bekannte Unternehmen nicht immer vermeidbar gewesen sein; dies ist aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfassend geschützt. Dieser Roman ist als Hardcover unter dem Titel »#KillTheRich – Wer Neid sät, wird Hass ernten« erschienen. Ein Namens- und Abkürzungsverzeichnis finden Sie im Anhang. Copyright der Originalausgabe © 2019 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Angela Kuepper Covergestaltung:© Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Toluk; Photo Boutique; Kitsana1980) und Dimitris Vetsikas/Pixabay LH ∙ Herstellung: sam Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN: 978-3-641-26940-1 V002 www.blanvalet.de
Für Katharina Deborah
Prolog
Bondo, Malawi; im August, 17:01 Uhr UTC+2
Kassim starrte auf das Display seines iPhones. Er hatte Netz. Riesige Ballons im Himmel sollten dafür verantwortlich sein. Monatelang hatte die Zeitungen Malawis die Debatte geprägt, ob die Technik funktionierte oder doch nur Humbug war – in Bondo waren die meisten skeptisch gewesen. Es war nie klug, den Versprechen der Amerikaner zu vertrauen.
Aber es klappte. Kassim hatte Netz. Bisher hatte er nach Pelete fahren müssen, wenn er surfen wollte. Zweieinhalb Stunden mit dem Rad, in der Regenzeit vier. Nie wieder. Kassim grinste. Das Internet war jetzt überall, wo er auch war.
Er öffnete seinen Twitter-Account. Sein erster Beitrag sollte besonders sein. Stark und poetisch. Er schrieb: Africa wakes up. #killtherich.
Zwei Stunden später und fünftausendachthundert Kilometer entfernt lehnte sich Prakash Khan in seinem Ledersessel zurück. Nur gedämpft drang das Fluchen der Rikschafahrer durch die modernen Fenster. Leise surrte die Klimaanlage. Prakash blickte zufrieden auf den Bildschirm. Er war der berühmteste Blogger Neu-Delhis, und der Artikel, den er gerade fertiggestellt hatte, zeigte einmal mehr seine Klasse. Prakashs Follower würden Hunderte Kommentare schreiben. Googles Wunsch, die weltweiten Datenströme zu kontrollieren, näherte sich der Erfüllung – und niemand schien es zu merken. Akribisch hatte Prakash alle Informationen zusammengetragen, die im Netz zu finden waren. Punkt für Punkt hatte er aufgezeigt, wie geschickt Google andere Konzerne und ganze Staaten manipulierte, um sein Ziel zu erreichen. Über ein Ballonsystem die entlegensten Regionen Afrikas mit Internet zu versorgen war der letzte Coup gewesen.
Rhetorisch gesalzen hatte Prakash den Text mit einigen Tweets der ersten Stunde. Ein wirklich guter Beitrag.
Zwei Wochen später war der Artikel von Prakash Kahn schon längst wieder im digitalen Mahlstrom versunken. Unter den Tweets, auf die er verwiesen hatte, war einer allerdings geteilt geworden. #killtherich. Millionenfach. Und Hunderttausende folgten dem Aufruf.
1. Kapitel
Vier Wochen später. Brüssel, Belgien; Mittwoch, 20:13 Uhr UTC+2
Conrada van Pauli spannte das Klettband um ihr rechtes Hosenbein und zog die Warnweste über ihren Blazer. Dann setzte sie ihren Fahrradhelm auf und straffte dessen Kinnriemen. Ihre Kollegen verspotteten sie seit jeher für den Aufwand, aber das störte sie nicht. Sie fand, wenn sie schon Bürokratin war, durfte sie das auch zeigen.
Conrada schob ihr Rad aus der Tiefgarage in die Brüsseler Dämmerung. Der Verkehr auf dem Schuman-Kreisel war überschaubar, die Rushhour war bereits einige Stunden vorüber. Das letzte Abendrot verabschiedete sich hinter ihrem Rücken. Conrada schwang sich auf den Sattel. Sie hatte den wohl repräsentativsten Heimweg, den es auf der Welt zu finden gab. Zuerst durchquerte sie den Parc du Cinquantenaire. Er hatte zum fünfzigsten Jahrestag von Belgiens Unabhängigkeit angelegt werden sollen, pünktlich zum fünfundsiebzigsten hatte man ihn dann fertiggestellt.
Conrada verließ den Park durch den Triumphbogen und fuhr auf die Avenue de Tervueren, wobei sie die kanadische Botschaft links liegen ließ. Ab jetzt wurde es afrikanisch. Sie passierte nacheinander die Botschaften von Äthiopien, Togo, Uganda und Nigeria.
Als Nächstes kam sie vorbei am Verlagshaus von New Europe, der Zeitung mit dem unbequem gründlichen Blick, außerdem an der Verbraucherschutzorganisation ANEC und an der europäischen Niederlassung des WWF. Die Straße führte sie am Parc de Woluwe vorbei, die Kastanien flüsterten bereits vom Herbst. Später am Abend würde sie noch zwei oder drei Runden laufen. Sie brauchte Bewegung wie Häftlinge ihren Hofgang. Bei der Botschaft von Ruanda bog sie ab in die Rue des Fleurs. Eine Minute später erreichte sie ihr neues Zuhause; einen Quader, dessen erster Stock vorgelagert war und so die Veranda überdachte. Hinter den riesigen Fenstern brannte Licht, doch waren die Vorhänge zugezogen.
Dass sie im vornehmsten Viertel Brüssels ein Haus gekauft hatten, hielt sie fast für anmaßend, aber Hermann hatte sich nicht umstimmen lassen. Conradas Ehemann war Mitglied des Europäischen Parlaments und darüber hinaus zum Quästor gewählt worden, zu einem der fünf Zuständigen für die Arbeitsbedingungen der Abgeordneten. Es schien ihm nur angemessen, wenn sich diese verantwortungsvolle Aufgabe in seiner Wohnsituation widerspiegelte. Die Diskussion darüber, ob ein Parteimitglied der Allianz der Sozialdemokraten nicht eher dem solidarischen Gedanken gerecht werden sollte als dem eigenen Statusbewusstsein, suchte Conrada seit Längerem nicht mehr.
Sie schob das Fahrrad in die Garage. Hermanns Dienstlimousine stand darin, er war also immer noch nicht wieder ganz bei Kräften. Sie hängte ihren Helm an den Fahrradlenker. Beim Zahnarzt hatte sie eine Studie gelesen, dass Radfahrer ohne Helm seltener in Unfälle verwickelt waren. Als Erklärung hieß es, ohne Helm fahre man vorsichtiger, und die anderen Verkehrsteilnehmer nähmen mehr Rücksicht. Conrada schüttelte lächelnd den Kopf. Was für ein Unsinn.
Sie betrat die Diele und zog die Schuhe aus. Für eine Niederländerin war sie nicht besonders groß, aber Absätze trug sie trotzdem nicht, ihre Füße schmerzten so schon genug. Sie stellte die Schuhe ins Regal und räumte auch die von Emilia auf. Ihre Tochter hatte ein Talent dafür, mit minimalem Aufwand größtmögliche Unordnung zu schaffen.
Sie hörte den Fernseher. Es geschah selten, dass jemand zu Hause war, wenn Conrada von der Arbeit kam. Das Parlament hatte seinen Sitz in Straßburg, gewöhnlich nahm Hermann den Weg nach Brüssel höchstens am Wochenende auf sich. Emilia war nur deshalb nicht im Internat, weil morgen Feiertag und dementsprechend schulfrei war.
Conrada ging ins Wohnzimmer. Hermann lag auf der Couch, umgeben von Grippostad-Packungen, zerknüllten Papiertaschentüchern und der Aura des ermatteten Mannes. Sie küsste ihn rasch auf die Glatze und ließ sich neben ihn aufs Sofa fallen.
»Pass auf, dass du dich nicht ansteckst«, brummte er.
»Nach zwei Wochen? Geht’s dir besser?« Sie redeten Deutsch miteinander. Hermann verstand zwar etwas Niederländisch, aber Conradas Deutsch war fließend, sie hatte in Heidelberg studiert. In Heidelberg hatte sie auch Hermann kennengelernt.
»Na ja.« In Hermanns Schoß lag sein Tablet, er öffnete das E-Mail-Programm. »Emilia hat gekocht. Ist noch was in der Küche.«
Conrada bemerkte den Geruch gebratener Zwiebeln.
»Wo ist sie denn?«
»Oben, denke ich.« Er überflog die neuesten Nachrichten in seinem Posteingang. Conrada saß eine Weile unschlüssig neben ihm. Als er sie nicht weiter beachtete, ging sie nach oben und klopfte an Emilias Zimmertür.
»Bist du da?«, fragte sie. Mit ihren Töchtern sprach sie Niederländisch, auch wenn Emilia Französisch am liebsten war.
»Komm rein«, ertönte es von innen. Emilia war gerade in die elfte Klasse vorgerückt. Die Neigung, ihre Einrichtung in rosa Tönen zu gestalten, hatte sie schon länger verloren. Seit Kurzem hatte sie eine neue Vorliebe: schwarz.
»Hey, Maman«, sagte sie.
»Hallo, mein Schatz.« Conrada betrat das Zimmer. Emilia lag auf dem Bett vor ihrem Laptop und schaute eine Serie.
»Störe ich?« Conrada musterte die schwarze Netzstrumpfhose, die ihre Tochter trug, verkniff sich jedoch einen Kommentar.
Emilia schüttelte den Kopf und klappte den Laptop zu. »Hast du meinen Auflauf probiert? Ich glaub, ich hab ihn zu lange im Ofen gelassen. Papa sagt, dass er gut geworden ist, aber der schmeckt ja gerade nichts.«
»Ich probier ihn gleich.«
»Ich hab mir überlegt, dass ich Oma zum Geburtstag einen Kuchen backe. Kannst du mir da helfen?«
Conrada versprach es. Sie ging wieder nach unten, sie wollte Emilia nicht zu lange behelligen.
An ihrer älteren Tochter, Theresa, hatte Conrada schmerzlich erfahren, dass es möglich war, zu wenig Zeit für die eigenen Kinder zu haben und ihnen zugleich zu wenig Freiraum zu lassen. Theresa hatte der Mutter noch immer nicht verziehen, dass sie ihr vor ein paar Jahren verboten hatte, durch Europa zu trampen. Inzwischen absolvierte sie über Projects Abroad einen Freiwilligendienst in Tansania. Conrada hoffte, dass sich nach dem Jahr in der Ferne ihr Verhältnis wieder verbessern würde.
Sie ging ins Schlafzimmer und zog sich ihren Jogginganzug an, dann holte sie sich aus der Küche etwas von dem Kartoffelauflauf und setzte sich wieder zu Hermann ins Wohnzimmer.
»Hast du mitbekommen, was Guterres gesagt hat?«, fragte er. »Die P5 sollten die Vorschläge berücksichtigen, weitere ständige Sitze im Sicherheitsrat zuzulassen.«
Der Sicherheitsrat war das einzige Gremium der UN, das rechtsverbindliche Beschlüsse verabschieden konnte. Die Permanent Five, seine fünf ständigen Mitglieder, lagen sich nicht nur regelmäßig in den Haaren, sondern verfügten jeweils über ein Vetorecht, mit welchem sie jeglichen Beschluss blockieren konnten. Es war kaum verwunderlich, dass die Vereinten Nationen nicht besonders ernst genommen wurden.
»Lass uns nicht über die Arbeit reden«, bat Conrada.
»Guterres ist wirklich ein anderes Kaliber als Ban«, fuhr Hermann fort. »Der Mann ohne Eigenschaften hätte sich nie so direkt in die Politik eingemischt. Und Guterres landet solch ein Pfund.«
Hermann hatte recht: Ban Ki-moon, der ehemalige Generalsekretär der UN, war nicht bekannt gewesen für seine medienwirksamen Äußerungen. Ein UN-Generalsekretär war nicht nur Verwaltungsbeamter, sondern auch Repräsentant. Ban war regelmäßig vorgeworfen worden, sich in ersterer Rolle einzurichten. Conrada war recht angetan von den forschen Vorstößen von António Guterres – doch welche Früchte sie tragen würden, musste sich noch zeigen.
Im WDR lief eine Reportage über private Zugunternehmen. Conrada war keine Verfechterin von deutschem Fernsehen, aber selbst die Belgier schauten kein belgisches.
»Ich sage dir«, meinte Hermann, »wenn er sich zu so einer Aussage hinreißen lässt, dann liegt einiges im Argen bei denen.«
Emilias Auflauf war nicht nur verbrannt, sondern außerdem versalzen, Conrada stellte ihren Teller auf den Beistelltisch. »Willst du Wein?«, fragte sie.
»Vielleicht war es auch einfach wieder zu lange ruhig«, überlegte Hermann. »Wer heutzutage politisch aktiv ist und zwei Wochen keine Krise zu bestehen hatte, beginnt sich zu langweilen. Aber ich habe auch was verpasst. Bei uns im Parlament hat Gabi einen Antrag der Rechten verteidigt. Gegen Militäreinsätze im Ausland. Das musst du dir mal vorstellen. Die Vorsitzende der Kommunisten unterstützt den Klassenfeind. Griechische Verhältnisse.« Er schnaubte. »Und das jetzt – keine zwei Wochen vor den Neuwahlen in Frankreich. Ich sage dir, Le Pen gewinnt das Ding noch.«
Während die Deutsche Bahn berüchtigt für ihre Verspätungen war, erklärte der Fernseher, konnten die privaten Unternehmen in puncto Pünktlichkeit gute bis glänzende Zahlen vorlegen. Selbst der Kommentator schien beeindruckt. Conrada holte Wein und zwei Gläser.
Hermann schaute auf. »Wolltest du nicht joggen gehen?«, fragte er mit Blick auf ihren Trainingsanzug.
»Nur ein Glas.«
Je größer das Netz, desto komplexer seien die Abläufe, bemühte sich ein DB-Sprecher um Verständnis. Conrada füllte die Gläser, gab Hermann eines, sie stießen an.
»Auf deine Genesung«, sagte sie.
»Es ist die Ablehnung«, erklärte Hermann bestimmt. »Linke wie Rechte speisen ihre politische Motivation aus der Ablehnung des Mainstreams. Und sie fahren ja gut damit. Realpolitik ist ein Schimpfwort geworden …«
»Nimm mich in den Arm«, unterbrach ihn Conrada.
»Warum?« Hermann zögerte, offenbar hatte sie ihn mit der Aufforderung überrascht. Etwas unbeholfen folgte er ihrem Wunsch.
Ein paar Minuten saßen sie schweigend auf dem Sofa. Im Fernsehen wurde eine Waschanlage für Züge gezeigt. Langsam, beinahe rücksichtsvoll legte sich eine Schwere auf Conradas Brust, drückte sich in ihren Magen, glitt ihr den Hals herauf. Sie versuchte nicht, die Tränen aufzuhalten. Leise tasteten sie sich ihre Wangen hinunter. Conrada schluchzte nicht. Das Gefühl war nicht unangenehm: eine stille Übereinkunft zwischen ihrem Willen und ihrem Körper, der Erschöpfung endlich einmal Raum zuzugestehen.
»Was ist los?«, fragte Hermann erschrocken.
»Nichts.« Conrada lächelte. »Ich bin müde.«
»Du arbeitest zu viel«, brummte Hermann.
»Wahrscheinlich.«
Der Skandal lag Monate zurück, doch noch immer schlief Conrada schlecht. Sie arbeitete beim Europäischen Auswärtigen Dienst EAD, in der Abteilung für Südamerika. Bei einer Routineüberprüfung der Handelszahlen Brasiliens waren ihr Unregelmäßigkeiten bei Petrobras aufgefallen. Ihre Entdeckung hatte den Ölkonzern in die schlimmste Krise seiner ohnehin krisengeschüttelten Geschichte katapultiert. Die europäische Presse porträtierte Conrada fortan als Heldin, Juncker persönlich schüttelte ihr die Hand, sie wurde zur Abteilungsleiterin befördert. Doch während alle um sie herum teils bewundernd, teils neidvoll auf ihren Erfolg schauten, fühlte Conrada sich nur müde. Was hatte sie erreicht? Ja, bei Petrobras waren Köpfe gerollt, aber sie war sich sicher: nicht die entscheidenden. Und Brasilien schlingerte auf den Abgrund zu, da half es nichts, wenn der größte Konzern des Landes um seine Existenz rang.
Sie wischte sich die Tränen ab. Passend zu ihren Gedanken wurde die Zug-Doku abgelöst von den Nachrichten. Weder das Statement des UN-Generalsekretärs noch die Vorkommnisse im Europäischen Parlament schienen der Redaktion eine Meldung wert. Das bestimmende Thema waren nach wie vor die Aufstände in Brasilien. Seit Jair Bolsonaro an die Macht gekommen war, führte er das Land mit einer Geschwindigkeit in den Faschismus, dass es an Deutschland 1933 erinnerte. Die fanatische Beschwörung einer völkischen Identität diente als Rechtfertigung für das Aufheben der Gewaltenteilung, für die Kontrolle der Medien, für die Jagd auf Eliten und Minderheiten, für die Unterwerfung der Wissenschaft.
Bolsonaro hatte nie einen Hehl aus seiner Gesinnung gemacht. Aber als die Weltöffentlichkeit sah, dass er es ernst meinte, war sie gleichwohl fassungslos. Wie 1933. Und tat nichts. Es war die brasilianische Zivilgesellschaft, die sich wehrte. Doch Bolsonaro hatte das Militär auf seiner Seite und gewann.
Neben dem ideologischen Umbau des Systems lag Bolsonaros Augenmerk auf der radikalen Liberalisierung der Wirtschaft. Er senkte nicht nur Unternehmenssteuern, sondern kassierte darüber hinaus zahlreiche Bestimmungen zu Umwelt- und Arbeitnehmerschutz. An den Börsen ging es aufwärts, und eine Weile kehrte Ruhe ein. Selbst für Petrobras schien es nach Jahren voller Skandale endlich aufwärtszugehen. Bis Conrada einen Blick auf die Bilanzen warf und feststellte: Die Zahlen waren nicht etwa ein bisschen geschönt worden, sondern utopisch. Seither kämpfte der Konzern ums Überleben …
Sie hörte nicht zu. Die letzten vier Tage hatte sie nichts anderes getan, als alle Informationen zu den Aufständen zu sammeln, an die ihr Team beziehungsweise die EU-Delegation vor Ort gelangen konnte. Fernsehnachrichten vermochten ihr keine Neuigkeiten zu bieten.
»Hat das bald ein Ende?«, fragte Hermann.
»Es ist keins absehbar.« Conrada seufzte. Es handelte sich wirklich um eine vertrackte Situation. »Während Ober- und Mittelschicht beinahe geschlossen gegen Bolsonaro sind, unterstützt ihn so ziemlich jede Gruppe, die man in Europa als verfassungsfeindlich einstufen würde: Identitäre, religiöse Fundamentalisten, Chauvinisten – ein Who is Who der Kotzbrocken. Außerdem genießt er nach wie vor großen Rückhalt in der einfachen Bevölkerung. Doch für seine Sozialprogramme geht ihm das Geld aus. Deswegen hat er die größten Ölfelder Brasiliens an US-Unternehmen verkauft. Unfassbar, wenn man bedenkt, dass er einige dieser Unternehmen vor einem halben Jahr noch enteignet hat. Unternehmen, gegen die er unermüdlich den Hass geschürt hat. Dieser Hass richtet sich nun gegen ihn selbst. Der Hass erstickt alles und jeden. Es gibt keinen Platz mehr für Argumente. Alles ist hochemotional. In Onlinekommentaren wird offen zu Mord und Vergewaltigung der jeweiligen Gegner aufgerufen.«
»Das ist das Internet.«
»Das Ausmaß ist neu. Das aktuell erfolgreichste Schlagwort auf Twitter in Brasilien ist killtherich. Und die Leute scheinen zum Handeln bereit. Da hilft es natürlich nicht, wenn der Präsident droht, das Militär einzusetzen.«
»Tut er das nicht sowieso?«
»Bisher hat er zumindest keinen Schießbefehl gegeben. Für Jan ist es nur eine Frage der Zeit, bis es so weit ist.« Jan Kopański lebte erst seit drei Jahren als europäischer Botschafter in Brasília. Doch ein besserer Kenner des Landes war Conrada bisher nicht begegnet. Sie kam gut mit ihm aus, verstand aber auch, dass dies nicht allen Kollegen gelang. Kopański war nicht nur mit einer überragenden Intelligenz gesegnet. Für Leute, die ihm nicht folgen konnten, brachte er wenig Geduld auf. Im Übrigen machte er keinen Hehl daraus, dass er den EU-Posten nur als Sprungbrett für die polnische Landespolitik nutzen wollte. Es hieß, Kaczyński halte große Stücke auf ihn. Conrada konnte sich ausmalen, wie verärgert Jan gewesen sein musste, als man ihr und nicht ihm die Abteilungsleitung übergeben hatte. Sie war selbst aus allen Wolken gefallen. Sicher, sie hatte die letzten Jahre hart gearbeitet, doch das hatten andere auch.
In den Nachrichten ging es inzwischen um die Rente. Das Eintrittsalter, das 2014 von Andrea Nahles auf dreiundsechzig Jahre gesenkt worden war, sollte auf fünfundsechzig zurückgesetzt werden. Erneut auf Betreiben der SPD. Hermann knurrte nur. Conrada schenkte Wein nach.
»Willst du, dass ich nie wieder auf die Beine komme?«, fragte Hermann.
»Dann lass ihn halt stehen.«
»Jetzt gib schon her.«
Sie tranken. »Hat sich Theresa gemeldet?«, fragte Conrada.
»Bei mir?« Hermann grinste säuerlich. »Bestimmt nicht. Emilia meinte, es geht ihr gut.«
»Vielleicht sollten wir mal wieder gemeinsam Urlaub machen.«
Hermann zog die Brauen hoch. »Du arbeitest mehr als ich, Conrada.«
»Zusammen mit den Kindern. Wenn Theresa wieder da ist. Es muss ja nicht lange sein. Ein Wochenende.«
»Schlag das Theresa mal vor. Ich wünsch dir Glück.«
Auf dem Bildschirm leuchteten Fußballergebnisse auf. Der Sommer war zu Ende. Endlich begann die Champions-League-Saison. Eindhoven hatte 0:4 verloren.
»Verdammt«, murmelte Conrada. So viel zum Trainerwechsel.
»Natürlich ist nach dem ersten Spieltag noch nichts entschieden, sehen wir uns trotzdem die Tabellen an …« Der Nachrichtensprecher unterbrach sich, neigte den Kopf leicht zur Seite und starrte eine Sekunde lang schräg in die Kamera.
»Ich erfahre gerade, wir haben eine Eilmeldung.«
Er drehte den Kopf von seinem Publikum weg. Ein Arm geriet ins Bild, reichte dem Sprecher ein Blatt Papier. Dieser nahm es entgegen, überflog es kurz, sah wieder in die Kamera. Mit dem Blick derer, die sich bewusst sind, etwas Wichtiges mitzuteilen zu haben, sagte er: »Offenbar sind einige Aufständische in den Regierungssitz des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro eingedrungen. Über den Verbleib des Präsidenten ist nichts bekannt. Auch gibt es zurzeit keine Informationen darüber, wie viele Aufständische sich im Palast befinden. Selbstverständlich erfahren Sie mehr, sobald wir über weitere Informationen verfügen.«
»Hast du das gewusst?«, fragte Hermann
Conrada starrte entgeistert auf den Bildschirm. »Das kann nicht sein«, flüsterte sie. »Wenn es so schlimm wäre, hätten sie mich angerufen.« Sie griff nach ihrem Telefon. Im selben Moment begann es zu vibrieren.
2. Kapitel
Brasília, Brasilien; Mittwoch, 14:33 Uhr UTC-3
Jason Silver rieb sich sein letztes Kokain ins Zahnfleisch. Er hatte die Nacht nur vier Stunden geschlafen. Doch wenn er heute erfolgreich sein wollte, musste er hellwach sein. Er nahm noch eine Handvoll Tabletten gegen die Schmerzen im Knie. Verdammtes Rugby. Ein einziges Semester hatte er in Yale gespielt, fünfunddreißig Jahre war das her, und das Scheißknie schmerzte immer noch. Er hasste Linienflüge.
Silver war nicht nur der Vorstandsvorsitzende von Corner’s, dem zweitgrößten Sojabohnenverarbeiter in den USA, sondern darüber hinaus Vizepräsident der Vereinigung der US-Futtermittelhersteller AFIA, zuständig für internationale Kontakte.
Er verließ die Toilette und eilte den anderen Passagieren hinterher. Am Zoll hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Der Flughafen Brasílias galt zwar als hochmodern, aber genügend Personal schienen sie trotzdem nicht zu haben.
Es stand nicht gut um die AFIA. Erst war Monsanto von Bayer geschluckt worden, dann hatten die Japaner DuPont gekauft, und jetzt drängten auch noch die Chinesen auf den Markt. Doch wenn Blut auf den Straßen lag, musste man Geschäfte machen, hatte Rothschild gesagt. Selbst wenn es das eigene war.
Der brasilianische Minister für Wirtschaft und Außenhandel hatte ihn gebeten, aufgrund der Unruhen das Treffen zu verschieben, aber Silver hatte die Bitte ignoriert. Die AFIA mochte kränkeln – die brasilianische Regierung lag im Sterben. Sie brauchten positive Nachrichten, und Silver würde sie ihnen geben.
Die Zollbeamten belangten ihn nur kurz, zügig ging er zur Ausgangshalle. Er überflog die Schilder der Wartenden. Seinen Namen fand er nicht. Wo war der Fahrer? Da es sich um eine informelle Sitzung handelte, hatte er darauf verzichtet, sein Team mitzunehmen. Er musste wohl selbst nach dem Fahrer suchen. Was, wenn der Minister den Termin ohne seine Zustimmung abgesagt hatte? Eine Unverschämtheit. Silver spürte Schweiß auf der Stirn. Die verfluchten Schmerztabletten.
Auch für ihn persönlich lief es aktuell nicht gut. Es mehrten sich die Stimmen im AFIA-Vorstand, die ihm die Schuld dafür gaben, dass ihre Unternehmen global so schlecht dastanden. Und erst vor ein paar Wochen hatten die Chinesen ein Angebot für Corner’s geschickt. Für seine eigene Firma! Gott bewahre. Er würde seine Firma doch keinem Chinesen verkaufen.
Wo war bloß der verdammte Fahrer? Sollte er sich etwa ein Taxi nehmen?
»Mr. Silver?«
Silver fuhr herum. Hinter ihm stand ein kleiner Latino in schwarzem Anzug und Kappe unter der Achsel.
»Du bist der Chauffeur?« Silver musterte ihn gereizt. Er war mehr überrascht als empört, dass der Bursche seinem Blick standhielt. Ungewöhnlich. Und warum schrieben die Zeitungen über die Diskriminierung der Indianer? Der Typ war so dunkel, wenn es wirklich so schlimm wäre, hätte er ja wohl kaum seinen Job behalten dürfen.
»Wo hast du gesteckt?«
»Aufgrund der Demonstrationen sind einige Straßen gesperrt«, antwortete er. Sein Englisch war passabel. Aber das war auch das Mindeste. Immerhin handelte es sich um den offiziellen Chauffeurservice der brasilianischen Regierung.
»Wo ist der Wagen?«
»Sie sind allein?«
»Wonach sieht’s denn aus, du Comedian?«
»Folgen Sie mir, Sir.«
Als Silver endlich im Fond der Mercedes-Limousine saß, ging er noch einmal gedanklich alle wichtigen Details durch: erst den Minister reden lassen, die Körperhaltung spiegeln, zuvorkommend wirken, Verständnis zeigen für die schwierige politische Lage. Dann die bisherige Zusammenarbeit loben, knapp musste das passieren, auf den Punkt. Brasiliens Entwicklungsmöglichkeiten preisen. Das war der anspruchsvollste Teil. Der Minister wusste genauso gut wie Silver selbst, dass die Zukunft des Landes gerade alles andere als rosig aussah. Der Minister würde darauf hinweisen, und Silver würde die Zahl nennen. Er würde dem Minister einige Sekunden geben, die Zahl zu verdauen. Es war eine stolze Zahl. Der Preis für die Nutzungsrechte eines Drittels der brasilianischen Sojaanbaugebiete. Nutzungsrechte für zwanzig Jahre.
Silver atmete tief durch und strich über den Aktenkoffer neben sich. Hier lagen die Verträge, die die AFIA-Anwälte vorbereitet hatten. Natürlich würde der Minister selbst sie gar nicht ansehen. Aber er würde entscheiden. Vielleicht sogar noch im Herbst, die Regierung brauchte das Geld dringend, der Staatsbankrott rückte näher.
Er rief Susie an.
»Hey, Honey, in welchem Hotel bin ich untergebracht?«
»Windsor, Mr. Silver.«
»Ruf da an und sag, dass ich gern was zu essen auf dem Zimmer hätte. Fisch oder so. Außerdem Wein und zwei Mädchen.«
»Haben Sie besondere Wünsche?«
»Irgendwas, was man hier halt trinkt. Mit Beschreibung.« Ganz gleich, wo man sich befand, es war immer von Vorteil, ein paar passende Adjektive zu den lokalen Weinen zu kennen.
»Und die Frauen?«, fragte Susie.
»Ist mir egal, such dir was aus.«
Silver drückte sie weg und wählte die Nummer von Ed Minsterson, seinem Assistenten.
»Mr. Silver?«
»Eddie, ich brauche bis heute Abend die Analyse zum chinesischen Angebot. Inklusive der Meinung des Aufsichtsrats.«
»Sir? Der Aufsichtsrat trifft sich erst nächste Woche wieder.«
»Und außerdem soll die Rechtsabteilung ein Übernahmeangebot unsererseits vorbereiten.«
»Sir?«
»Sieh zu, dass es möglichst schnell in die Presse kommt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall schwach wirken.« Wenn der Deal mit Brasilien klappen sollte, würde sich zu Hause der Verteilungskampf anschließen. Und Silver würde dafür sorgen, dass Corner’s nicht leer ausging.
»Wir haben doch gar nicht das Kapital für eine Übernahme.«
»Deswegen müssen wir umso selbstbewusster auftreten. Die verkaufen eh nicht; das sind Chinesen, die machen lieber Pleite, als dass sie Ausländer an ihre Suppe lassen. Warum halten wir?«
»Bitte?«
»Ich meinte den Fahrer.« Ohne ersichtlichen Grund hatte dieser den Wagen abgebremst. Irgendjemand rief etwas auf Portugiesisch, der Fahrer öffnete sein Fenster. Ein Polizist trat heran und redete heftig auf ihn ein.
»Wir müssen zurück«, sagte der Fahrer, zu Silver gewandt.
»Wieso?«
»Im Regierungsviertel ist es zu Ausschreitungen gekommen, das ganze Areal ist abgesperrt.« Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein.
»Fahr sofort weiter.«
»Sir, ich kann nicht, die Straße ist gesperrt.«
»Dann nimm einen Umweg.«
»Selbst wenn ich einen Weg fände, die Polizei wäre nicht begeistert.«
»Wie heißt du?«
»José Colasanti, Sir.«
»Jetzt hör mal zu, José. Ich verdiene eine Menge Geld damit, dass ich weiß, wo ich hinwill. Du wirst dafür bezahlt, dass du mich dorthin bringst. Nicht umgekehrt. Du machst jetzt, was ich sage, oder ich sorge dafür, dass du bald gar nicht mehr bezahlt wirst.«
»Wie Sie meinen, Sir.« Der Fahrer stoppte den Wagen, schaltete und bog in eine Seitenstraße ab.
»Eddie, bist du noch dran?« Silver wandte sich nach der leidigen Unterbrechung wieder seinem Telefon zu.
»Mr. Silver, wir werden Wochen brauchen, um das Angebot an die Chinesen zu lancieren. Selbst wenn es eine Finte ist. Und vorausgesetzt, die übrigen Mitglieder des Vorstands teilen Ihre Meinung, worüber ich mir durchaus nicht sicher bin.«
»Was ist heute?«
»Mittwoch, Sir.«
»Du hast Zeit bis Freitag.«
»Sir!«
»Bei den Summen, die unsere Anwälte verlangen, können die auch mal was arbeiten.« Silver kappte die Verbindung. Er hatte nur noch eine halbe Stunde bis zu seinem Termin. Bescheuerte Aufstände. Konnten die Leute nicht irgendwo anders pöbeln? Silver trommelte mit den Fingern an die Scheibe und stöhnte.
»Verzeihung, Sir?«
»Wird das noch was heute?« Sie kurvten zwischen hässlichen Betonklötzen herum. Silver hatte nicht das Gefühl, dem Regierungsviertel näher zu kommen.
»Sehen Sie aus dem Fenster.«
Silver wollte die flapsige Antwort schon mit einer angemessenen Replik quittieren, da erkannte er, was José meinte. Sie waren auf einen Hunderte Meter breiten Grünstreifen gestoßen, der von zwei mehrspurigen Straßen gesäumt wurde. Nur Autos fanden sich keine. Stattdessen rannten Leute kreuz und quer durcheinander. Viele kamen ihnen entgegen, doch die meisten schienen ebenfalls Richtung Regierungsgebäude unterwegs zu sein. Manche hielten Baseballschläger in den Händen, andere hatten sich Tücher vor Mund und Nase gebunden. Wie Banditen, dachte Silver. Zwischen den Hochhäusern stieg Rauch auf. Von allen Seiten waren Sirenen zu hören.
»Nimm einen anderen Weg«, befahl er José.
»Wie Sie meinen, Sir.« José setzte erneut zurück und lenkte den Wagen in eine schmalere Straße. Weniger Leute zwar, aber auch hier brannten Fahrzeuge und wurden Böller geworfen. Jugendliche rasten auf einem Polizeimotorrad an ihnen vorbei.
Ein Knall, Silver fuhr zusammen. Irgendetwas war gegen die Heckscheibe geschlagen.
»Verdammt, José, pass auf!«
»Das Fahrzeug ist gepanzert. Hier drinnen kann Ihnen nichts passieren.« In der Ferne war eine Explosion zu hören. Schreie. »Allerdings sollten wir vielleicht wirklich umkehren.« Der Fahrer sagte es mit einer Arroganz, als wollte er sich über ihn lustig machen. Silver bebte.
»Du Würstchen willst mir sagen, was ich tun soll? Du fährst jetzt zum Wirtschaftsministerium und nirgendwohin sonst!«
»Sir, sehen Sie doch.« Sowohl die Trennscheibe als auch die Windschutzscheibe waren getönt. Trotzdem konnte Silver genug erkennen, dass er vor Zorn auf seinen Aktenkoffer eindrosch.
Vor ihnen war die Straße vollkommen von einer Menschenmenge in Beschlag genommen. Einige hielten Plakate hoch, andere warfen Gegenstände. Manche zwängten sich aus der Meute. Diejenigen, die hinten standen, drängten hinein. Aufgehalten wurden die Randalierer von einer Polizeiblockade. Gewöhnliche Streifenwagen schrumpften neben gepanzerten Spezialfahrzeugen. Ein Meer aus roten und blauen Lichtern waberte über die Köpfe hinweg. Silver entdeckte einen Wasserwerfer. Ein Megafon plärrte.
»Fahr woanders lang«, fluchte Silver. Aus verschiedenen Richtungen knallten Schüsse.
»Die anderen Straßen sind größer«, wandte der Fahrer ein. »Da werden noch mehr Leute sein.«
Silver dachte nach. Wie kam er an den Minister heran? Er hätte nicht erwartet, dass die Aufstände ein solches Ausmaß annehmen würden. Aber die Eskalation traf sich perfekt. In der aktuellen Lage hatte die Regierung gar keine andere Wahl, als auf das AFIA-Angebot einzugehen. Man musste sich nur vorstellen, wie viel Geld die Straßenkämpfe kosteten. Die Sachschäden und die Polizeieinsätze waren noch der kleinste Posten. Die Öffentlichkeitsarbeit im Nachhinein, die Steuergeschenke, die nötig werden würden, das alles würde Unsummen verschlingen. Und zwar in einem Land, das nur deswegen noch nicht für bankrott erklärt worden war, weil dies für seine Handelspartner gewaltige Abschreibungen bedeuten würde.
Nein, Silver holte tief Luft, diese Bauernlümmel würden ihn nicht von dem Coup seines Lebens abhalten.
»José, wir gehen zu Fuß.«
»Sir, Sie belieben zu scherzen.«
Aber Silver hatte schon die Tür aufgemacht und sprang aus dem Wagen. Dann öffnete er die Fahrertür. »Los, steig aus, du hast ja wohl eine Ausbildung zum Personenschützer.«
Der Fahrer starrte ihn eingeschüchtert an. »Einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich. Fahrer mit Zusatztraining werden nur besonders wichtigen Gästen zugeteilt.«
Silver hatte Lust, dem Affen die Fresse zu polieren.
»Aussteigen!«, befahl er. Der Fahrer gehorchte widerwillig.
»Wir halten uns links an den Häusern, du bleibst vor mir, falls der Wasserwerfer in unsere Richtung zielt.« Sobald die Polizisten sie entdeckten, würden sie ihnen entgegenkommen und eine Gasse sichern. Es war offensichtlich, dass er auf die andere Seite der Blockade gehörte.
Glas splitterte. Viel zu nah. Silver brauchte einen Augenblick, bis er verstand, dass es sich um den Außenspiegel ihres eigenen Wagens handelte. Einige Halbstarke kamen näher.
»Los, wir müssen hier weg!«, rief Silver.
Einer der Schurken zeigte auf das Nummernschild. »Político!«, brüllte er. »Político!«
Der Fahrer war schon losgerannt, Silver folgte ihm. Auf einmal waren überall Männer, die auf ihn zukamen, ihm den Weg verstellten, ihn mit ihren vulgären Drohgesten einzuschüchtern versuchten. Wo war sein Aktenkoffer? Hatte er ihn im Wagen gelassen? Scheiße, wie sein Knie wehtat. Es war ein Fehler gewesen, ohne Team zu reisen. Eddie hätte ihm widersprechen müssen.
Ein Typ mit Eisenstange grinste ihn an. Silver floh in die andere Richtung. Er würde Eddie feuern. Etwas traf ihn am Bein, er stolperte. Warum half ihm denn niemand? Er schrie um Hilfe. Wo war bloß die Scheißpolizei? Die Männer riefen sich auf Portugiesisch Stichworte zu, lachten, johlten. Er würde sich ihre Gesichter merken müssen, für das Gerichtsverfahren. Ein stechender Schmerz fuhr ihm in die Schulter, fuck, auch das noch. Weiter, runter von der Straße, zu den Lichtern. Bei den Lichtern wäre er sicher. Sirenen. War das die Polizei? Er brauchte dringend ein Megafon. Bei dem Lärm hörte ihn ja sonst niemand. Der Teer kam rasend schnell auf ihn zu, augenscheinlich war er gestürzt, den Anzug würde er wegwerfen müssen, warum brummte ihm der Kopf auf einmal so? Seine Füße waren kalt, er hatte schon als Kind kalte Füße gehabt. Gab es hier denn nirgendwo ein Megafon?
3. Kapitel
Brüssel, Belgien; Mittwoch, 21:33 Uhr UTC+2
Der Jogginganzug war rosa mit lila Streifen. Aber Conrada van Pauli störte das nicht. Sie ging nicht laufen, um gesehen zu werden. Sie schnürte ihre Sportschuhe und verabschiedete sich von Hermann.
Kurz überlegte sie, ihre Uhr abzulegen, entschied sich dann aber dagegen. Es war eine Patek Philippe Calatrava, römische Ziffern, Lederband, die schlichteste aller Uhren. Und teurer als ein Kleinwagen. Hermann hatte sie ihr zu ihrem vierzigsten Geburtstag geschenkt. Erst Monate später hatte Conrada vom Wert einer Calatrava erfahren, als der französische Botschafter sie bei einem Empfang darauf angesprochen hatte. Protz war Conrada zuwider, sie versuchte Hermann davon zu überzeugen, die Uhr zurückzugeben, es wurde der schlimmste Streit des Jahres. Zur selben Zeit begann Theresa in pubertärer Gründlichkeit ihre Eltern zu verachten. Conrada hatte keine Kraft für eine weitere Front und akzeptierte schließlich Hermanns Wunsch. Und schön war die Uhr ja, das musste Conrada zugeben.
»Ich hoffe, ich bin um Mitternacht zurück«, sagte sie. Sie glaubte selbst nicht daran.
Sie griff nach EAD-Ausweis und Telefon und joggte los. Natürlich wäre sie mit dem Fahrrad schneller, aber auf die zehn Minuten kam es nicht an. Hoffte sie. Sie brauchte einen klaren Kopf. Zumal sie sich mit ihrer neuen Rolle noch immer schwertat.
Am Teich Mellaerts vorbei führte der Weg in den Parc de Woluwe, den sie leider nur durchqueren durfte, anstatt Runden zu laufen. Danach ging es wieder die Avenue de Tervueren entlang. Sie war gut in Form, nach zwanzig Minuten erreichte sie die Triangel. Während insgesamt nur wenige Fenster leuchteten, war der vierte Stock ein einziger Lichtbalken.
Der Sitz des EAD war erst vor ein paar Jahren fertiggestellt worden. Es handelte sich um ein architektonisches Kunstwerk mit dem Grundriss eines Dreiecks, das einen Kreis umrahmte. Die prächtige Fassade und ein begrünter Innenhof konnten selbst hohe Staatsgäste beeindrucken. Der Rest war ein Fiasko.
Jahrelang hatte die EU mit der Bauherrin, der französischen AXA-Gruppe, erbittert um die Konditionen gestritten. Mehrmals standen die Bauarbeiten still, immer neue Mängel traten auf. Während der fehlende Hubschrauberlandeplatz nur ein Ärgernis war, mussten alle sicherheitsrelevanten Systeme vollständig überarbeitet werden. Selbst den Fluchttunnel, den das Vorgängergebäude noch besessen hatte, hatte man zugeschüttet. Die Anpassung von Kommunikationsnetz und Energieversorgung war am aufwendigsten. In manchen Abteilungen arbeiteten die Handwerker noch immer.
Conrada wischte sich den Schweiß von der Stirn und wartete, bis sich ihr Atem normalisiert hatte. Dann betrat sie den Mitarbeitereingang an der Avenue de la Joyeuse Entrée, scannte ihren Ausweis und nickte dem Sicherheitsmann zu. Das Waffenerkennungssystem war noch nicht installiert, eigentlich hätte sie durchsucht werden müssen. Doch der Mann winkte sie durch. Auch im Herzen der europäischen Bürokratie fanden sich noch Rebellen. Conrada nahm den Aufzug in den vierten Stock.
Kaum hatte sie den Fahrstuhl verlassen, kam ihr Stéphane entgegengerannt.
»Conrada, da bist du ja endlich.« Stéphane Aurel war Conradas rechte Hand; als sie zur Abteilungsleiterin für Südamerika befördert worden war, hatte sie ihn zu ihrem Stellvertreter ernannt. Der Belgier war ein fröhlicher Mittfünfziger mit tiefen Geheimratsecken in seinen ansonsten dichten grauen Locken. »Gut, dass du da bist. Ernsthaft, du bist gejoggt?« Er redete Französisch. Stéphane hatte Jahrzehnte seines Lebens in europäischen Institutionen verbracht, doch sein Englisch war nach wie vor nur für Eingeweihte zu verstehen. Obwohl Französisch ebenfalls Arbeitssprache der EU war, hatte sich in der Abteilung – sehr zu seinem Leidwesen – Englisch durchgesetzt. Nach dem – zumindest gedanklichen – Ausscheiden Großbritanniens aus der Union wurde deren Hauptverkehrssprache ironischerweise nur noch in Irland und auf Malta gesprochen. Das entsprach etwa einem Prozent aller Einwohner.
»Treffen wir uns in zehn Minuten im Konferenzraum? Ich will noch kurz duschen.«
Stéphane schnüffelte übertrieben und grinste. »Solltest du.« Doch seine Augen leuchteten nicht.
»Keine Neuigkeiten zu Jasmin?«, fragte Conrada.
Seine Miene verdunkelte sich weiter. Er schüttelte den Kopf. Stéphanes Exfrau arbeitete für Reporter ohne Grenzen. Das letzte halbe Jahr hatte sie den Schutz verfolgter Journalisten in Brasilien koordiniert. Eine zermürbende Aufgabe; Bolsonaro arbeitete mit den zwei klassischen Werkzeugen des Autokraten – Angst und Propaganda. Eine freie Presse hatte keinen Platz in einem solchen System. Stéphane hielt immer noch Kontakt zu Jasmin. Vor einigen Wochen war sie verschwunden.
»Wenn du was brauchst, sag Bescheid.« Conrada lächelte ihm aufmunternd zu.
Stéphane nickte.
In Gedanken noch bei Jasmin, eilte Conrada zu ihrem Büro, sie hatte stets Wechselkleidung vor Ort. Doch bevor sie das Büro erreichte, wurde sie abgefangen.
»Ms. van Pauli. Wie schön. Da haben Sie sich tatsächlich doch noch bequemt, mal vorbeizuschauen.« Conrada kniff die Lippen zusammen. Vor ihr hatte sich Jonathan Rhodes aufgebaut. »Ich dachte schon, die große Retterin der Welt gibt sich nicht länger mit schnöder Büroarbeit ab.« Der Exekutivdirektor der beiden Amerikas war nicht nur dick wie ein Walross, sondern auch ihr direkter Vorgesetzter. Seit Großbritannien beschlossen hatte, die EU zu verlassen, war das Amt des Walisers zu einem Politikum geworden. Außereuropäische Diplomaten fragten immer offener nach besser geeigneten EU-Repräsentanten. Was allerdings auch an Rhodes’ berüchtigt undiplomatischem Auftreten liegen mochte. Conrada hätte nichts gegen einen anderen Chef einzuwenden gehabt, sie empfand den Mann als zutiefst unsympathisch. Doch solange der Austritt der Insel nicht formal vollzogen war, konnte Rhodes so oder so nicht von seinem Posten freigestellt werden.
»Direktor Rhodes. Ich dachte, Sie sind in Chile?«
»Nicht mehr, wie Sie sehen. Haben wir einen neuen Dresscode?«
»Ich wollte mich gerade umziehen.«
»Wozu? Mit Ihren Beinen lenken Sie bloß die Mitarbeiter ab.« Rhodes lachte, Conrada zwang sich zur Gelassenheit.
»Entschuldigen Sie mich«, presste sie hervor und schob sich an dem Fleischberg vorbei.
»Keine Eile«, rief er ihr hinterher. »Ohne unsere Superfrau fangen wir doch nicht an.«
Frisch geduscht und der Situation entsprechend gekleidet, betrat Conrada den Konferenzraum. Fast alle Stühle waren bereits besetzt. Der Tisch war mit Laptops gepflastert. Conrada hatte sechzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon war bestimmt die Hälfte da. Sogar die Praktikantin, stellte sie verdutzt fest. Stéphane hatte ihre Bitte, allen Bescheid zu geben, offenbar sehr ernst genommen.
Abgesehen von ihrem Team waren drei weitere Personen anwesend. In den Armstuhl zurückgelehnt, die Arme auf seinem schweren Bauch verschränkt: Jonathan Rhodes. Außerdem ein Mitarbeiter des Emergency Response Coordination Centre ERCC, unschwer zu erkennen an dem blauen Poloshirt mit Aufdruck. Den dritten Gast konnte sie nicht zuordnen. Sie streckte ihm die Hand entgegen: »Conrada van Pauli, Abteilungsleiterin Südamerika.«
Der Angesprochene war schmal, fast zierlich, doch sein Händedruck war fest. »Thomas Prinz. INTCEN. Abteilung Auswärtige Angelegenheiten. Informationsanalyse.« Er hatte einen deutschen Akzent, aber welche Gegend?
Rhodes schnaufte belustigt: »Es gibt euch also tatsächlich.«
Der Geheimdienstmitarbeiter schwieg irritiert. Offensichtlich kannte er Rhodes noch nicht. Conrada begrüßte auch den ERCC-Mitarbeiter und kontrollierte die Ausweise. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemand ihre Abteilung unterwanderte, aber Vorschrift war Vorschrift.
»Schön, dass Sie da sind«, sagte Conrada zu den beiden Gästen. Sie drückte ihren Rücken durch, bemühte sich, ihre Stimme fest klingen zu lassen. Sie spürte Rhodes’ gehässigen Blick auf ihrem Ohr. Im Umgang mit ihren Mitarbeitern fühlte sie sich sicher, aber je erfolgreicher sie wurde, desto weniger konnte sie einfach nur ihre Arbeit machen. Stattdessen wurde sie zu einem Spiel der Macht und Eitelkeiten gedrängt. Das Spiel war Conrada zuwider.
»Was verschafft uns die Ehre?«, fragte sie.
»Mr. Aurel«, sagte der ERCC-Mitarbeiter.
»Ich dachte, wenn wir schon ein Zentrum für Real-Time-Monitoring haben, können wir das auch nutzen«, erklärte Stéphane. In der Gruppe musste er Englisch sprechen. Es klang wie Französisch, das hier und da mit einer englischen Vokabel garniert war.
Conrada nickte. Die interne Vernetzung scheiterte viel zu oft am Zuständigkeitsgerangel zwischen den einzelnen Abteilungen. Sie blickte den Geheimdienstler an.
»Ich bin ohne Einladung hier«, sagte er.
»Wie bitte?« Jetzt erkannte sie den Akzent. Wien.
»Und das ist Ihr Versäumnis.« Der Ton war unbeteiligt, selbstsicher.
Conrada war sprachlos. Wenn INTCEN in der Öffentlichkeit bekannt wäre, gäbe der Dienst das perfekte Beispiel dafür ab, weswegen die EU an Rückhalt in der Bevölkerung verlor. INTCEN – ehemals SITCEN – verfügte über keinerlei demokratische Legitimation. Ins Leben gerufen worden war der Geheimdienst Ende des zwanzigsten Jahrhunderts auf Betreiben des Berner Clubs, der informellen Gemeinschaft europäischer Nachrichtendienste. Auf Gründungsdokumente wurde verzichtet. Als die britische Bürgerrechtsbewegung Statewatch nach der Rechtsgrundlage fragte, lautete die Antwort, es handle sich um eine dem Generalsekretariat des Europäischen Rates untergeordnete Verwaltungseinheit, die keiner weiteren Kontrolle bedürfe. Das genügte, um einen Skandal zu vermeiden, war aber natürlich eine Farce.
Im Jahr 2010 wurde deshalb die komplette Belegschaft dem EAD angeschlossen. Da die Hohe Vertreterin des EAD Vizepräsidentin der Kommission war und sowohl vom Europäischen Rat als auch vom Parlament kontrolliert wurde, sei SITCEN nun automatisch mitlegitimiert. Zwei Jahre später wurde SITCEN in INTCEN umbenannt, um der neuen Fassade auch noch einen frischen Anstrich zu verpassen. Dass das Parlament nach wie vor weder die Agenda mitbestimmen durfte noch Einsichtrechte besaß, regte zwar Hermann und einige andere Parlamentarier auf. Aber hinter den globalen Krisen der Zeit verblasste das Problem. Öffentlichkeit und politischer Betrieb wandten sich drängenderen Herausforderungen zu.
»Sie meinen«, fragte Conrada den Geheimdienstler betroffen, »es wäre meine Aufgabe gewesen, Sie einzuladen?«
»Nun, die Hohe Vertreterin hat neue Richtlinien zur internen Koordination ausgegeben. Im menschengemachten Krisenfall soll INTCEN die zentrale Anlaufstelle werden.«
»Vielleicht sollten Sie weniger joggen«, spottete Rhodes, »und stattdessen Ihre Mails lesen. Sie sind jetzt Führungskraft, da werden Sie mit einem hübschen Lächeln nicht weit kommen.«
Conrada schluckte. Die Mails der Hohen Vertreterin richteten sich üblicherweise nur an die Direktoren des EAD. Rhodes musste ihr die Information unterschlagen haben. Und die Selbstverständlichkeit, mit der Prinz sie vor ihrem eigenen Team zurechtwies, machte es nicht besser. Sie war alles andere als begeistert, mit INTCEN zusammenzuarbeiten. Doch wie es aussah, hatte sie keine Wahl.
»Stéphane«, bat sie, »gibst du uns einen Lagebericht?«
Auf das Stichwort sprang Stéphane auf und trat vor die Gruppe.
»Über die Geschehnisse der letzten Tage sind Sie alle auf dem Laufenden, ich beginne direkt mit der aktuellen Situation. Heute um 15:08 Uhr Ortszeit – 20:08 Uhr in Brüssel – haben sich etwa drei Dutzend Personen der Rückseite des Palácio do Planalto genähert. Da die Menge der Demonstranten sich vor dem Palast auf der Esplanada dos Ministérios aufhielt, war die Rückseite nur spärlich bewacht. Die Angreifer durchbrachen den Polizeiring und gelangten in den Palast, indem sie mit einem Bulldozer die gläserne Wand zum Splittern brachten.«
»Gab es keine Betonbarrieren?«, fragte der ERCC-Mitarbeiter.
Stéphane zögerte.
»Natürlich gab es die«, warf Prinz ein. »Der Raddozer, der verwendet wurde, wird vierzig Stundenkilometer schnell und wiegt dreißig Tonnen. Betonbarrieren wiegen zwei Tonnen. Ich überlasse Ihnen die Physik.«
»Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt«, grunzte Rhodes.
Eine unangenehme Stille senkte sich über die Anwesenden. Conrada warf Stéphane einen Blick zu und räusperte sich.
Stéphane fuhr fort: »Die Eindringlinge haben sich im Gebäude verschanzt. Sie behaupten, der Präsident befinde sich in ihrer Gewalt. Die brasilianischen Behörden konnten das bisher weder verifizieren noch widerlegen. Funkaufnahmen zeugen aber von Schusswechseln zwischen Sicherheitspersonal und Angreifern. Aufgrund der großen Menschenmenge, die sich zurzeit im Regierungsviertel Brasílias befindet, ist das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Ob über das Festnetz Kontakt hergestellt werden konnte, wissen wir nicht.« Stéphane machte eine kurze Pause, sah auf einen zerknitterten Zettel in seiner Hand.
»Seit heute Nachmittag hat die Gewalt noch einmal stark zugenommen«, fuhr er fort. »Die Polizei fährt auf Reserve, um die Demonstranten in Schach zu halten. Aktuell sind etwa vierhunderttausend Menschen in Brasília auf der Straße, in Rio eine halbe Million, in São Paolo zweihundertfünfzigtausend. Das sind konservative Schätzungen. In manchen kleineren Städten wurden Rathäuser besetzt, in Recife wurde der Bürgermeister erschossen.«
Die Anspannung im Raum war mit Händen zu greifen. Conrada sah verstohlen nach den Gesichtern ihres Teams. Sie alle hatten seit Wochen die Geschehnisse verfolgt. Vielleicht war es die letzte Möglichkeit für die Brasilianer, den Weg in die Autokratie noch abzubrechen. Und wenn nicht? Würde das größte Land Südamerikas Opfer des Faschismus werden? Oder zu einem Failed State? Conrada schauderte.
»Botschafter Kopański hat seinen Mitarbeitern eine Ausgangssperre verhängt«, unterbrach Stéphane ihre Gedanken. »Das Gleiche haben die Botschafter der europäischen Mitgliedsstaaten getan. Der Kulturattaché von Italien wird vermisst. Zurzeit halten sich Zehntausende europäische Staatsbürger in Brasilien auf, die sich potenziell in Gefahr befinden.« Stéphane schwieg. Im Raum wusste jeder, dass ihnen aktuell kaum zu helfen war. Eine sichere Evakuierung benötigte Militär. Und selbst wenn die brasilianische Regierung europäische Soldaten ins Land ließe – was in der derzeitigen Situation äußerst fraglich war – , waren die Betroffenen verstreut unter zweihundert Millionen Menschen in einem Land, in dem die Innenstädte brannten.
»Ist das alles?«, fragte Rhodes.
»Jawohl, Mr. Rhodes.«
»In Ordnung«, sagte Conrada. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen. Sie stand auf. »Danke, Stéphane. Wann erwartet der Generalsekretär unseren Bericht?«
»Zügig. Er hat die Hohe Vertreterin zwar informiert, aber noch nicht sprechen können«, Stéphane zuckte mit den Schultern. »Sie befindet sich beim Essen.«
»Hä?«, rutschte es der Praktikantin heraus.
»Beim Papst«, flüsterte ihr Sitznachbar ihr zu. Die Praktikantin wurde rot.
»Und da hat er sie nicht unterbrochen?«, blaffte Rhodes in die Runde.
»Wozu?«, fragte Conrada. »Sie ist informiert, sie weiß, dass wir bei der Arbeit sind. In Anbetracht der Situation wird der Papst die Audienz sowieso bald beenden. Was ist mit den DSG?«
Der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik unterstand ein Generalsekretär. Dieser wiederum hatte drei Stellvertreter – Deputy Secretary Generals oder abgekürzt DSG – , die in die Bereiche Wirtschaft (ECO), Politik (POL) und Sicherheit (SEC) untergliedert waren. Rhodes war direkter Untergebener des DSG-POL.
»POL telefoniert gerade mit Deutschland«, erklärte Stéphane, »SEC mit den UN. ECO befindet sich zufälligerweise gerade beim SecState. Er wünscht trotzdem, dass wir ihm unsere Berichte unverzüglich zur Verfügung stellen.« Der Secretary of State war der Außenminister der Vereinigten Staaten. Dass die Abkürzung wie Sex-Date klang, hatte beim EAD eine Weile zu allerlei Zoten geführt. Vor zwei Jahren allerdings war die pikante Umschreibung in eine offizielle Mail geraten. Der unvorsichtige Verfasser war entlassen worden, und seitdem beschränkten sich die Witzeleien auf Mitarbeiterfeste zu vorgerückter Stunde.
»Meine Herren, meine Damen«, begann Conrada, »wir haben vier Aufgaben. Erstens das Kommuniqué für die Hohe Vertreterin.« Sie mochte Listen. Listen gliederten das Denken, erleichterten die Kommunikation, dokumentierten den Projektstand. »Zweitens Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Drittens der Schutz europäischer Staatsbürger. Viertens die Unterstützung der örtlichen Behörden. Punkt zwei, drei und vier werden wir in enger Abstimmung mit den Botschaften sicherstellen.«
Sie verteilte ihr Team auf die verschiedenen Aufgaben.
»Meine Herren«, wandte sich Conrada an die beiden Gäste von Katastrophenschutz und Geheimdienst, »haben Sie etwas hinzuzufügen?«
»Selbstverständlich können Sie zur Informationsbeschaffung auf unsere Systeme zurückgreifen«, meinte der ERCC-Mitarbeiter. »Unser Team konzentriert sich aktuell auf Brasilien.«
»Unseres ebenso«, erklärte Prinz beiläufig. »Auch unsere Informationen stellen wir Ihnen zur Verfügung. Sofern sie nicht der Geheimhaltung unterliegen, versteht sich.«
»Danke schön«, sagte Conrada. Welchen Sinn hatte ein Geheimdienst, fragte sie sich, wenn er geheime Informationen besaß, aber diese den verantwortlichen Bereichen nicht zur Verfügung stellte?
Offiziell verzichtete INTCEN auf geheimdienstliche Informationsermittlung. Gemäß seiner obersten Chefin, der Hohen Vertreterin des EAD, bestand seine Aufgabe vielmehr in der Analyse der Berichte, die er von den Diensten der Mitgliedsstaaten erhielt. In der Triangel freilich glaubte das niemand. INTCEN besaß eine eigene Abteilung für Außenbeziehungen. Und eine weitere Abteilung für Außenbeziehungen war das Letzte, was dem EAD fehlte.
Conrada teilte eine Mitarbeiterin ein, die Koordination zwischen ERCC, INTCEN und ihrem eigenen Team zu leiten. Während INTCEN im Haus untergebracht war, war das ERCC Teil der Generaldirektion humanitäre Hilfe und Bevölkerungsschutz ECHO. Das ECHO-Gebäude befand sich gute fünfhundert Meter entfernt Richtung Innenstadt.
»Entschuldigung«, sagte Prinz. »Dürfte ich Ihnen etwas zeigen?« Er deutete auf den Präsentationslaptop, der an den Beamer angeschlossen war.
»Gerne«, erwiderte Conrada. Sie schielte auf die Uhr.
Prinz öffnete den Browser und schaltete den Beamer ein. »Während das ERCC seine Daten primär von universitären Quellen und Behörden bezieht, konzentrieren wir uns auf frei verfügbares Material.«
Stell dir mal vor, hätte Conrada am liebsten gesagt, wir machen beides. Manchmal googeln wir sogar. Nur dass ich sechzehn Mitarbeiter habe und du neunzig. Der Vergleich hinkte natürlich, ihr Team war für Südamerika zuständig, INTCEN für die ganze Welt. Conrada war von sich selbst überrascht; gewöhnlich gelang es ihr recht gut, sich auf die verschiedenen Charaktere einzulassen. Prinz jedoch kannte sie erst eine Viertelstunde und verspürte bereits Widerwillen.
Der Geheimdienstler sprach weiter, während er auf den internen EAD-Server zugriff. »Gewalt entsteht nie aus dem Nichts. Stattdessen muss sie immer in der Struktur betrachtet werden, innerhalb derer sie auftritt. Gleich, ob es sich um eine Familie handelt, eine Arbeitsgemeinschaft, eine kriminelle Vereinigung, einen Staat.« Conrada wurde unruhig. Sie hatten keine Zeit für soziologische Einführungsseminare.
Prinz öffnete eine Datei, der Beamer warf Balkendiagramme an die Wand. »Die fundamentale Regel lautet: Gewalt findet entweder statt, weil keine Vergeltung droht. Oder sie bricht aus, weil der Druck ein solches Maß erreicht hat, dass die Vergeltung in Kauf genommen wird.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte Rhodes.
»Sofort«, entgegnete Prinz unbeeindruckt. »Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, die aus friedlichen Protesten gewaltgetragene Aufstände macht, stellen wir zweierlei fest.« Er wies auf die Projektion. »Die Gewalt bricht immer erst punktuell aus und verbreitet sich dann sternförmig. Einzelne gehen voran, dann folgt die Masse. Im Schutz der Menge scheint die Gefahr der Vergeltung gering. Zweitens endet die Gewalt dann, wenn sich entweder die Zustände angepasst haben oder die Angst vor Vergeltung reaktiviert wurde. Spartakus, Tiananmen, Arabischer Frühling – sehen Sie, wohin Sie wollen, es greift immer dasselbe Prinzip.«
»Ist das nicht Zeug für Militärs?«, knurrte Rhodes. »Das sollte Bolsonaro ja wohl wissen. Genug Erfahrung mit so was hat der ja.« Conrada war ihm fast dankbar, dass er den Geheimdienstler zurechtstutzte.
Dieser fuhr ungerührt fort: »Warum sind die Leute in Brasilien auf die Straße gegangen?«
»Weil sie die Demokratie retten wollen«, entgegnete Stéphane.
»Naiv. Die wenigsten riskieren ihr Leben für die Demokratie. Die wirtschaftlichen Zustände sind unhaltbar. Das bedeutet: Wenn die Staatsgewalt den Frieden wiederherstellt, sind die Zustände zwar stabilisiert, aber keiner kann sagen, für wie lange.«
»Es ist doch klar, dass eine wirtschaftliche Konsolidierung dringend in Angriff genommen werden muss«, rief Stéphane. Auch er hatte anderes zu tun, als banale Zusammenhänge erläutert zu bekommen.
Prinz ging nicht auf ihn ein. »Doch das ist nicht die eigentliche Gefahr. Wirklich gefährlich wird es, wenn die Ordnung nicht zügig wiederhergestellt werden kann.«
Jetzt wurde auch das restliche Team unruhig.
»Sie wollen Bolsonaro stürzen sehen?«, fragte Conrada.
»Im Gegenteil. Ich will, dass er an der Macht bleibt.«
»Er ist ein Faschist!«, riefen Conrada und Stéphane wie aus einem Munde.
»Es geht nicht um Brasilien, es geht um mehr. Gewalt verbreitet sich, wie gesagt, durch die Identifikation mit gewalttätigen Leitfiguren. Die neue Variable Internet verteilt Nachrichten und Bilder global. Die Identifikation findet heute ohne direkten Kontakt statt. Auch hier dient der Arabische Frühling als gutes Beispiel. Die Revolution stützte sich in einigen Ländern nicht unerheblich auf Facebook und Twitter.«
»Was schlagen Sie vor?«, fragte Conrada argwöhnisch.
»Die Stabilisierung der Verhältnisse hat absolute Priorität. In der aktuellen Lage muss die Angst vor Vergeltung reetabliert werden. Gewalt muss bestraft werden. Schnell und hart. Rädelsführer müssen öffentlichkeitswirksam zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar unverzüglich. Nur so können wir die Gewalt eindämmen, bevor es zu spät ist.« Conrada wollte ihm widersprechen, Prinz hob abwiegelnd die Hand: »Ich weiß, Sie sind anderer Meinung, ich kenne Ihre Akte. Bedenken Sie, dass …«
»Die EU hat keine Exekutivgewalt in Südamerika«, unterbrach ihn Stéphane gereizt. Merkwürdigerweise war sein Englisch besser zu verstehen, wenn er zornig war. »Vielleicht sollten Sie Ihre Erkenntnisse den Brasilianern mitteilen.«
»Die Aufgabe der EU muss lauten, medial Druck aufzubauen. Die globalen Verwerfungen der letzten Jahre haben die Politik zu viel Vertrauen gekostet, als dass es erfolgversprechend wäre, Reformen anzukündigen. Diese würden als leere Versprechen abgetan werden. Die EU muss nicht nur die Gewalt klar verurteilen, sondern Strafmaßnahmen vorantreiben. Schreiben Sie das in das Kommuniqué der Hohen Vertreterin. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht, dass der Schneeball ins Rollen kommt.«
»Wollen Sie lieber eine Diktatur unterstützen?«, fragte Conrada aufgebracht. »Sollen wir eine bigotte Haltung annehmen, wie wir sie gegenüber Saudi-Arabien pflegen?«
»Wieso nicht?«
»Weshalb sollte ich daran glauben«, fragte Rhodes, »dass es einen Schneeball gibt? Die Staaten um Brasilien herum sind leidlich stabil. «
»Venezuela?«, fragte Stéphane. Das von Hungersnöten gebeutelte Land taumelte bereits Richtung Failed State. Wer konnte, floh. Die meisten hatten sich Richtung Brasilien gewandt.
»Ach was.« Rhodes fuhr unbeirrt fort: »Bisher finden sich keinerlei Anzeichen, dass die Gewalt in andere Länder überspringt.«
Prinz lächelte kühl. Er beugte sich über den Rechner und öffnete eine Datei. Sie zeigte den Screenshot einer Twitter-Seite, eine knappe Stunde alt. Jemand hatte ein Foto gepostet.
Ein Mann im Anzug, groß gewachsen, helle Hautfarbe, lag mit verdrehten Gliedmaßen auf Straßenteer. Um seinen Kopf herum war eine Pfütze zu erkennen. Es war totenstill im Raum. Conrada beobachtete ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hatte den Hang, sich in Stresssituationen auf ihre Umwelt zu konzentrieren. Alle anderen starrten gebannt auf das Bild. Selbst Rhodes saß auf der Stuhlkante, lehnte sich nach vorn, die Hände auf die Knie gestützt.
»Ein Weißer«, sprach jemand das Offensichtliche aus.
»Ein Diplomat?«, fragte Stéphane.
»Ist er tot?«, flüsterte die Praktikantin.
»Jason Silver«, referierte Prinz. »US-Amerikaner. Vorstandsvorsitzender des US-Futtermittelherstellers Corner’s. Heute Mittag um 14:28 Uhr Ortszeit in Brasília gelandet, hatte um 16 Uhr einen Termin beim brasilianischen Wirtschaftsminister. Letzter Kontakt mit seinem Assistenten Edward Minsterson um 15:22 Uhr. Vermutlich durch Schläge auf den Kopf zu Tode gekommen.«
Das Foto war einem Schlagwort zugeordnet worden: #killtherich.
»Die Welt verfolgt sehr genau, was in Brasilien geschieht.« Prinz öffnete eine weitere Datei, eine Tabelle mit Kurztexten, jeweils mit Datum und Verfasserakronym versehen. »Mein Team hat die kommentierenden Retweets gesammelt.«
Von den Postings waren nur wenige portugiesisch. Viele waren auf Englisch verfasst, die meisten auf Spanisch. Fast alle trieften vor Schadenfreude und Hass.
4. Kapitel
Chennai, Indien; Mittwoch, 18:22 Uhr UTC+5:30
Er müsse das verstehen, hatten sie gesagt, die Zeiten änderten sich. Ha, die Languren! Und jetzt, hatte er gefragt, was solle er tun? Nun, hatten sie gesagt, im Boulevard seien gerade Stellen frei.
Es war unfassbar. Boulevardjournalismus! Bimal ballte die Fäuste, allein wenn er daran dachte, zitterte er vor Zorn. Er war Journalist, kein Paparazzo!
Bimal Kapoor war einundsechzig Jahre alt, vierunddreißig davon hatte er für The Hindu geschrieben, die ehrwürdigste englischsprachige Zeitung Indiens. Seine Methoden entsprachen vielleicht nicht der Konvention, aber gab der Erfolg ihm nicht recht? Er hatte den Bofors-Skandal mit aufgedeckt, er hatte über Palmölschmuggel geschrieben, über Veruntreuung von Steuergeldern, über illegale Massenenteignungen von Bauern durch Granitabbauunternehmen und über Korruption – aufgrund seiner Recherchen hatte der damalige Außenminister Natwar Singh zurücktreten müssen! Bimal Kapoor hatte keine Angst vor den Mächtigen. Die Mächtigen hatten Angst vor Bimal Kapoor.
Umstrukturierung, ha! Die Wahrheit verkaufte sich nicht mehr, das war alles. Boulevardjournalismus! Er schnaubte vor Wut. Zwei Mönche sahen sich nach ihm um, es war ihm egal. Mochte die ganze Mall mitbekommen, wie übel ihm mitgespielt wurde. Das Express Avenue war eines der neuesten und imposantesten Einkaufscenter Chennais. Prächtig und geschmacklos, willkommen im Indien der Zukunft. Eine glitzernde Zukunft für alle Mitläufer. Er kochte. Er sei nicht mehr zeitgemäß, hatten sie gesagt. Ha! Was sollte das heißen: nicht mehr zeitgemäß? Er trat gegen einen Mülleimer. Das Geräusch war enttäuschend unspektakulär.
Seit Stunden lief er ziellos durch die Stadt, versuchte die Schmach zu verarbeiten. Boulevardjournalismus. Hätten sie ihm lieber gleich gekündigt, als ihn derart lächerlich abzuspeisen. Oder nein, im Gegenteil, wahrscheinlich hatten sie sich alles genau überlegt. Er nahm einen Schluck von seinem Mangoschnaps. Zumindest das Trinken konnten sie ihm nicht verbieten. Wahrscheinlich warteten sie nur darauf, dass er von sich aus kündigte. Natürlich, Bimal Kapoor wurde nicht entlassen, nicht der Journalist, der das Exklusivinterview mit Schachweltmeister Anand geführt hatte, direkt nach dessen historischer Niederlage gegen Carlsen. Schlechte Presse wäre das. Bimal lachte bitter.
Er habe die Digitalisierung verpasst, hatten sie gesagt. Ha! Als ob er nicht genauso erwartungsvoll gewesen wäre wie die anderen, anfangs. Das Internet hätte ein neues Zeitalter des Qualitätsjournalismus einläuten können. Egal ob Aktualität, Recherche, Vernetzung, es bot unvorstellbare Möglichkeiten. Und was machten die Herausgeber stattdessen? Social Media! Ließen sich von der User-Herde treiben wie Schuljungen. Bimal merkte, wie der Alkohol ihm zu Kopf stieg. Menschen mit riesigen Einkaufstüten hasteten an ihm vorbei, Hamsterkäufer des Luxus. Irgendwo wurde der Anstand verramscht, aber niemand bekam es mit – alle waren zu beschäftigt, ihren Selbstwert zu externalisieren auf ihren Besitz.
Nein, entschied Bimal und nahm einen Schluck vom Schnaps, so einfach würden sie ihn nicht los. Und wenn sie ihn zu einem Boulevardjournalisten machen wollten, dann würde er sich auch verhalten wie ein Boulevardjournalist. Sie würden noch bereuen, ihn nicht einfach mit einer Abfindung aus dem Haus gejagt zu haben.
Er kam an einem Elektronikgeschäft vorbei. In grellen Farben wurde Kameraausrüstung angepriesen. Warum nicht?, dachte er grimmig. Brauchte er nicht die passende Ausrüstung zu seinem Niedergang? Kein Paparazzo ohne Teleobjektiv. Natürlich würde er es ihnen in Rechnung stellen – aber vor allen Dingen würden sie die Fotos zu verantworten haben. Er war fest angestellt, die juristische Abteilung von The Hindu würde noch fluchen über ihn.
Das Geschäft war groß wie ein Parkhaus. Die Kunden drängten sich so dicht durch die Regalreihen, dass Bimal übel wurde. Wo befand sich die Kameraabteilung?
Ein Sicherheitsmann in westlicher Kleidung bat ihn, die Flasche abzugeben. Bimal trank sie aus. Die Welt war am Ende. Der Journalismus war tot. Unverschämtheit ersetzte die Recherche, Technik ersetzte das Denken. Und er, Bimal Kapoor, Starjournalist einer untergegangenen Epoche, hatte keinen Schnaps mehr.
Als er die Kameraabteilung erreichte, sah er sich nach einem Angestellten um. Niemand da. Bimal hatte keine Ahnung von Technik, früher hatte man ihm regelmäßig einen Fotografen an die Seite gestellt.
Es schien, als wären normale Kameras genauso passé wie geduldige Recherchearbeit. Drohnen waren das große Ding: prominent platziert, reißerisch beworben, von potenziellen Kunden begafft wie fliegende Kühe.
»Sie suchen etwas Bestimmtes?« Ein pickliger Jugendlicher war hinter Bimal getreten. Er trug ein Hemd mit dem Namen des Elektromarktes.
»Schnaps«, sagte Bimal.
»Bitte?«
»Eine Drohne.«
Der Jugendliche wollte sich nach Details erkundigen, Bimal winkte ab. »Zeig mir einfach die teuerste, die ihr habt.«
Der Jugendliche nickte willfährig und führte ihn den Verkaufsgang entlang. Vor einem blau-weißen Karton blieb er stehen.
Er begann zu erklären.
»Was kostet sie?«, unterbrach ihn Bimal.
Der Jugendliche nannte einen Preis, mit dem man einen Bundespolitiker hätte kaufen können.
»In Ordnung«, sagte Bimal.
Als Bimal das Express Avenue verließ, lief er wie immer in eine Wand aus schwülheißem Gelee, zusammengerührt aus 33 Grad Celsius, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit, etwas Straßenstaub und den Abgasen von vier Millionen PKW. Alle vier Millionen PKW hupten.
Den verblüffend leichten Drohnenkarton unterm Arm, in der freien Hand eine neu erworbene Schnapsflasche, sah er sich nach einem Taxi um. Er hatte Glück, nach kurzer Zeit hatte er eines gefunden. Taxis waren zwar nicht schneller als Fußgänger, aber klimatisiert.
Zu der Drohne hatte er sich eine passende Kamera und ein Mikrofon gekauft. Es dunkelte bereits, aber Bimal war fest entschlossen, seinen Kauf noch heute auszuprobieren. Nur wo?
Er wies den Taxifahrer an, in den Südwesten zu fahren, nach Kodambakkam. Wenn er schon zum Paparazzo wurde, dann konnte er seine Fähigkeiten auch gleich dort testen, wo die Idee des Voyeurjournalismus geboren worden war. Hoffentlich war der Akku geladen.
Kodambakkam war zwar nicht die Wiege aller Popstars, aber immerhin das Zentrum der tamilischen Filmindustrie. In Anlehnung an Bollywood trug es den Spitznamen Kollywood. Hier wurden über dreihundertfünfzig Filme im Jahr produziert, mehr als beim großen Bruder in Mumbai. So stolz die ansässigen Filmemacher über diesen Umstand waren, so sehr litten sie darunter, dass sie an Umsatz nicht einmal die Hälfte erzielten.
Endlich hatten sie das Viertel erreicht, Bimal bezahlte den Taxifahrer und stieg aus. Schick war es hier, das musste er zugeben. Schlaglochfreier Asphalt, frisch gestrichene Fassaden statt Wellblech, Bäume statt Müll. Nirgendwo Kühe. Bimal setzte sich auf den Bürgersteig – es gab einen Bürgersteig – , nahm einen Schluck von seinem Schnaps – diesmal Litschi – und öffnete den Karton. Dass ihn in Kodambakkam jemand überfiel, hielt er für unwahrscheinlich.
Die Drohne war bereits zusammengebaut, er musste sie nur aus ihrem Styropor lösen. Es gab eine Bedienungsanleitung, Bimal blätterte sie ungeduldig durch. Auf Seite vier ließ er es bleiben. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, seine Augen waren nicht mehr die besten.
Zum Glück war die Inbetriebnahme idiotensicher. Der Akku war durch eine Klebefolie geschützt und aufgeladen. Bimal setzte ihn ein und klickte dann Kamera und Mikrofon in die entsprechenden Halterungen.
Plötzlich spürte er ein Ziehen im Magen. Er war betrunken, er hatte noch nie eine Drohne geflogen. Was, wenn er sie direkt gegen die nächste Hauswand setzte? Sicher, er musste sich finanziell keine Sorgen machen, aber reich war er auch nicht. Und dass