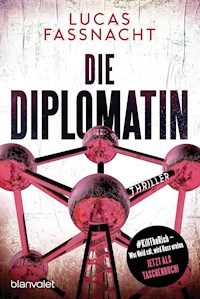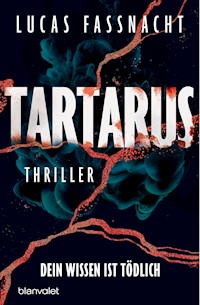
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein junger Doktorand, ein geheimes Projekt und eine brisante Entscheidung – für alle Fans der Netflix-Serie »Biohackers«.
Geschafft! Leon Gärtner hat den Masterabschluss in der Tasche, und als ihm die berühmte Genetikerin Nicole Stierli eine Promotionsstelle an ihrem Institut anbietet, erfüllt sich ein Kindheitstraum. Auf seiner ersten Konferenz lernt er eine Journalistin kennen, die geheimnisvolle Valérie. Doch dann wird Valérie vor seinen Augen ermordet, der Traum gerät zum Albtraum. Leon hat eine einzige Spur: den Namen Tartarus. Als die offiziellen Ermittlungen stocken, beginnt er, auf eigene Faust zu recherchieren – und gelangt in eine Welt, in der jedes falsche Wort den Tod bedeuten kann. Bald steht mehr als nur sein eigenes Leben auf dem Spiel. Leon muss sich entscheiden: Wie weit will er gehen, um seinen Glauben an die Wissenschaft zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tartarus
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
Nachwort
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Orientierungsmarken
Copyright-Seite
Hauptteil
Nachwort
Buch
Geschafft! Leon Gärtner hat den Masterabschluss in der Tasche, und als ihm die berühmte Genetikerin Nicole Stierli eine Promotionsstelle an ihrem Institut anbietet, erfüllt sich ein Kindheitstraum. Auf seiner ersten Konferenz lernt er eine Journalistin kennen, die geheimnisvolle Valérie. Doch dann wird Valérie vor seinen Augen ermordet, der Traum gerät zum Albtraum. Leon hat eine einzige Spur: den Namen Tartarus. Als die offiziellen Ermittlungen stocken, beginnt er, auf eigene Faust zu recherchieren – und gelangt in eine Welt, in der jedes falsche Wort den Tod bedeuten kann. Bald steht mehr als nur sein eigenes Leben auf dem Spiel. Leon muss sich entscheiden: Wie weit will er gehen, um seinen Glauben an die Wissenschaft zu retten?
Autor
Lucas Fassnacht hat in Tansania Radfahren gelernt, in Hessen Bruchrechnen und in Bayern Altgriechisch. Am Pforzheimer Stadttheater hat er Kulissen geschoben; inzwischen wohnt er in Nürnberg und schreibt. Am liebsten über Macht: Wie sie entsteht, wo sie sich zeigt – und ob ihr Besitz zwangsläufig ins Dunkel führt.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.
Lucas Fassnacht
TARTARUS
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Angela Kuepper Covergestaltung: www.buerosued.deLH • Herstellung: sam Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-27152-7V003
www.blanvalet.de
1. Kapitel
BRAUNSCHWEIG
Leon Gärtner rannte, als ginge es um sein Leben. Und in gewisser Weise tat es das auch. Sechs Monate hatte er das Labor nur zum Essen und Schlafen verlassen. Und jetzt das: zwölf Minuten vor zehn. Seine berufliche Zukunft löste sich auf, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
Das Hemd klebte ihm am Rücken. Die Meteorologen erwarteten den heißesten Septembertag seit Beginn der Aufzeichnungen.
Im Dauerlauf wählte er Felis Nummer. Nimm ab, Schwester, verdammt.
»Was gibt’s, Bruderherz? Sag mal, kennst du …«
»Ich brauch dein Fahrrad.«
»Was? Wozu?«
»Abschlussprüfung. Ich hab verpennt.«
»Wo bist du? Ich bring’s dir.«
Am Institut für Fahrzeugtechnik brauste Feli ihm entgegen, brachte ihre klapprige Karikatur von einem Rad so rabiat zum Stehen, dass die Bremsschuhe aufschrien vor Sehnsucht nach ihren verschollenen Belägen.
»Der Code fürs Schloss ist …«
»… vier-drei-sieben-zwei.« Leon schwang sich auf den Sattel und trat in die Pedale. Über die Schulter warf er ein »Ich liebe dich«, Felis Antwort schluckte der Wind.
Er erreichte das Biozentrum, warf Felis Fahrrad gegen die vertrocknete Linde auf dem Vorplatz, rannte die Stufen zum Haupteingang hoch, rannte zurück zum Fahrrad, weil er vergessen hatte abzuschließen, wieder zum Haupteingang, stürmte durch die Flügeltür, wich einer Gruppe Laborassistenten aus. Zweiter Stock, nach links, Kleiner Saal, die Tür war geschlossen. Ein letzter Blick auf die Uhr, der Minutenzeiger stand senkrecht. Schweiß tropfte ihm von Kinn und Nase. Zwei Sekunden durchatmen. Die wichtigste Prüfung seines Lebens. Leon drückte die Klinke und trat ein.
2. Kapitel
Ein älterer Mann mit weißem Haarkranz blickte von seinem Notizblatt auf und wandte sich Leon zu. Professor Sigfried Stadelmann. Daneben saß Robert, der Betreuer von Leons Masterarbeit. Ansonsten waren sie allein in dem holzvertäfelten Saal, der mehrere Dutzend Personen fasste.
»Sie sind spät«, begrüßte Stadelmann Leon und fuhr mit der Zunge unter seiner Oberlippe entlang. Der Professor war eine ehrfurchtgebietende Erscheinung: ein großer Körper, begleitet von einem noch größeren Ego. »Was hat Sie aufgehalten?«
»Ich dachte, zehn …«
»Um zehn wollten wir beginnen.« Stadelmanns ungnädiger Blick fiel auf den ausgeschalteten Beamer.
Hilfesuchend sah Leon nach seinem Betreuer. Robert fixierte mit zusammengekniffenen Lippen den Kugelschreiber, der vor ihm auf dem Pult lag. Persönlich kamen sie gut miteinander aus. Aber während Leon Wert auf wissenschaftliche Korrektheit legte und Formalia am liebsten zum Teufel gewünscht hätte, war es bei Robert andersherum.
»Also?«, fragte Stadelmann.
»Verzeihung«, murmelte Leon und kramte seinen USB-Stick aus der Hosentasche. Zwei Minuten später prangte die Begrüßungsfolie seiner Präsentation an der Projektionswand.
»Soll ich anfangen?«, fragte er nervös.
Stadelmann neigte mit cäsarischer Nachlässigkeit das Haupt. »Wenn Sie müssen.«
»Okay.« Leon sah ein letztes Mal zu Robert, der ihm aufmunternd zunickte, und begann: »Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Waldpilze und Cas9-induzierte Kettenablation als entscheidendem Faktor zur Kontrolle Gene-Drive-bezogener Risiken …«
Nach zwei Sätzen hatte Leon den Spurt durch die Innenstadt vergessen. Verwendete keinen Gedanken mehr daran, dass die nächsten Minuten entscheiden würden, ob er gut genug war für eines der wenigen gewichtigen Promotionsstipendien. Nichts erfüllte Leon mehr, als die Prinzipien zu erkunden, die dem scheinbaren Chaos der Welt zugrunde lagen. Es gab nichts Unberechenbares; alles Ungefähre bekam Struktur, wenn man nur genau genug hinsah. Wie sehr liebte er die Unbedingtheit der Mathematik.
Leon forschte zu Gene Drives, der genetischen Manipulation von Pilzen oder Insekten mit dem Ziel, dass das veränderte Erbgut sich in der gesamten Population ausbreitete. Wurde zum Beispiel eine Fruchtfliege so modifiziert, dass sie nur noch weibliche Nachkommen erzeugte, und in eine bestehende Population integriert, führte das – zumindest theoretisch – zum Aussterben der Population. Denn mit jeder Generation nahm der Anteil der genetisch modifizierten weiblichen Mitglieder zu, bis es nach einer gewissen Anzahl von Generationen keine männlichen mehr gab.
Die Gene-Drive-Forschung wurde als Schlüsseltechnologie der Zukunft gehandelt, weckte etwa in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten immense Erwartungen. Und wie jede Forschung, die Erwartungen weckte, versprachen schnelle Ergebnisse großes Renommee und üppige Drittmittel. Leons Ansicht nach war Geltungsdrang der Tod nachhaltiger Wissenschaft. In seiner Arbeit hatte er sich mit Waldpilzen beschäftigt. Genauer, mit Mykorrhiza: Mischstrukturen aus Pilzen und Baumwurzeln, über die Nährstoffe ausgetauscht und Schadstoffe gefiltert wurden. Achtzig Prozent aller Landpflanzen waren von einer solchen Symbiose ganz oder teilweise abhängig.
Leon forschte daran, wie Waldpilze so modifiziert werden konnten, dass sie widerstandsfähiger gegen Dürren und Starkregen würden. Im Angesicht der Klimakatastrophe ein zukunftsträchtiges Forschungsfeld. Doch auch wenn er fasziniert von der Technik war, hatte er sich mit den Risiken befasst. Und die waren nicht von der Hand zu weisen.
»Insgesamt lässt sich festhalten«, schloss er, »dass die Werkzeuge, die uns bisher zur Verfügung stehen, um eine unkontrollierte Ausbreitung genmodifizierter Organismen zu verhindern, kaum erprobt sind. Noch auf Jahre hinaus wird sich die Forschung auf Versuche unter strikten Laborbedingungen beschränken müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
»Na ja«, knurrte Stadelmann, »Sie brauchen ja nicht gleich den Teufel an die Wand zu malen.« Es war ein offenes Geheimnis, dass der Professor mehrere Pharmafirmen beriet. Dass Leons Ergebnisse ihm nicht gefielen, war wenig überraschend. »Und Ihre Thesen zur Verbreitungsgeschwindigkeit entsprechen nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung.«
»Berechnungen.«
»Bitte?«
»Nicht Thesen, Berechnungen. Und meine Berechnungen sind korrekt.« Dessen war Leon sich sicher. Er verrechnete sich selten, und für seine Masterarbeit hatte er alles dreimal geprüft. »Im Übrigen findet sich einige aktuelle Literatur, die meinen Punkt unterstützt.«
»Manche picken sich die Rosinen raus«, erwiderte Stadelmann feindselig. »Sie hingegen entscheiden sich für faule Zwiebeln.«
Leon zögerte. Er wollte nicht an irgendeiner mittelmäßigen Uni promovieren, er brauchte Stadelmanns Plazet. Rasch warf er einen Blick zu Robert, doch der überprüfte soeben die Nähte seiner Hemdsärmel. »Ich habe alle relevante Literatur gesichtet«, verteidigte er sich.
»Und trotzdem wollen Sie behaupten, Pilzsporen müssten unter denselben Sicherheitsbestimmungen modifiziert werden wie Fliegen?«
Leon begann wieder zu schwitzen. Klar, Stadelmann hätte gern gehört, dass die Risiken überschaubar wären – aber so war es nun mal nicht. Schweigend beobachtete er, wie der Professor mit spitzen Fingern durch das Manuskript blätterte.
»Sie beziehen sich auffällig häufig auf Stierli et alteri. Sie scheinen geradezu ein Fan zu sein …«
»Nein«, stotterte Leon verwirrt, »ich meine, ja, sie ist eine Koryphäe.« Er hatte fast zwanzig ihrer Publikationen zu Hause – ausgedruckt und gebunden.
»Soweit ich weiß, liegt Stierlis Forschungsschwerpunkt bei Bakterien und Viren, nicht Pilzen.«
Leon bebte in ohnmächtigem Zorn. »Die Theorien lassen sich übertragen. Sie werden keine aktuelleren Paper finden, die sich mit dem Thema befassen.«
»Mhm«, machte Stadelmann.
»Stierli hat den tiefsten Einblick in die Materie, in Europa auf jeden Fall.«
»Wenn ich ehrlich bin«, Stadelmann sah vom Manuskript auf, »bin ich weniger überzeugt von Frau Stierli als Sie. Erfahrungen mit Hefebakterien auf Waldpilze zu übertragen, scheint mir ziemlich naiv.«
»Beachten Sie bitte Kapitel vier. Wenn sich der Generationenzyklus verkürzen lässt, wird sich das manipulierte Erbgut in einigen Jahren oder spätestens Jahrzehnten durchsetzen können.«
Stadelmann ließ das Manuskript sinken. Seine Zunge fuhr nun unter der Unterlippe entlang, erzeugte ein schmatzendes Geräusch. »Und Stierli rät zur Vorsicht. Fraglich, wie sie da zu ihren Drittmitteln kommen will.«
Leon sah unruhig zu der Uhr, die über der Tür hing. Es war bereits ein Drittel der Zeit vergangen, die für das Gespräch anberaumt war. Bisher hatte Stadelmann ihm noch keine einzige fachliche Frage gestellt.
»Die Formel, die Sie angesprochen haben«, sagte der Professor, »ist tatsächlich beachtlich.« Dann, mit einem Stirnrunzeln: »Sie haben die Quelle vergessen.«
»Nein, habe ich nicht.«
Stadelmanns Kiefer arbeitete. Offenen Widerspruch war er nicht gewohnt. »Wissen Sie, Herr Gärtner, was ich von Unterschleif halte?«
»Es gibt keine Quelle.« Leon räusperte sich verlegen.
»Was soll das heißen?«
»Die Formel ist von mir.«
Die Verachtung in Stadelmanns Blick war vollkommen.
»Robert«, bat Leon seinen Betreuer um Unterstützung.
Dieser zuckte die Achseln. »Ich hab den Text durchs Plagiatsprogramm gejagt, da war alles sauber.«
»Software arbeitet auch nicht immer perfekt. Hören Sie zu, Herr Gärtner«, Stadelmann zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ich weiß, dass diese Formel kein Masterand geschrieben hat. Also? Wenn Sie jetzt den Urheber benennen, lasse ich Sie vielleicht bestehen.«
Vielleicht?, dachte Leon erschrocken. Für jedes Promotionsstipendium, das seinen Namen verdiente, brauchte er eine Eins. In seinen Schrecken mischte sich Empörung. Er selbst war es gewesen, der die Formel entwickelt hatte. Er hatte sie nicht geklaut.
»Ich warte«, sagte Stadelmann gefährlich ruhig.
Leon verschränkte die Arme. »Es ist meine Formel.«
»Na gut«, Stadelmann griff nach seinem Jackett, das über der Lehne seines Nachbarsitzes hing, zog sein Handy hervor. »Wir klären das hier und jetzt.« Und dann fügte er noch hinzu, beiläufig, während er auf dem Gerät herumtippte: »Ihre Zukunft suchen Sie sich aber lieber nicht in der Biologie.«
Es war so still im Kleinen Saal, dass Leon das Pochen in seinen Schläfen hören konnte. Zu dem Pochen gesellte sich der Wählton aus Stadelmanns zu laut eingestelltem Handy.
Jemand nahm ab. Stadelmann lehnte sich in seinem Sitz zurück. »Hallo, Nicole, wie ist Zürich? Ich hoffe, ich störe nicht.«
Leon lauschte verdattert. Nicole? Nicole Stierli? Er hätte nicht gedacht, dass Stadelmann Stierli kannte, aber die wissenschaftliche Gemeinde war gut vernetzt. Mehr verstörte es ihn, dass Stadelmann den Kontakt tatsächlich nutzte, um seine bescheuerte Unterstellung zu prüfen.
Robert hatte sich kerzengerade hingesetzt, starrte Stadelmann an, offenbar genauso verwirrt wie Leon selbst.
Der Professor hingegen war die Ruhe in Person. Er plauderte kurz, bevor er den Grund seines Anrufs schilderte und die fragliche Formel vom Manuskript ablas.
Plötzlich wich der joviale Ton aus seiner Stimme. »Von wem könnte er die sonst haben?«, fragte er angespannt.
Nach einer weiteren Minute ließ er das Handy sinken. »Hexe«, murmelte er.
»Was sagen Sie?«, fragte Leon fassungslos. Hatte er gerade richtig gehört?
Als Stadelmann sprach, war seine Stimme kalt. »Stierli behauptet, sie kennt keine Studie, von der Sie abgeschrieben haben könnten.«
Als Leon das Biozentrum verließ, empfing ihn Feli mit einem so schrillen Tusch, dass er zusammenzuckte. Lachend nahm sie die Trompete von den Lippen und reichte ihm eine Schachtel Cupcakes. »Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss, kleiner Bruder!«
»Du spielst Trompete?«
»Ich übe noch. Wir proben gerade Medea.«
»Mit Trompete?«
Sie zuckte die Schultern. »Unser Regisseur hat irgendwas über Cultural Fusion gelesen, und jetzt glaubt er, man muss das Stück aus seinem kulturellen Korsett befreien, was weiß ich … Wie war’s?«
»Ehrliche Antwort?«
»Hyperehrliche Antwort.«
»Furchtbar.«
»Hä, warum?« Feli verzog das Gesicht. »Ich dachte, Robert hat gesagt, alles ist Bombe …«
»Stadelmann hat mir eine Zwei gegeben.«
»Und das ist schlecht?«
»Bei uns schon. Niemand lässt dich promovieren mit einer Zwei.«
»Das kann doch nicht sein.« Feli riss die Augen auf, Leon zuckte resigniert mit den Schultern. »Zumindest niemand aus der Spitzenforschung.«
»Oh.«
»Du hältst mich für abgehoben …«
»Nein. Ich versteh dich schon. Wenn du fürs Theater lebst, ist dir auch nicht egal, an welchem Haus du spielst.« Sie legte den Arm um ihn. »Wir finden schon eine Stelle für dich. Im Zweifel halt nicht an der Uni … vielleicht ja sogar was mit Tageslicht. Und feiern können wir trotzdem – zumindest, dass du diesen bescheuerten Prof los bist.« Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Heute Abend leider erst, ich muss zurück zur Probe. Bist du eigentlich mit deinem Kettenhemd fertig geworden?«
3. Kapitel
Sechstausend der Geburtsurkunde nach erwachsene Menschen verkleideten sich als Druide oder Schwertmeisterin und schlugen sich ein Wochenende lang die Köpfe ein.
Leon konnte sich nichts Schöneres vorstellen. Seit Jahren wählte er als Figur immer einen einfachen untoten Krieger, dessen einzige Bestimmung darin lag, sich in seinem Kettenhemd schreiend ins Kampfgetümmel zu stürzen.
Ganz anders Feli. Seine Schwester war erst zum zweiten Mal dabei und hatte es bereits zur Knochenkönigin gebracht, einer der wichtigsten Rollen des Spiels. Sosehr er sie bewunderte, manchmal beneidete er sie für ihre Kraft, ihre Lebensfreude, ihre Selbstsicherheit; sie besaß die Gabe, mit einem einzigen Wort, einer kleinen Handbewegung, einem Blick Menschen in ihren Bann zu ziehen. Immer war sie der Stolz der Eltern gewesen, der Sonnenschein, der strahlende Mittelpunkt jedes Familientreffens, der bezaubernde Engel – und daneben er, der kleine Bruder, der verschrobene Eigenbrötler, der Superman-Figuren in den Ofen legte, um den Schmelzpunkt von Plastik herauszufinden.
Die Rückfahrt zurück ins echte Leben war trostlos wie immer. Als Knochenkrieger hatte Leon sich keine Gedanken über seine berufliche Zukunft machen müssen; tagsüber Paladine jagen, bis Adrenalin und Schlachtlärm in den Ohren rauschten. Nachts am Lagerfeuer sitzen und Met trinken. Das Leben als Untoter war von allen Sorgen frei.
Auf der A2 kamen die Grübeleien. Eine Zwei. Verfluchter Stadelmann. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, bei irgendeinem Pharma- oder Agrarchemiekonzern anzufangen. Die Vorgehensweise der Privatwirtschaft ließ sich aus wissenschaftlicher Perspektive bestenfalls als schlampig bezeichnen. Vielleicht sollte er einfach ein Start-up gründen.
Leon fuhr; Feli hing so schlaff im Beifahrersitz, dass man glauben konnte, sie habe ihr Amt als untote Königin noch nicht aufgegeben. In pinken Leggins und mit überdimensionaler Sonnenbrille auf der vom Sonnenbrand gezeichneten Nase schien sie eher für die Rolle eines britischen Teenagers gecastet als für die einer mächtigen Zauberin.
Kein Wunder. In der letzten Nacht hatte die Knochenkönigin ihre Loyalitäten aus den Augen verloren und war mit dem Hüter des Weltenbaums, Joshua, durchgebrannt.
»Und«, fragte Leon, nachdem sie zwanzig Kilometer in Schweigen verbracht hatten, »hast du ihn gevögelt?«
»Na gut, ich bekenne mich schuldig.« Theatralisch legte sie sich den Handrücken auf den Scheitel. »Ich bin ein böses Mädchen. Bitte sag Mama nichts.«
Leon setzte den Blinker, überholte einen Viehtransporter. »Da käme ich ja zu nichts anderem mehr.«
»Sehr witzig. Hörst du das?« Von dem Sattelzug neben ihnen drang vielstimmiges Quieken. »Arme Dinger. Bei den Temperaturen ohne Klimaanlage.«
»Ich bin nicht diejenige, die den ganzen Tag Junkfood in sich reinstopft.«
»Dafür feierst du Gentechnik wie die Rettung der Welt.«
»Ich feier gar nichts«, rief Leon. »Frag gern Stadelmann.« Verärgert wechselte er zurück auf die rechte Spur. »Aber ernähr mal acht Milliarden Menschen mit Urkorngetreide.«
»Vielleicht würde es ja reichen, wenn wir ein bisschen nachhaltiger wirtschaften würden.«
»Seit der Sesshaftwerdung versuchen wir das«, entgegnete Leon genervt. Er hatte das Thema mit Feli schon hundertmal durchgekaut. »Nachhaltigkeit ist nur ein Modewort für Effizienz. Wir kreuzen Nutztiere mit denjenigen Eigenschaften, die wir in ihrem Nachwuchs wiederfinden wollen. Wir verwenden als Saatgut den Samen derjenigen Pflanzen, die uns am kräftigsten erscheinen. Ganz im Sinne Darwins. Gentechnik ist nicht anders als traditionelle Zucht, nur präziser.«
»Böden, die toter sind als ich gerade, und Lebensmittel mit dem Nährstoffgehalt eines Backsteins, danke.«
»Das hat doch nichts mit Gentechnik zu tun. Klar kann ich Pflanzen genetisch so modifizieren, dass sie den Stress einer Überbewirtschaftung besser aushalten als ihre konventionellen Alternativen. Aber die rücksichtslose Verwendung eines genialen Werkzeugs macht das Werkzeug an sich nicht weniger genial. Und wir stehen ganz am Anfang. Weißt du, wie viele Leute auf Spenderorgane warten? Und wenn sie dann eins bekommen, müssen sie ihr Leben lang Immunsuppressiva nehmen, damit es nicht abgestoßen wird. Jeder Schnupfen kann dich umbringen. Ein Ersatzorgan aus den eigenen Stammzellen hingegen wird bald keine große Sache mehr sein. Der Körper wird es als sein eigenes erkennen. Kannst du dir vorstellen, was das für die Behandelten bedeutet? Und darüber hinaus – die Ersparnisse fürs Gesundheitssystem, das Ende des Organhandels …«
Feli schwieg.
»Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es wird keine Krankheiten mehr geben, wir werden das Altern radikal verlangsamen …«
»Und dann werden wir alle tausend oder was?«
»Wenn du was Konkreteres willst, denk an die pränatale Medizin. Kein Kind wird mehr mit Erbkrankheiten auf die Welt kommen. Oder mit sonstigen gesundheitsgefährdenden Veranlagungen. Somatisch, psychisch, ganz egal …«
»Psychisch?« Feli schnaubte. »Echt jetzt? Schöne neue Welt. Die totalitären Regime finden es sicher super, brave Lemminge zu züchten.«
»Technik lässt sich immer missbrauchen. Aber wie wäre es, wenn man Neigungen zur Depression vor der Geburt entfernen könnte? Psychopathische Merkmale? Würdest du das für deine Kinder nicht auch in Betracht ziehen?«
»Ich will keine Kinder.«
Leon ignorierte den Einwurf. »Du würdest sie doch auch gegen Kinderlähmung impfen lassen. Damit nimmst du ihnen die freie Entscheidung, ihr Leben lang …«
»Das ist was anderes.«
»Weil du die Psyche entmaterialisierst. Aber die Anfälligkeit für Depressionen ist genetisch bedingt. Psychopathie entsteht durch Störungen in Großhirnrinde und Amygdala. Der Schmerz, der bei einer Blinddarmentzündung entsteht, aktiviert dieselben Hirnregionen wie Liebeskummer. Und egal, wie mulmig dir dabei ist, die Entwicklung wird kommen – die Frage ist bloß, ob wir einen Anteil an der Richtung nehmen wollen, die sie einschlägt.«
Feli ließ ihr Fenster einen Spalt herunter, zündete sich eine Zigarette an.
»Ich finde«, bemerkte Leon, »du solltest weniger rauchen.«
»Ach, findest du?«, ätzte Feli. »Wo ist mein Handy? Ich google gleich, wo das nächste Kloster ist. Dann kannst du mich da abgeben.«
»Kannst du ein einziges Mal ernst bleiben? Lernt man am Theater nicht, mit Kritik umzugehen?«
»Okay, Leon«, Feli schob sich aus ihrem Sitz hoch. »Ich habe ein anderes Leben als du. Aber ich verrate dir mal was – ich habe mich freiwillig dafür entschieden. Wann hast du das letzte Mal jemand im Bett gehabt, hm? Merkst du was? Im Gegensatz zu dir vögel ich überhaupt ab und zu. Und weißt du was, ich habe einen Job, auf den ich Bock hab. Wie sieht’s da bei dir aus, hast du Bock auf deinen Job? Ach, du hast ja gar keinen, stimmt, mein hochbegabter kleiner Bruder hat nur eine Zwei auf seine Masterarbeit bekommen. Upsi. Das tut mir aber leid, hatte ich gerade vergessen.«
Die nächsten zwanzig Kilometer schwiegen sie wieder.
Leon klammerte sich am Lenkrad fest, während Feli sich mit ihrem Handy beschäftigte. Braungrüne Felder flogen vorbei, Windräder, Weideflächen mit Kühen, ab und zu eine Schafherde.
»Kein Stau bei Hannover«, murmelte sie.
»Cool«, brummte Leon.
Feli stöpselte ihr Handy ans USB-Kabel der Soundanlage. »Ich mach mal Musik an, ja?«
»Okay.«
Sie hörten schweigend Felis Strandurlaub-Playlist. In der Stille danach wirkte das Rattern des Fahrtwinds noch bedrohlicher.
»In zwanzig Minuten sind wir da«, murmelte Leon.
»Entschuldigung«, sagte Feli.
Leon räusperte sich.
»Ich war gemein«, fügte sie hinzu.
»Ich auch.« Er bremste für die Ausfahrt.
»Wegen Joshua …«, begann Feli.
»Lass uns nicht mehr drüber reden, okay?« Er holte Luft. »Ich sollte dir nicht reinquatschen.«
»Das meine ich nicht«, entgegnete Feli. Ein Lächeln stahl sich in ihr Gesicht. »Wir haben gar nicht gevögelt.«
»Hä?«
»Aber Nummern getauscht …«
»Du willst ihn noch mal treffen oder was?«
»Er wohnt in Hannover.« Jetzt grinste sie über beide Ohren. Die alte Feli war zurück. »Vielleicht bin ich ja doch erwachsener, als du denkst.«
Leons Handy klingelte. »Kannst du rangehen?«
Feli nahm ab. »Pressestelle Leon Gärtner Heavy Industries, Natascha Romanoff am Apparat, was kann ich für Sie tun?«
Kaum hatte die Person am anderen Ende etwas gesagt, gab Feli ihren spielerischen Tonfall auf. »Er fährt. Ich bin die Schwester.«
Leon bemerkte, wie sie sich aufrechter hinsetzte. Während er versuchte, den Verkehr im Auge zu behalten, schielte er immer wieder nach rechts zu ihr hinüber. Ihre Züge wirkten angespannt.
»In Ordnung«, sagte Feli mit bleierner Miene. »Er ruft Sie zurück.«
»Was ist passiert?«, platzte es aus Leon heraus, kaum dass sie das Gespräch beendet hatte. »Wer war das?«
»Du hast einen krassen Fehler gemacht«, druckste Feli herum.
»Was denn?«
»Um ehrlich zu sein, einen ziemlich krassen Fehler.«
»Mensch, jetzt sag’s halt!« Unter seinen schweißigen Händen wurde das Lenkrad klebrig.
»Du hast doch gemeint, mit einer Zwei kannst du nicht promovieren«, erklärte Feli, die Stimme flatternd.
»Ja, und?«
»Offenbar doch.«
»Was?«
Mit dem nächsten Wimpernschlag war die Düsternis aus ihrem Gesicht verschwunden, verwandelte sich in pure Fröhlichkeit.
»Du hast ein Angebot für eine Promotionsstelle.«
Leon starrte sie ungläubig an. »Echt jetzt?«
»Augen auf die Straße, Junge. Exzellenzuni.«
Von der Seite her warf Leon seiner Schwester einen Blick zu. Langsam kam das Verständnis. »Verdammte Schauspielerin!«
Feli brach in Lachen aus. »Dein Gesicht eben hättest du sehen müssen. Als hätte dir jemand Matrix Reloaded zum Geburtstag geschenkt.«
»Ehrlich, du verschaukelst mich nicht?«
»Nope.« Feli hatte vom Lachen inzwischen Tränen in den Augen.
»Und wer?«, fragte er aufgewühlt. »Wo?«
»Zürich. Ein Joint Venture zwischen verschiedenen Unis.«
»Und welcher Lehrstuhl?«
»Keine Ahnung, hätte ich das fragen sollen? Ich denke mal Bio, was denn sonst? Die Frau, die angerufen hat, hieß jedenfalls Nicole Stierli, kennst du die?«
4. Kapitel
ZÜRICH
Aufgekratzt sprang Leon auf den Bahnsteig.
Zürich. Schokolade, Uhren, asiatische Touristen. Verschlafenes Alpenstädtchen – und internationales Finanzzentrum. Unter den vierhunderttausend Einwohnerinnen und Einwohnern gab es über zwanzigtausend Millionäre. Eine Arbeitslosenquote von zweieinhalb Prozent, Döner für umgerechnet zwölf Euro, Mietwohnungen im mittleren vierstelligen Bereich. Es hieß, manche Züricher würden für ihren Junggesellenabschied nach München fahren, weil es sich dort so günstig feiern ließe.
Die Fahrt mit der Tram dauerte acht Minuten. Nach einer knappen Viertelstunde Fußweg durch einen Park und an einem See vorbei erreichte Leon den Campus der Universität. Mit jedem Meter pochte sein Herz schneller. Das Doktoratsprogramm, zu welchem Stierli ihn eingeladen hatte, war eines der begehrtesten Europas.
Ein Traum, zum Greifen nah. Dass Stadelmann Stierli eine Hexe genannt hatte, spukte zu Leons Ärger noch immer in seinem Kopf herum. Egal – er war bereit, alles zu tun, was die Stelle verlangte. Er würde sogar unterrichten, wenn es sein musste. Noch immer wurden ihm die Beine schwach bei dem Gedanken, dass die große Nicole Stierli ihn tatsächlich als Doktoranden einstellen könnte.
Es ging bergauf, Leon hatte den Wanderrucksack viel zu schwer gepackt für seinen schmächtigen Körper; zumindest die sperrige Rolle mit dem Poster des Fliegenden Spaghettimonsters hätte er zu Hause lassen sollen.
Der Campus versprühte den Charme eines Krankenhauses aus den Siebzigern. Leon störte es nicht. Die klassizistischen Uni-Gebäude in Braunschweig hatte er achselzuckend hingenommen. Für gute Wissenschaft brauchte es Räume der Funktion, nicht der Ästhetik. Beschwingt lief er an den Betonklötzen vorbei. Zum ersten Mal in seinem Leben würde er frei forschen können. Keine unsinnigen Pflichtpraktika mehr, keine überfüllten Seminare, keine limitierten Laborzeiten.
Endlich erreichte er das Gebäude für Evolutionsbiologie.
Ein Pförtner mit einer Warze mitten auf der Stirn sah von seiner Zeitung hoch und brummte ihm etwas entgegen.
»Bitte?«, fragte Leon erschrocken und begriffsstutzig zugleich. Er hatte kein Wort verstanden.
»Can I help you?«
»Ich suche Professorin Stierli«, stotterte Leon. »Evolutionsbiologie.« Wie dumm, wo sonst?
Der Pförtner erkannte den Deutschen und passte seinen Akzent an. »Haben Sie einen Termin?«
Er nickte.
Der Pförtner tippte etwas in seinen Computer und telefonierte. Leon versuchte das Schweizerdeutsch zu verstehen, es war aussichtslos.
»Warten Sie bitte.«
»Hier?«, fragte Leon. Doch der Mann hatte sich bereits wieder seiner Zeitung gewidmet. Das Foyer war nicht groß, einen Wartebereich gab es nicht, geschweige denn eine Sitzgelegenheit. Zwischen Treppenaufgang und Aufzügen hingen Schwarz-Weiß-Porträts von Männern mit kunstvoll gezwirbelten Schnurrbärten. Leon kannte sie nicht, selbst dann nicht, als er die Namensplaketten entdeckte, die in die Bilderrahmen geschraubt waren.
»Leon?«
Er fuhr herum. Die Frau, die ihn angesprochen hatte, war nicht von der Treppe oder dem Aufzug her gekommen, sondern von draußen. Sie hatte ihr blondes Haar zu einem strengen Dutt gebunden, ihre Füße steckten in Pumps, das graue Business-Kostüm saß wie angegossen. Stierli selbst war das nicht. Eine Sekretärin? Das Kostüm hätte eher zu einer Bankerin gepasst. Peinlich wurde Leon sich seiner eigenen Klamotten bewusst: Jeans und T-Shirt.
Die Frau mochte Anfang vierzig sein. Das Gesicht war ebenmäßig, doch der schmale Mund verlieh ihr eine Strenge, die Leon einschüchterte.
»Leon Gärtner«, bestätigte er, verwirrt, dass sie ihn beim Vornamen genannt hatte.
»Komm mit.« Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich zur Tür und verließ das Gebäude. Hastig setzte Leon den Rucksack auf und stolperte ihr hinterher. Trotz der hohen Absätze ging sie so zügig, dass er sich beeilen musste, zu ihr aufzuschließen. Sie kamen an einer Cafeteria vorbei; Studenten sahen von ihren Tablets auf, als sie die Pumps auf dem Betonboden klicken hörten.
»Ich wollte Ihnen nur sagen, was für eine Ehre es für mich ist …«, plapperte Leon los und wurde umgehend unterbrochen.
»Du kannst mich duzen. Ich duz dich ja auch.« Sie sagte es, ohne sich zu ihm umzudrehen. »Im Übrigen erspar mir dein Gesülze. Du kannst es gleich Nicole persönlich sagen.«
»Nicole …?«
»Professor Stierli.« Die Frau lachte kurz auf. »Aber sprich sie nicht mit Titel an, das kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Geradeaus weiter geht es zu den Apartments für Gastwissenschaftler; dort wirst du untergebracht – gesetzt den Fall, Nicole will dich tatsächlich haben. Wir müssen nach rechts.« Sie bogen ab, gingen an der Seite des Gebäudes entlang.
»Und du bist?«
»Kinga. Ich arbeite für Nicole als Laborleiterin.«
»Erfreut.«
»Ja, sicher.«
»Und ihr duzt euch alle? Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich dachte nur, in der Schweiz ist man irgendwie, also …«
»Du meinst, förmlicher?« Kinga schnaubte. »Super. Vorurteile bringst du auch noch mit. Ich bin Polin. Und Nicole ist … nun ja … Nicole.«
Bevor Leon die naheliegende Frage stellen konnte, kam Kinga ihm zuvor. »Du wirst sie gleich kennenlernen.«
5. Kapitel
Sie hatten die Rückseite des Gebäudes erreicht, vor ihnen erhob sich ein schlanker Neubau, der über eine halb fertige gläserne Brücke mit dem Hauptgebäude verbunden war.
»Voilà«, sagte Kinga gleichgültig, »unser neu geschaffenes Reich.«
Der Bau war nicht nur neu, sondern mit so viel Glas versehen, dass er fast transparent wirkte und dabei eine Eleganz und Weltläufigkeit ausstrahlte, die eher eine Unternehmensberatung erwarten ließ als ein Forschungsinstitut. Beklommen trat Leon einen Schritt zurück. Wer hatte das bloß bezahlt? Er musste sich eingestehen, dass Kinga in ihrem Business-Kostüm bedeutend besser hierher passte als er mit seinem Wanderrucksack.
Es gab keine Rezeption; mit ihrer Chipkarte öffnete Kinga das gläserne Portal, das zur Lobby führte. »Wie eine Bank«, entfuhr es Leon. Wo war er hier bloß gelandet? »Und im Penthouse sitzt der Vorstand …«
Kinga schüttelte den Kopf. »Oben ist die Administration, Nicole forscht im Erdgeschoss.«
Sie gingen einen Flur entlang, an den Wänden hingen Rauchverbotsschilder und Hinweise auf Feuerlöscher, links und rechts zweigten Türen ab. Manche waren geöffnet, doch Kingas schneller Schritt erlaubte Leon kaum mehr, als erste Eindrücke zu erhaschen. Was er entdeckte, beruhigte ihn ein wenig: Büros, Labore, eine Mitarbeiterküche. Alles nicht viel anders als in Braunschweig – wenn man davon absah, dass Gebäude und Einrichtung nagelneu waren: höhenverstellbare Schreibtische, digitale Raumbeschilderungen, automatische Jalousiensteuerung.
Die drei, vier Beschäftigten, die er zu sehen bekam, trugen entweder weiße Arbeitskittel oder Alltagskleidung; ein Umstand, der ihn noch weiter beruhigte. Vielleicht hatte er sich von Kingas Kostüm und der Wall-Street-Architektur doch unnötig verunsichern lassen.
Vor einer Sicherheitstür mit Hinweis auf biologische Gefährdung blieben sie stehen. Kinga warf einen Blick durch das Bullauge, das in die Tür eingelassen war.
»Bereit für die Chefin?« Ohne seine Antwort abzuwarten, hielt sie ihre Schlüsselkarte an ein Sensorpad, ein Surren verriet die Entriegelung.
»Mein Rucksack?«
»Du kannst ihn erst mal hier im Flur stehen lassen.« Sie zog die Tür auf, trat zur Seite und bedeutete Leon vorzugehen.
Er zögerte. »Meine Sachen …«
Kinga bedachte ihn mit einem mitleidigen Blick. »Hier klaut dir keiner was.«
Verlegen stellte er seinen Rucksack ab.
Es handelte sich um ein Labor der Stufe zwei, besondere Vorkehrungen waren nicht erforderlich. Leon betrat einen großen, gefliesten Raum, an dessen Wänden sich ringsum die immer gleichen Werkbänke aneinanderreihten; in der Mitte befanden sich die Desinfektionsstationen. Jede Station wiederum besaß mehrere Waschbecken, außerdem eine Augendusche. Der vertraute Geruch von Ethanol und Sauerkraut. Leon musste nicht nachdenken, um zu wissen, dass er sich in einem Praktikumslabor befand. Er hatte sein halbes Studium in solchen Räumen Bakterienkolonien gezüchtet und Enzymlösungen pipettiert, Schulter an Schulter mit zwei Dutzend Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Aktuell fand kein Unterricht statt. Erst dachte Leon, das Labor sei vollkommen leer, dann nahm er im mittleren Bereich eine Bewegung wahr. Hinter einer der Desinfektionsinseln huschte etwas hervor; ein Tier, winzig, schnell, flitzte über die freie Fläche und verschwand hinter der nächsten Insel.
Mit offenem Mund drehte er sich nach Kinga um. »Eine Maus?«, stotterte er. »Sollte die hier … ich meine, unbeaufsichtigt … Wie ist die denn …?«
»Eine Ratte.« Die Antwort kam nicht von Kinga, sondern von der anderen Seite. »Rattus norvegicus forma domestica«, dozierte eine weibliche Stimme aus dem Verborgenen. »Eine Laborratte, um genau zu sein. Und wer sagt denn, dass sie unbeaufsichtigt ist?« Nun trat die Sprecherin zwischen den Desinfektionsinseln hervor: eine kleine, pummelige Frau mit wildem rotem Haar, das – halb hochgesteckt, halb offen – in alle Richtungen floh wie das Klischee des verrückten Genies. Entweder die Frau hatte Glubschaugen, oder die Brille, die auf ihrer knolligen Nase saß, hatte enorm dicke Gläser. Leon hatte gedacht, die Optik wäre inzwischen weit genug, auch bei ausgeprägter Sehschwäche schmale Linsen zu schleifen. Unwillkürlich musste er an das Fliegende Spaghettimonster denken. Doch ihr eigenwilliges Äußeres schien der Frau nicht aufs Gemüt zu drücken – die Grübchen in ihren Wangen kamen zweifelsohne vom vielen Lachen, und ihr ansonsten faltenfreies, rundes Gesicht machte die Vorstellung schwer, dass sie sich jemals sorgen könnte. Sie mochte um die fünfzig sein, Leon fand sie sofort sympathisch. Als sie näher kam, stutzte er. Denn zu ihrem langen Labormantel trug sie keine normalen Schuhe, sondern – Flipflops.
»Nicole«, rief Kinga, die mit aufgerissenen Augen beobachtete, wie die Ratte an einem der Metallschränke schnüffelte. »Ist dir jetzt alles egal? Schaff das Tier hier raus. Wenn das irgendjemand mitbekommt – die machen uns das Institut zu!«
»Sei mal nicht so melodramatisch«, kam es nachlässig zurück. »Du bist Leon?« Die Frau streckte ihm die Hand entgegen. »Nicole Stierli. Schön, dass du’s geschafft hast.«
»Frau Stierli«, murmelte Leon, er spürte seine Wangen glühen. »Es ist mir eine Ehre, wirklich. Eine sehr große Ehre.« Ein hilfloses Stammeln, er war vollkommen überfordert. Er spürte geradezu, wie Kinga neben ihm die Augen verdrehte, doch gegen seine Eindrücke kam er nicht an: Vor ihm stand eine der einflussreichsten Virologinnen ihrer Zeit – die gerade von ihrer Mitarbeiterin angefahren worden war wie eine ungezogene Pubertierende. Und zwar aus nachvollziehbarem Grund: Die Vordenkerin der Genomchirurgie, Trägerin der Copley-Medaille, seit Jahren heiß gehandelte Kandidatin für den Nobelpreis, ließ eine Ratte durchs Labor rennen! Leon schauderte. Schon die Flipflops verstießen gegen jede Hygieneregel.
»Ehre, Ehre, Stachelbeere. Nenn mich Nicole. Willst du was essen? Wir haben eine kleine Cafeteria im Haus. Du hast doch sicher einen Riesenhunger.« Sie ging in die Hocke. »Anton, komm schon, wir machen Feierabend.« Die Ratte schien tatsächlich auf sie zu hören, trippelte herbei, kletterte flink in ihre dargebotene Hand und dann den Arm hoch, bevor sie es sich auf der Schulter bequem machte.
»Nicole, du kannst nicht …«, rief Kinga zornig, doch die Professorin schnitt ihr das Wort ab.
»Entspann dich, ich übernehme die Verantwortung.«
Es war wohl kein reguläres Vorstellungsgespräch geplant. Während Kinga grimmig hinterhertrottete, erklärte Stierli auf dem Weg zur Cafeteria, wie die Forschungsgruppe zusammengesetzt war: Sie selbst als die Leiterin war zuständig für die Ausrichtung sowie die Repräsentation nach außen; die Genetikerin Kinga überwachte die praktische Laborarbeit. Ein Molekularbiologe namens Carl übernahm nicht nur die Auswertung und den größten Teil der Lehre, sondern war außerdem für die IT verantwortlich. Leon war der einzige Doktorand.
»Das sind alle?«, fragte er überrascht.
»Wir stellen uns gerade erst auf«, erwiderte Stierli.
»Nicole hat einen ziemlich exklusiven Anspruch, wer mit ihr zusammenarbeiten darf«, warf Kinga ein.
Stierli ignorierte sie. »Master-Studis haben wir auch noch ein paar. Carl wird dir sicher einen abgeben wollen«, verkündete sie fröhlich. »Leider liegt er mit Borreliose krank im Bett, sonst hätte ich ihn dir schon vorgestellt. Ja, im Grunde ist das mein Team; klein, aber fein. Außerdem arbeiten wir natürlich eng mit den anderen Lehrstühlen zusammen. Die IT-Infrastruktur für die Modellierungen bekommen wir von der ETH. Fragen?«
Leon starrte die Ratte an, die mit Stierlis Haaren spielte.
»Anton.« Stierli nahm die Ratte in die Hand und streichelte sie liebevoll. Leon bemerkte, wie Kinga das Gesicht verzog. »Ich versuche ihm noch ein paar schöne Tage zu bereiten, bevor Kinga ihn bekommt.«
Die Ratte schnupperte an Stierlis Fingern. Es war unmöglich, den Blick abzuwenden. »Was testen Sie an ihm?«
»Was weißt du denn über unsere Forschungsgruppe?«
»Sie simulieren ein Influenza-Virus, das Sie genetisch so zu modifizieren suchen, dass die Letalität sinkt, während gleichzeitig die Infektiosität steigt.«
Ein faszinierendes Projekt. Attenuation, also die Reduktion der Gefährlichkeit eines Erregers, wurde schon länger praktiziert. Der Clou war das Erhöhen der Ansteckungsrate. Leon hatte es die Sprache verschlagen, als er zum ersten Mal davon gehört hatte. Nach den Erfahrungen mit der konfliktreichen Impfstoffdistribution für Covid-19 hatte Stierli in einer Fachzeitschrift ein Gedankenspiel veröffentlicht: Statt einen Impfstoff zu entwickeln, könne man das entsprechende Virus direkt genetisch so manipulieren, dass es nicht mehr bedrohlich sei, sich aber schneller ausbreite als zuvor. Im idealen Fall ließe sich so mit der manipulierten Version eine Herdenimmunität erzeugen, bevor das gefährliche Original seinen Tribut fordern würde. Der Aufsatz schlug Wellen – in der Szene zumindest –, es fanden sich zahlreiche Investoren, und aus dem Gedankenspiel wurde ein Forschungsprojekt.
Es gab nicht nur Zustimmung: Auch genmanipulierte Viren konnten mutieren und gefährlich werden – im schlimmsten Fall könnte eine Variante entstehen, die nicht nur ansteckender wäre, sondern auch gefährlicher. Allen Risiken zum Trotz – wenn Stierli Erfolg haben sollte, wäre der Nobelpreis ihr sicher. Leon konnte es kaum erwarten, an dem Projekt teilzunehmen.
»Wir machen auch mit anderen Viren als Influenza Versuche«, erklärte Stierli. »Bei den weniger gefährlichen belassen wir es nicht bei Simulationen. Anton zum Beispiel haben wir mit einer modifizierten Hantavirus-Variante infizieren wollen. Hat nicht geklappt. Kinga vergast ihn am Donnerstag.«
»Sie lassen eine Ratte frei im Labor herumlaufen, die Sie zuvor mit einem Virus infiziert haben?« Leon wollte es nicht glauben: Das war das Gegenteil von allem, was er zu Hygienevorschriften gelernt hatte.
»Ach was«, winkte Stierli ab. »Ist ein Praxislabor, da bringen die Studis so viele Keime rein, dass man die fingerdick von den Scheiben kratzen kann. Was willst du essen?« Sie hatten die Cafeteria erreicht, Stierli steuerte auf die Auslage zu. »Es gibt Sandwiches, Sandwiches und … Sandwiches.« Sie hob entschuldigend die Hände. »Ich würde behaupten, es ist die Uhrzeit. Aber ich fürchte, wenn du richtiges Essen willst, musst du in die Hauptmensa. Und die hat tatsächlich schon zu.«
»Nee, passt, ein Sandwich ist gut.« Leon wollte seinen Geldbeutel zücken, Stierli winkte ab. »Ich mach schon.«
Während Stierli bestellte, setzte sie Anton wieder auf ihre Schulter. Bis auf das gelegentliche Zucken seines langen, nackten Schwanzes regte er sich kaum. Die Verkäuferin musste den Anblick bereits gewohnt sein; statt zu protestieren, schüttelte sie nur resigniert den Kopf.
Sie setzten sich an den nächsten Tisch, Stierli hatte drei in Plastik gewickelte Sandwiches gekauft. Wenn man eine undefinierbare Pampe zwischen labbrigen Weißbrotscheiben als Sandwich bezeichnen wollte. Das angebräunte Alibi-Salatblatt machte den Anblick nur noch trauriger. Doch Stierli schien nicht im Mindesten verunsichert: Nachdem sie die kümmerlichen Päckchen verteilt hatte, wickelte sie ihres sogleich aus der Folie und biss herzhaft hinein. Leon beobachtete entgeistert, wie Anton zwischen den Tellern herumtappte und dann anfing, die Krümel auf Stierlis Teller zu verspeisen.
»Los, esst«, befahl Stierli. Kinga regte sich nicht, und auch Leon tat sich schwer, der Aufforderung zu folgen.
»Lasst euch doch von dem armen Anton nicht verunsichern«, sagte Stierli kauend. »Gestern ist Pünktchen gestorben. Jetzt ist er ganz allein, habt ein bisschen Mitgefühl.«
Leon legte sein Essen zurück auf den Teller.
»Du denkst, ich bin völlig durchgeknallt.« Stierli sah ihn über ihr Sandwich hinweg an. »Dabei versuche ich nur, dem armen Anton gegenüber nett zu sein.«
»Und hier kommt die Predigt.« Kinga verzog wie unter Schmerzen die Lippen. »Ins Labor …«
»Scht«, machte Stierli in ihre Richtung, bevor sie sich wieder Leon zuwandte. »Die Biologie ist die Wissenschaft vom Leben. Aber manchmal verrennen wir uns so darin, das Leben verstehen zu wollen, dass wir vergessen, nach dem Wofür zu fragen. Wofür leben wir? Was macht das Leben wertvoll?« Sie nahm einen weiteren Bissen. In ihrem Mundwinkel klebte etwas, das Mayonnaise sein mochte. »Wer hinter die Bedeutung des Lebens kommen will, muss sich mit dem Sterben auseinandersetzen.« Sie ließ die Ratte Soße von ihrem Finger lecken. »Wir töten Anton übermorgen. Und wofür?«
Kinga stand auf und holte sich aus dem Getränkekühlschrank eine Wasserflasche.
»Für Erkenntnisse«, murmelte Leon, »die unsere eigenen Leben bereichern sollen?« Eine nervöse Ungeduld ergriff ihn – als befände er sich auf einer Einführungsveranstaltung für Bioethik.
»Ja«, bestätigte Stierli. »Weil wir glauben, sein Leben ist weniger wertvoll als unseres.«
»Tun wir das?«, wagte Leon zu zweifeln. »Oder reden wir es uns ein, weil wir diese Überzeugung brauchen, um unsere Arbeit machen zu können?«
Während Kinga sich wieder zu ihnen setzte, stöhnte sie leise. Stierli hingegen nickte. »Genau das ist die Frage.« Sie wedelte mit ihrem Sandwichrest vor Leons Gesicht herum. »Und deswegen kümmere ich mich um Anton. Damit ich nicht vergesse, ab und zu über das Wofür meiner Arbeit nachzudenken.«
»Was aber nichts an deiner Entscheidung ändert«, spottete Kinga. »Du bewertest menschliches Leben höher. Sonst hättest du dir wohl einen anderen Job gesucht …«
»Das Leben bleibt ein Geheimnis, meine Liebe. Da kann es nicht schaden, ab und an die eigenen Ansichten dazu zu hinterfragen, findest du nicht?«
»Und morgen heuerst du bei PETA an«, entgegnete Kinga trocken. Leon war immer noch baff über die flapsige Art, in der sie mit ihrer Vorgesetzten sprach, aber Stierli schien das nicht weiter zu stören.
»Ach was«, winkte sie ab. »Wir forschen ja nicht an Kosmetika. Diese ganzen aufgeregten Weltverbesserer würden doch auch nicht auf moderne Medikamente verzichten, wenn sie erst mal ein Melanom diagnostiziert bekommen haben.«
»Bob Marley«, rutschte es Leon heraus; er biss sich auf die Lippe. Ein unqualifizierter Beitrag.
»Bitte?«
»Bob Marley«, wiederholte er notgedrungen. »Der ist gestorben, weil er sich nicht behandeln lassen wollte.«
Kinga verschluckte sich an ihrem Wasser. Stierli hörte auf zu kauen. Nahm eine Serviette und wischte sich die Mayonnaise vom Mund.
»Entschuldigung.« Leon wurde rot.
»Junger Mann«, sagte Stierli ernst, »ich freue mich, dich in meinem Team zu haben.« Sie reichte ihm feierlich die Hand. Als Leon selbige ergriff, merkte er, wie feucht seine eigene war. War es das schon gewesen? War er dabei? Hatte er die Stelle?
Plötzlich lachte Stierli los. »Und nicht nur, weil du Sigfried so schön blamiert hast.«
»Professor Stadelmann? Das wollte ich gar nicht.«
»Sein Gesicht hätte ich trotzdem gern gesehen.«
»Deswegen haben Sie mich eingeladen?«
»Wegen Sigfrieds Anruf habe ich mir deine Formel angeschaut. Und ich muss sagen – vielleicht etwas unkonventionell, aber erhellend. Besonders die Analyse, wie die Hefemodifizierung auch bei anderen Pilzen funktionieren kann.«
»Ich weiß ja gar nicht, ob sich das experimentell bestätigen lässt«, gab Leon zu bedenken.
»Nie und nimmer«, erklärte Stierli fröhlich. »Aber ich mag deine Herangehensweise. Hast du Flugangst?«
»Bitte?«, fragte Leon, überrumpelt vom Themenwechsel.
»Freitag geht’s auf die Gene-Con nach Nairobi. Weil Carl ausfällt, haben wir einen Platz frei. Hast du Lust?«
6. Kapitel
NAIROBI
»Ich weiß nicht, ob ich das alles gerade nur träume, Feli.«
Leon stand in Boxershorts auf dem Balkon seines Zimmers im sechzehnten Stock des King’s Palace, das am Rande des Karura Forest gelegen war, direkt neben dem Gelände der Vereinten Nationen. Jenseits des Waldes spiegelte sich die Abendsonne rot wie Grapefruit-Fleisch in den Pools der Reichen von Muthaiga; und noch weiter in der Ferne glitzerten die Wellblechdächer von Korogocho, einem der größten Slums Nairobis.
»Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, Bruderherz«, rief Feli durchs Telefon. »Typisch Leon – kaum erreichst du was, hinterfragst du, ob du’s verdient hast. Andere würden im Viereck springen, wenn sie mit dir tauschen dürften.«
»Weiß ich ja«, gab Leon zu. Natürlich hatte Feli direkt die offene Wunde gefunden. »Aber es geht alles so schnell …«
»Freu dich doch. Ich habe heute vier Stunden lang geprobt, eine Plastikpuppe möglichst brutal umzubringen.«
»Wann hast du denn Premiere?«
»In exakt vier Wochen. Kommst du?«
»Ich muss mal schauen, wie sich die Arbeit entwickelt, aber ich hoffe schon.«
»Cool. Du, wir quatschen wann anders weiter, ich muss zum Lasertag.« Sprach es und hatte ihn weggedrückt.
Leon seufzte und legte sein Handy weg. Ihm blieben noch zwanzig Minuten bis zum Eröffnungsvortrag. Ein Glück, dass er den Anzug aus Braunschweig mitgenommen hatte. Rasch zog er sich an. Feli hatte ja recht. Er sollte dankbar sein für die Wendungen, die sein Leben genommen hatte. Nachdenklich band er sich die Krawatte. Und damit, dass er bei jedem Lob reflexhaft fürchtete, als Hochstapler enttarnt zu werden, hatte sie ebenfalls recht. Als er im Badezimmerspiegel den Krawattenknoten überprüfte, entschied er sich für einen neuen Anlauf. Es wurden vier.
Gleichzeitig mit Kinga traf er in der Lobby ein; Stierli wartete bereits, nicht zu übersehen in einem pinken Kleid voller Sonnenblumen. Sie mussten nur über die United Nations Avenue und an einem Parkplatz vorbei, schon waren sie am Empfangsgebäude. Selbst wenn der Weg nicht von Nationalflaggen gesäumt gewesen wäre, hätten sie sich kaum verlaufen können, denn ein Dutzend anderer Personen strömte in dieselbe Richtung. Es stand außer Zweifel, dass sie dasselbe Ziel hatten; allesamt waren sie sorgfältig gekleidet, hatten den festen Schritt der Erfolgsverwöhnten. Die Limousinen, die auf den Parkplatz fuhren, spuckten weitere High Performer aus.
Die anbrechende Nacht brachte eine leichte Brise, die durch die Olivenbäume strich, es war angenehm kühl. »Irgendwie habe ich mir Afrika heißer vorgestellt«, bemerkte Leon, halb zu sich selbst.
»Wir sind sechzehnhundert Meter über dem Meeresspiegel«, erklärte Stierli.
»Wir sind spät dran«, sagte Kinga.
Für die Konferenz hatten die UN ihren Plenarsaal zur Verfügung gestellt. Leon vermutete, dass mindestens achthundert Leute hier Platz fanden. Blauer Teppichboden, Palmen in den Ecken, die Arbeitsflächen vor den Stuhlreihen großzügig bemessen – die Hörsäle in Braunschweig hätten geweint vor Neid.
Der Raum war vielleicht zur Hälfte gefüllt. Die verglaste Galerie mit den Dolmetscherkabinen blieb leer, Konferenzsprache war Englisch. Die Ordner wiesen ihnen einen Platz zu, Leon kam in der Mitte zu sitzen. Während sie warteten, blätterte er das Programm durch, das bei der Akkreditierung ausgeteilt worden war.
»Wer redet denn heute Abend? Hier steht nichts.«
»Ist eine Überraschung«, sagte Stierli von rechts.
»Wer hätte es gedacht«, fügte Kinga von links hinzu, »die Eventisierung hat es in die Wissenschaft geschafft.«
Das Saallicht wurde gedimmt; nur ein Spot blieb an, der die Bühne beleuchtete, setzte das Rednerpult in den Fokus. Das letzte Gemurmel verstummte.
Der Mann, der die Konferenz eröffnete, hatte einen dunkelbraunen Teint, war von schmächtiger Statur und sah ansonsten ganz und gar durchschnittlich aus.
»Jérôme Bounou«, flüsterte Stierli, »der macht nur die Eröffnung. Leiter des Umweltprogramms der UN. Wirkt harmlos, ist aber mit allen Wassern gewaschen. War früher marokkanischer Außenminister, hat dann eine Politikberatungsfirma gegründet und erst vor ein paar Jahren bei den UN angeheuert. Verfügt über eine Menge Kontakte, kaum Skrupel, keine erkennbare Agenda. Ach ja, sieht Gentechnik als Lösung für alle Probleme: Klimawandel, Hunger, Wüstenbildung.«
Warum auch nicht?, dachte Leon. Allein mit Gottvertrauen ließ sich der Planet bestimmt nicht retten.
Genauso durchschnittlich wie seine Erscheinung waren auch Bounous monoton abgelesene Worte: Freude über hochkarätige Gäste trallala große Herausforderungen trallala die Macht der Zusammenarbeit trallala. »Ich komme schon zum Ende meiner Begrüßung und freue mich, als Eröffnungsredner einen Mann ankündigen zu dürfen, dessen Visionen bereits viel bewegt haben – und ich wage zu behaupten: noch viel bewegen werden.«
Er blickte einmal von seinem Skript auf, wollte wohl bedeutsam in die Runde schauen, schien aber von so viel Kühnheit selbst überrascht und senkte den Blick schnell wieder. »Meine sehr verehrten Damen und Herren, heißen Sie mit mir unseren Eröffnungsredner der achten globalen Konferenz für Gentechnik und Genomik willkommen: Dr. Cameron Slate.«
»Bockmist«, entfuhr es Stierli.
»Was?«, flüsterte Leon.
»Das ist die Kapitulation.«
»Was ist mit ihm?«
»Slate ist kein Wissenschaftler, keine Ahnung, woher der Doktortitel kommen soll. Stattdessen ist er einer der berüchtigtsten Unternehmer Australiens – und einer der reichsten. Hat ein Heidengeld mit Kohle gemacht. Und dabei so oft Umweltbestimmungen und Arbeitsrecht verletzt, dass für die Prozessakten ein ganzer Wald gestorben sein muss. Die letzten Jahre inszeniert er sich als gewandeltes Kind, nennt sich Philanthrop und sonst was. Aber sieh selbst.«
»Scht«, machte Kinga.
Auf die Bühne war ein Mann getreten, der Bounou um mehr als einen Kopf überragte. Er trug Vollbart, dazu einen Cowboyhut, bespornte Lederstiefel und einen sandfarbenen Anzug. Leon musste an Stierlis Flipflops denken, als er ihr zum ersten Mal begegnet war. Hatte er einen Trend zu fragwürdiger Schuhmode verpasst?
»Okay, Freunde.« Obwohl das Mikrofon immer noch auf Bounou eingestellt war und somit Slate nur zur Brust reichte, dröhnte seine Stimme mühelos durch den Saal. »Ich weiß, dass ihr ganzen Einsteins nicht darauf wartet, von mir die Welt erklärt zu bekommen.« Im Gegensatz zu Bounou sah er sein Publikum an, hatte keine Notizkarten mitgebracht. »Keine Sorge, ich verstehe das.« Er grinste breit. »Ich schlafe ja auch ein, wenn einer von euch mir seine genialen Gedanken näherbringen will.« Leises Murren regte sich, doch Slate ließ sich davon nicht beirren. Im Gegenteil, sein Grinsen wurde breiter. »Aber das Schöne ist ja, in unserer spezialisierten Welt können wir alle voneinander profitieren. Das müssen wir auch, denn wir stehen vor fetten Herausforderungen, was ich euch ja nicht erklären muss. Zum Glück habt ihr klugen Köpfe genug Ideen, um die Werkzeuge zu entwickeln, mit denen wir die Welt aus der Scheiße ziehen können. Tragischerweise sind die Nationalstaaten zu schlapp, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich Entscheidungen sage, meine ich natürlich Geld.« Er machte eine Pause, genoss es sichtlich, sein Publikum auf die Folter zu spannen. »Und wer hat mehr Geld als jeder andere hier im Raum? Was rede ich, als jeder andere in Kenia?« Er glitt mit der Hand unter seinen Bart und kratzte sich, tat nachdenklich. »Ach, sagen wir doch, wie es ist: mehr als jeder andere in Afrika? Ihr ahnt es schon. Zu euren Diensten, der gute Cameron.« Er deutete eine Verbeugung an. Seine Zuschauer rutschten unruhig auf ihren Stühlen herum.
»Die meisten von euch wissen sicherlich schon, dass ich gern mithelfen will, die Welt vor den Hyänen zu retten. Und weil ich nun mal nicht so viel auf dem Kasten habe wie ihr, aber ein extrem reicher Bursche bin, ist es doch das Beste, ihr denkt euch was Smartes aus, und ich schieße das nötige Kleingeld dazu.« Sein schelmischer Gesichtsausdruck passte nicht so recht zu der Tragweite des Gesagten. »Damit ihr seht, dass ich es ernst meine, habe ich die Slate Foundation gegründet. Das Startkapital beträgt vierzig Millarden US-Dollar.«
Leon glaubte, sich verhört zu haben. Auch um ihn herum kam Bewegung in die Anwesenden. Dem Tuscheln nach, das durch den Raum rieselte, hatte die genannte Summe einige Ohren geöffnet.
Slate hob gelassen den Arm. »Aufmerksamkeit bitte. Ich denke, ich finde noch weitere Spender, sodass mittelfristig achtzig bis hundert Milliarden Dollar im Topf sind. Was macht man mit so viel Geld? Politik natürlich.« Wieder sein Grinsen, breiter als zuvor. Verärgerte Rufe im Saal.
»Beruhigt euch, war nur ein Witz. Neben dem Wunsch, sich gegenseitig umzubringen, sind es doch im Grunde zwei Dinge, die die Menschheit an den Eiern halten: Hunger und Krankheiten. Ich habe mich entschieden, mich dem Hunger zu widmen.« Wieder der selbstsichere Blick in die Runde. »Mein erstes Projekt betrifft den Schwarzrost. Ein Pilz, der – wie die meisten von euch wissen werden – dramatischere Ernteausfälle verursachen kann als die schlimmsten Heuschreckenschwärme. Eigentlich hat man ihn in den Griff gekriegt, aber dank der veränderten klimatischen Bedingungen breitet er sich wieder aus. Ich würde ihn gern ausrotten. Die theoretische Arbeit läuft fantastisch, einen Namen haben wir auch schon: Projekt Uranus. Man muss ja groß denken.« Grinsen. »Jetzt stehen Experimente an. Und damit komme ich auch schon zu der eigentlichen Frage meines Vortrags: Wer hat Interesse an einem Job?«
7. Kapitel
Slates Eröffnungsvortrag war ein Blitz gewesen, der in einen Hühnerstall einschlug.
Auf dem Empfang, der sich an seine Rede anschloss, gab es kein anderes Thema als das ominöse Projekt Uranus. Stierli war in ihrem Element. Sie hatte eine Traube an Leuten angezogen, vor denen sie sich funkensprühend darüber ausließ, dass Forschung nicht von Einzelpersonen abhängig gemacht werden dürfe – erst recht nicht in Zeiten, in denen jene so massiv unter Druck stehe. Leon hielt sich an seiner Sektflöte fest und bemühte sich, kein Wort zu verpassen.
Eine Kellnerin kam mit einem Tablett vorbei.
Ohne sich zu unterbrechen, tauschte Stierli ihr leeres Glas gegen ein volles. »Es ist schlimm, wie wir politisch unterminiert werden. Wissenschaft ist schon fast ein Schimpfwort heutzutage. Die Leute betrachten es als Sport, alles infrage zu stellen, was ihnen nicht in den Kram passt. Und macht die öffentliche Hand dann doch mal Gelder locker, muss die Forschung opportun sein – oder zumindest praxisnah, wirtschaftlich relevant. Grundlagen braucht doch niemand. Wer versteht die Programme überhaupt noch, mit denen er oder sie arbeitet? Läuft ja alles über intuitiv zu bedienende Masken. Ich glaube, ich brauche noch einen Sekt. Intuitiv, wie verrückt. Was ist das Gegenstück zu Intuition? Leon, was meinst du?«
»Was?«, fragte Leon kalt erwischt. Ein Dutzend Augenpaare richtete sich auf ihn. »Kristalline Intelligenz?«, versuchte er es.
Stierli strahlte. Die Aufregung hatte ihre gute Laune nicht vertrieben. »Ich hätte jetzt schlicht Verstand gesagt, aber kristalline Intelligenz gefällt mir noch besser … Wir wollen also unsere Nutzeroberflächen so intuitiv wie möglich haben, und was bedeutet das im Umkehrschluss? Sapere aude war gestern. Irgendwann sind unsere Geräte alle so raffiniert, dass niemand mehr seinen Verstand einsetzen muss, großartig …«
»Arbeitsteilung«, murmelte Leon.
Stierli fuhr zu ihm herum: »Was?«
»Also, na ja …« Er räusperte sich. Er hatte nicht geplant, seiner Chefin in der Öffentlichkeit zu widersprechen. Doch Stierli sah ihn auffordernd an.
»Unsere technologische Revolution basiert darauf, dass viele Fachleute jeweils ihre spezifische Expertise einbringen. Diese Expertise könnten sie gar nicht entwickeln, wenn sie sich auch auf anderen Gebieten auskennen müssten.«
Hinter Stierlis Brille blinkten ihre abstrus vergrößerten Augen. Doch sie hatte offenbar nicht vor, ihn zu maßregeln. »Sicher, natürlich«, rief sie stattdessen, »das Weltbild, das die Wissenschaft hervorbringt, ist ein Mosaik. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir beim Herumwerkeln an unseren Steinchen das Gesamtbild aus den Augen verlieren. Und egal, ob ein Cameron Slate seine Milliarden in den Raum wirft oder staatliche Einrichtungen ihre Gelder verteilen – wir sind abhängig davon, unsere Steinchen so zu bemalen, wie das Geld es will. Und jetzt, meine Lieben, erkennt ihr die Gefahr? Wenn wir das Gesamtbild nicht mehr sehen, wie wollen wir dann bemerken, wenn unsere Steinchen nicht mehr passen?«
Stierli echauffierte sich weiter, ohne dass die Traube kleiner wurde. Dabei sprang sie so schnell von einem Punkt zum nächsten, als wäre sie ein Sternekoch, der drei Gerichte gleichzeitig an den Gast bringen wollte.
Irgendwann lehnte sich Kinga zu Leon: »Das läuft jetzt so, bis der Laden abgesperrt wird. Ich gehe zum Büfett, kommst du mit?«
Eigentlich hätte Leon gern weiter zugehört; aber es war das erste Mal, dass er von Kinga eine freundliche Geste empfing, weswegen er sich nicht traute, sie abzuweisen. Und jetzt, da sie es angesprochen hatte, spürte er das Loch in seinem Magen. Das letzte Mal gegessen hatte er im Flugzeug. »Okay«, nickte er, »essen wir was.«
Nach Slates Vortrag war man vom Plenarsaal in das Gebäude des UN-Umweltprogramms umgezogen, ein Nullenergiehaus mit einer begrünten Halle in der Mitte. Der Empfang fand in einem verglasten Eckraum statt, auch das Büfett war dort aufgebaut worden. Der Platz hätte niemals für alle Konferenzgäste gereicht, doch viele hatten sich bereits in ihre Hotels oder zum Essen in privaterer Runde zurückgezogen.
Trotzdem staunte Leon, als er die lange Reihe an Warmhaltebecken sah. Alles war sorgfältig angerichtet. Alles sah köstlich aus. Satéspieße, gebratener Fisch, Granatapfelsalat, Safranreis mit Koriander und Nelken, gebackener Ziegenkäse – und tausend andere Gerichte, bei denen Leon nicht die blasseste Vermutung hatte, worum es sich handelte. Wo waren überhaupt die Teller? Zum Glück steuerte Kinga zielsicher in Richtung Geschirr, Leon folgte überwältigt.
»Das ist unglaublich«, murmelte er.
Kinga zuckte mit den Schultern. »Einer der Vorteile von Konferenzen, auf denen auch die Privatwirtschaft vertreten ist.« Sie schaufelte sich eine Portion Garnelen auf den Teller.
Leon, überfordert von der Auswahl, zögerte noch. »Und das ist alles umsonst?«
»Du bist süß.« In einer Metallschale lagen halbe Limetten. Kinga nahm eine heraus und träufelte den Saft über die Garnelen. »Die Uni bezahlt das. Sechshundert Dollar pro Person. Für den Empfang. Das Conference Dinner morgen kostet neunhundert.«
Fast wäre Leon der Teller aus der Hand gefallen. »Nicht dein Ernst.«
»Für Externe kostet der Empfang allein schon neunhundert«, schaltete sich neben ihm jemand in das Gespräch ein. Als Leon sich umsah, spürte er, wie ihm das Blut in die Wangen schoss. Die Frau, die vor ihm stand, einen Teller mit Reis und Tomatensalat in der Linken, eine Servierzange mit einer Gemüseroulade in der Rechten, war anmaßend schön.
»Äh«, sagte Leon und starrte sie an.
Die Frau war ein paar Jahre älter als er. Sie war nicht klein, aber zierlich, trug eine dunkelrote Bluse, dazu eine dunkle Stoffhose. Die langen hellbraunen Locken fielen ihr bis auf die Schultern; ihr Gesicht wirkte blass, sie hatte wohl länger keinen Urlaub mehr genommen. Ein Piercing blitzte in der rechten Braue.
»Äh«, wiederholte Leon. Krampfhaft versuchte er, sich daran zu erinnern, worüber sie geredet hatten. »Neunhundert Dollar, nur für den Empfang? Warum?«
»Sonst könnte ja jeder kommen«, erklärte Kinga. »Man will zwar networken – aber bitte nicht mit den falschen Leuten.«
»So ist es«, bestätigte die fremde Schöne. »Die kritischen Stimmen sollen ferngehalten werden. Und während für die Konzerne ein paar tausend Dollar nicht der Rede wert sind, wissen wir manchmal nicht, ob wir am Ende des Monats unsere Mitarbeiterinnen bezahlen können.« Sie legte die Servierzange zurück und schritt zum nächsten Warmhaltebecken. Kleine rote Klöße.
»Von welcher Organisation sind Sie denn?«, fragte Leon ungelenk.
»Save The Media.« Sie wandte sich von ihm ab. »Eric, weißt du, was das ist?«
»Keine Ahnung«, antwortete ein durchtrainierter Enddreißiger in Jeans und Hemd. Keine Strähne wich aus dem perfekten Fall seines halblangen strohblonden Haares.
»Gnocchi mit roter Bete, denke ich«, warf Leon ein. »Was steht denn auf dem Zettel?« Er zeigte auf den umgekippten Tischaufsteller.
Der Typ sah nach. »Stimmt. Gnocchi.« Er hatte nicht nur den Körper eines Filmstars, er sah auch aus wie einer.
Leons Hoffnungen schwanden. Offensichtlich sah die Frau den Austausch mit ihm als beendet an. Aber er konnte sie nicht einfach gehen lassen. Der Typ mochte nur ein Kollege von ihr sein. Leon nahm all seinen Mut zusammen und hakte nach: »Entschuldigung, aber weswegen interessiert sich denn Save The Media für eine Gentechnik-Tagung?« Er hatte von der Organisation schon gehört, allerdings nur im Kontext verfolgter Journalisten.
»Sieht reizvoll aus«, sagte die Frau mit Blick auf die Gnocchi. Und zu Leon: »Wieso sollten wir nicht?« In ihrer Stimme schwebte ein französischer Akzent.
»Na ja, ich weiß nicht«, stotterte Leon, »also … irgendwie dachte ich, Sie kümmern sich eher um Kriegsreporterinnen oder so …« Er schwieg. Lieber den Mund halten, wenn man keine Ahnung hatte.
»Wir kämpfen für Informationsfreiheit. Da ist es ganz gut, ab und zu an den Orten zu sein, wo Informationen entstehen.« Sie sagte es weder unfreundlich noch besonders aufgeschlossen.
»Darf ich mal?« Kinga schob sich an ihm vorbei, streckte sich nach einem Schaumlöffel.
»Und Sie sind von den UN?«, fragte der deprimierend gut aussehende Typ.
»Ich? Nein«, winkte Leon erschrocken ab. »Ich bin von der Uni Zürich.«
»Ich bin Eric. Von TechWatch.«
»Leon.« Sie schüttelten sich die Hände. »Das ist meine Kollegin Kinga.«
»Und das ist Valérie.« Eric nickte in Richtung seiner Gefährtin.
»Hi«, sagte Valérie, während sie Leons Hand ergriff.
»Deine erste Konferenz?«, fragte Eric.
Leon nickte. Im letzten Moment verkniff er sich die Nachfrage, woran Eric es erkannt hatte.
Während Valérie sich ihrem Telefon widmete, zeigte Eric sich interessiert an einem Gespräch. Augenscheinlich war sein gutes Aussehen ihm nicht zu Kopf gestiegen. Auf Leons Fragen ging er bereitwillig ein; TechWatch habe es sich zur Aufgabe gemacht, moderne Technologien kritisch zu hinterfragen und im besten Fall Unternehmen zu zwingen, den Verbraucherschutz nicht dem Profit zu opfern.
»Kann eine Wissenschaft, die frei sein soll, sich zurückhalten?«, bemerkte Leon. »Wäre die Kontrolle nicht eigentlich die Aufgabe des Staates?«
»Eigentlich«, erwiderte Eric, »ja. Aber da hat die Wirtschaftslobby die letzten Jahrzehnte ganze Arbeit geleistet – und inzwischen glauben wirklich erschreckend viele Politiker denselben Mist: Wer nicht das neueste Produkt auf dem Markt hat, der wird über kurz oder lang abgehängt; ein Land ohne Wachstum hat keine Chance im globalen Wettbewerb, immer dieselbe Leier, der Friedman-Unfug eben. Wir sitzen da drüben, kommt doch mit.«
An dem Tisch, auf den Eric gezeigt hatte, saß bereits eine Frau mit orientalischem Teint, einem schwarzen Zopf und einem Weinglas in der Hand. Sie schien etwa in Valéries Alter zu sein.
»Niloufar«, stellte Eric vor, »und das sind Leon und Kinga.«
Während Kinga sich unverzüglich ihrem Essen widmete, versuchte Leon sich in Konversation.
»Du arbeitest auch bei TechWatch?«, fragte er die Dunkelhaarige.
»Nein, ich bin Ärztin. Ich habe Eric heute erst kennengelernt – wir saßen im selben Flugzeug.«
»Aus Belgien?« Dass Eric aus Brüssel stammte, hatte Leon schon erfahren.
»Ich bin Deutsche. Wir sind beide über Frankfurt geflogen.«
»Ich auch«, rief Leon auf Deutsch, erfreut, eine Landesgenossin vor sich zu haben. »Also, ich bin Deutscher«, plapperte er nervös, »geflogen sind wir von Zürich aus.«
Niloufar lächelte unbeeindruckt. Valérie hob den Blick nicht von ihrem Handy. Ihr Essen hatte sie nicht angerührt.
Bevor die Stille unangenehm werden konnte, fragte Eric: »Du promovierst also, Leon? Was ist denn dein Thema?«
»Ich habe noch keins. Hab erst diese Woche angefangen. In meiner Masterarbeit ging’s um Gene Drives, falls dir das was sagt.«
»Irgendwas klingelt«, sinnierte Eric. »Macht man das nicht bei der Anophelesmücke? Man verändert die Mücke gentechnisch so, dass sie nur noch weibliche Nachkommen kriegt, schließlich ausstirbt und den Malaria-Erreger nicht mehr übertragen kann?«
»Ziemlich verkürzte Darstellung«, warf Kinga ein.
»In der Richtung wird auf jeden Fall geforscht«, bemerkte Leon versöhnlich.
»Und deine Arbeitsgruppe in Zürich?«