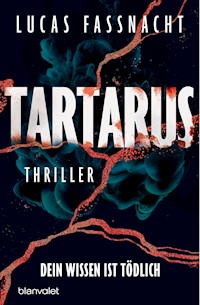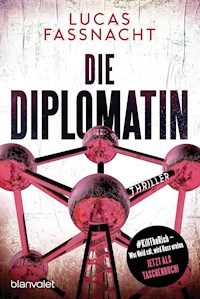12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, in der alles vernetzt ist, wird der Kampf um die Macht ein gefährliches Spiel.
Im Zenit seiner Macht stürzt sich einer der bedeutendsten Konzernchefs des Landes in den Tod. An seine Stelle tritt Fridolin von Wolfenweiler, und dieser hat eine kühne Vision: die Entwicklung einer Software, die den kompletten Zahlungsverkehr Europas abwickeln soll – schnell, transparent, sicher. Um die Sicherheit der Software zu überprüfen, wird der berüchtigte IT-Spezialist Tamás Varta angeheuert. Varta entdeckt mysteriöse Fehler im Code. Und ahnt, dass ihn die Entdeckung das Leben kosten kann. Zu Recht. Als er untertaucht, wird die ehemalige Kampfschwimmerin Anna-Lena Herbst auf ihn angesetzt. Doch dann tritt ein weiterer Killer auf den Plan – Herbst und Varta geraten in ein Spiel der Mächtigen, in dem es keine Regeln gibt.
Von Lucas Fassnacht außerdem bei Blanvalet lieferbar: »#KillTheRich. Wer Neid sät, wird Hass ernten/Die Diplomatin«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch:
Im Zenit seiner Macht stürzt sich einer der bedeutendsten Konzernchefs des Landes in den Tod. An seine Stelle tritt Fridolin von Wolfenweiler, und dieser hat eine kühne Vision: die Entwicklung einer Software, die den kompletten Zahlungsverkehr Europas abwickeln soll – schnell, transparent, sicher. Um die Sicherheit der Software zu überprüfen, wird der berüchtigte IT-Spezialist Tamás Varta angeheuert. Varta entdeckt mysteriöse Fehler im Code. Und ahnt, dass ihn die Entdeckung das Leben kosten kann. Zu Recht: Als er untertaucht, wird die ehemalige Kampfschwimmerin Anna-Lena Herbst auf ihn angesetzt. Doch dann tritt ein weiterer Killer auf den Plan – Herbst und Varta geraten in ein Spiel der Mächtigen, in dem es keine Regeln gibt.
Autor:
Lucas Fassnacht wurde 1988 in Dieburg geboren; zurzeit wohnt er in Nürnberg, nachdem er in Erlangen Altgriechisch, Germanistik und Linguistik studiert hat. Neben seiner Arbeit als Autor gibt Fassnacht Workshops für Kreatives Schreiben. Er veranstaltet regelmäßig Literatur-Shows in Nürnberg und Erlangen. Von März bis November 2015 leitete er eine Poetry-Slam-Werkstatt mit Mittelschülerinnen und -schülern der Nürnberger Südstadt, welche mit der Kamera begleitet wurde. Der entstandene Dokumentarfilm »Südstadthelden« wurde 2018 fertiggestellt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
LUCAS FASSNACHT
DIE MÄCHTIGEN
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Dieses Buch ist ein Roman und kein Tatsachenbericht. Das Beschriebene hat sich so nicht ereignet. Trotz der vom Autor in künstlerischer Freiheit gewählten fiktiven Handlungsabläufe mögen im Einzelfall Anklänge an Verhaltensweisen lebender oder verstorbener Personen oder an öffentlich bekannte Unternehmen nicht immer vermeidbar gewesen sein; dies ist aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfassend geschützt.
Copyright der Originalausgabe © 2020
by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Covergestaltung und - motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (E. O.; Netfalls Remy Musser; marcokuschfotografie)
LH ∙ Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25663-0V005www.blanvalet.de
Für Jonas
Prolog
»Herr Beheim, es wartet noch immer für Sie: Philipp Linde, Mitglied des Aufsichtsrats der EuroBinary AG. Ihr vereinbarter Termin war um 12:15 Uhr.«
Die Nüchternheit in Aisanas Stimme ließ Stefan Beheim zusammenfahren. Dabei war er es gewesen, der sie erschaffen hatte. Und wozu? Düster stemmte er sich von seinem Schreibtisch hoch.
»Herr Beheim?«
»Was denn noch?«
»Philipp Linde für Sie. Ihr vereinbarter Termin war um …«
»Lassen Sie ihn warten, verdammt noch mal!« Eigentlich versuchte Beheim, freundlich zu seinen Programmen zu sein. Maschinen lernten nicht anders als Kinder. Erziehung brauchte Vorbilder. Aber selbst zu einem höflichen Ton gegenüber Aisana fehlte ihm inzwischen die Kraft. Er schleppte sich zu der Bar im Salonbereich seines Büros.
»Sehr gern, Herr Beheim. Ich richte Herrn Linde aus, dass der Termin sich verschiebt.«
Aisana sagte es ruhig, freundlich. Ein Jammer, dachte Beheim. Alle Welt sprach ehrfurchtsvoll von der Überlegenheit Künstlicher Intelligenz. Aber wenn es um Empathie ging, hatten die Algorithmen noch einiges zu lernen.
Denn Stefan Beheim hatte vor, sich umzubringen.
Mit der Linken lockerte er seine Krawatte, mit der Rechten warf er eine Handvoll Eiswürfel in ein Glas und übergoss sie mit Whiskey. Fast musste er lächeln. Whiskey mit Eis. Undenkbar wäre das gewesen, die letzten Jahre. Preis des Erfolgs. Nie hätte er sich ausgemalt, wie wenig man davon hatte, reich zu sein. Geld machte nicht frei, im Gegenteil. Es galten zwar nicht mehr die alten Regeln, denen der Rest der Gesellschaft sich zu unterwerfen hatte, aber der Kampf um die Macht wurde erbittert geführt. Die, die oben waren, sahen dich als Gefahr und arbeiteten gegen dich; die, die nach oben wollten, sahen dich als Hindernis und arbeiteten gegen dich; die, die unten waren, neideten dir deinen Erfolg und arbeiteten gegen dich. Beheim hasste es.
Auf dem Fernseher erschien ein Porträt von ihm. Gegen seinen Willen sah er hin.
»… bedeutet die Fusion den vorläufigen Höhepunkt der beeindruckenden Karriere des Vorstandsvorsitzenden der EuroBinary AG, Stefan Beheim. Der Sohn eines Krankenpflegers und einer Lehrerin entwickelte bereits als Jugendlicher seine ersten Computerprogramme, unter anderem ein Verschlüsselungsprogramm für Textnachrichten – fünfzehn Jahre vor WhatsApp. Nach dem Studium in Karlsruhe und einer Promotion in den USA am renommierten Massachusetts Institute of Technology verbrachte Beheim einige Jahre bei SAP im baden-württembergischen Walldorf, bevor er ein Angebot von Google annahm und nach London zog, wo er für die Sicherheitsarchitektur der konzerneigenen Finanzgeschäfte zuständig war. 2005 machte er sich selbstständig und gründete EuroBinary, einen Anbieter von Finanztransaktionssoftware. Nur vier Jahre später folgte der Börsengang, seit 2015 ist EuroBinary im DAX notiert und gilt somit als eines der dreißig wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Ein Wachstum, das Kritiker wiederholt als ungesund bezeichnet haben …«
Beheim stürzte den Whiskey hinunter, stellte das Glas ab. Dann zog er sein Sakko aus.
»Aisana.«
»Was kann ich für Sie tun, Herr Beheim?«, fragte die Software.
»Rufen Sie bitte Cate an.« Höflichkeit. Anstand. War er ein anständiger Mensch? Er hatte es versucht – und wie viel Kraft hatte ihn dieser Versuch gekostet.
»Sehr gern, Herr Beheim. Ich wähle die Nummer von Cate Beheim.«
Der Wählton ertönte.
Beheim trat an einen der Gästesessel und legte sein Sakko über die Lehne.
»Stefan. Gut, dass du anrufst«, drang die Stimme seiner Frau aus Boxen, die genauso diskret im Raum verteilt waren wie die Mikrofone. Beheim konnte sich frei in seinem Büro bewegen, während er telefonierte.
»Philipp hat sich gerade bei mir gemeldet. Er meint, ihr hättet eigentlich einen Termin, aber er erreicht dich nicht.«
Auf einmal schnürte es Beheim die Kehle zu. Seit er seine Entscheidung gefällt hatte, hatte ihn eine betäubende Leichtigkeit erfüllt. Und nun, mit der Stimme seiner Frau, kehrte die Last zurück, hundertfach schwerer. Sie ahnte, was er vorhatte. Natürlich. Sie kannte ihn so gut.
»Du, Cate …«
»Was ist?« Dann, eine Sekunde später: »Alles in Ordnung?«
Beheim starrte auf den Fernseher, ohne die Bilder wahrzunehmen.
Drängender jetzt: »Stefan, sag schon.«
»Cate«, Beheim gelang kaum mehr als ein Flüstern, »du … es tut mir leid.«
»Stefan, was ist los? Du machst mir Angst.«
»Ich liebe dich.«
Er schnipste mit den Fingern, automatisch, wie er es unzählige Male getan hatte. Doch plötzlich widerte die Geste ihn an. Wie geschmacklos, wie nachlässig sie war, wie würdelos.
»Gespräch beendet«, verkündete Aisana gelassen.
»Aisana, öffnen Sie bitte die Balkontür.«
»Sehr gern, Herr Beheim.« Lautlos schob sich die Glaswand hinter seinem Schreibtisch zur Seite. Ein kühler Luftzug kündigte den Herbst an.
»… Nun also sahen die kritischen Stimmen sich bestätigt«, erklärte der Fernseher hinter ihm, »Bankrott und Zerschlagung schienen unausweichlich. Doch in buchstäblich letzter Sekunde gelang es EuroBinary, einen Investor zu finden: die Privatbank Fischer & Söhne. Die Fusion zwischen einer Bank und einem Technologieunternehmen ist ein Präzedenzfall, dessen Bedeutung wohl erst in einigen Jahren abzusehen ist …«
Ja, er hatte verkauft. Beheim trat auf den Balkon. Verkauft. Kaum drangen die Geräusche des Feierabendverkehrs zu ihm herauf. Aus statischen Gründen schwankte das Gebäude etwas. Zweiunddreißig Stockwerke lagen zwischen ihm und dem Asphalt der Frankfurter Innenstadt. Der Ausblick ließ ihm immer noch die Knie weich werden. Erst vor einem halben Jahr waren sie umgezogen. Auf dem Höhepunkt der Krise.
»Sie haben eine Anrufanfrage von Cate Beheim«, verkündete Aisana. »Möchten Sie sie annehmen?«
»Nein, danke.«
»Sehr gern, Herr Beheim.«
»Für die Anleger hingegen scheint die Lage klar: Seitdem heute Mittag das Bundeskartellamt seine Zustimmung zu der Fusion erteilt hat, stieg die Aktie um sagenhafte fünfundsechzig Prozent und macht damit den angeschlagenen Konzern innerhalb von Stunden zum wertvollsten Titel, den die Deutsche Börse je notiert hat. Unter dem neuen Namen FisherEuroBinary AG steigt wahrhaftig ein Phönix aus der Asche …«
»Sie haben eine Anrufanfrage von Cate Beheim. Möchten Sie ...?«
»Nein. Keine Anrufe mehr bis auf Weiteres.«
»Sehr gern, Herr Beheim.«
»… die anglisierte Schreibweise Fisher soll die neue, noch internationalere Ausrichtung unterstreichen, erklärt Fridolin von Wolfenweiler, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Fischer & Söhne, der in seiner neuen Funktion als Finanzvorstand …«
»Und machen Sie verdammt noch mal den Fernseher aus.«
»Sehr gern, Herr Beheim.«
Beheim trat ans Geländer. Um ihn her ein Wald schlanker Bürotürme. Potenzprojektionen des Geldadels. Ein Schauer strich ihm den Rücken hoch. Frankfurt. Was hatte er sich nur gedacht?
In seiner Hosentasche vibrierte sein privates Telefon. Cate. Geradezu aus Versehen nahm er ab.
»Stefan.« Cates Stimme war ruhig. Es war eine Ruhe, die Beheim nur zu gut kannte. Das Geländer war mit Blumenkästen geschmückt. Die Blumen reckten ihm heiter die Köpfe entgegen, wussten nichts von der letzten Hitzewelle, die ihre Verwandtschaft dahingerafft hatte.
»Hör mir zu, Stefan. Wo bist du? Im Büro?«
»Ja.«
»Ich komme vorbei. Ich bin schon unterwegs. In Ordnung?«
Beheim wollte etwas sagen, doch er konnte nicht.
»Stefan. Leg nicht auf. Versprich mir das.«
»Es tut mir leid.«
»Stefan. Wir schaffen das.« Cates Worte kamen nicht hektisch. Nur bestimmt. »Du kannst das. Du weißt, dass du das kannst. Du bist wundervoll. Du hast das schon mal geschafft. Du schaffst das wieder.«
Beheim schluckte. »Ich habe keine Kraft mehr.«
Am anderen Ende der Leitung war es still. Einen Augenblick nur, doch Beheim musste sich am Geländer festhalten, wurde schwach vor Schmerz.
»Stefan.« Die Stimme war rauer, eine Nuance nur. Aisana hätte es nicht bemerkt. »Stefan, hör mir zu. Du kannst das. Denk an die Firma.«
»Die Firma ist tot.«
»Stefan, du hast selbst gesagt, es ging nicht anders. Du musstest verkaufen, du konntest nichts dafür. Es war der einzige Weg, die Firma zu retten. Dein Lebenswerk zu retten.«
»Mein Lebenswerk.«
»Stefan, ich liebe dich. Du bist ein guter Mensch. Du hättest nicht anders handeln können.«
»Mein Lebenswerk«, flüsterte Beheim. »Ich habe es dem Teufel verkauft.«
»Stefan.«
»Ich liebe dich.«
Beheim beendete die Verbindung, kletterte über das Geländer und sprang.
Zwei Monate später
Montag
… mit dem Rücktritt verliert FisherEuroBinary seinen zweiten Vorstandsvorsitzenden in zwei Monaten. Neuer Chef des DAX-Konzerns wird Fridolin von Wolfenweiler, welcher bisher als Finanzvorstand bei FEB tätig war …
1. Kapitel
Die Durchsage des Zugführers schien nicht enden zu wollen. Monique Roux-Pastor verstand vieles, aber Deutsch gehörte nicht dazu. Sie griff nach dem Reinigungstuch und putzte ihre Brille. Hoffentlich nicht noch eine Verspätung. Sie mussten bereits kurz vor Frankfurt sein. Kein Staubkorn war mehr auf den Brillengläsern. Roux-Pastor putzte trotzdem. Es war ihr Weg, mit der Nervosität fertigzuwerden. Die Brille war ihr wertvollster Besitz; sechs Dioptrien rechts, drei Komma sieben links.
Nachdem der Zugführer geendet hatte, endlich die englische Entsprechung – die irritierenderweise aus einem einzigen Satz bestand: »We are arriving now Frankfurt Central Station.«
Roux-Pastor seufzte erleichtert. Sie griff nach ihrem Schminkspiegel und überprüfte ihr Make-up. Sie hatte ihre Mähne gebändigt, sich Ohrstecker von ihrer Mutter geliehen und sogar Lippenstift aufgetragen. Sah passabel aus. Sie wirkte viel älter als einundzwanzig. Roux-Pastor hatte sich nie viel aus ihrem Äußeren gemacht, eigentlich mochte sie ihr Gesicht sogar. Leider war sie die Einzige. Bis heute hatte sie nicht herausgefunden, ob es an ihrer Brille lag, die ihre Augen grotesk vergrößerte, oder daran, dass sie klug war. Nicht klug im Vergleich zu ihren Eltern oder im Rahmen des Schulsystems, sondern wirklich klug.
Monique Roux-Pastor erinnerte sich an jedes Wort aus jedem Buch, das sie je gelesen hatte. Sie konnte die Kohärenzeigenschaften quantenmechanischer Zustände modellieren. Sie verstand, warum null keine Zahl war.
Es war nicht immer einfach.
Sie klappte den Schminkspiegel zu, packte ihre Sachen zusammen und eilte zum Ausstiegsbereich ihres Waggons. Viel zu früh. Der TGV rumpelte über den Main.
Endlich fuhr der Zug in den Bahnhof ein, kam zum Halten. Weitere zähe Augenblicke, bis die Tür sich öffnen ließ, Roux-Pastor nahm die Stufen zu hastig, stolperte, fast wäre sie gefallen, zum Glück stützte jemand sie rechtzeitig. Verdammt. Sie zog sich die Bluse gerade. Sie war nicht zu spät. Es gab keinen Grund zur Eile. Die Werbefläche auf dem Bahnsteig präsentierte Schokolade, allerdings stimmte die Proportion zwischen Haselnüssen und Trauben nicht. Im Vergleich zu Paris trugen die hiesigen Menschen ihre Aktentaschen häufiger in der linken Hand, oder täuschte sie sich?
Am Kopf des Bahnsteigs hielt ein Asiat in roter Kordhose und gelbem Wollpullover ein Blatt Papier hoch, auf dem ihr Name stand, in der Schriftart Verdana. Sie fasste sich ein Herz und ging auf den Mann zu.
»Hallo«, sagte sie.
»Frau Roux-Pastor?«, fragte der Mann auf Englisch. »Schön, dass Sie da sind. Willkommen in Frankfurt. Ich bin Tao Wu.«
Sein Gesicht sah angespannt aus.
»Geht es Ihnen nicht gut?«
»Zahnschmerzen.«
»Sie haben sich angepasst.«
»Bitte?«
»Im Chinesischen wird der Familienname zuerst genannt, Tao ist aber kein Familienname – Wu schon. Sie haben Ihre Namen in derjenigen Reihenfolge angeordnet, die in westlichen Gesellschaften üblich ist.«
Der Asiat lächelte. Er schielte ein bisschen, aber ansonsten sah er gut aus. Roux-Pastor begann zu schwitzen. Sie senkte die Augen. »Verzeihen Sie. Ich sage zu oft, was ich denke.«
»Alles in Ordnung. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen. Folgen Sie mir bitte, der Fahrer wartet draußen.«
Sie saßen im Fond einer Mercedes-Limousine. Während der Fahrt fragte Wu sie über ihre Anreise aus. Roux-Pastor konnte mit Small Talk nicht umgehen. Ihre Oberschenkel klebten am Sitz. Ihr Kleid war zu kurz. Dabei wusste sie doch, dass sie schnell an den Oberschenkeln schwitzte. Als es ihr unerträglich wurde, fragte sie: »Was ist Ihre Aufgabe bei FisherEuroBinary, Herr Wu?«
»Ich leite das Projekt Alyattes.«
Roux-Pastor blieb das Herz stehen. Komplexe Dinge fielen ihr leicht, doch wie oft scheiterte sie an den einfachen. »Sie entscheiden über meine Einstellung«, stammelte sie. »Das Vorstellungsgespräch findet bereits statt.«
Wu lächelte wieder. »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Roux-Pastor. Wir haben Sie angefragt. Ich bin guten Mutes, dass wir zusammenfinden. Aber verraten Sie mir, warum haben Sie überhaupt Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten? Wir haben Ihnen bisher ja noch nicht viel verraten außer der Höhe des Honorars. Und das Honorar wird es wohl kaum sein.«
»Doch«, gab Roux-Pastor zu. »Meine Mutter sagt, ich soll mir ein Haus kaufen. Als Altersvorsorge.«
Wu zögerte mit seiner Antwort. Aber insgesamt hatte Roux-Pastor den Eindruck, er war nicht ganz so langsam wie normale Menschen.
»Abgesehen von der Fields-Medaille haben Sie alles gewonnen, was man als Mathematikerin gewinnen kann, Sie haben mit achtzehn promoviert, Sie tragen das Offizierskreuz der französischen Ehrenlegion. Sie sollten sich keine Gedanken um Ihre Altersvorsorge machen müssen.«
»Ich mache mir keine Gedanken um meine Altersvorsorge. Meine Mutter macht sich Gedanken.«
»Sie haben tatsächlich Geldmangel?«
»Das weiß ich nicht.«
Nun zeigte auch Wus Gesicht das Unverständnis, das sie von ihren Mitmenschen gewohnt war. Doch Roux-Pastor hatte gelernt, sich zu erklären, auch wenn es um Belanglosigkeiten ging. »Ich besitze ein Konto, aber ich kam noch nicht dazu, das Guthaben zu prüfen. Bisher war es immer gedeckt. Also habe ich keinen Grund, die Prüfung zu priorisieren.«
»Sie bewerben sich also bei uns, weil Ihre Mutter Ihnen rät, ein Haus zu kaufen, und Sie nicht wissen, ob Sie genügend Geld dafür haben, weil Sie es nicht für wichtig erachten, Ihren Kontostand zu verfolgen?«
Roux-Pastor nickte ergeben. Was für ein lästiges Gespräch. »Das habe ich doch gerade gesagt.«
Wu musterte sie. Unter seinem Blick wurde ihr heiß. Warum bloß konnte sie ihre Ungeduld nie für sich behalten.
»Ist es nicht ironisch, dass Sie für einen Finanzdienstleister arbeiten möchten, wenn Sie sich nicht einmal für Ihre eigenen Kontoauszüge interessieren?«
Roux-Pastor blickte verbissen auf den Fußraum des Fonds. Wenn Menschen Ironie in etwas entdeckt zu haben glaubten, hielt sie besser den Mund. Eine schmerzhafte Lektion, die zu lernen ihre gesamte Schulzeit durchzogen hatte. Es half jedenfalls nicht, auf Krawall gebürsteten Neuntklässlern zu erklären, dass man nicht neun Mal so klug war wie sie, sondern abhängig von der Messmethode zwischen eins Komma acht Mal und zwei Komma zwei Mal.
Wu schien ihr verzeihen zu wollen. Er lächelte.
»Abgesehen vom Geld – gab es noch einen Grund, weswegen Sie unserer Einladung gefolgt sind?«
Roux-Pastor widerstand dem Drang, ihre Brille zu putzen. Sie hasste es, wenn Menschen private Fragen stellten. »Meine Mutter«, murmelte sie. »Sie meint, es tut mir gut, wenn ich mal etwas Praktisches mache.«
Wu holte ein Tablet hervor. »Nun ja, etwas Praktisches«, er öffnete eine Datei, »zumindest im Vergleich zu Ihrer Forschung, sicher.« Er reichte ihr einen Touchstift. »Wenn Sie hier unterschreiben möchten, sage ich Ihnen, um was es geht. Keine Sorge, ist nur eine Verschwiegenheitserklärung.« Mit einer Wendung seines Kopfs wies er zum Fenster auf ihrer Seite. »Wir sind gleich da.«
Roux-Pastor blickte hinaus. Hinter einer Reihe von Buchsbäumen in Betonkübeln erhob sich ein Wolkenkratzer, der aussah wie ein überdimensioniertes gläsernes Modell des Schiefen Turms von Pisa. Als sie heranfuhren, entdeckte sie zwischen den Buchsbäumen ein paar Demonstranten, die um eine Boombox hockten. Kein Gebäude war die letzten Wochen häufiger in den Medien gewesen. Es handelte sich um die Zentrale der umstrittensten Firma Europas: der FisherEuroBinary AG.
Wu führte sie in eine Lobby, die den Großteil des Gebäudegrundrisses einnehmen musste. Roux-Pastor schätzte die Höhe des Raumes anhand dessen, wie scharf sie die Decke sah. Ungefähr siebzehn Meter. Die Rezeption war ähnlich lang und wurde von vier Leuten betreut. Wu zeigte seine Mitarbeiterkarte und ließ eine Gästekarte für Roux-Pastor ausstellen, wofür sie ihm ihren Personalausweis hatte geben müssen.
Während sie auf den Fahrstuhl warteten, erklärte er: »Die Europäische Union arbeitet daran, den Zahlungsverkehr zwischen den Banken von den Amerikanern unabhängiger zu machen. Bisher läuft ja alles über SWIFT, und dass das manipuliert wird, wissen wir spätestens seit Snowden. Für die Entwicklung des entsprechenden Systems hat die EU den Europäischen Bankenverband beauftragt. Der Verband wiederum hat sich dafür entschieden, dass EuroBinary die Feder führen soll. Also FisherEuroBinary inzwischen.«
»Deswegen hat das Kartellamt also die Fusion bewilligt.«
»Bitte?«
»Um Alyattes zu retten.«
»Wie kommen Sie darauf?«
Roux-Pastor zuckte die Schultern.
Der Fahrstuhl kam. Sie traten ein. Wu drückte einen der untersten Knöpfe, während er seine Karte vor einen Sensor hielt. Der Fahrstuhl setzte sich nach unten in Bewegung, Wu fuhr mit seinen Ausführungen fort.
»Ziel ist mittelfristig, auch private Transaktionen über das System laufen zu lassen. Vor allem Transaktionen, die bisher noch bar geschehen. Allerdings steigt in der Bevölkerung das Bewusstsein für Datensicherheit – wenn ein einzelnes System alle Überweisungen bündeln soll, ist der Aufschrei abzusehen. Im Übrigen vertrauen die Menschen Giralgeld vielleicht im Alltag – aber sobald die kleinste Krise kommt, rennen sie doch alle wieder zum Automaten.«
Roux-Pastor schüttelte stumm den Kopf. Geld war nur eine Wette darauf, dass andere dem notierten Betrag einen bestimmten Wert zuwiesen. Ob es bar gehandelt wurde oder digital, war unerheblich. Praktisch war Giralgeld sogar sicherer – weil es nicht physisch vorlag, konnte es redundant gesichert werden. Wie nur hatte die Menschheit es so weit gebracht, wenn die meisten nicht einmal die grundlegenden Mechanismen durchschauten, nach denen die Gesellschaft organisiert war?
»Um den Ängsten zu begegnen, haben wir uns entschieden, DLT zu verwenden«, erklärte Wu. DLT stand für Distributed-Ledger-Technologie und beschrieb die kryptografische Verkettung von Datensätzen sowie deren Streuung auf unabhängige Systeme. Auch das wusste jeder, der einmal in eine Zeitung geschaut hatte. Roux-Pastor verkniff sich einen Kommentar. Klug zu sein erforderte viel Geduld.
»Wir möchten, dass Sie uns helfen, eine Blockchain zu schaffen, die der Aufgabe gewachsen ist.«
»Das stand bereits in der Einladung, die ich erhalten habe.« Roux-Pastor nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. Es strengte sie an, sich mit Menschen zu beschäftigen. Als sie die Brille wieder aufgesetzt hatte, sah Wu sie merkwürdig an. »Was ist los?«, fragte sie.
»Wollen Sie überhaupt den Job?« Wu legte den Kopf schief. »Sie wirken etwas desinteressiert.«
Roux-Pastors Wangen glühten. Verdammt, warum fühlten sich nur immer alle angegriffen von ihr? Der Fahrstuhl bremste ab, die Türen öffneten sich und gaben den Blick auf einen kargen Gang frei.
»Warum wollen Sie mir den Serverraum zeigen?«, fragte sie, um von ihrer Verlegenheit abzulenken.
»Woher wissen Sie das?«
Roux-Pastor erklärte zahm das Offensichtliche: »Weil wir nach unten gefahren sind.«
»Ich möchte Sie dem Kollegen vorstellen, mit dem Sie zusammenarbeiten werden.« Wu zögerte wieder. »Falls Sie mit uns arbeiten wollen.«
»Doch, sicher«, bekräftigte Roux-Pastor hastig, »ich wollte Sie nicht beleidigen.«
»Keine Sorge, das haben Sie nicht.« Er klang auf einmal ganz freundlich. »Hier entlang.« Er zeigte den Gang hinunter. Wohin auch sonst?
»Ich habe nur einen Kollegen?«, fragte Roux-Pastor, während sie den Gang entlangliefen. »Wie groß ist das Team?«
»In der Abteilung von FisherEuroBinary sind wir dreiundvierzig. Insgesamt arbeiten über zweihundert Leute für Alyattes plus zahlreiche Externe. Aber die sensible Arbeit versuchen wir, auf möglichst wenige Köpfe aufzuteilen, da sind wir zwölf. Alle bei FisherEuroBinary. Mit Ihnen dreizehn.«
»Was ist das Problem?«
»Bitte?«
»Wenn Sie mich als Externe ins Kernteam integrieren wollen, gehen Sie ein Risiko ein. Also brauchen Sie mich dringend. Wofür?«
Wu rieb sich die Nase. »Wir haben in acht Tagen unsere erste Präsentation. Und bisher haben wir nicht viel vorzuweisen. Der zuständige EU-Kommissar muss entscheiden, ob er uns die Weiterfinanzierung bewilligt. Und nach den aufregenden letzten Monaten ist die Öffentlichkeit uns nicht besonders gewogen. Wenn herauskommt, dass die EU gerade mit uns ein milliardenschweres Projekt aufzieht, das auch noch die kritische Infrastruktur betrifft … unser Vorstand vermutet, wenn unsere Präsentation nicht ausgesprochen überzeugend ist, wird der Kommissar Alyattes fallen lassen.«
Das war nicht ihre Frage gewesen. Was Roux-Pastor an ihren Mitmenschen mit am meisten betrübte, war, dass alle immer bei Adam und Eva anfangen mussten. Sie hatte die Fusion von Fischer und EuroBinary mit mäßigem Interesse verfolgt, während die Medien kaum davonlassen konnten: Ein Vorstand, der sich am Tag der Fusion vom zweiunddreißigsten Stock seines Firmengebäudes stürzte, geleakte Paper, die von feindlicher Machtübernahme sprachen, Berichte über manipulierte Bilanzen in den Büchern von Fischer & Söhne, Umstrukturierungen, die von EuroBinary nichts übrig ließen außer dem Kerngeschäft – und die EU glaubte weiterhin, genau dieses Unternehmen sei qualifiziert, den Finanzhandel radikal umzuwälzen? Kühn.
»Das Programm soll später SAFE heißen. In Anlehnung an SWIFT.«
»Raffiniert. Wofür brauchen Sie mich?«
»Wir machen zwar vom Build her Fortschritte, aber scheitern nach wie vor an der Effizienz.«
Eine Blockchain war typischerweise so aufgebaut, dass mehrere Datensätze verkettet wurden. Änderte sich ein einzelner Datensatz, wurde diese Änderung in allen anderen Datensätzen ebenfalls gespeichert. Blockchains hatten einen Hype ausgelöst, weil sie Transparenz und Sicherheit versprachen. Um einen Datensatz zu manipulieren, mussten alle übrigen verketteten Datensätze ebenfalls manipuliert werden. Aber je mehr Veränderungen, desto höher der Speicher- und Rechenaufwand. Der Hype ebbte bereits wieder ab. Und wenn sich die Effizienz nicht steigern ließe, würde er auch nicht zurückkehren.
Roux-Pastor sah die Herausforderung nicht. »Sie müssen doch nur einen Weg finden, ältere Veränderungen aus dem System zu löschen, ohne die Prüfsumme zu verändern.«
Die Prüfsumme garantierte die Integrität des jeweiligen Datensatzes.
»Das ist der Knackpunkt.« Wieder rieb Wu sich die Nase. War er Allergiker? »Sobald wir die untergeordneten Ebenen löschen, kompromittieren wir die Prüfsumme. Unser Penetrationstester hat alle unsere bisherigen Ansätze zerlegt. Wenn wir dem Kommissar kein Konzept vorweisen können, das absolute Sicherheit verspricht, dann ist Alyattes tot. Wir haben noch acht Tage.«
»Dann kann ich nur für Sie hoffen, Ihre Ansätze waren nicht einfach stümperhaft, sondern Ihr Tester ist gut.«
»Sie werden ihn gleich kennenlernen. Es ist der Mann, den ich Ihnen vorstellen möchte.«
Nachdem sie mehrmals abgebogen waren, erreichten sie einen Sicherheitsmann, der eine schwere Feuerschutztür bewachte. Er war ausgerüstet wie ein Militär. Wu begrüßte ihn, der Mann grüßte zurück und trat zur Seite. Wu legte den Daumen auf ein Pad, das neben der Tür eingelassen war, und die Tür schwang mit pneumatischem Zischen auf.
Sie gelangten in einen kleinen, kahlen Raum: eine Schleuse. Es war deutlich kälter als zuvor. Der Luftzug verschaffte Roux-Pastor eine Gänsehaut. Erst als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, ließ sich die nächste öffnen, wieder über ein Touchpad.
»Voilà«, sagte Wu.
Sie betraten eine niedrige Halle, die hell erleuchtet war. In langen Reihen standen die Hosts in ihren Neunzehn-Zoll-Racks. Der Boden war sauber wie ein OP-Tisch. Dubstep. Es kreischte so laut, dass Roux-Pastor sich die Ohren zuhalten musste. Menschen waren keine zu sehen.
Wu rief in den Raum: »Tamás, bist du da?« Es war aussichtslos, die Musik verschluckte alles. Wu schritt die Regalreihen ab und winkte Roux-Pastor, ihm zu folgen. Die Bässe ließen die Glasverkleidung der Racks vibrieren.
Sie fanden den Gesuchten im vorletzten Gang. Roux-Pastor hielt den Atem an. Der Mann stand auf der Sitzfläche eines Bürostuhls, die Arme ausgebreitet, die Augen geschlossen. Er trug eine Jeans, sonst nichts, nicht einmal Schuhe. Einige Kleidungsstücke lagen verteilt um ihn herum. Der Mann war nicht groß, sein Gesicht wirkte jung, Mitte zwanzig vielleicht. Seine dunklen Locken flogen in alle Richtungen, sie hätten es mühelos mit Roux-Pastors eigener Mähne aufnehmen können. Einer seiner Unterarme war mit dunklen Flecken übersät. Um den Bürostuhl herum lagen einige aufgeklappte Laptops auf dem Boden. Weiter hinten stand ein schwarzer Rollkoffer. Roux-Pastor brauchte eine Sekunde, um zu verstehen, dass es sich um die Anlage handelte, aus der die Musik dröhnte. Aber so bizarr die ganze Szene war, Roux-Pastor hielt aus einem anderen Grund die Luft an: Sie kannte den Mann.
»Tamás«, rief Wu, doch der Angesprochene reagierte nicht. »Tamás!«
Jetzt bemerkte der Mann seinen Besuch. Er nahm die Arme herunter, stieg von seinem Bürostuhl, drehte die Musik leiser und kam ihnen entgegen. In den Dubstep mischte sich das Summen der Klimaanlage, das Klicken der Switches, das Rauschen der servereigenen Kühlsysteme – es klang, als befänden sie sich im Raumhafen von Coruscant.
»Tao.« Der Halbnackte wirkte neben Wus gelbem Pulli noch seltsamer. »Was gibt’s? Was machen die Zähne?«
»Passt schon. Monique Roux-Pastor ist da.«
Der Mann musterte sie freundlich. »Hi, beautiful.«
»Hi.« Roux-Pastor brachte die Silbe kaum über die Lippen. Der andere wandte sich wieder an Wu. »Sollte ich sie kennen? Warum ist sie hier?«
»Deine Unterstützung für die Präsentation. Du erinnerst dich?«
»Ach so. Ihr wollt die Sache also wirklich runterspielen.« Es war keine Frage. Roux-Pastor wurde übel vor Aufregung. Er war es wirklich.
»Wir wollen gar nichts runterspielen«, widersprach Wu. »Aber wir brauchen einen positiven Ausblick; ein Versprechen, das wir geben können. Dass wir an was dran sind.«
»Sind wir aber nicht.«
»Deswegen haben wir ja Frau Roux-Pastor eingeladen. Vielleicht verschafft sie uns den Durchbruch.«
»Warum steckt ihr sie dann nicht in die Entwicklung?« Der Mann zog eine Kaugummipackung aus der Hosentasche. »Na gut, Nicky«, sagte er zu ihr und schob sich ein Kaugummi in den Mund, »dann lass mal die Kryostase-Pantomime und schieß los.«
»Sie sind Tamás Varta!«, platzte es aus ihr heraus.
»Stimmt.«
»Ich träume von Ihnen, seit ich sechzehn bin.« Roux-Pastor stockte. Was sagte sie da? Sie ballte die Fäuste vor Scham. Weil das alles nur noch schlimmer machte, nahm sie die Brille ab, zog das Putztuch aus ihrer Jacke und begann zu polieren.
»Ein Fan?« Varta lachte. »Wie alt bist du, Nicky?«
Rasch setzte sie die Brille wieder auf. »Einundzwanzig.«
»Hammer. Du träumst von mir seit fünf Jahren. Weißt du, wann ich mein letztes Match bestritten habe?«
»Am 18. November 2012. Finale der Weltmeisterschaft. Gegen Wonderboy drei zu eins.«
»Alter, schon als du mit deiner Verehrung angefangen hast, warst du drei Jahre zu spät.« Varta klaubte ein Shirt vom Boden auf und streifte es über.
»Niemand spielt wie Sie, Herr Varta.«
»Spielte. Aber gut, danke für die Blumen. Weißt du, wie alt ich bin?«
»Sie werden am 7. Januar sechsundzwanzig.«
»Sehr richtig, Frau Stalkerin. Und damit ich mich nicht wie dreißig fühle, fände ich es nett von dir, wenn du mich duzt. Nenn mich Tamás.«
»Monique«, haspelte Roux-Pastor.
»Okay, ihr zwei Turteltauben«, warf Wu ein, »ich lass euch mal alleine. Von Wolfenweiler erwartet am Mittwoch mein Konzept für die Präsentation. Es wäre schön, wenn wir bis dahin einen Ansatz hätten, der die Leute nicht Zeter und Mordio schreien lässt. Tamás, du kennst die Schwachstellen am besten. Wenn dir Frau Roux-Pastor bei der Auswertung hilft, findet ihr vielleicht einen Ansatz, der fürs Erste tragfähig genug wäre.«
War sie etwa schon eingestellt? Würde sie wirklich mit Tamás Varta arbeiten dürfen?
»Alles, was ihr mir geschickt habt, war verwundbar. Das wird sich weder bis übermorgen ändern noch bis nächsten Dienstag.«
»Wenn wir die Präsentation gegen die Wand fahren, ist nicht nur Alyattes am Ende«, Wu wandte sich bereits zum Gehen, »dann ist auch FisherEuroBinary so schnell wieder Geschichte wie deine Karriere als Profi-Zocker.«
»Ich kann auch nur den Finger in die Wunde legen. Nähen müsst ihr selbst.«
Wu drehte sich noch einmal zu ihnen um. »Es würde schon reichen«, sagte er, »wenn du nicht ganz so tief bohrst.«
2. Kapitel
Die Sprechanlage des Learjet knackte. »Frau Avari, wir beginnen nun den Landeanflug auf Marsa Matruh. Wir würden Sie bitten, sich anzuschnallen und Ihren Platz nicht mehr zu verlassen.«
Aurora Avari holte langsam und sorgfältig Luft. Sie saß mit verschränkten Beinen im Master-Sessel der Passagierkabine, hatte die Arme mit den Handflächen nach oben auf ihre Knie gelegt und lauschte ihrem Atem. Seit einer halben Stunde versuchte sie zu meditieren, erfolglos. Ihre Augen juckten, vor dem Abflug hatte sie sich schnell noch die Krähenfüße behandeln lassen. Gewöhnlich verzichtete sie darauf, ihre Schönheit medizinisch zu unterstützen. Avari ging auf die vierzig zu, doch noch immer konnte sie an keiner Baustelle vorbeigehen, ohne dass die Arbeiter von ihren Gerüsten fielen. Nicht, dass es Avari störte.
Fridolin hatte auf der Maßnahme bestanden – obwohl sie ihm versichert hatte, dass es zu spät dafür war; es würde Tage dauern, bis das Botox tatsächlich etwas bringen würde.
Fridolin.
Was ging in ihm vor? Warum war er nicht selbst nach Ägypten geflogen, hatte stattdessen sie geschickt? Er hatte behauptet, sie sei die bessere Verhandlerin. Ein armseliger Vorwand. Avari zweifelte nicht an ihren Fähigkeiten – doch eine bessere Verhandlerin als Fridolin war sie nicht. Das war niemand. Avari ahnte den wahren Grund, weswegen Fridolin von Wolfenweiler nicht selbst hatte fliegen wollen.
Der Mann, den sie bewunderte wie keinen anderen, hatte Angst.
Der Flughafen von Marsa Matruh war kaum mehr als ein Rollfeld. Als der Stewart die Gangway ausklappte, griff Avari ihre Aktentasche fester und streckte den Rücken durch. Sie war kein sentimentaler Mensch. Doch sie wusste: Egal, wie der heutige Tag verlief, es würde der bedeutsamste ihres Lebens werden.
Direkt vor dem Jet parkten zwei Fahrzeuge: ein gelb-schwarz karierter PKW der Flughafenaufsicht und ein schwarzer Geländewagen mit getönten Scheiben. Avari stellten sich die Nackenhaare auf. Sie war auf Sizilien groß geworden. In der Heimat der Cosa Nostra hatte sie früh gelernt: Schwarze Geländewagen verhießen selten etwas Gutes.
Die Gangway war steil, Avaris Rock eng und kurz, vorsichtig setzte sie ihre Schritte. Die Beifahrertür des Geländewagens öffnete sich, ein gedrungener Mann in dunklem Konfektionsanzug trat auf den Asphalt, wartete, musterte sie kalt. Kein gutes Zeichen. Wenige Männer blieben ruhig, wenn sie Avari das erste Mal sahen.
Als der Mann weiterhin keine Anzeichen machte, ihr entgegenzukommen, ging Avari auf ihn zu. Sie setzte ein gewinnendes Lächeln auf und hielt ihm die Hand entgegen. »Aurora Avari.«
Der Mann schlug langsam ein, ihr Lächeln erwiderte er nicht. »Nennen Sie mich Fjodor.« Sein Englisch war flüssig, der russische Akzent kaum wahrzunehmen. »Wo ist Herr von Wolfenweiler?«
»Herr von Wolfenweiler ist leider verhindert. Ich vertrete ihn.«
Ein Zucken um Fjodors Augen. »Das ist nicht möglich. Wir müssen mit Herrn von Wolfenweiler persönlich sprechen.«
Obwohl der November in Marsa Matruh nicht kühl war, fror es Avari. »Ich habe alle nötigen Vollmachten.« Wenn dieser Fjodor nicht mit ihr verhandeln wollte, musste sie Fridolin kontaktieren. Was er verboten hatte – ihre Verhandlungsposition wäre desavouiert. Würde er überhaupt abnehmen? Avari war nicht religiös. Doch sie betete, dass sie Fridolin nicht würde anrufen müssen.
»Es geht nicht.«
»Dann nicht.« Avari wandte sich Richtung Jet. Der Blick des Russen in ihrem Rücken brannte wie Nesseln. Es waren nur wenige Schritte bis zur Gangway. Wenige Sekunden, in denen sich ihr Schicksal entschied. Entweder die Russen brauchten sie, oder das Spiel war verloren.
»Halt.«
Mit Mühe nur verhinderte Avari, dass sie vor Erleichterung die Schultern sinken ließ. Unverändert ging sie weiter.
»Warten Sie.«
Nachlässig drehte sie sich um. »Bitte?«
»Kommen Sie mit.«
Avari hatte viele Jahre Übung darin, sich Menschen zu eigen zu machen. »Wie Sie meinen«, sagte sie und lächelte, als bedeute es ihr nichts.
Im Geländewagen fuhren sie dem Fahrzeug der Flughafenaufsicht hinterher. Die Fahrt dauerte zwei Minuten. Neben einem ockerfarbenen Amphibienflugboot mit laufenden Rotoren blieben sie stehen. Fjodor führte Avari direkt zur ausgeklappten Gangway. Auf der Gangway stand ein Mann in Kampfanzug und schutzsicherer Weste, etwas jünger als Fjodor, ausgesprochen muskulös. Eine Narbe kroch ihm wie eine Raupe quer über die rechten Wange. Am Gürtel trug er eine Pistole, über der Schulter hing ein Sturmgewehr.
»Frau Avari«, stellte Fjodor sie vor. Er musste schreien, um den Rotorenlärm zu übertönen. »Sie vertritt Herrn von Wolfenweiler.«
Der andere runzelte die buschigen Brauen, sagte aber nichts.
»Und Sie sind …?«, fragte Avari, während sie ihm die Hand bot.
»Nennen Sie mich Leonid.«
Er schlug nicht ein.
Fjodor forderte sie auf, das Flugboot zu betreten. Es war überraschend geräumig. Kyrillische Hinweisschilder deuteten darauf hin, dass es dem russischen Militär gehörte.
Kaum waren sie eingestiegen, setzte das Flugzeug sich in Bewegung. »Ihr Telefon«, sagte Fjodor. Avari händigte es ihm notgedrungen aus.
Der Jüngere, der sich Leonid genannt hatte, zog einen Stoffsack hervor. »Entschuldigen Sie«, sagte er gleichgültig und stülpte ihr den Sack über den Kopf. Avari wehrte sich nicht. Sie hatte mit Profis zu tun – die Vorkehrungen waren nicht vertrauenerweckend, aber nachvollziehbar. Avari hätte an Stelle der Russen nicht anders gehandelt. Sie konzentrierte sich auf ihre Atemübungen. Es gab keinen Grund, ängstlich zu sein. Wie gerne hätte sie gewusst, warum Fridolin solche Angst vor ihnen hatte. Doch er hatte verbissen geschwiegen. Was immer sie fordern, hatte er nur gesagt, im Zweifelsfall gibst du nach.
Sie mochten etwa eine Dreiviertelstunde in der Luft gewesen sein, als Avari Druck auf den Ohren spürte – sie sanken. Minuten später setzten sie klatschend auf und schlitterten weiter. Avaris Oberkörper wurde vor- und zurückgeschleudert, bis feste Hände sie packten. Atmen. Es gab keinen Grund, ängstlich zu sein.
Ohne dass man ihr den Sack abnahm, musste sie in ein schaukelndes Boot wechseln, dessen Zweitaktmotor im Leerlauf brummte. Es war wohl Mittag inzwischen. Die Sonne traf sie von vorne, als sie die Gangway verließ. Die Gangway befand sich auf der linken Seite des Wasserflugzeugs, sie waren also nach Westen geflogen. Libyen. Avari stockte der Atem. Was zur Hölle machten sie in Libyen?
Zwei Leute stiegen mit ihr in das Boot und stützten sie dabei, Fjodor und Leonid vermutlich. Das Englisch, mit dem sie begrüßt wurden, war in einen dicken arabischen Akzent gekleidet. Als Antwort Arabisch mit russischem Akzent. Avari musste sich auf einen harten Schalensitz setzen. Der Zweitaktmotor röhrte auf, und das Boot brauste los.
Nach wenigen Minuten bremste das Boot ab, arabische Rufe schallten ihnen entgegen, es roch nach Algen. Sie stießen irgendwo an, mehrere Hände griffen nach Avari und zogen sie aus dem Boot. Sie wurde über Holzplanken gezerrt, zum Glück hatte sie sich für Schuhe mit niedrigen Absätzen entschieden. Dann einige Meter auf Sand, Motorengeräusche, sie wurde in ein Fahrzeug mit hohem Einstieg verladen, mehr Leute stiegen zu, es wurde eng, der Geruch von Schweiß und Tabak. Sie fuhren, eine Viertelstunde vielleicht, niemand sprach. Dann Halten. Türenöffnen, Leute sprangen aus dem Wagen, wieder wurde sie gepackt, nach draußen gezerrt, sie stolperte, aber sie konnte nicht fallen, überall waren Hände.
Endlich Stillstand. Wie auf ein stummes Kommando ließen alle Hände von ihr ab. Jemand zog ihr den Sack vom Kopf. Ihre Haare hatten sich elektrisch geladen, Avari spürte das Knistern. Ihre Frisur konnte sie vergessen.
Es war gleißend hell. Langsam öffnete sie die Augen, ließ ihnen Zeit, sich an das Licht zu gewöhnen. Sie befand sich in einem ungepflasterten Innenhof, der Putz blätterte von den sandfarbenen Mauern. Ihr gegenüber befand sich ein halb verfallenes, schmuckloses Gebäude, dessen unverglaste Fensteröffnungen sie anstarrten wie die Augenhöhlen eines Totenschädels.
Fjodor und Leonid standen links und rechts von ihr. Leonid trug noch immer seinen Kampfanzug, war jedoch unbewaffnet. Beim Eingang des Gebäudes und in den Ecken des Hofs hockten Araber in Wüstentarn, auf automatische Waffen gestützt. Fridolin, fluchte Avari still, wohin hast du mich geschickt?
Aus dem Gebäude trat ein Mann mit grauem Haar und braunem Vollbart. Er trug eine schlichte olivgrüne Uniform und Kampfstiefel. Die Kämpfer im Hof blieben hocken, doch veränderte sich ihre Haltung: die Waffen fester gepackt, die Blicke aufmerksamer, die Muskeln gespannter. Wie Schäferhunde, die Wolfsheulen hörten. Avari kannte das Phänomen. Ähnlich war es, wenn Fridolin einen Raum betrat.
Der Mann in der schlichten Uniform war zweifellos der, vor dem man sich zu fürchten hatte.
Fjodor sagte etwas auf Arabisch, der Mann kam auf ihn zu und schüttelte ihm die Hand. Leonid nickte er zu, Avari ignorierte er. Der Mann wechselte einige Worte mit Fjodor, dann rief er etwas in das Gebäude, man brachte einen Korbsessel heraus, er setzte sich.
»Abdallah al-Fattah«, sagte Fjodor, an Avari gerichtet, »der Oberkommandeur Libyens.«
Oberkommandeur in einem zerfallenen Staat? Warlord hätte es wohl besser getroffen. Avari wartete schweigend. Sie hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, was sie hier sollte. Jedes falsche Wort gefährdete ihren Auftrag. Vermutlich auch ihr Leben.
»Sie sind hier, weil Sie Ihre Kredite verlängern wollen, richtig?«
Avari nickte. Fischer & Söhne hatte einige Leichen im Keller. Diejenige, um die es hier ging, war eine der ältesten. Sehr bald hatte sie zu riechen begonnen – und bis heute nicht aufgehört.
2012 war bekannt geworden, dass der Libor manipuliert worden war. Beim Libor handelte es sich um einen Referenzzinssatz, zu dem sich die Banken gegenseitig Geld liehen. Einige der Großbanken, die den Zins festsetzten, hatten sich abgesprochen – für diese ausgetüftelte Art des Insiderhandels mussten sie stramme Strafen zahlen.
2016 fand die Bundesfinanzaufsicht heraus, dass auch kleinere Banken an den Manipulationen beteiligt waren. Sie bestimmten zwar nicht direkt die Höhe des Zinssatzes mit – doch wer gute Kontakte zu den Großbanken hatte, konnte sehr erfolgreich Wünsche äußern. Die besten Kontakte hatte Fischer & Söhne.
2018 einigte man sich auf einen Vergleich, und Fischer & Söhne zahlte 430 Millionen Strafe. Das hätte eigentlich die Pleite der Bank bedeutet, doch Fridolin war es gelungen, von Russland die benötigten Kredite zu bekommen. Nicht offiziell natürlich – auf dem Papier stammte das Geld von einer harmlosen Strohfirma. Im Gegenzug erhielten die Russen stille Anteile an Fischer & Söhne. Still waren die Anteile allerdings nur formal.
Eigentlich hätten die Kredite bereits zurückgezahlt werden sollen, doch Fischers Übernahme von EuroBinary war kostspieliger als erwartet. Und acht Tage bevor die erste Präsentation zum SAFE-Verschlüsselungssystem stattfinden sollte, stand Fischer & Söhne mit dem Rücken zur Wand.
»Ja«, sagte Avari, »wir möchten gern die Kredite verlängern.« Doch das war nicht wahr. Ihr Auftrag war ungleich schwieriger. Fischer & Söhne brauchte keinen Aufschub der Kredite. Fischer & Söhne brauchte neue.
Fjodor wiegte den Kopf. »Das ist leider nicht möglich.«
Avari konzentrierte sich auf ihren Atem. Einatmen. Ausatmen. Warten. Einatmen. Sie war stark. Ausatmen. Sie war gut. Warten. Sie war eine Siegerin. »Tatsächlich?«, fragte sie lächelnd. »Warum dann der Aufwand für dieses Treffen?«
Der Warlord zischte etwas, Fjodors Augen weiteten sich. Einen Millimeter nur, aber genug, dass Avari ahnte: Auch Fjodor hatte Angst. Ein bedeutsames Detail. Wenn ein Vertreter der russischen Staatsgewalt einen libyschen Freischärler fürchtete, hieß das zweierlei: Der Libyer kannte seinen Platz nicht. Und der Russe konnte nicht auf seine Vorgesetzten zählen.
Gut zu wissen.
»Er wird nicht verhandeln«, sagte Fjodor. »Nicht mit Ihnen.«
Wenn sie die Ablehnung akzeptierte, würde man sie gehen lassen? Fridolin würde sie verstoßen, Fischer & Söhne wäre pleite, ihre Karriere am Ende – aber sie hatte eine genügend große Summe gespart, um ein angenehmes Leben führen zu können.
Es war keine Option. Aurora Marianna Avari verlor nicht, ohne gekämpft zu haben.
Sie sah al-Fattah direkt in die Augen. »Er muss.«
Fjodor übersetzte, al-Fattah rief einen Befehl. Einen Augenblick später hatten seine Kämpfer sich aufgerichtet, die Gewehre im Anschlag, die Mündung auf Avari. Al-Fattah erhob sich aus seinem Korbsessel, trat nah an Avari heran. Er war einen halben Kopf größer als sie, sah auf sie herab. Er roch nach Alkohol. Was er sagte, verstand sie nicht.
Die Luft stand schwül in dem ummauerten Hof. Auf Fjodors Stirn glänzte der Schweiß. »Was will er?«, fragte sie Fjodor ruhig.
Fjodor benetzte mit der Zungenspitze die Lippen. »Er verhandelt nicht mit einer weißen …«
»Einer weißen was?«
Fjodor schwieg.
Avari bemerkte, dass al-Fattah ihrer Konversation folgte. Verstand er Englisch? Es war kein besonders neuer Trick, in Verhandlungen ein paar Karten in der Hinterhand zu behalten.
Sie wandte sich ihm zu. Wenn ihr Eindruck stimmte, würde er jedes Entgegenkommen als Schwäche deuten. Sie war Aurora Marianna Avari. Es gab keinen Grund, ängstlich zu sein. Sie würde ihre Taktik ändern. »Herr Oberkommandeur. Sind Sie eingeschüchtert? All die Waffen gegen eine einzelne Frau?«
Al-Fattahs Kiefer spannten sich, offenbar verstand er sie tatsächlich. Er wollte etwas erwidern, Avari hob die Hand. »Sie haben recht.« Es war nicht Wahnsinn. Es war ihre einzige Chance. »Sie sollten eingeschüchtert sein.« Sie sagte es so leise, dass sie fürchtete, die anderen würden das Hämmern ihres Herzens hören. »Ich bin umfassend bevollmächtigte Vertreterin des bedeutendsten Finanzunternehmens Europas. Sie möchten einen Krieg gewinnen«, noch immer wusste sie nicht, warum sie eigentlich hier war, sie konnte nur raten, »dafür brauchen Sie unsere Hilfe. Sagen Sie, was Sie benötigen. Ich sage Ihnen, was möglich ist. Danach können Sie mit mir machen, was Sie wollen.«
Es war sehr still. Ein Schatten legte sich über den Innenhof, eine Wolke hatte sich vor die Mittagssonne geschoben. Die Kämpfer hielten ihre Waffen weiterhin auf Avari gerichtet.
Fjodor wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er öffnete den Mund, doch al-Fattah gebot ihm Einhalt. »Frau Avari«, sagte er, wie zuvor kam er nah an sie heran. »Sie sind schlank wie eine Gazelle. Wissen Sie, was die Gazelle macht, wenn der Löwe zur Wasserstelle kommt?« Er beugte sich noch näher zu ihr herab. »Sie flieht.«
Avari hielt seinem Blick stand. »Sie verwechseln mich. Ich bin nicht die Beute. Ich bin die Jägerin.«
Al-Fattahs rechtes Auge wirkte trüb, kündigte den grauen Star an; er würde sich bald operieren lassen müssen. Auf seiner Unterlippe schimmerte ein Herpesbläschen. Die Wolke wanderte weiter, die Sonne flutete den Hof. Avari spürte, wie ihr ein Schweißtropfen das Nasenbein entlang rann. Sie widerstand dem Drang, ihn wegzuwischen, verharrte weiterhin reglos, den Blick auf al-Fattah gerichtet.
»In Ordnung«, sagte al-Fattah, »wir verhandeln.«
Neben ihr stieß Fjodor die Luft aus.
»Nur, damit keine Missverständnisse entstehen«, sagte Avari, »lassen Sie mich die Lage noch einmal zusammenfassen.«
Sie saßen zu viert an einem niedrigen Tisch und tranken Tee. Al-Fattah, die beiden Russen und Avari selbst. Fjodor hatte den Deal geschildert.
»Kommandeur al-Fattah braucht Waffen für seinen Befreiungskrieg«, begann Avari. Sie achtete darauf, dieselben Begriffe zu gebrauchen wie ihre Gesprächspartner. »Fjodor will ihm helfen, aber weil die französische Marine das Mittelmeer kontrolliert, kann er ihm keine russischen Waffen schicken. Allerdings hat die deutsche Regierung eine Lieferung an Rüstungsgütern für Ägypten autorisiert. Fjodor hat Freunde in Kairo, die ihm versichert haben, sie würden die Lieferung nicht vermissen, wenn sie ausfiele. Wenn allerdings ein Frachtschiff zehn Container mit Rüstungsgütern verliert, dürfte die eine oder andere Ratte zu schnüffeln beginnen. Glücklicherweise ist Fjodor mit der Geschäftsleitung einer dänischen Reederei befreundet, die bereit wäre, die Lieferung zu übernehmen. Und just in diesem Moment tun sich private Spender auf, die Hilfsgüter für die libysche Bevölkerung zur Verfügung stellen wollen. Die Reederei freut sich, diesen Auftrag ebenfalls übernehmen zu dürfen. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht geschieht ein Missgeschick während der Verladung, und die Container werden vertauscht. Plötzlich landen die Waffen in Libyen und die Kondensmilchpackungen in Ägypten.« Sie lächelte geflissentlich. »Und da die ägyptische Bevölkerung gerade nicht besonders glücklich ist mit ihrer Situation, würde sie sich über die Milch durchaus freuen. Es gäbe also keinen zwingenden Grund, das Missgeschick zu korrigieren.«
Avari interessierte sich wenig für Politik, aber es war klar, warum die Russen Interesse hatten, einen libyschen Warlord zu unterstützen. Chaos an der Nordküste Afrikas sorgte für eine weitere Eskalation der Flüchtlingskrise, sorgte für rechte Parteien in Südeuropa, sorgte für eine weitere Destabilisierung der EU. Und das war das außenpolitisch wichtigste – wenn auch unerklärte – Ziel des Kreml.
»So ist es«, bestätigte Fjodor ihre Zusammenfassung.
»Gut«, Avari sammelte sich für die eine brisante Frage, die bisher unbeantwortet geblieben war. »Und wie können wir Ihnen helfen?«
»Das deutsche Kriegswaffenkontrollgesetz überprüft recht genau, welche Gelder bei Rüstungsexporten fließen«, erklärte Fjodor.
Avari bemühte sich, ihren Schrecken zu verbergen. »Sie wollen, dass FisherEuroBinary die Transaktionen abwickelt.«
Der Schreck rührte nicht von den moralischen Implikationen – im globalen Wettbewerb konnte sich kaum noch jemand leisten, den Wertvorstellungen der Öffentlichkeit zu folgen. Außer – und das war die Krux – die Öffentlichkeit hatte sich auf dich eingeschossen. Und FisherEuroBinary stand im Fadenkreuz. Der Bundesfinanzaufsicht, der Medien, der Wutbürger, der Konkurrenz.
»Nein«, sagte Avari.
Mit höchster Wachsamkeit nahm sie die Reaktionen wahr. Leonid verschränkte die Arme und senkte das Kinn auf die Brust. Al-Fattah hatte die Hände in den Schoß gelegt, wirkte unbeteiligt, fast entspannt. Fjodor beobachtete sie mit zur Seite geneigtem Kopf. Al-Fattah mochte seine Gorillas haben, aber Avari spürte, Fjodor war die größere Gefahr.
»Was?«, fragte er.
»Nein.«
»Das meinen Sie nicht ernst.«
Natürlich nicht. Aber sie hatte einen Auftrag. »Das Risiko ist zu hoch.«
Ein harter Zug legte sich um Fjodors Mundwinkel. »Hat Herr von Wolfenweiler Ihnen nicht gesagt, dass wir ihn in der Hand haben?«
Hatte er nicht. Avari zuckte mit den Schultern. Doch ihr Magen zog sich zusammen. Egal, was sie fordern, erinnerte sie sich wieder an Fridolins Worte, im Zweifel gibst du nach. Schweigend griff sie nach ihrer Tasse, nahm einen Schluck von dem Tee.
»Sechs Monate«, sagte Fjodor, »wir verlängern die Kredite um sechs Monate.«
Der Tee war so süß, als wäre ein Zuckerstreuer hineingefallen. Kaffee wäre ihr lieber gewesen.
»Nein.«
Hier drinnen war es kühl. Dennoch leuchtete wieder Schweiß auf Fjodors Stirn. Avari war sich sicher: Es ging bei diesem Treffen nicht nur um ihr eigenes Überleben, es ging auch um seines.
»Zwölf Monate«, sagte sie, »und eine Verdopplung der Kreditsumme.«
Fjodor starrte sie mit offenem Mund an.
»Ja«, log Avari, »Herr von Wolfenweiler hat mir gesagt, was er Ihnen schuldet. Dieser Deal ist wichtig für uns.« Sie schenkte Fjodor ihr unschuldigstes Lächeln. »Genauso wichtig wie für Sie.«
3. Kapitel
Es war Montag.
Anna-Lena Herbst stand am Bett ihres Bruders und legte ihm die Hand auf die Brust. Durch das dünne Pflegehemd konnte sie seinen Herzschlag spüren, langsam, gleichmäßig.
»Rafael«, sagte sie.
Wie immer reagierte er nicht.
»Du wirst aufwachen.«
Es war eine Formel. Anna-Lena Herbst spürte nichts.
»Bis morgen.« Sie griff nach ihrer Sporttasche. »Ich muss ins Training.«
4. Kapitel
»Lust auf ein Bier?«
Nicky starrte ihn mit großen Augen an.
»Was ist?«, fragte Varta, während er nach seinem Mantel griff. »So gern ich meine Zeit zwischen blinkenden Festplatten verbringe – Dehydrieren ist auch nicht gut.«
Nickys Augen wurden noch größer. »Alkoholgenuss ist die häufigste Ursache hypertoner Dehydration. Mit jedem Bier, das Sie konsumieren, entziehen Sie Ihrem Körper die dreifache Menge Wasser.«
»Nicht in meiner Welt.« Varta grinste. »Im Übrigen: Haben wir nicht vereinbart, dass wir uns duzen wollen?« Er konnte nicht sagen, wieso, aber irgendwie mochte er dieses neunmalkluge französische Psycho-Mädchen.
Nicky hielt die Augen gesenkt. »Ich trinke nicht.«
»Nie?«
»Bisher nicht.«
»Na dann«, lachte Varta, »es ist Montag – der beste Tag, um anzufangen.«
Bevor Nicky ihn fragen konnte, was an Montagen so besonders war, packte er sie am Handgelenk und zog sie aus dem Serverraum. Durch die Schleuse und an dem Sicherheitsmann vorbei gelangten sie zum Fahrstuhl. Varta wählte die Garage, die sich zwei Stockwerke unter der Lobby befand.
»Fährst du Motorrad?«
Nicky schüttelte den Kopf.
Er führte sie zu seiner flammlackierten Kawasaki Ninja. »Eigentlich ist der Sitz nicht für Beifahrer ausgelegt, aber das kriegen wir schon hin.« Er öffnete das Schloss des Karabiners, mit dem er seinen Helm am Lenker befestigt hatte.
»Ich habe keinen Helm«, murmelte Nicky.
»Du kannst meinen haben.«
»Dann hast du aber keinen.«
»Stimmt.« Varta setzte ihr den Helm auf.
»Ohne Helm zu fahren, ist illegal. Und erhöht die Verletzungsgefahr bei Unfällen beträchtlich. Lässt du die Turnschuhe an?«
Varta zog ihr den Kinnriemen fest. »Wer frei sein will«, grinste er, »lebt gefährlich.« Dann schwang er sich auf die Maschine.
Als sie vor der Frankfurter Hauptwache hielten, tränten Varta die Augen vom Fahrtwind. »Du kannst deine Fingernägel wieder aus meinen Eingeweiden nehmen«, rief er fröhlich. Doch als er sah, wie Nicky zitternd von seinem Motorrad stieg, zweifelte er kurz, ob er ihr zu viel zugemutet hatte. Rasch nahm er ihr den Helm ab. »Alles in Ordnung?«
Nicky starrte ihn an. »Das war das Verrückteste, was ich je gemacht habe.«
Ihr Gesicht war papierweiß.
»War es schlimm?«
Nicky zog ihre Bluse zurecht. Dann hob sie den Blick. »Es war … großartig.«
»Nicht wahr?« Beglückt drückte er sie an sich. »Und jetzt Bier.«
Er zog sein Handy hervor. Zwei Tipper später entschied er: »Wir gehen ins Mountain Lion. Das ist der Bunker da vorne.«
Während sie an der Katharinenkirche vorbeiliefen, fragte Nicky: »Sollten wir uns nicht um Alyattes kümmern? Herrn Wu scheint diese Präsentation nächste Woche sehr wichtig zu sein.«
»Ach was. Die Zeit reicht sowieso nicht, einen neuen Ansatz zu entwickeln. Also werden sie einen der alten nehmen und versuchen, ihn so aufzumotzen, dass die EU bereit ist, weiter ihr Geld zu versenken.«
»Warum hasht ihr nicht einfach die Sekundär-Layer paarweise und splittet sie dann wieder in Abhängigkeit von ihrer Prüfsumme?«
Varta blieb stehen vor Überraschung. »Ich wusste nicht, dass Tao dir schon den Front-End-Build gezeigt hat.«
»Hat er nicht. Wie kommst du darauf?«
Varta stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Du bist echt smart, weißt du das?«
»Ja.«
»Wenn wir die Layer splitten, erhöhen wir die Vulnerabilität im Default.«
»Das System wäre trotzdem sicherer als die aktuell verwendeten.«
»Vermutlich.« Varta dachte nach. »Allerdings habe ich den Back-End-Build nicht gesehen. Und die EU hat sich für ein Blockchain-basiertes Konzept entschieden, weil Blockchain in der Öffentlichkeit nun mal einen guten Ruf hat. Aber nur wenn es eine echte Alternative zu SWIFT darstellt, hat es eine Chance, angenommen zu werden.«
»Oder zumindest wie eine Alternative aussieht.«
Aus Höflichkeit fluchte Varta auf Ungarisch. Dann sagte er: »Tao steht enorm unter Druck. Die Schneckenhirne über ihm haben klargemacht, dass er weg vom Fenster ist, wenn Alyattes scheitert. Und da die sowieso nicht checken, um was es geht, kann man ihnen schlecht zeigen, wo die Probleme liegen. Wir sind da.«
Vor ihnen öffnete sich die goldene Pforte eines vielstöckigen Luxushotels.
»Tamás«, Nicky strich sich eine Strähne ihres buschartigen Schopfes hinters Ohr. »Darf ich dich etwas fragen?«
»Klaro.«
»Im Interview mit der GamesView hast du 2011 gesagt, dass du Großkonzerne für die größte Gefahr für den Weltfrieden hältst. Warum arbeitest du jetzt für FisherEuroBinary?«
Varta lachte. »Abgesehen davon, dass ich damals putzige sechzehn war – ich wurde als Pentester angeheuert. Ich arbeite nicht im eigentlichen Sinn für FEB. Ich zeige ihnen die Lücken in ihren Codes. Wenn es um den Finanzhandel Europas geht, ist das doch ein ehrenwertes Ziel, oder?«
Nicky senkte den Blick.
Varta kratzte sich verlegen den vernarbten Unterarm. Sie hatte die richtige Frage gestellt. Die ehrliche Antwort lautete: In seiner alten Welt gab es keinen Platz mehr für ihn. »Ich kannte einmal ein Mädchen.«
»Was ist passiert?« Nicky fragte es so furchtsam, es war herzergreifend.
»Wir haben uns getrennt.«
»Wie traurig.«
»Ja.«
»Wie hieß sie?«
»Florentina.«
»Die Blühende. Ein schöner Name.«
»Lass uns reingehen.«
Eine dunkelblau livrierte Angestellte des Mountain Lion hielt ihnen die Tür auf. Varta warf einen Blick auf sein Handy und ging zur Rezeption.
Der Concierge musterte kritisch seine Kleidung. »Was kann ich für Sie tun?«
»Milán Swoboda«, antwortete er. »Ich habe meine Schlüsselkarte verloren.«
Der Concierge gab den Namen in seinen Computer ein. Zwei Sekunden später war seine Miene pure Freundlichkeit. »Einen Augenblick.« Er holte eine neue Schlüsselkarte hervor, aktivierte sie und reichte sie Varta. »Einen schönen Tag, Herr Swoboda.«
Die Schlüsselkarte gab den Zugang zu den Fahrstühlen frei. Varta wählte das oberste Stockwerk: die Sky Lounge.
»Woher hast du gewusst, dass dieser Swoboda im Hotel ist?«, fragte Nicky.
Varta hielt sein Handy hoch. »Vor ein paar Jahren wurde die größte Onlinebooking-Plattform der Welt gehackt. Und seitdem kann man für nur ein paar Euro erfahren, wer wo eingecheckt hat.«
»Vor Jahren? Da muss die Sicherheitsarchitektur doch längst überarbeitet worden sein.«
»Wurde sie nicht.«
Nicky nahm ihre Brille ab, zog ein Tuch aus ihrem Mantel und begann, sie zu putzen.
»Du machst das, wenn du nervös bist, oder?«
»Was?«
»Bist du nervös, weil wir die Schlüsselkarte ergaunert haben oder weil du ausnahmsweise einmal etwas nicht verstehst?«
Nicky widmete sich schweigend ihrer Brille.
»Die Sicherheitsarchitektur wurde nicht angepasst, weil niemand je von dem Hack erfahren hat.« Er zwinkerte Nicky zu. »Bis auf ein paar aufmerksame Beobachter, natürlich.«
Die Sky Lounge war mit braunem Teppichboden ausgelegt, das Mobiliar war in Rottönen gehalten, ein Pianist improvisierte an einem Flügel. Die letzten Strahlen der Novembersonne glitten durch Panoramafenster in den Raum. Der Barkeeper trug kein Sakko, aber Hemd, Fliege und Hosenträger. Varta bestellte zwei Daiquiri und bezahlte bar. Eine verlorene Schlüsselkarte interessierte niemanden – aber würde Varta sie zur Abrechnung benutzen, wäre es durchaus möglich, dass der gute Herr Swoboda Ärger machen würde.
Sie fanden einen abgeschiedenen Zweiertisch, Varta reichte Nicky einen der Daiquiris.
»Auf dich!«
Nicky starrte ihn an. »Warum denn auf mich?« Sie war wirklich eine Süße.
»Weil du heute zum ersten Mal in deinem Leben etwas Verbotenes tust.«
»Ich habe nichts Verbotenes getan!« Auf ihren Wangen hatten sich rote Flecken gebildet. »Du bist es, der ohne Helm gefahren ist. Du hast den Concierge angelogen.«
»Das meine ich auch nicht.« Varta grinste. Er beugte sich über den Tisch zu Nicky hinüber, näherte sich mit den Lippen ihrem Ohr. Sie zuckte zurück, doch nur Zentimeter. Er wisperte: »Ich habe uns ein gewisses Methylendioxymethylamphetamin in die Daiquiris getan. Weißt du, was das ist?« Er musste lächeln. Natürlich wusste sie es. MDMA.
Nicky griff nach ihrer Brille.
Sie standen auf dem Dach des Mountain Lion und blickten hinunter auf die glitzernde Frankfurter Nacht. Varta hatte die Feuertreppe gefunden. Gegen alle Wahrscheinlichkeit war keine der Türen alarmgesichert gewesen.
Ein leichter Regen setzte ein. Fasziniert beobachtete er, wie Nicky versuchte, auf das Dach des Treppenturms zu klettern. Er hatte ihr die minimale Dosis gegeben, er wollte nicht schuld daran sein, dass sie eine Psychose bekam.
»Komm da runter«, rief er lachend. »Das wird nichts.«
»Tamás, ich springe«, rief sie zurück, sie hing an der Dachkante wie ein Beutel Kaffeesatz. »Du fängst mich auf, ja?«
»Bitte tu das nicht!«
»Zu spät.« Nicky ließ die Dachkante los.
Varta versuchte, ihren Fall abzufedern, stattdessen stürzten sie beide. Lachend blieben sie liegen. Der Regen knisterte leise.
»Du, Tamás?«
»Ja?«
»Ich will nie wieder nüchtern sein.«
»Warum?«
»Weil ich nicht aufhören kann zu denken, wenn ich nüchtern bin.«
Tamás stützte sich auf einen Ellenbogen, sah sie an. Die nassen Haare klebten ihr im Gesicht. »Du bist nicht anders.«
»Was meinst du?«
»Dein ganzes Leben lang wurde dir gesagt, du bist besonders. Das ist nicht wahr.«
»Ich bin besonders.«
»Ja. Jeder Mensch ist besonders. Oder niemand. Eine Frage der Perspektive. Wenn du die erste einnimmst, vergisst du, dass du Bedürfnisse hast wie jeder andere Mensch auch. Du brauchst keine Drogen.« Er strich ihr die Haare aus dem Gesicht. »Du brauchst jemanden, dem egal ist, wie klug du bist.«
Nickys Brille war verrutscht, sie schob sie wieder gerade. Varta wusste, was das Skript von ihm verlangte, doch er konnte nicht. Nickys unschuldige Aufregung stach ihm in die Brust. Manche Dinge wurden schwieriger, je mehr man sich nach ihnen sehnte. Der Beton schmerzte unter seinem aufgestützten Ellenbogen, er ließ sich wieder auf den Rücken sinken.
»Du, Tamás?«
»Ja?«
»Warum hast du den Back-End-Build nicht gesehen?«
Tamás musste lachen. »Wirklich? Jetzt, hier – und du denkst an die Arbeit?«
»Komm, sag schon.«
»Aus Sicherheitsgründen werden die Kernelemente unabhängig voneinander geprüft. Tatsächlich sind die Chefs so paranoid, dass sich die Teammitglieder nicht kennenlernen dürfen. Tao muss den Vermittler spielen. Nicht einmal ich selbst kenne die Tester für den Back-End-Build.«
»Merkwürdig.«
Etwas in ihrer Stimme beunruhigte ihn. »Was?«
»Herr Wu hat mir gesagt, er wolle mir den Penetrationstester vorstellen, nicht einen von ihnen.«
»Vielleicht erinnerst du dich nicht richtig.«
»Bitte.«
»Entschuldigung.«
»Wenn wir annehmen, es war kein Missverständnis, und es gibt keine Tester für den Back-End-Build, wäre das nicht merkwürdig?«
»Dann wäre meine Arbeit sinnlos.« Vartas Mantel war durchgeweicht, langsam wurde das Liegen auf dem Steinboden unbequem.
»Du, Tamás?«
»Ja?«
»Du hast recht. Wenn ich Dinge nicht verstehe, macht mich das nervös.«
Tamás schwieg. Ihm fiel nur ein einziger Grund ein, weswegen man sich dagegen entschieden haben könnte, den Back-End-Build zu testen – es gab eine Lücke im Code. Eine Lücke, die nicht entdeckt werden sollte. Die Blockchain sollte nicht sicher sein. Aber warum?
Ihn fröstelte.
Dienstag
… was von Ungarn vehement zurückgewiesen wird. Der EU bleibt nun nichts anderes übrig, als das Strafverfahren weiterzuführen. Um Ungarn das Stimmrecht im Europäischen Rat zu entziehen, ist allerdings ein einstimmiger Beschluss erforderlich. Dies gilt nahezu als ausgeschlossen. Polen hat bereits klargestellt, keinerlei Sanktionen mittragen zu wollen …
5. Kapitel
Mein Lebenswerk. Ich habe es dem Teufel verkauft.
Cate Beheim saß in ihrem Büro der Michael-Ende-Gesamtschule Offenbach und nahm eine Diazepam-Tablette. Die dritte heute. Die erste Schulstunde war noch nicht vorbei.
Zeit ihres Lebens hatte Beheim weitestgehend auf Medikamente verzichtet. In ihrer Laufbahn als Lehrerin und Schulpsychologin hatte sie zu oft den elenden Versuch gesehen, Kinder mit Pillen zu erziehen statt mit Aufmerksamkeit.
Dann hatte sich Stefan das Leben genommen. Und Cate Beheim, die sich immer für stark gehalten hatte, die immer die Trösterin gewesen war, stürzte in eine bodenlose Tiefe ohne Licht.
Es klopfte.
»Ja?«
Ein junger Kollege steckte den Kopf zur Tür herein. Er war zu Beginn des Schuljahres erst dazugestoßen, sie hatte seinen Namen vergessen. Das war ihr früher nie passiert.
»Cate, kannst du mal kurz nach der 7a gucken? Ich glaube, Anna braucht Hilfe.«
»Hat sie mit dir geredet?«
»Nee, bin nur gerade am Zimmer vorbeigelaufen, klang nach Stress.«
»Okay, ich schau mal.«
Beheim ging zu dem genannten Klassenzimmer. Anna war Referendarin, Beheim Seminarlehrerin, also war sie zuständig. Obwohl Offenbach sich die letzten Jahre gemausert hatte, war es immer noch keine Stadt für Flitterwochen. Die Michael-Ende-Gesamtschule bot alles an Abgründen, die das Bildungsbürgertum sich mit wohligem Schaudern für das Milieu ausmalte, welches es für den gesellschaftlichen Rand hielt: Drogen, Springmesser, sexuelle Übergriffe – und natürlich Kinder, deren Eltern kein Deutsch sprachen.
Beheim besaß vierzehn Prozent der Stammaktien von FisherEuroBinary; sie ging nicht in die Arbeit, weil sie das Geld brauchte. Sie liebte, was sie tat. Bei ihren Referendaren war es anders.
Schon vom Treppenhaus aus hörte sie den Lärm, der aus dem Klassenzimmer der 7a drang. Sie klopfte an die Tür. Laut genug, um das Geschrei dahinter zu übertönen.
Anna öffnete. Sie war groß, sportlich, trug ein Blümchenkleid und Pippi-Langstrumpf-Zöpfe. Die Erleichterung in ihren flackernden Augen zeigte Beheim, dass es höchste Zeit war.
»Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. Passt es dir gerade?« Die erste Regel der Erziehung lautete Konsequenz. Und das bedeutete, Autorität niemals vor den Augen derer infrage zu stellen, die erzogen werden sollten.
Anna nickte fahrig. »Ja, bitte. Komm rein.«
Die Klasse war im Krieg. Der Raum dröhnte von dem Johlen, Schreien und Brüllen aus zwei Dutzend Kehlen. Mülleimer kullerten über den Boden, Bücher flogen aus dem Fenster, Tische krachten gegeneinander, Penisse prangten an der Tafel und den Wänden.
Beheim betrat den Raum.
Alle erstarrten.
»Setzt euch bitte.«
Alle suchten ihre Plätze auf.
»Tarek, nimm den Besen vom Fensterbrett. Ceyda, wasch dir die Hände. Roman, zieh dein T-Shirt wieder an. Die anderen räumen den Boden auf und stellen die Sitzordnung wieder her.«
Die Schülerinnen und Schüler gehorchten, schweigend, sorgfältig darauf bedacht, Beheims Blick auszuweichen.
Als der Raum wieder halbwegs hergerichtet war, fragte Beheim: »Warum seid ihr hier?«
»Weil wir lernen wollen, was in uns steckt.« Die Antwort kam im Chor, es war ein Ritual, dessen genaue Wortwahl Beheim mit jeder Klasse neu verhandelte.
»Warum ist Frau Aster hier?« Anna stand zerrüttet neben der Tür.