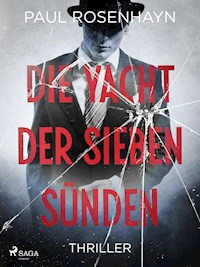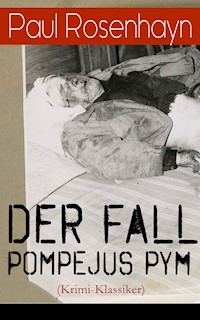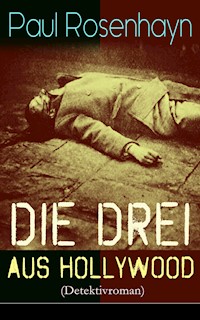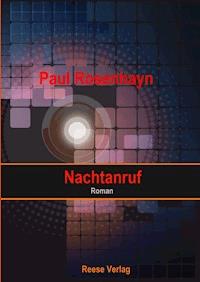Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In 'Die drei aus Hollywood' von Paul Rosenhayn handelt es sich um einen fesselnden Detektiv-Krimi, der die Leser auf eine packende Reise durch die Welt des Films und der Verbrechen mitnimmt. Rosenhayns literarischer Stil zeichnet sich durch seine präzise Beschreibung von Details und seine knackigen Dialoge aus, die die Spannung des Romans weiter steigern. Das Buch spielt in der glamourösen Umgebung von Hollywood und verwebt geschickt die Welt des Films mit der düsteren Realität von Verbrechen. Durch seine geschickte Verknüpfung von Unterhaltung und Spannung hebt sich 'Die drei aus Hollywood' von anderen Krimis ab und bietet den Lesern ein einzigartiges Leseerlebnis. Paul Rosenhayn, der Autor, ist selbst ein großer Filmfan und hat seine Leidenschaft für das Kino in dieses Buch integriert. Seine genaue Beobachtungsgabe und sein Sinn für Details bringen die Welt von Hollywood und seinen Schattenseiten eindringlich zum Leben. Mit 'Die drei aus Hollywood' bietet Rosenhayn den Lesern einen unterhaltsamen und fesselnden Krimi, der Filmfans und Krimiliebhaber gleichermaßen ansprechen wird. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für die dunklen Geheimnisse hinter den Kulissen des Films interessieren und gleichzeitig nach einer spannenden Lektüre suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die drei aus Hollywood
Table of Contents
I.
Peter Thornquist fuhr verwirrt aus dem Schlaf empor. Er richtete sich im Bette auf. Das Zimmer war dunkel. Das Fenster, das auf den lichtlosen Hof blickte, war geöffnet; er wußte, daß er es am Abend empor geschoben und festgeriegelt hatte.
Undurchdringliche Septembernacht lag über dem Geviert des Hofes. Thornquist fühlte noch das Klopfen seines Herzens, noch zitterte das jähe Erschrecken in ihm nach. Aber es mußte ein Irrtum gewesen sein. Vielleicht ein Traum. Ärgerlich lehnte er sich in die Kissen zurück.
Da, plötzlich, kam von neuem der Ton durch die Nacht: jenes unerklärliche Gelächter.
Es war also kein Irrtum gewesen.
Er sprang aus dem Bett und ging über den weichen Fries, der den Boden bedeckte, ans Fenster.
Alles war in schweigendes Dunkel gehüllt. Gleichwohl – aus einem dieser Fenster, die sich verhundertfachten, die in regelmäßigen und monotonen Reihen im Rechteck den Hof säumten, in acht, zehn, zwölf Stockwerken – aus einem dieser Fenster mußte dieses beklemmende Gelächter gekommen sein. Das war das Lachen einer Frau gewesen, er hatte es ganz deutlich gehört. Es war an sich gewiß nichts besonderes, wenn in einem Straßenblock, der aus Hotels und Boardinghäusern bestand, menschliche Stimmen aufklangen – aber dieser Ton hatte etwas so Unnatürliches und Furchterregendes gehabt, dieses Lachen in der Tiefe der Nacht – er fühlte es; in diesem gellenden Gelächter lag Furcht. Vielleicht Entsetzen.
Merkwürdig, nichts neben ihm, unter ihm rührte sich. Hatte keiner außer ihm die Frauenstimme gehört?
Aber das war diese verwünschte deutsche Weichherzigkeit. Immer noch ergriff es ihn, wenn er fremdem Leid begegnete; mitten im rasenden Tempo dieses New York konnte er stehen bleiben, sich um ein Kind, um einen Hund ängstigen. Die Menschen hasteten an ihm vorüber: Amerikaner, Neger, Zugewanderte – alle erfaßt von dem erbarmungslosen Tempo dieser Stadt, mit einem flüchtigen Blick auf den komischen Fremdling, der Zeit hatte – für andere.
Ärgerlich über die Störung, nein, im Grunde ärgerlich über sich selbst, legte er sich von neuem schlafen. Das Ticken der Uhr störte ihn; sie stand auf dem Nachttischchen, er hatte sie bisher überhaupt nicht gehört; aber nun waren seine Nerven irritiert. Er knipste das Licht an.
Zehn Minuten nach drei.
Ein feines Summen tat sich auf; die Flamme hatte ein paar Moskitos angelockt; verdrießlich drückte er auf den Knopf.
Nun war das Zimmer wieder erfüllt von jener bläulichen Dunkelheit, die alle Dinge in einen gefährlichen und unentrinnbaren Schleier hüllte.
Er glaubte ein Geräusch zu hören, so als ob jemand mit leisen Schritten auf ihn zukomme; der Ton verstummte; plötzlich klang es aus einer anderen Richtung von neuem auf. Aber das waren die verdammten Nerven; er streckte sich im Bette aus, mit dem festen Willen, wieder einzuschlafen. Und bald schlief er wieder ein.
Peter Thornquist schrak aus dem Schlaf empor – mit dem bestimmten Gefühl: du bist nicht allein. Er konnte sich keine Rechenschaft über das Warum geben – das kam aus dem Unterbewußtsein. Eine beklemmende Angst stieg in ihm auf.
Er schaltete das Licht ein.
Dort, am Fenster, stand eine junge Dame. Thornquist richtete sich betroffen auf. Ihm fiel ein: unweit des Fensters lief die Feuerleiter ...
Die Fremde sah ihm unverwandt ins Gesicht. Sie war in einem dunklen Pyjama; sie war hübsch und jung. Während er sie betrachtete, trat in ihr Gesicht ein Ausdruck, den er nicht verstand.
»Was wünschen Sie?«
Die junge Dame zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen.
Nein: so sah keine Diebin aus. Und auch keine, die auf ungewöhnliche Weise ein galantes Abenteuer suchte.
Sie war von dunklem Typ: das Haar fast schwarz, die Augen, in denen der angsterfüllte Ausdruck wuchs, schimmerten dunkelbraun.
Diese Frau war vor irgend etwas geflohen. Vor einem Menschen. Vor einer Gefahr. Vor einer drohenden Katastrophe. Vor irgend etwas, was ihr Grauen eingeflößt hatte. Er sah, daß sie zitterte.
Ein Laut kam aus dem Zimmer nebenan. Schritte klangen auf; deutlich hörte er murmelnde Stimmen. Die Fremde wandte betroffen den Kopf; sie drängte sich, wie in dem Wunsch sich unsichtbar zu machen, gegen die dunkle Portiere, die das Fenster umrahmte.
»Sind Sie in Gefahr?« fragte er hastig. Die Schritte nebenan kamen näher. »Kann ich Ihnen helfen? Woher kommen Sie?«
»Mein Herr –« ihre Stimme kam leise, furchterfüllt, durch die Stille des Zimmers. »Ich habe ... Ja, ich bitte Sie, mir zu helfen. Ich bin auf der Flucht ...«
In diesem Augenblick klopfte es laut an die Tür: ein ganz bestimmtes Klopfen.
Die Fremde stieß einen halb unterdrückten Schrei aus.
Thornquist ging zur Tür, schloß auf und trat auf den Flur hinaus.
Dort stand der Hotelbesitzer. Neben ihm zwei Fremde.
»Mr. Thornquist?«
»Was wünschen Sie?«
Der eine der beiden, der Größere, er war von der kühlen und harten Gelassenheit des amerikanischen Beamten, sah Thornquist herausfordernd ins Gesicht.
»Wir suchen eine Frau.«
Gereizt antwortete Peter Thornquist: »Wie kommen Sie dazu, mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu stören?«
Der andere, unbeirrt, als ob er den unfreundlichen Ton gar nicht bemerkte, nickte.
»Diese Frau ist bei Ihnen.«
»Das ist nicht wahr«, sagte Peter kopfschüttelnd. Dabei wunderte er sich über seine eigene Dreistigkeit, Im nächsten Augenblick mußte sich die Lüge herausstellen. Aber er fühlte, das war wieder diese verdammte deutsche Ritterlichkeit. Diese Frau war in Not. Sie wurde gehetzt. Er mußte sie beschützen.
Der vor ihm Stehende schob ihn mit einer merkwürdig geschickten Handbewegung zur Seite und stieß die Tür auf.
Nun mußte man entdecken, daß er die Unwahrheit gesagt hatte.
Das Zimmer war leer.
Der Große wandte sich halb herum, zu seinem Kollegen, der ihm, die Hände in den Hosentaschen, mit breitschultriger Gemächlichkeit folgte. Dann blickten die beiden auf Thornquist; in ihren Augen malte sich ehrliches Erstaunen.
»Hier ist wirklich keine Dame?« fragte der Kleinere.
»Ich sagte es Ihnen bereits«, wiederholte Peter, der weit erstaunter war als die beiden.
Der Größere legte die Hand auf den Drücker zum Kleiderraum. Peter fühlte, wie ihm das Blut zum Herzen schoß. Jener riß die Doppeltür auf, automatisch schaltete sich das Licht ein.
Der Zweite, der im Hintergrunde des Zimmers geblieben war, vielleicht um Peter den Rückzug abzuschneiden, sah dem Kollegen neugierig zu. Der nickte anerkennend:
»Schöne Garderobe haben Sie! Der Smoking ist seine siebzig Dollars wert« und drückte die Doppeltür behutsam wieder zu.
»Sie ist nicht da«.
Der andere blickte unter das Bett, er ließ den Strahl der Taschenlampe hinter die Möbelstücke fallen. Das alles war überflüssig. Denn das ganze Zimmer war erleuchtet. Er blickte unter die Bibliothek.
»Haben Sie sich jetzt überzeugt?« erkundigte sich Peter.
»Hm. Sie erlauben ...« damit schlug der Größere, der offenbar der Führer war, die Bettdecke zurück.
»Tja« sagte er. »Das ist eine merkwürdige Geschichte. Wir suchen eine gewisse Susie Lacombe. Filmschauspielerin soll sie sein. Sie ist weiß Gott nicht hier. Aber sie ist hier gewesen. Oder ich will mit Gene Tunney drei Runden boxen.«
»Jetzt haben Sie wohl die Güte, die Tür von draußen zuzumachen.«
Der Beamte kniff ein Auge zu und wandte den Kopf zum Fenster. Er schürzte die Lippen; indem er, den Blick auf eine unsichtbare Spur geheftet, auf das Fenster zutrat, nickte er dem Kollegen zu.
Plötzlich drehte er sich zu Thornquist herum. » Was treiben Sie in New York?« fragte er, mit dem Finger inquisitorisch auf Thornquist deutend.
Thornquist antwortete, indem er zur Tür ging: »Ich wünsche jetzt zu schlafen.«
»Sie sind Deutscher?« fragte der andere, ohne sich im geringsten um die Abweisung zu kümmern.
»Gute Nacht,« Damit machte Thornquist die Tür auf.
»I say, old chap: so spricht man nicht mit uns. Entweder Sie sagen mir jetzt auf der Stelle, was Sie in New York treiben ... oder ich ...«
Damit schlug er die halb geöffnete Tür krachend ins Schloß.
Peter Thornquist zog fröstelnd den Kragen des Schlafanzugs hoch. Er ging langsam auf die beiden zu, die ihm mißtrauisch entgegenblickten; halblaut sagte er, so als ob er eine gesellschaftliche Floskel ausspräche:
»Wie denken Sie über S-L-Y?«
Die beiden sahen sich an. Sie wandten ihre Gesichter langsam, überrascht, Thornquist zu; wieder blickten sie einander an; wie auf ein unhörbares Kommando tippten sie mit den Zeigefingern an den Hutrand, und der Größere sagte:
»Das ist etwas anderes. Also nix für ungut. Blödsinnige Geschichte das mit dieser Susie Lacombe. Aber was kann man machen? Wenn sie nicht da ist, ist sie eben nicht da. Habe ich recht?«
»Zweifellos«, sagte Thornquist.
»Well, sir. Tut uns leid, Sie gestört zu haben. Schlafen Sie ruhig weiter. Und sollten Sie was von dieser Susie Lacombe hören: telephonieren Sie an die Einundfünfzigste Division.«
Noch einmal wandten ihm die beiden ihre betroffenen Gesichter zu; dann zogen sie geräuschlos die Tür hinter sich ins Schloß.
Peter Thornquist stand einen Augenblick lauschend. Die Schritte der beiden verklangen in der Tiefe des Hauses. Er trat ans Fenster. Nichts war zu sehen. Ein Lichtstrahl flimmerte in das Dunkel des Hofes hinaus; aber alles war regungslos. Er zuckte die Achseln, drückte auf den Ausschaltknopf und ging mißmutig wieder schlafen.
*
Hollywood ...
Die Pfeife des Regisseurs schrillt durch das Atelier:
»Achtung ... Aufnahme ...!«
Von der Decke tropft das Licht aus zwanzig Spot-Lights nieder; dreißig Quecksilberlampen flammen im Kreise auf.
In den Ecken zischt es: hinter den Riffelscheiben der großen Aufheller.
Der Primas hebt den Geigenbogen. Zwanzig Zigeuner fallen ein: ein Kálmán'scher Walzer.
Der Regisseur nimmt das Megaphon.
Vierzig Paare wirbeln durch den Saal; Ballnacht auf Schloß Klausenburg.
Der Regisseur kommandiert:
»Komparserie ... langsam auseinandertanzen!«
Ein Dutzend Honvedoffiziere mit ihren Damen folgt dem Befehl. Aus der Menge löst sich ein junges Paar.
»Fräulein Lacombe – Sie tanzen mit Ihrem Partner in den Vordergrund!«
Wieder geht die Pfeife. Die Aufnahmeleiter nehmen das Signal auf; sie schreien in den Saal:
» Licht aus!«
Zischend erlöschen die Flammen. Nun fällt das Sonnenlicht auf geschminkte Gesichter. Auf den zerschlissenen Lack der Filmmöbel. Auf tausend Requisiten, denen das Grau des Tages mit einem Schlage ihren Zauber nimmt.
Die junge Filmschauspielerin löst sich aus dem Arm ihres Tanzpartners; mitten im Saal bleiben die beiden stehen. Die Komparserie zieht sich zurück, gelangweilt, übermüdet. In die Winkel des Raums, wo Latten und Kabelschnüre aufgestapelt sind.
Der Regisseur geht auf die beiden zu.
»Großaufnahme!«
Eben bringen zwei Boys ein Fahrgestell. Zwei andere montieren unter Assistenz des Kameramannes den Aufnahmeapparat auf die Tragfläche.
»Licht!«
Wieder flammt es auf; mit einem Schlage wird aus belanglosen Kulissen der Ballsaal des Schlosses Klausenburg.
»Fräulein Lacombe – Sie nehmen den Arm Ihres Partners, Tanzen Sie langsam im Takt der Melodie mit ihm durch den Saal.«
Die beiden schmiegen sich fester aneinander; in ihre Gesichter tritt ein zärtlicher und leidenschaftlicher Ausdruck. Während sie durch den Saal gleiten, folgt ihnen die Kamera. Der Operateur beobachtet jede Nuance ihrer Bewegungen; in wiegendem Rhythmus fixiert sich das Bild ihres Tanzes auf dem rollenden Zelluloidband.
Der Regisseur ruft:
»Fräulein Lacombe – Sie heben den Kopf! Nicht zu sehr, ein wenig tiefer, bitte. So, danke. Herr Boothby: Sie werden durch die Bewegung Ihrer Partnerin aufmerksam. Sie sehen ihr in die Augen. In die Augen, Herr Boothby – in die Augen, nicht auf die Schultern! So, ausgezeichnet, meine Herrschaften. Jetzt bleiben Sie in Ihrem Tanze auf einem Fleck. Deuten Sie nur annähernd den Rhythmus an. Ihre Blicke versenken sich ineinander – Sie fangen Feuer. Haben Sie verstanden, Herr Boothby, Feuer! Ich danke. Aus!«
»Licht aus!« echot der Chor der Aufnahmeleiter.
Zischend erlöschen die Flammen.
*
Achtzig Komparsen strömten in die Kantine. Begleitet von Beleuchtern, Bühnenarbeitern, Malern, Friseuren und jenem Troß, der um das lockende Licht des Filmateliers schwirrt.
Der Regisseur stand, den Bleistift in der Hand, in der Ecke und notierte die Einstellungen für die nächste Aufnahme. Drüben warteten zwei, drei Journalisten. Gespannt. Sozusagen schußbereit.
Der Regisseur ging indessen durch die nächstbeste Tür von dannen. Ein Ereignis, das außerhalb aller Erwartungen lag.
Während er die Treppe hinunterging, begegnete ihm Mr. Shamrock vom »Standard«, dem großen Filmblatt.
»Hulloah, sir!«
»Hulloah, sir!«
»Gut, daß ich Sie treffe. Sie müssen mir den Inhalt Ihres Films erzählen.«
Dumpf sagte der Regisseur: »Meinetwegen. Kommen Sie mit in die Kantine.«
»Und dann: ich brauche ein Bild von Ihnen. Und von Miss Lacombe. Von ihrem Partner. Und vor allem von diesem Ladinser, dem Autor.«
»Er ist noch nicht da. Wir erwarten ihn jede Stunde.«
Während die beiden die Treppe hinuntergingen, zog Shamrock das Notizbuch:
»Wie heißt der Film?«
»Die Nacht von Klausenburg.«
»... Klausenburg ... Wo liegt das?«
»Der Film spielt in Ungarn.«
»... In Ungarn. Ausgezeichnet. Ungarn liegt an der Nordsee. Nicht wahr?«
»Zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer.«
»... Schwarzen Meer ...«
Der Regisseur stieß die Tür zur Kantine auf. Das Stimmengewirr der Statisterie schlug den beiden entgegen; Zurufe schwirrten um sie herum.
»Kommen Sie mit. Wir gehen hinüber. In den Raum für die Solisten.«
Sie gingen vorüber an den eleganten Frackherren; die hielten Frankfurter Würstchen in den Händen und kalifornische Maisbrötchen. An den Honvedleutnants, die geeiste Milch tranken und Grapefruit löffelten.
Der Kellner kam ihnen entgegen. » Fräulein Griffith sucht Sie.«
»Um Gottes willen!« der Regisseur erbleichte. »Kommen Sie, wir gehen in den Garten. Also, mein lieber Shamrock, Sie wollten den Inhalt des Films wissen. Passen Sie auf. Die alternde Fürstin Hannah Klausenburg kehrt mit ihrer Tochter Prisca auf ihr ungarisches Besitztum Klausenburg zurück.«
»Die Prinzessin Prisca spielt Fräulein Lacombe?«
»Ja. Mutter und Tochter haben jahrelang die Welt bereist. Der alte Fürst Klausenburg, in diplomatischen Diensten, ist vor längerer Zeit gestorben.«
»... gestorben.«
»Die Fürstin wird von den Aristokraten des Rába-Tales mit Mißtrauen aufgenommen: denn sie ist eine geborene Engländerin.«
»Ich kann die Engländer auch nicht leiden.«
»Auf dem Schlosse Klausenburg ist der junge Graf Faludi täglicher Gast.«
»Faludi ... Der Teufel soll diese verrückten Namen holen! Wie schreiben Sie das: Faludi?«
»Die Mutter verliebt sich in den jungen Grafen. Da, eines Abends, auf einem Ball, macht sie eine niederschmetternde Entdeckung: sie findet den Grafen in zärtlichster Umarmung mit ihrer Tochter Prisca.«
»Kann ich dem Grafen nicht verdenken!«
»Es kommt zu einer furchtbaren Szene zwischen Mutter und Tochter.«
Irgendwo wurde eine Tür aufgerissen; über den Kiesweg kamen eilige Schritte, und eine Frauenstimme sagte:
»Hier finde ich Sie endlich!«
Entsetzt drehte sich der Regisseur um: »Guten Tag, Fräulein Griffith!«
Der Journalist nahm den Hut ab.
»Es ist unglaublich, wie man mich in Hollywood behandelt. Was sagen Sie? Es ist unerhört! Kein Londoner Regisseur würde dergleichen wagen. Denken Sie sich, mein Herr –« damit wandte sich die Erregte an den Journalisten – »der Direktor engagiert mich mitten aus meinem Londoner Theater-Engagement weg nach Hollywood. Er verspricht mir eine Bombenrolle ...«
»... und zahlt Ihnen ein Bombenhonorar«, setzte der Regisseur hinzu.
»Meine Kunst ist mit Geld nicht zu bezahlen, mein Herr! Ich komme in Hollywood an; wir lesen das Manuskript. Wir besprechen die Kostüme ... Da – können Sie sich so etwas vorstellen – da, einen Tag vor den Aufnahmen, bekomme ich einen Brief vom Direktor: er habe die Rolle anderweitig besetzt.«
»Einen Brief mit einem Scheck. Nicht wahr, Fräulein Griffith? Mit Ihrem Honorar.«
»Den Scheck habe ich zerknüllt und in den Papierkorb geworfen.«
»Das ist Ihre Schuld!«
»Er habe die ideale Vertreterin für die Rolle gefunden: eine junge Dame: dunkelhaarig von ungarischem Typ – es täte ihm leid. Sagen Sie selbst, mein Herr: muß ich mir das gefallen lassen? Kann ich mir das gefallen lassen?«
Der Journalist trocknete sich die Stirn.
»Und jetzt kommt das Schönste von allem. Ich erkundige mich so beiläufig, wer denn diese ideale Schauspielerin ist. Und wissen Sie, was ich erfahre? Eine kleine Statistin! Ein Mädelchen, dem ich Kleider geschenkt habe, dem ich ein paar kleine Rollen verschafft habe. Das ist der Dank! Diese Kanaille! Weil sie schön tut mit dem Direktor, oder mit dem Regisseur ...!«
»Fräulein Griffith: Sie sind erregt ...«
»Soll ich dabei etwa ruhig bleiben?«
»Ich habe keinen Einfluß auf die Dispositionen des Direktors.«
»Das ist eine Unwahrheit! Sie bestimmen die Besetzung!«
»Nehmen wir einmal an, es wäre so ...«
»Sehen Sie wohl: Sie stecken dahinter! Und warum? Weil ich nicht Ihr Typ bin!«
»Nein, Fräulein Griffith, Weil Sie nicht der Typ sind, den die Rolle braucht. Und darauf kommt alles an.«
»Warum haben Sie mich dann aus London geholt?«
»Weil Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sind.«
»Nun also.«
»... und von scharmanten Manieren ...«
»Meine Londoner Kollegen werden sich über mich lustig machen.«
»Zeigen Sie ihnen den Scheck.«
»Aber ich lasse mir das nicht gefallen! Ich erschieße den Direktor!«
»Tun Sie das!«
*
»Aufnahme ...!«
Ein Schloßzimmer im Chippendale-Stil: eine brünette junge Dame stürzt mit allen Anzeichen der Erregung auf die Szene.
»Langsam den Kopf wenden, Fräulein Lacombe! Angstvoll nach der Tür sehen! Lauschen! So ... Gehen Sie jetzt auf Ihren Schreibtisch zu. Nehmen Sie aus der Schublade die Briefe, die der Graf Faludi an Sie gerichtet hat. Zünden Sie eine Kerze an. Nehmen Sie einen der Briefe. Falten Sie ihn auseinander. Halten Sie ihn in das Licht der Flamme.«
Der Direktor erscheint. Er sieht sich unruhig um. Vermutlich nach Fräulein Griffith.
»Auftritt Prinzessin-Mutter!«
Die Tür wird aufgerissen. Die Schloßherrin tritt mit schnellen Schritten ein. Sie wirft die Tür hinter sich zu. Sie blickt sich im Raum um; in ihrer Hand blitzt eine Waffe. Mit einer Geste des Hasses stürzt sie auf die Tochter zu, senkt den Arm; ein Schuß fällt.
»Fräulein Lacombe: niederfallen: den Leuchter mit der brennenden Kerze im Fallen mitreißen!«
Die Prinzessin Prisca bricht zusammen. Die Flamme Züngelt am Gardinenschal empor.
»Schluß!«
Die Lampen erlöschen.
*
Susie Lacombe erhob sich. Der Direktor ging ihr entgegen, drückte ihr die Hand. Dann wandte er sich zur Seite, winkte, und ein junger Herr, eher klein als groß, dunkelhaarig, mit lachenden Augen, kam eilends näher.
»Wissen Sie, wer das ist? Herr Ladinser! Der Autor unseres Films. Und hier: die Darstellerin der Hauptrolle: Fräulein Lacombe.«
Der Ankömmling verbeugte sich und lachte.
»Nun, wie gefällt Ihnen Ihre Prinzessin Prisca?«
Herr Ladinser antwortete in geläufigem Englisch, das unverkennbar Wiener Akzent hatte:
»Ich bin begeistert.«
»Ist sie nicht ein großartiger Typ?«
»Fräulein Lacombe ist der Typ, Direktor. So habe ich mir die Rolle erträumt.«
»Wirklich?« Fräulein Lacombe richtete ihre glänzenden Augen auf den Begeisterten.
»Draußen bin ich eben einer Dame begegnet. Sie suchte Sie, Direktor. Sie müßte Ihnen notwendig etwas sagen. Ein Fräulein Griffith.«
»Wo war die Dame?« erkundigte sich der Direktor interessiert.
»Dort drüben. An der Bureautür.«
»Das ist ja interessant« sagte der Direktor. Worauf er zum Erstaunen der beiden nach der entgegengesetzten Seite davon ging.
Ladinser stand vor Susie. Vielleicht mit einer gewissen Verlegenheit kämpfend. Er nahm stumm ihre Hand, um sie zu küssen; aber die Schauspielerin wehrte ab.
»Bei uns in Amerika ist das nicht Sitte, Herr Ladinser.«
»Verzeihung. Bei uns in Wien ...«
»Ihr Manuskript hat mich außerordentlich interessiert« sagte Susie. »Sie sind ein großer Künstler, Herr Ladinser.«
Er schüttelte den Kopf. »Wenn ich nicht ein so grundehrlicher Mensch wäre, würde ich jetzt Schönen Dank sagen und würde versuchen, Vorteile daraus zu ziehen, daß Sie mich für einen großen Künstler halten.«
»Was für Vorteile?«
»Nun – die Künstler haben Glück bei Frauen. Oder gibt es auch das in Amerika nicht?«
Sie lachte. »Doch.«
»Also heraus mit dem Geständnis: ich habe es mir mit diesem Film leicht gemacht. Ich habe ihn einfach aus den ungarischen Zeitungen abgeschrieben.«
»Nach einem Roman? Einer fremden Arbeit?«
»Nein. Für so schlecht dürfen Sie mich nun doch nicht halten. Der Prozeß der Fürstin Klausenburg beschäftigt augenblicklich ganz Ungarn.«
»Es gibt eine Fürstin Hannah Klausenburg?«
»Und eine Prinzessin Prisca. Oder richtiger gesagt: es gab eine. Genau wie in meinem Film.«
»Danach wäre die Fürstin Hannah eine Mörderin?«
»Stimmt. Sie ist in Budapest in Haft. Alle europäischen Zeitungen sind voll von diesem Prozeß.«
»Glaubt man an ihre Schuld?«
Ladinser nickte. »Die Mutter hat in ihrer Erregung in jener Nacht auf die Tochter geschossen. Sie versucht es zu bestreiten; aber der Schuß ist von den Dienstboten gehört worden. Ebenso der Aufschrei der Tochter.«
»Entsetzlich!«
Die Schauspielerin schüttelte den Kopf.
Ladinser lachte. »Warum sind Sie so betroffen? Sie kennen doch das Manuskript wahrscheinlich längst von Anfang bis zu Ende.«
»Ich habe doch bisher geglaubt, das alles seien Phantasien eines begabten Dichters.«
»Sie sehen: ich bringe mich durch meine Wahrheitsliebe wieder einmal um alle Chancen.«
»Und die Fürstin Hannah steht jetzt unter Mordverdacht?«
»Wenn nicht ein Wunder geschieht, ist sie verloren.«
Irgendwo knarrte eine Tür. Der Direktor kam mit dem Regisseur quer durch den Raum auf die beiden zu.
»Welches Wunder könnte die Fürstin retten?«
Ladinser wandte sich halb herum, dem Direktor zu. »Nun?« sagte er halblaut. »Wenn mitten in die Verhandlung hinein eine gewisse junge Dame in den Gerichtssaal träte mit den Worten: ›Ich bin die vermißte Prisca von Klausenburg ...‹ dann würde die Anklage ...«
»Also dieser Film –« der Direktor blieb mit hochgezogenen Schultern, die Hände in den Hosentaschen, vor Ladinser stehen – »dieser Film ist das Merkwürdigste, was mir jemals passiert ist. Erst dieser Krach mit der Griffith – sie will abreisen, Hals über Kopf, einfach nach London zurück – und nun, das Neueste, denken sie sich: eben kriege ich einen Brief. Irgend jemand, der sich nicht nennt, bietet mir eine Summe, die ich selbst bestimmen kann – wenn ich den Film ›Die Nacht von Klausenburg‹ nicht drehe.«
»Was werden Sie tun, Direktor?« fragte Susie.
»Natürlich ablehnen.«
»Aber wenn kein Absender angegeben ist?«
»Die Anfrage kommt aus London. Ich soll postlagernd an das Postamt Finsbury Pavement telegraphieren. Der Herr kann lange warten.«
»Es ist schade« sagte Ladinser mit dumpfer Stimme. »Hätte der Herr aus London sich nicht einfach vorher mit mir in Verbindung setzen können? Dann hätte ich das Manuskript nicht zu schreiben brauchen und hätte obendrein ein Honorar erhalten, wie es keine amerikanische Filmfabrik einem Autor zahlen würde.«
» Endlich!« sagte eine weibliche Stimme, bei deren Klang der Direktor zusammenfuhr.
»Jawohl. Ich bin es. Ivy Griffith. Da habe ich euch ja alle beisammen: den verehrten Herrn Direktor – den ehrenwerten Herrn Regisseur – und das saubere Fräulein Lacombe! Schämen Sie sich nicht, Herr Direktor, mir solch ein albernes Püppchen vorzuziehen?«
»Nein« sagte der Direktor freundlich.
»Ich werde die Künstler von ganz Hollywood gegen Sie alarmieren!«
»Was wollen Sie, Fräulein Griffith? Haben Sie nicht Ihr Honorar erhalten? Bis auf den letzten Cent?«
Verächtlich antwortete die Gekränkte: »Ich habe Ihren Scheck zerrissen und ihn in den Papierkorb geworfen.«
»Merkwürdig« sagte der Direktor.
»Jawohl, das halten Sie für merkwürdig! Für den künstlerischen Schmerz einer Schauspielerin haben Sie kein Verständnis!«
»Ich sagte nicht deshalb: merkwürdig. Ihr Scheck ist nämlich prompt auf der Bank präsentiert und ausgezahlt worden. Es muß ihn wohl irgend jemand wieder aus dem Papierkorb herausgefischt und zusammengeklebt haben.«
»Pah« Fräulein Griffith lächelte überlegen: »glauben Sie, ich wäre so leichtfertig, einen wertvollen Scheck im Papierkorb verkommen zu lassen?«
Der Regisseur lachte.
»Fräulein Lacombe, ich glaube, es wird Zeit, daß Sie sich umziehen. Wir drehen jetzt die Gerichtsszene.«
*
Der Pförtner kam die Kellertreppe herauf.
»Fräulein Lacombe? Zweiter Stock – Zimmer Siebenunddreißig.«
Er sah dem Besucher kopfschüttelnd nach; der ging mit schnellen Schritten die schmale Treppe hinauf. Ein paar junge Damen kamen ihm entgegen, blickten ihn forschend an; er nahm schleunigst den Hut ab. Soviel hatte er von Amerika bereits begriffen: daß überall und in jeder Lage des Lebens zuerst die Frau kam.
Er ging an weißen Türen vorüber, mit zierlichen Nummerntäfelchen. Hie und da spähte ein Frauengesicht durch den schmalen Spalt. Der Schritt eines Mannes schien in diesem Hause aufzufallen. Alle hatten den gleichmäßigen Sweet-Girl-Ausdruck, der dem Schönheitsbegriff des Amerikaners entspricht.
Nummer Siebenunddreißig ...
Er klopfte. Ein Riegel wurde zurückgedreht; das erstaunte Gesicht Susie Lacombes blickte ihn an.
»Herr Ladinser ...??«
»Seien Sie nicht böse, Fräulein Lacombe. Und tun Sie mir den einen Gefallen: machen Sie die Tür etwas weiter auf.«
»Warum?« fragte sie, ein bißchen schnippisch.
»Damit ich hinein kann.«
Sie lachte; aber während er ins Zimmer trat und die Tür hinter sich zudrückte, wurde ihr Gesicht ernst.
»Ich habe Feindinnen, Herr Ladinser«, sagte sie. »Meine Kolleginnen sind neidisch; das ist kein Wunder: ich habe plötzlich Karriere gemacht. Das können sie mir nicht verzeihen. Man wird den Besuch eines Herrn bei mir falsch auslegen.«
Ladinser machte ein todernstes Gesicht. »Ich werde also sofort wieder gehen. Aber nicht eher als bis ich Ihnen gesagt habe ...«
»Um Gottes willen!«
»Fürchten Sie nichts. Sie bekommen keine Liebeserklärung zu hören.«
»Wirklich nicht?«
»Kein Gedanke. Ganz ausgeschlossen. Ich habe gar keine Zeit für die Liebe. Und Sie auch nicht.«
»Nun, dann bin ich beruhigt.«
»Aber etwas anderes möchte ich mit Ihnen besprechen. Darf ich mich einen Augenblick setzen?«
»Bitte.«
Er ließ sich behutsam in den schmalen Schaukelstuhl nieder; sie blickte ihn erwartungsvoll an. Vielleicht ein kleines bißchen mißtrauisch.
»Nun?«