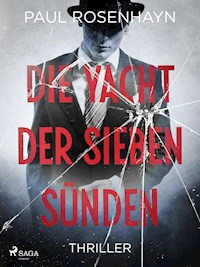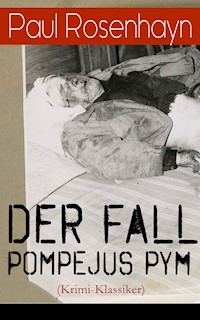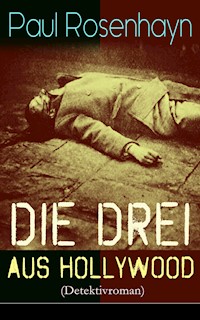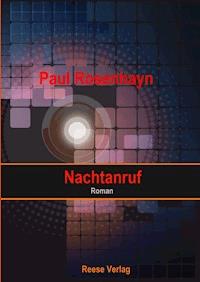Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof Forlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Léonie fiel ihm ein; er schrak fast zusammen. Merkwürdig: ein Mann konnte sich wegen einer Frau erschießen – und dabei das Lächeln einer andern suchen." Dennoch bleibt Kilian Gurlitt bei seiner Entscheidung, seinem Leben ein Ende zu setzen. Seine Frau hat ihn verlassen und ist verschwunden, seine Arbeitskraft und Produktivität als Schriftsteller ist erschöpft, seine Gedanken sind verdorrt; kurz: Sein gesamtes Leben hat seinen Sinn verloren. Am Berliner Tiergarten will er seinem Leben ein Ende setzen. Allein – ein rätselhafter Mann taucht immer wieder in seiner Nähe auf und macht seinem Vorhaben zunächst einen Strich durch die Rechnung. Gurlitt schiebt den Selbstmord um einige Stunden auf und begibt sich ins Hotel Adlon – wo er prompt wieder auf jenen rätselhaften Fremden trifft. Der Fremde spricht ihn an, stellt sich als „Holger Harrendorf" vor, und unerklärlicherweise scheint er alles über Gurlitts Leben zu wissen. Ja, er weiß sogar von dem, was er in den kommenden Stunden zu tun entschlossen ist. Und er hat eine Bitte: Wenn Gurlitt schon stirbt, möge er doch ein Geheimnis mit in den Tod nehmen. Und mehr als nur das: Er soll einen Mord gestehen, den er gar nicht begangen hat. Als sich dem zunächst widerstrebenden Gurlitt dadurch die Möglichkeit eröffnet, einem befreundeten Musiker die Mittel zur Fertigstellung seiner Oper zu verschaffen, willigt er schließlich ein. Doch dann stellt sich heraus, dass jener Mann gar nicht der wirkliche Holger Harrendorf war, Gurlitts verschollene Frau Léonie taucht wieder auf, und plötzlich sieht sich Kilian Gurlitt in ein Netz gefangen, aus dem nicht einmal der Selbstmord ein Entrinnen bietet … Paul Rosenhayn schrieb bereits Anfang des 20. Jahrhunderts atemlos spannende Thriller, wie wir sie heute in Deutschland etwa von Autoren wie Sebastian Fitzek kennen und die es unbedingt wert sind, der Vergessenheit entrissen zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Rosenhayn
Die Yacht der sieben Sünden
Roman
Saga
Die Yacht der sieben Sünden
© 1928 Paul Rosenhayn
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592694
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Kilian Gurlitt öffnete behutsam, während er scheu nach der Tür spähte, das untere Fach des Schreibtisches und knipste das Kästchen auf. Ohne hinzusehen griff er hinein; kalt und hart fühlte er das Metall in seinen Händen. Dann schlug er die kleine Tür zu, dass es dumpf krachte; erschrocken hielt er inne. Da nichts im Hause sich rührte, liess er die Waffe spielend in die Tasche gleiten.
Über dem Tiergarten lag der junge Abend. Bogenlampen, aufgereiht in leuchtenden Schnüren, flankierten die grosse Allee. Die letzten Anzeichen des Frostes waren der Wärme des Vorfrühlings gewichen; nun lag bläulicher Dunst über den dunklen Bäumen, die schon junges Grün ahnen liessen.
Er ging hinüber, quer über die Geleise der Hofjägerallee, hinein in den Tiergarten. Es galt für gefährlich, hier zu gehen; er musste lächeln bei dem Gedanken. Seltsam, wie alles sich änderte, wie die Perspektive zu den Dingen blitzschnell wechselte, wenn man sie von der anderen Seite betrachtete!
Einen Moment lang blieb er stehen, das schimmernde Bild zu erfassen. Die Konturen der Stadt, fern drüben jenseits der dunklen Alleen, verschwammen im Dunst des Abends. Die Lichter der Strassen gaben der Ferne seltsam geometrische Linien; zur Rechten lief die Tiergartenstrasse; das endlose Défilé der Autos, unabsehbar nach rechts und links, führte, ein glühendes Band, vom Kurfürstendamm ins Innere der Stadt.
Ein Schritt klang hinter ihm auf. Er wandte sich um.
Der Herr, der eben aus dem Lichtkreis der Bogenlampen in den dunklen Weg trat, war ihm nicht fremd. Freilich, seltsam genug: auch nicht bekannt. Dieses Gesicht hatte er schon gesehen. Oft. Noch heute. Noch vor kurzem. Er erinnerte sich jetzt: als er heute mittag heimkam, war ihm dieser Herr vor der Tür begegnet.
Von einem unbehaglichen Gefühl erfasst beschleunigte Kilian Gurlitt den Schritt. Während er, das Gesicht halb zur Seite gewendet, rückwärts blickte, sah er, dass auch der Fremde schneller ging. Gurlitt blieb stehen, öffnete den Mantel, nahm das Zigarettenetui. Der Fremde ging achtlos an ihm vorüber, die Augen geradeaus gerichtet. Gurlitt nahm umständlich eine Zigarette aus der Dose und zündete sie an; dabei bemerkte er, dass der Fremde langsamer ging.
War das Zufall? Er warf das Streichholz fort. Dort war ein Seitenweg, der zu einem unbeleuchteten Innenpfad führte. Vorsichtig bog er zur Linken ein; der Weg lief, parallel der Strasse, auf den Kemperplatz zu.
Der Fremde war stehengeblieben. Er sah sich suchend um; dann wandte er den Kopf zur Linken und spähte in das Dunkel hinein.
Gurlitt betrachtete ihn aufmerksam von der Seite. Er war gross, breitschultrig, nicht mehr jung; der blaue Raglan war von fremdartigem Schnitt. Unter dem steifen schwarzen Hut schimmerten graue Schläfen. Der Fremde versenkte die Hände in die Taschen und ging mit plötzlichem Entschluss weiter. Hatte er ihn gesehen? Hatte er die Verfolgung aufgegeben? Oder war das alles ein Irrtum?
Wie wichtig er diese Belanglosigkeiten nahm! So sehr war man verwachsen mit den Nichtigkeiten des Alltags; man spürte die tauselnd Wurzeln erst, wenn man im Begriff war, sie zu zerreissen.
Während er gedankenverloren dem Wasser zuging, stürmten die Gedanken von neuem auf ihn ein. Was hinderte ihn eigentlich, in diesem Augenblick, an dieser Stelle, in der Einsamkeit des dunkelnden Parks, sein Vorhaben auszuführen? Ein kurzer kleiner Knall, wahrscheinlich würde ihn niemand hören, vielleicht, dass jener Fremde neugierig hinzukommen würde — warum zögerte er noch? Hatte er sich selbst belogen? War in seinem Unterbewusstsein eine Stimme, die abriet? War das alles nur eine Spielerei gewesen, ein Kreisen der Gedanken um die letzten Dinge, ein Kokettieren mit einem heroischen Entschluss, dem seine Nerven nicht gewachsen waren? Für den er zu feige war?
Er senkte den Kopf; unwillkürlich ging er langsamer.
Ja, es war so; dennoch war es nicht so.
Was aber sollte werden? Wollte er in diesem Trott weiterleben, in dieser völligen, erbarmungslosen, unerträglichen Einsamkeit? Seine Arbeitskraft war erschöpft, aufgerieben, zermürbt durch das endlose trostlose Warten; zerschlagen war seine Produktivität, alles war wie ausgetilgt, seine Gedanken waren verdorrt; ausgelöscht war jeglicher erfinderische Gedanke. Er ging in einem starren und trostlosen Gefühl durch den Tag, wie durch eine Wüste — nicht lustig, nicht traurig, nur mit einer grenzenlosen Gleichgültigkeit gegen alles. Das eben war es. Irgendein grosser himmelstürmender Schmerz: der raste vorüber, tobte sich aus — machte das Innere bereit für ein neues, tröstendes, freudebringendes Erlebnis. Aber diese dumpfe Apathie war hoffnungslos.
Warum also zögerte er?
Unmittelbar neben ihm scharrte ein Schritt über den Sand. Er wandte sich betroffen zur Seite.
Der Fremde ging an ihm vorüber.
Welch eine ungezogene Zudringlichkeit! Wäre er in anderer Stimmung, er würde den Fremden zur Rede stellen. So ging er der Belästigung aus dem Wege: dort war die Siegesallee; der Fahrdamm war eben frei.
Worauf wartete er noch?
Und dann gab er sich selbst die Antwort. Noch einmal musste er unter Menschen sein. Noch einmal, im Rahmen einer Stunde, einer Nacht, die Dinge des Lebens an sich vorüberziehen sehen: Lachen. Frauen. Musik. Menschen ... Noch einmal, ehe er das Leben verliess, wollte er es grüssen — so wie jemand zurückwinkt vom Deck des abfahrenden Schiffes.
Ja, das war es. Abschied nehmen; ein Abschied, wie ihn ein Mann von Geschmack, von Kultur, von Diskretion feiern mag: still, lächelnd, mit einem schweigenden Kapitulieren vor dem Unvermeidbaren.
Zum Teufel, was bedeutete das? Auf der andern Seite der Strasse ging der Fremde. In plötzlich aufsteigendem Ärger ging Gurlitt schnellen Schrittes über die Strasse. Ein paar Chauffeure schimpften; warnend kam der Zuruf des Polizisten; gleichmütig überquerte er den Asphalt.
Der Fremde hatte sich umgewandt; mit schnellen Schritten ging er davon, in der Richtung nach der Bellevuestrasse.
Mochte er ... Fast musste Gurlitt lachen, als er dem geschäftig Davonchastenden nachsah.
Nun hatte er wenigstens Ruhe. Er rief ein Auto an.
„Zum Hotel Adlon!“
Durch das kleine Fenster spähte er zurück. Dort, unter der Laterne, stand der Fremde, aufmerksam zu ihm hinüberblickend. Nun hob er die Hand; nun hielt ein Auto ...
Gurlitt lehnte sich achselzuckend in das Lederpolster zurück; eben bog der Wagen zur Rechten ein; dort war schon das Brandenburger Tor. Das altvertraute Bild der Linden tat sich auf: bläuliches Licht lag schimmernd über dem Asphalt, Transparente standen leuchtend gegen den Himmel; schon hielt der Wagen.
Gurlitt blickte sich um; nichts war zu sehen. Dann ging er hinein.
In der Bar sassen gelangweilt-wichtig ein paar Herren hinter Strohhalmgetränken. Der Mixer grüsste ihn mit einem Lächeln in seinem frischen Amerikanergesicht. „Martini?“
Gurlitt nickte und schwang sich auf den unbequemen Bock. Vor ihm, über einer Parade farbiger Flaschen, hing ein Schiffsplakat: das Sonnendeck eines schneeweissen Dampfers, leuchtend von Blumen; dazwischen die Gesichter lachender Frauen.
Der Mixer balancierte kunstgerecht die Zitronenschale über den Glasrand und zog zwei seidenpapierumhüllte Strohhalme aus dem Becher. „Das ist die ‚Yoshiwara‘“, sagte er mit einem lächelnden Blick auf das weisse Schiff. „Haben Sie schon von der ‚Yoshiwara‘ gehört?“
„Ich glaube.“
„Es ist das schönste Schiff der Welt. Ich kenne es. Ich war früher Steward; die ‚Yoshiwara‘ war nämlich noch vor einem Jahr die Yacht des Fürsten von Monaco. Nicht so eine Yacht wie man sie sich sonst vorstellt — ein Vierundzwanzigtausend-tons-Dampfer. Ich glaube, er hat sie gleich bauen lassen, um sie mit Vorteil zu verkaufen. Jetzt hat eine Hamburger Reederei das Schiff. Das wäre etwas für Sie, mein Herr. Ein Kollege hat es mir gezeigt, vor acht Tagen war ich in Hamburg. Es hat den schönsten Tanzsaal der Welt, mit Parquet lumineux, mit Scheinwerfern; es hat ein Theater; die ersten und teuersten Kräfte von New York, London und Berlin sind verpflichtet, für jede Fahrt neue.“
„So, so“, sagte Gurlitt.
„Und die schönsten Frauen der Welt. Das ganze Schiff ist ein Blumengarten. Ja, wahrhaftig: es ist ein schwimmender Palast.“
„So, so“, sagte Gurlitt.
„Wissen Sie, wie man das Schiff nennt?“
„Nein.“
„Die Yacht der Sieben Sünden. Es macht nur ‚wilde‘ Fahrten; es ist ein Schiff für Millionäre — und für Hochstapler. Die nächste Fahrt geht, glaube ich, nach Amerika. Nehmen Sie noch einen Cocktail?“
Gurlitt schüttelte den Kopf und legte einen Schein auf den Tisch. „Es ist gut.“
Der Mixer betrachtete die Note erstaunt; auf Gurlitts abwehrende Handbewegung machte er eine tiefe betroffene Verbeugung.
Aus dem kleinen Saal kam Tanzmusik; der scharfe Rhythmus der Jazzband schnitt sich verheissungsvoll in das Stimmengewirr. Ein paar Bekannte grüssten; er ging langsam an den Tischen vorüber; dort war die schlanke Braune; sie grüsste lächend herüber. Vor einer Woche noch hätte ihm ihr Gruss ein leises, vielleicht uneingestandenes, Herzklopfen verursacht. Vor einer Woche noch wäre er um das Rund der Tanzfläche herumgeschlendert, um eine Anknüpfung zu suchen; leicht genug wäre es gewesen. Heute, in dieser seltsamen Stimmung, in dieser letzten Stunde, zwischen hier und dort, war alles gleich.
Léonie fiel ihm ein; er schrak fast zusammen. Merkwürdig: ein Mann konnte sich wegen einer Frau erschiessen — und dabei das Lächeln einer andern suchen.
Die Braune blickte aufmerksam zu ihm hinüber; er sah an ihr vorbei, fast ohne es zu wollen; dann ging er in den Speisesaal.
Der Kellner begrüsste ihn; er war häufiger Gast in diesen Räumen. „Ein Ecktisch“, flüsterte der Kellner; „ich habe ihn für Sie freigehalten.“
Gurlitt nickte. Er warf einen Rundblick durch den Raum. Der Saal war noch halb leer; ein paar Amerikaner, ruhig, sicher, souverän, sassen an den Tischen gegenüber dem Orchester. Ihre Frauen, schlank, dekolletiert, mit dem unbefangenen Lächeln der Amerikanerinnen, musterten ihn; er bemerkte, dass sie von ihm sprachen. Eine von ihnen, es war die Schönste, lächelte mit einem halben Lächeln zu ihm hinüber. Dort, schräg rechts, war der Tisch des peruanischen Gesandten; die junge exotische Schönheit mit den grossen Ohrringen, die an der Seite des Attachés sass, war eine berühmte südamerikanische Primadonna. An dem kleinen Tisch, nahe dem Eingang zum Ballsaal, sass ein unscheinbar aussehender Herr; er sprach mit dem Geschäftsführer, der sich bei jedem zweiten Wort verneigte. Es war ein ehemals regierender König.
Eben ging die Tür auf; ein grosser, dunkler Exote trat ein; zu seiner Rechten eine schlanke, blonde Frau: der Präsident von Venezuela.
Der Kellner brachte den Sekt. Er löste behutsam den Draht und warf ihn mit dem Stanniol in den Kübel; dann drehte er mit einer zärtlichen Bewegung den Korken aus dem Hals und schenkte vorsichtig ein. „Der Herr wünscht nicht zu essen?“
Gurlitt blickte flüchtig auf die Karte. „Bringen Sie mir Natives. Und Welsh Rarebits.“
Der Kellner schenkte ein und verschwand mit einer flüchtigen Verbeugung.
Gurlitt trank das Glas in einem Zuge leer. Welch belebende Macht dieser seltsame Wein hatte! Er spürte noch das Brennen des eiskalten Tranks im Halse; zugleich fühlte er, wie aus der Kälte des rinnenden Weins eine unbegreifliche Wärme aufstieg, die, eine machtvolle Welle, sein Blut erfüllte. Wie frei und leicht plötzlich alles wurde! Alle Dinge waren unbeschwert, die Musik, die durch die pendelnden Glastüren kam, wurde zärtlicher; das Lächeln in den Zügen der Frauen schien ihm mit einem Schlage wärmer, persönlicher.
Er nahm die Flasche und schenkte von neuem ein. Und trank.
Ja, ein paar Glas Sekt: das hatte ihm gefehlt. Die Dinge ergaben sich von selbst, die Hemmungen waren fortgespült, lichter kreisten die Gedanken, alles schien vereinfacht, in die Nähe gerückt. Alles war leicht ...
Nicht leicht genug zwar um ihn vergessen zu lassen, dass dies alles ein Rausch war. Aber leicht genug: für den Entschluss zu der einen letzten einfachen Tat.
Wieder trank er. Und während er das Glas niedersetzte, geschah es plötzlich:
Jemand sagte:
„Herr Gurlitt, nicht wahr?“
Er blickte auf. Vor ihm stand jener Fremde.
„Herr Gurlitt, nicht wahr?“
„Was wünschen Sie von mir?“
„Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen.“
„Ich wüsste nicht ...“
„Haben Sie zehn Minuten Zeit für mich?“
Wieder fragte Gurlitt mit einem kühlen Blick in das Gesicht des andern:
„Wer sind Sie?“
Der Fremde, der im Frack war, sagte, während er den Stuhl heranzog:
„Mein Name wird Ihnen zwar nichts sagen. Aber ich begreife schon, dass Sie wissen möchten, wer ich bin. Ich heisse Holger Harrendorf.“
„Sie verfolgen mich seit einer Stunde.“
Der Fremde nickte. „Ja, Herr Gurlitt. Ich ... es ist nicht das richtige Wort. Ich suche Sie. Rund heraus gesagt.“
Der Kellner erschien mit den Austern. Er warf einen fragenden, ein wenig unfreundlichen Blick auf den Hinzugekommenen.
Der wies lässig auf die Sektflasche im Kübel: „Bringen Sie mir dasselbe.“
„Auch Austern?“
„Auch Austern.“
„Auch Welsh Rarebits?“
„Auch Welsh Rarebits.“
Während der Kellner eilfertig verschwand, sagte der Fremde, indem er ihm mit einem halben Blick nachsah:
„Was ich Ihnen zu sagen habe, Herr Gurlitt, ist seltsam genug. Ich würde vielleicht nicht daran denken, mit Ihnen über diese Dinge zu sprechen — aber ich glaube: diese Nacht ist für Sie ohnehin so ungewöhnlich, dass es ..., dass es ...“
„... dass es auf ein bisschen mehr nicht mehr ankommt?“ fragte Gurlitt, fast lächelnd.
„Ja, Herr Gurlitt.“
„Woher wissen Sie, dass diese Nacht für mich ungewöhnlich ist?“
Der andere sah ihm ins Gesicht. Langsam hob er die Hand; und indem er seinem Gegenüber in die Augen blickte, sagte er leise:
„Ich weiss alles.“
Gurlitt runzelte die Stirn. „Und woher?“ fragte er kurz und scharf.
In das Gesicht des andern trat ein begütigendes Lächeln. „Es steht Ihnen frei, mir diese Unterredung abzuschlagen. Das brauche ich kaum zu betonen. Es steht Ihnen frei, sie mir zu gewähren. Das alles ist in Ihrem Belieben. Sie können jede Frage stellen, Herr Gurlitt — Sie sollen auf jede Frage Antwort haben. Sie werden Fragen stellen. Nur um das eine muss ich Sie bitten: fragen Sie mich nicht, woher ich das weiss — was ich weiss. Diese eine einzige Frage, Herr Gurlitt, kann ich Ihnen nicht beantworten.“
Der andere zuckte die Achseln. „Das ist ein schlechter Scherz.“
Harrendorf schüttelte leise, mit einem fast traurigen Lächeln, den Kopf. „Nein, Herr Gurlitt. Das ist kein Scherz. Kein schlechter Scherz. Es ist Ernst. Es ist tödlicher Ernst.“
„Ich wüsste mit dem besten Willen nicht“; Gurlitt nahm ostentativ eine Auster und löste mit dem kleinen Stahlmesser den Bart ...
„Natürlich wissen Sie nicht“, sagte der andere. „Natürlich wissen Sie nicht. Darum eben will ich mit Ihnen sprechen.“
Gurlitt liess die geleerte Austernschale auf den Teller fallen. „Also meinetwegen ...“, sagte er achselzuckend. „Sie gestatten vielleicht, dass ich dabei weiteresse.“
„Bitte.“ Der Fremde sah mit leeren Augen in den Saal hinein, an Gurlitt vorüber; während Gurlitt ihn betrachtete, bemerkte er den traurigen Ausdruck in seinen dunklen Augen. Nein, dieser Mann sah nicht aus wie jemand, der einen Scherz vorhatte.
„Ich weiss“, begann Harrendorf leise; „ich weiss, dass Sie seit zwei Monaten auf die Rückkehr Ihrer Frau warten. Dass Sie vergeblich warten; und ich weiss, dass heute die Scheidungsklage gekommen ist.“
„Das wissen Sie? Und woher ...?“
Der andere hob die Hand. „Nicht wahr, Herr Gurlitt, Sie lieben Ihre Frau? Ich begreife, dass Sie sie lieben. Jeder muss es begreifen. Sie waren sehr glücklich miteinander, nicht wahr?“
„Ja“, sagte Gurlitt, fast ohne es zu wollen.
„Ich habe Ihre Frau im vorigen Jahre im Deutschen Theater in London spielen sehen.“
„Wirklich?“ fragte Kilian, unwillkürlich interessiert. „Wirklich? Aber woher wissen Sie, dass es meine Frau war? Sie führt als Schauspielerin nicht meinen Namen!“
„Sie nennt sich mit ihrem Mädchennamen: Léonie Storm.“
„Ja“, bestätigte Gurlitt immer erstaunter.
„Ich sah sie zweimal: in einem Stück von Molnar und in einem Drama von Ihnen.“
„Sie erhielt auf die Rolle in meinem Stück einen Engagementsantrag nach Hollywood.“
Harrendorf lächelte. „Dieser Engagementsantrag ist, wenn ich nicht irre, der Grund zu Ihrer Scheidung.“
„Auch das ...“, fuhr der Schriftsteller auf.
„Sie waren gegen die Reise nach Hollywood. Gegen das Engagement. Sie verlangten, dass Ihre Frau bei Ihnen bleiben solle. Es kam zu einem furchtbaren Streit. Schliesslich erklärten Sie Ihrer Frau, dass Sie als Ehemann das Bestimmungsrecht hätten — und dass Sie die Erlaubnis für Hollywood einfach verweigerten.“
„Mein Gott!“
„Sie sehen, jede Einzelheit ist richtig. Ich begreife, dass ein Mann, der seine Frau liebt, so handeln kann wie Sie. Dass er zugleich stolz auf ihren Ruhm sein — und dennoch eifersüchtig auf jeden sein kann, der sie auf der Bühne oder im Filmatelier mit seinen Blicken streicheln darf.“
Gurlitt nickte. „Ich kann auch meine Frau begreifen“, sagte er. „Damals konnte ich es vielleicht nicht — heute denke ich immerhin schon ein bisschen anders. Cecil de Mille hat ihr ein Engagement für drei Filme angetragen: der grösste Filmregisseur der Welt! Ich war dagegen — wie man eben dagegen ist, wenn man liebt, gegen alles, sinnlos, ohne Überlegung. Nach jenem furchtbaren Auftritt ist sie abgereist: am nächsten Mittag, als ich heimkam, war sie fort.“
„Und haben Sie nicht versucht, sie umzustimmen?“
Gurlitt machte eine trostlose Handbewegung. „Eine Woche habe ich gewartet. Dann schrieb ich ihr. Einen ausführlichen langen Brief. Ich schrieb ihr, dass alles ein Missverständnis sei — dass ich sie noch liebe, bass ich sie mehr liebe als je — und dass ich sie bitte, meine Worte zu vergessen. Sie antwortete nicht.
Ich wartete drei Tage. Vier Tage. Dann schickte ich ein Telegramm. Auch darauf kam keine Antwort. Dann schrieb ich wieder einen langen Brief — ich bat sie, ich bat sie, Herr Harrendorf: das Engagement nach Hollywood anzunehmen: ich würde getreulich auf sie warten, auf meine berühmte, schöne, begehrte Frau.“
„Und Sie erhielten keine Antwort?“
„Keine.“
„Warum fuhren Sie nicht nach Oberhof?“
„Ich wollte es. Ich meldete ein Telephongespräch an. Die Zofe meiner Frau erklärte mir: die gnädige Frau lehne es ab, mit mir zu sprechen. Ich möge nicht kommen: sie würde sofort abreisen. Jeder Versuch sei von vornherein vergeblich.“
„Das sieht fast aus“, sagte Harrendorf, „als ob ein Dritter ...“
Eben erschien der Kellner; er brachte Sekt und Austern.
„Sie haben recht“, sagte Gurlitt. „Als ob ein Dritter ... Inzwischen habe ich es erfahren: Léonie steht im Begriff, einen andern zu heiraten. Einen reichen Mann. Zu heiraten ... oder, man wusste es nicht genau: oder seine Freundin zu ...“
„Hm. Hm.“
„Noch ein paarmal habe ich versucht, sie umzustimmen. Es gibt kein zärtliches Wort, das ich ihr nicht gesagt hätte; ich habe sie an ihre scheuen und verstohlenen Liebesgeständnisse erinnert, an unsere gemeinsamen Reisen — an unsere gemeinsame Arbeit: die junge Frau des jungen Schriftstellers — war das nicht das schönste Fundament einer glücklichen und sonnigen Ehe? Alles war vergeblich. Alles war in den Wind gesprochen. Léonie hat kein Wort der Verzeihung für mich gefunden. Sie ist in ihren Gedanken wohl längst über mich hinweggeschritten zu jenem Neuen. Er kann ihr das bieten, was ich nicht habe: Reichtum.“
„Ja“, nickte der Fremde. „Reichtum.“
„Ich weiss selbst nicht“ — der Schriftsteller sah mit einem halben Blick zu Harrendorf hinüber; „warum ich das alles so rückhaltlos mit Ihnen bespreche“; der andere machte eine Bewegung mit der Hand; „aber da Sie ohnehin eingeweiht sind ...“
„Ich muss jetzt“, sagte Harrendorf, „von den Dingen der letzten Tage sprechen. Sie glauben die Trennung von Ihrer Frau nicht verwinden zu können.“
Kilian Gurlitt schüttelt den Kopf. Er stützte die Stirn in die Hand. „Nein“, sagte er leise. „Ich kann es nicht überwinden. Ich kann ohne Léonie nicht leben. Alles ist zerstört; ich kann keinen Gedanken mehr fassen; alles ist leer, phantasielos, meine Worte sind ohne Schwung, alle Erfindungsgabe ist versiegt. Und, was das Schlimmste ist: ich habe nicht mehr den Wunsch, dass es anders werden möge. Ich stehe unaufhörlich vor der Frage: für wen sollst du arbeiten?“
„Ja“, sagte Harrendorf. „Und so haben Sie den Entschluss gefasst — sich heute nacht zu erschiessen.“
Gurlitt liess die Hand auf den Tisch niederfallen und blickte hinüber zu Harrendorf, der ihn mit ernsten, tiefen Augen betrachtete. „Was wünschen Sie mir zu sagen, Herr Harrendorf?“
Der andere nahm die Flasche aus dem Eiskübel und füllte die beiden Gläser. „Ich weiss, Herr Gurlitt“, sagte er, „dass Sie nicht zu denen gehören, die mit einem solchen Gedanken spielen. Ich weiss es genau. Sie werden die Tat ausführen. Heute nacht werden Sie es tun.“
„Nun ja.“ Und in plötzlichem Begreifen fragte Gurlitt: „Haben Sie etwa die Absicht, mich daran zu hindern? Dann muss ich Ihnen sagen, dass Ihre Mühe von vornherein vergeblich ist.“
Wieder blickte ihm der andere ins Gesicht. Endlich, nach einer langen stummen Pause, sagte er langsam:
„Ich habe nicht die Absicht, Sie an Ihrem Vorhaben zu hindern.“
Ein wenig verwirrt murmelte Gurlitt: „Dann weiss ich nicht ... dann weiss ich nicht, welchen Zweck diese Unterredung haben soll.“
Der andere, der fast mit einer leisen Verlegenheit zu kämpfen schien, legte sinnend die Serviette zusammen. „Was ich Ihnen zu sagen habe, Herr Gurlitt, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Vorschlag. Sie können ihn annehmen, Sie können ihn ablehnen; das ist selbstverständlich. Der Vorschlag, den ich Ihnen mache, ist, ich sagte es schon, vielleicht das Ungewöhnlichste, was je ein Mensch einem Menschen gesagt hat. Ja, es ist so ungewöhnlich, dass ich mich schon eines Gleichnisses bedienen muss: Wenn jemand in ein fernes und fremdes Land reist, so geschieht es wohl, dass in dem Augenblick, da das Schiff abgehen will, noch jemand erscheint, ein Fremder vielleicht — um ihm einen wichtigen Brief mitzugeben. Oder einen Auftrag. Oder eine Mission. Irgend etwas, was jener Reisende in das ferne und fremde Land mitnehmen soll. Ja, das ist das richtige Wort: etwas mitnehmen.“
Gurlitt richtete sich erstaunt auf. „Sie meinen, ich soll etwas ... in das Jenseits ... mit hinübernehmen?“
Der andere nickte. „Ja. Ein Geheimnis.“
Die Augen der beiden trafen sich. Harrendorfs Blick irrte zur Seite.
„Wollen Sie das tun?“
Wieder sah Gurlitt auf; wieder wich der andere seinem Blicke aus. „Ein okkultes Experiment?“
Harrendorf lächelte und schüttelte den Kopf. „Etwas ganz Reales. Ich muss deutlicher werden. Ein Geheimnis, das Sie mit ins Grab nehmen sollen.“
Gurlitt ballte die Hand auf der Tischplatte; irgendwo, aus dem Unterbewusstsein vielleicht, stiegen seltsame und argwöhnische Gedanken auf. „Ein Verbrechen?“ fragte er leise, mehr vor sich hin.
„Können Sie sich vorstellen,“ Harrendorf senkte den Kopf, „können Sie sich vorstellen, dass ein ehrlicher und rechtschaffener Mann in eine Zwangslage gerät, aus der es keinen andern Ausweg gibt als ein Verbrechen?“
„Vielleicht.“
„Können Sie sich denken, dass, wenn dieses Verbrechen nicht geschieht, unabsehbares Unglück droht?“
„Was für ein Verbrechen, Herr Harrendorf?“
„Leuchtet es Ihnen ein, dass eine solche Tat moralisch eine Notwendigkeit ist — juristisch indessen ein Verbrechen bleibt?“
Gurlitt hob den Kopf und sah seinem Gegenüber ins Gesicht. „Ein Mord ...?“
„Ja“, sagte der andere leise.
„Ich soll einen Mord begehen?“
Wieder schüttelte jener den Kopf. „Die Tat ist geschehen. Sie sollen sie auf sich nehmen.“
Gurlitt fühlte, dass ihn jemand ansah; er wandte den Kopf; drüben ging Alfons Costa, der junge Komponist. Mit seiner Freundin. Die beiden grüssten lachend herüber; dann ging die Tür zum Tanzsaal auf, ein Tango schmeichelte herüber; pendelnd fielen die Türen wieder zusammen.
„Wer hat den Mord begangen?“ fragte Gurlitt.
Der andere sah ihn an, mit einem halben Lächeln, das langsam in einen leeren und starren Ausdruck überging.
„Ich.“
„Sie?“ Gurlitt richtete sich auf, abweisend, in einem jähen Erschrecken. „Sie, Herr Harrendorf?“ Indem er einen hastigen Blick auf sein Gegenüber warf, setzte er hinzu: „Wer sind Sie?“
Der andere machte eine hilflose Handbewegung. „Was würde es nützen, wenn ich Ihnen jetzt antworten würde: ich bin der Kaufmann Harrendorf aus Hamburg? Oder der Plantagenbesitzer Harrendorf aus Brasilien? Würde das irgend etwas erklären? Ich kann Ihnen nur wiederholen: man hat mich gehetzt, man hat mich in eine Falle gelockt; die äussere Konstellation der Dinge spricht gegen mich, so geschickt hat man es eingefädelt, ich habe jahrelang gegeben und beschwichtigt und gebeten, ich habe mehr getan als ein Mensch wohl sonst tun kann — aber immer noch hatte ich nicht genug getan; er verlangte alles, mit einem Wort, mit einem Schlage: alles. Da schoss ich ihn nieder.“
Gurlitt schüttelte den Kopf. „Was habe ich mit Ihrer Tat zu schaffen, Herr Harrendorf? Jeder muss für sich einstehen; jeder hat mit seinem Leben genug zu tun, mit seinen Schmerzen, mit seinen Hoffnungen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen.“
Eine lange Pause entstand. Herr Harrendorf liess seine Augen durch den Saal schweifen, nachdenkliche, kluge, ein wenig müde Augen.
„Vielleicht wissen Sie,“ sagte er nach einer Weile, fast flüsternd, „vielleicht wissen Sie jemanden, den Sie glücklich machen möchten. Dem mit einer Geldsumme geholfen wäre?“
„Nein.“
„... haben Sie keinen Freund, dem es schlecht geht, keine Geliebte? Keine alte Mutter? Sie können den Betrag bestimmen.“ Harrendorf fasste in die Brusttasche. „Wissen Sie keinen, für den Hunderttausend Mark ein neues Leben bedeuten würden?“
„Nein“, sagte Gurlitt. „Ich will einen ehrlichen Namen hinterlassen.“