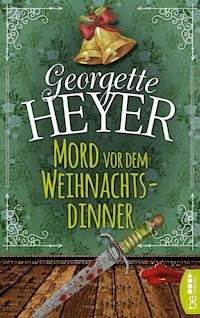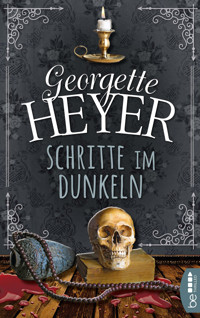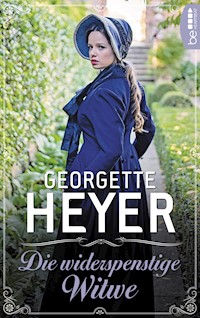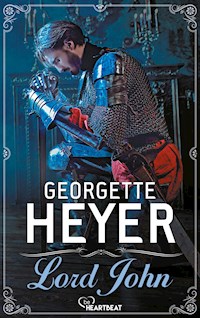Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
London, 1816: Als die 20-jährige Sophy Stanton-Lacy im Haus ihrer Tante eintrifft, ist die gesamte Verwandtschaft schockiert. Alle hatten ein schüchternes junges Mädchen erwartet. Aber Sophy ist eine hochgewachsene, selbstbewusste und energische junge Frau, die sich keck über die ungeschriebenen Gesetze der gehobenen Gesellschaft hinwegsetzt. Voller Elan mischt Sophy sich in die Liebesangelegenheiten anderer Leute ein und treibt ihren gutaussehenden Cousin Charles langsam aber sicher in den Wahnsinn. Doch am Ende finden sich alle Paare, und auch Sophy kann der Liebe nicht auf Dauer entfliehen ...
"Die drei Ehen der Grand Sophy" ist ein wunderbarer und amüsanter Regency-Roman mit einer charmanten Heldin. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Über dieses Buch
London, 1816: Als die 20-jährige Sophy Stanton-Lacy im Haus ihrer Tante eintrifft, ist die gesamte Verwandtschaft schockiert. Alle hatten ein schüchternes junges Mädchen erwartet. Aber Sophy ist eine hochgewachsene, selbstbewusste und energische junge Frau, die sich keck über die ungeschriebenen Gesetze der gehobenen Gesellschaft hinwegsetzt. Voller Elan mischt Sophy sich in die Liebesangelegenheiten anderer Leute ein und treibt ihren gutaussehenden Cousin Charles langsam aber sicher in den Wahnsinn. Doch am Ende finden sich alle Paare, und auch Sophy kann der Liebe nicht auf Dauer entfliehen ...
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Die drei Ehen der Grand Sophy
Aus dem Englischen von Edmund Th. Kauer
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1950
Die Originalausgabe THE GRAND SOPHY erschien 1950 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1963.
Textredaktion: Birthe Schreiber
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven von © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-3176-9
luebbe.de
lesejury.de
Kapitel 1
WIE DER KAMMERDIENER nachher seinen minder scharfblickenden Untergebenen zu verstehen gab, erkannte er den einzig überlebenden Bruder Ihrer Ladyschaft auf den ersten Blick. So erwies er Sir Horace die besondere Ehre einer tiefen Verneigung und versicherte ihm auf eigene Verantwortung, die Ladyschaft sei zwar für weniger eng dem Hause verbundene Personen nicht zu sprechen, werde aber gewiss erfreut sein, ihn zu empfangen.
Das beeindruckte Sir Horace nur wenig. Er reichte dem einen Lakai seinen Kragenmantel, dem andern Hut und Stock, warf seine Handschuhe auf das Marmortischchen, stellte fest, dass er sich das auch nicht anders vorgestellt hätte und fragte wie es Dassett ginge. Nicht recht sicher, ob er sich freuen sollte, dass man sich seines Namens entsann, oder ob er Sir Horace´ allzu freies Gehabe missbilligen sollte, antwortete der Kammerdiener, er fühle sich so wohl, wie man das bei seinem Alter erwarten dürfe. Besonders glücklich aber mache ihn (wenn es ihm gestattet sei, das zu bemerken), dass Sir Horace nicht um einen Tag gealtert sei, seit er das letzte Mal den Vorzug gehabt, ihn Ihrer Ladyschaft zu melden. Dann schritt er dem Besuch in wahrhaft majestätischer Haltung voran und geleitete ihn die imposante Treppe hinauf zum blauen Salon.
Dort saß Lady Ombersley in der Nähe des Kamins auf einem Sofa, einen Paisley-Schal um die Füße gewickelt, das Häubchen zur Seite gerutscht, und döste vor sich hin. Dassett, dem keine dieser Einzelheiten entging, hüstelte und brachte dann seine Meldung in bestimmtem Ton vor: «Sir Horace Stanton-Lacy, Mylady!»
Lady Ombersley fuhr aus ihrem Schläfchen auf, starrte einen Moment lang verständnislos in die Luft, tastete nach ihrem Häubchen und stieß einen unterdrückten Schrei aus: «Horace!»
«Hallo, Lizzie, wie geht es immer?», fragte Sir Horace und versetzte ihr einen aufmunternden Klaps auf die Schulter.
«Heiliger Himmel, hast du mich aber erschreckt!», seufzte Ihre Ladyschaft. Sie griff nach dem Riechfläschchen, das immer in ihrer Reichweite stand, und zog den Stöpsel heraus.
Der Kammerdiener, der diese Ausbrüche ungedämpfter Gefühle duldsam mitangesehen hatte, schloss hinter den wiedervereinigten Geschwistern die Tür und kehrte ins Dienerzimmer zurück. Dort verriet er seinen Untergebenen, dass Sir Horace ein Gentleman sei, der zumeist im Auslande lebe. Ihm, Dassett, sei bekannt, dass die Regierung ihn zu diplomatischen Missionen verwende, die wohl zu heikel wären, als dass man seiner Dienerschaft verständlich machen könnte.
Der Diplomat hatte sich mittlerweile an den Kamin gelehnt, um seine Frackschöße anzuwärmen. Er erfrischte sich, indem er eine Prise aus der Dose nahm, und eröffnete seiner Schwester, dass sie zugenommen hätte. «Ja, ja, wir werden auch nicht jünger, keiner von uns beiden», fügte er freundlich hinzu. «Obwohl ich dir um fünf Jahre voraus bin, Lizzie, falls mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt. Und das nehme ich keineswegs an.»
An der Wand gegenüber dem Kamin hing ein großer, goldgerahmter Spiegel, und Sir Horace erlaubte es seinem Blick, während er so sprach in kritischer Anerkennung auf seinem Spiegelbild zu ruhen. Die fünfundvierzig Jahre, die er durchlebt hatte, hatten ihn nicht unfreundlich behandelt. Vielleicht hatte er ein wenig Bauch angesetzt, aber die sechs Fuß, die er maß, erlaubten es dem Kritiker, über eine gewisse Stattlichkeit hinwegzusehen. Er war wirklich ein ansehnlicher Mann und besaß, neben seiner guten und wohlproportionierten Figur, Haltung, eine gewisse Contenance, die durch seine braunschimmernden, noch von keinem Silberstreifen durchzogenen Locken gehoben wurde. Er trug stets gewählte Kleidung, war aber viel zu klug, um modische Extravaganzen zu adoptieren, die eher geeignet waren, die Nachteile der mittleren Jahre hervorzuheben. «Seht euch doch den armen Prinny an», sagte Sir Horace gern zu minder vorsichtigen Freunden. «Er muss uns allen eine Lehre sein.»
Seine Schwester nahm die leise Kritik nicht übel auf. Siebenundzwanzig Jahre des Ehestandes waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen; und dass sie ihrem unsteten und keineswegs dankbaren Gatten acht Kinder geschenkt hatte, hatte sie seit langem allem Anspruch enthoben, für schön zu gelten. Ihre Gesundheit ließ nichts zu wünschen übrig, ihr Wesen war zu Nachgiebigkeit geneigt, und so hatte sie sich angewöhnt zu sagen: Wenn sie erst einmal Großmutter wäre, brauche sie sich über ihr Aussehen keine Gedanken mehr zu machen.
«Und wie geht es Ombersley?», erkundigte sich Sir Horace mehr aus Höflichkeit als aus Interesse.
«Die Gicht macht ihm ein wenig zu schaffen, aber alles in allem fühlt er sich recht gut», erwiderte sie.
Sir Horace nahm, was wohl nur so dahin gesagt war, in einem unerwünscht wörtlichen Sinn und bemerkte kopfnickend: «Er hat immer zu viel getrunken. Na, immerhin, er nähert sich jetzt auch den sechzig. Da hast du doch wohl wenigstens die anderen Sorgen nicht mehr, wie?»
«Aber nein, längst nicht mehr», versicherte sie hastig. Lord Ombersleys Seitensprünge, die er nur zu oft im vollen Lichte der Öffentlichkeit begangen hatte, hatten ihr nie besonderen Kummer bereitet. Sie aber hatte keine Lust, mit ihren Verwandten offen darüber zu sprechen, und so gab sie dem Gespräch mit der Frage, woher er käme, eine jähe Wendung.
«Aus Lissabon», erwiderte er und nahm wieder eine Prise.
Lady Ombersley war leicht verwundert. Es waren jetzt zwei Jahre vergangen, seit der lange Krieg in Spanien zu Ende gekommen war. Wenn sie sich nicht täuschte, so hatte sie von Sir Horace zuletzt aus Wien gehört, wo er ohne Zweifel eine geheimnisvolle Rolle bei dem Kongress gespielt hatte, der dann durch die Flucht dieses grässlichen Scheusals aus Elba zu einem so jähen Schluss gekommen war. «Ach», sagte sie ein wenig ratlos, «natürlich, du hast ja ein Haus dort! Das hatte ich beinahe vergessen. Und wie geht es der lieben Sophia?»
«Es ist sich in der Tat so», sagte Sir Horace, schüttelte seine Schnupftabaksdose und schob sie in die Tasche, «dass ich hier hergekommen bin, um mit dir über Sophy zu sprechen.»
Sir Horace war seit fünfzehn Jahren Witwer. In all dieser Zeit hatte er weder die Hilfe seiner Schwester in Anspruch genommen, wenn Fragen der Erziehung seiner Tochter zu klären waren, noch hatte er unerbetenem Rat ein Ohr geliehen. Bei seinen Worten empfand Lady Ombersley jetzt ein leises Unbehagen. «Ja, Horace? Die liebe kleine Sophia. Das ist auch wieder mindestens vier Jahre her, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wie alt ist sie jetzt? Sie muss doch beinahe erwachsen sein?»
«Erwachsen ist sie schon seit Jahren», erwiderte Sir Horace. «Sie war es eigentlich von jeher. Jetzt ist sie zwanzig.»
«Zwanzig!», rief Lady Ombersley. Sie rechnete nach, dann sagte sie: «Ja, das muss sie wohl sein, denn meine Cecilia ist eben neunzehn geworden, und ich erinnere mich, dass deine Sophia ihr fast um ein Jahr voraus war. Ach du lieber Himmel, ja, ja. Die arme Marianne! Was für ein reizendes Geschöpf sie doch war, weiß Gott!»
Es kostete Sir Horace eine leichte Anstrengung, sich das Bild seiner verstorbenen Frau vor Augen zu rufen. «Ja, das war sie wohl. Man vergisst mit der Zeit so vieles, nicht wahr? Sophy ist ihr übrigens nicht sehr ähnlich. Gott sei Dank!»
«Ich kann mir denken, dass sie dir ein großer Trost gewesen sein muss», seufzte Lady Ombersley. «Und gewiss muss die tiefe Zuneigung, die du ihr entgegengebracht hast, mein lieber Horace, dem Kind bewusst sein.»
«Von so einer Zuneigung war nicht im Geringsten die Rede», unterbrach Sir Horace die Schwester. «Ich hätte sie gar nicht bei mir behalten, wenn sie mir Unannehmlichkeiten bereitet hätte. Aber das hat sie nie getan. Nettes kleines Ding, die Sophy.»
«Nun ja, mein Lieber, ohne Zweifel. Aber ein kleines Mädchen in Spanien und Portugal herumzuschleppen, wenn es doch eigentlich in ein anständiges Pensionat gehört ...»
«Das wäre gar nichts für sie gewesen. Dort hätte sie höchstens gelernt, sich wie ein zimperlicher Backfisch zu benehmen», sagte Sir Horace zynisch. «Es hat übrigens keinen Sinn, mir jetzt deswegen Vorhaltungen zu machen. Dazu ist es zu spät. Die Sache ist die, Lizzie, dass ich ein wenig in Verlegenheit bin. Ich hätte gern, dass du Sophy in deine Obhut nimmst, für die Zeit, die ich nach Südamerika gehe.»
«Nach Südamerika?» Lady Ombersley schnappte nach Luft.
«Nach Brasilien. Ich nehme eigentlich nicht an, dass ich sehr lange dort bleibe, aber ich kann die kleine Sophy nicht mitnehmen. Bei Tilly kann ich sie auch nicht lassen, denn Tilly ist tot. Schon vor Jahren in Wien gestorben. Es war das verteufelt Unpassendste, was sie tun konnte, aber sie hat es ja wohl nicht absichtlich getan.»
«Tilly?», fragte Lady Ombersley, gänzlich ratlos.
«Großer Gott, Elizabeth, gewöhne dir doch nicht an, jedes Wort zu wiederholen, das ich sage! Eine abstoßende Gewohnheit. Miss Tillingham, Sophys Gouvernante.»
«Du meine Güte, willst du etwa sagen, dass das Kind seither ohne Gouvernante ist?»
«Natürlich ist sie ohne Gouvernante! Sie braucht auch keine. Als wir in Paris lebten, fand ich stets in Hülle und Fülle Anstandsdamen für sie, und in Lissabon spielt das überhaupt keine Rolle. Aber in England kann ich sie unmöglich allein lassen.»
«Wahrhaftig, das scheint mir auch so. Aber, liebster Horace, wenn ich auch alles tun will, um dir gefällig zu sein, so weiß ich doch nicht recht –»
«Unsinn», sagte Sir Horace entschlossen. «Sie wird eine angenehme Gefährtin für dein Mädel sein – wie hieß sie doch? Cecilia? Sophy ist ein liebes junges Ding, verstehst du: sie hat kein schwarzes Fleckchen auf ihrer Seele.»
Dieses väterliche Lob ließ seine Schwester schmunzeln und einen schwachen Protest äußern. Sir Horace störte sich nicht daran. «Was wichtiger ist, sie wird dir keinerlei Ungelegenheiten bereiten. Sie hat den Kopf genau dort, wo er hingehört, meine Sophy. Ich mache mir nie Sorgen um sie.»
Lady Ombersley kannte den Charakter ihres Bruders genau und glaubte besonders seinen letzten Satz aufs Wort. Da sie aber gutmütig war, kam keine scharfe Bemerkung über ihre Lippen. «Ich bin überzeugt, dass sie ein liebes Ding ist. Immerhin musst du einsehen, Horace ...»
«Des Weiteren ist es an der Zeit, dass wir uns nach einem Gatten für sie umsehen», fuhr Sir Horace fort und ließ sich in einen Lehnstuhl auf der anderen Seite des Kamins fallen. «Ich weiß, dass ich mich in solchen Dingen auf dich verlassen kann. Bringe das in Ordnung, du bist schließlich ihre Tante. Und noch dazu meine einzige Schwester.»
«Es wäre mir eine Freude, sie in die Gesellschaft einzuführen», sagte Lady Ombersley versonnen. «Ich glaube nur nicht ... ich fürchte geradezu ... verstehst du, die Vorstellung Cecilias bei Hof, voriges Jahr, hat furchtbare Ausgaben mit sich gebracht. Und das, nachdem wir die liebe Maria kurz vorher verheiratet haben! Hubert schicken wir nach Oxford, und was uns der arme Theodore in Eton kostet, brauche ich gar nicht zu erwähnen.»
«Wenn dir bloß das Geld Sorgen macht, Lizzie, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Für diese Kleinigkeit komme ich auf. Bei Hof brauchst du sie nicht vorzustellen, das besorge ich alles, wenn ich zurückkomme. Wenn es dir dann zu lästig ist, finde ich schon irgendeine Dame, die es übernimmt. Worauf es mir für den Augenblick ankommt, ist, dass sie im Kreis ihrer Vettern und Kusinen lebt, unter die richtigen Leute kommt – dass sie den richtigen Stil der Dinge erlernt.»
«Das verstehe ich schon, und lästig wäre es mir wohl auch nicht. Nur kann ich mir einfach nicht helfen. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht ... dass es vielleicht nicht gut gehen würde ... nicht das Richtige wäre. Viel Gesellschaft haben wir hier nicht.»
«Was denn, mit einer ganzen Ladung Mädchen auf dem Buckel müsstet ihr das aber», sagte Sir Horace unumwunden.
«Lieber Horace, ich habe keine ganze Ladung Mädchen auf dem Buckel», protestierte Lady Ombersley. «Selina ist erst sechzehn, und Gertrude und Amabel sind kaum aus den Kinderschuhen geschlüpft.»
«Ich sehe schon, was los ist», sagte Horace nachsichtig. «Du hast Angst, dass sie deine Cecilia aussticht. Nein, nein, meine Liebe! Meine kleine Sophy ist keine Schönheit. Sie ist nicht übel – ich möchte sogar sagen, dass sie ein recht hübsches Ding ist –, aber deine Cecilia fällt ja ganz aus dem Rahmen. Ich erinnere mich noch deutlich, dass mir das auffiel, als ich sie voriges Jahr sah. Es hat mich sogar in Staunen versetzt, denn du selbst, Lizzie, bist nie überdurchschnittlich gewesen. Und Ombersley erschien mir immer ausgesprochen hässlich.»
Seine Schwester nahm diese scharfe Kritik geduldig hin, empfand es aber schmerzlich, dass er sie für fähig hielt, so unfreundliche Gedanken in Bezug auf ihre Nichte zu hegen. «Sogar wenn ich so abscheulich wäre, besteht nun doch nicht der geringste Anlass zu solchen Verdächtigungen», bemerkte sie. «Es ist noch nichts formell bekannt gegeben, Horace, aber ich kann dir eröffnen, dass Cecilia im Begriff ist, eine sehr günstige Verbindung einzugehen.»
«Das ist gut», sagte Sir Horace. «So bleibt dir wenigstens Muße, dich um einen Gatten für Sophy umzusehen. Schwer wirst du es nicht haben: sie ist ein reizendes kleines Ding, und sie wird ein für heutige Begriffe solides Vermögen haben. Ganz zu schweigen von dem, was ihre Mutter hinterlassen hat. Du brauchst auch nicht zu befürchten, dass ihre Wahl uns missfallen wird, sie ist ein vernünftiges Mädchen, und sie ist genug in der Welt herumgekommen, um zu wissen, worauf es ankommt. Wen hast du übrigens für Cecilia bekommen?»
«Lord Charlbury hat Ombersley um die Erlaubnis gebeten, um sie anhalten zu dürfen», antwortete seine Schwester mit leisem Stolz.
«Charlbury, eh!», sagte Sir Horace. «Das ist wenigstens etwas, Elizabeth! Muss schon sagen, ich habe nicht erwartet, dass du einen so guten Fang machen würdest. Das Aussehen allein macht es nicht, und nach der Art, wie Ombersley sein Vermögen durchbrachte, als ich ihn zuletzt sah ...»
«Lord Charlbury», bemerkte Lady Ombersley ein wenig steif, «ist ein außerordentlich reicher Mann, dem solche vulgären Gedanken bestimmt ganz fern liegen. Tatsächlich hat er mir selbst gesagt, dass es ein Fall von Liebe auf den ersten Blick war ...»
«Großartig! Und ich hatte gedacht, dass er schon seit einiger Zeit nach einer Frau herumsucht – dreißig ist er bestimmt, oder nicht? Aber wenn er wirklich für das Mädchen Zuneigung empfindet, umso besser. Das wird doch wohl sein Interesse für sie festigen.»
«Ja, und ich bin überzeugt, dass sie gut miteinander auskommen werden. Er ist die Liebenswürdigkeit und Verbindlichkeit selbst, ein vollendeter Gentleman, ungewöhnlich verständnisvoll, und sein Äußeres muss gefallen.»
Sir Horace, dem das Glück seiner Nichte nicht so sehr am Herzen lag, bemerkte nur: «Gut, gut. Er ist offenbar ein Spiegel aller Vorzüge, und Cecilia kann sich nur beglückwünschen, dass sie eine so gute Verbindung eingeht! Hoffentlich bringst du für Sophy auch etwas so Hübsches zustande.»
«Ich wollte, es gelänge mir», antwortete sie mit einem Seufzer. «Nur ist der Augenblick nicht gerade günstig, denn die Sache ist die, verstehst du, ich fürchte, es wird Charles nicht recht sein.»
Sir Horace runzelte in der Bemühung, sich des Namens zu entsinnen, die Stirn. «Und ich dachte, er hieße Bernard. Warum sollte es ihm nicht recht sein?»
«Ich spreche ja gar nicht von Ombersley, Horace. Du wirst dich doch an Charles erinnern!»
«Wenn du den ältesten von deinen Jungen meinst, nun gewiss, natürlich erinnere ich mich seiner. Aber was hat er in dieser Sache mitzusprechen? Und warum, zum Teufel, sollte er etwas gegen meine Sophy haben?»
«Aber nein, doch nicht gegen sie! Das könnte er doch nicht! Ich fürchte nur, es könnte ihm nicht recht sein, wenn wir uns gerade jetzt in einen geselligen Trubel stürzen! Vermutlich hast du seine Verlobungsanzeige nicht bekommen, und so muss ich dir also sagen, dass er mit Miss Wraxton verlobt ist.»
«Was, doch nicht mit des alten Brinklows Tochter? Auf mein Wort, Lizzie, du hast etwas geleistet! Ich hätte nie gedacht, dass du so verständig bist! Das ist einmal eine Wahl! Da kann man dir nur gratulieren.»
«Ja», bestätigte Lady Ombersley, «wahrhaftig! Miss Wraxton ist ein ganz ausgezeichnetes Mädchen, sie hat tausend hervorragende Eigenschaften. Eine vorzügliche Bildung und Prinzipien, die Achtung einflößen müssen.»
«Klingt, als ob sie entsetzlich langweilig wäre», äußerte Sir Horace freimütig.
«Charles», sagte Lady Ombersley und blickte trübe in das Kaminfeuer, «Charles macht sich nichts aus lebensprühenden jungen Mädchen. Er hat nichts übrig für irgendwelche extravagante Narrheiten. Mir wäre es nicht unlieb, wenn Miss Wraxton über etwas mehr Lebhaftigkeit verfügte ... aber das bedeutet schließlich nichts, Horace. Ich hab zwar zeitlebens keine Neigung gezeigt, aus mir einen Blaustrumpf zu machen, aber heutzutage, wo so viele junge Frauenspersonen aufmüpfig sind, tut es gut, eine zu finden, die ... nun, Charles findet jedenfalls, dass ihr Ernst Miss Wraxton gut steht!», beendigte sie fast überstürzt ihre Ausführungen.
«Weißt du, Lizzie, es ist eigentlich komisch, dass gerade ein Sohn von dir und Ombersley ein solcher Langweiler sein soll», bemerkte Sir Horace gleichmütig. «Ich nehme doch an, du hast Ombersley nicht hintergangen, oder –?»
«Horace!»
«Nein, bestimmt hast du es nicht getan. Du brauchst nicht gleich den Mund zu verziehen! Bei deinem Ältesten schon gewiss nicht: Dazu warst du zu gescheit! Trotzdem ist es merkwürdig. Mir ist das oft zu Bewusstsein gekommen. Von mir aus mag er seinen Blaustrumpf heiraten, mir ist das gleich, aber all das erklärt nicht, warum du einen Pfifferling dafür geben sollst, was ihm recht ist oder nicht!»
Lady Ombersley wandte ihren Blick wieder von den glimmenden Kohlen ihm zu. «Du verstehst nicht ganz, Horace.»
«Genau das habe ich eben festgestellt.»
«Ja, nun, Horace ... Matthew Rivenhall hat Charles sein ganzes Vermögen hinterlassen.»
Sir Horace verstand es im Allgemeinen seine Fassung zu wahren, aber jetzt fiel es ihm offenbar doch schwer, diese Mitteilung mühelos zu verdauen. Einen Augenblick lang starrte er seine Schwester an, dann fragte er: «Du meinst doch nicht diesen alten Onkel Ombersley?»
«Ja, gerade den meine ich.»
«Den Nabob?»
Lady Ombersley nickte, aber ihr Bruder schien immer noch nicht befriedigt. «Der Bursche, der in Indien ein Vermögen gemacht hat?»
«Ja, und wir meinten immer ... aber er sagte dann, Charles wäre außer ihm der einzige Rivenhall, der eine Spur Verstand hat, und so hinterließ er ihm alles, Horace! Alles!»
«Du lieber Gott!»
Dieser Ausruf schien Lady Ombersley durchaus passend. Sie nickte wieder, sah ihren Bruder trübselig an und zerknitterte die Fransen ihres Schals zwischen den Fingern.
«Und jetzt ist es Charles, der hier den Ton angibt!», sagte Sir Horace.
«Niemand hätte großzügiger sein können als er», bemerkte Lady Ombersley unglücklich. «Wir müssen schließlich vernünftig sein.»
«So eine Frechheit!», brummte Sir Horace, jetzt selbst ganz und gar Vater. «Was hat er denn getan?»
«Nun, Horace, du weißt das wohl nicht, weil du ja immer im Ausland lebst. Der arme Ombersley hatte eine Menge Schulden.»
«Das weiß alle Welt! Hab ihn nie anders gekannt als in Bedrängnis. Du willst doch nicht sagen, dass der Junge so verrückt war, ihm die Schulden zu bezahlen?»
«Nun, Horace, einer musste es ja schließlich tun!», protestierte sie. «Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig die Lage bereits war! Und dabei hatten wir die jüngeren Burschen standesgemäß unterzubringen, die lieben Mädchen erst! Es ist schließlich kein Wunder, dass Charles darauf Wert legt, Cecilia gut verheiratet zu sehen.»
«Also er sorgt für das ganze Nest? Doppelter Narr! Und wie ist es mit den Hypotheken? Wenn nicht der größte Teil von Ombersleys Besitz ein unveräußerliches Erblehen wäre, hätte er das Ganze gewiss längst verspielt.»
«Ich verstehe nicht allzu viel von Erbrechten», sagte seine Schwester, «aber ich fürchte, Charles hat in dieser Sache nicht immer ganz so gehandelt, wie er eigentlich sollte. Ombersley war es gar nicht recht. Und trotzdem werde ich immer sagen, dass es sich ganz und gar nicht schickt, seinen Erstgeborenen einen Schlangenzahn zu nennen! Vermutlich hätte Charles, als er großjährig wurde, seinem armen Papa manches erleichtern können, wenn er nur ein ganz klein wenig verständnisvoll gewesen wäre. Aber nichts konnte ihn dazu bringen, in eine Aufhebung des Erbrechtes einzuwilligen. Und so kam alles auf einen toten Punkt. Können wir Ombersley tadeln, dass er ärgerlich ist? Dann starb dieser widerwärtige alte Mann –»
«Wann?», fragte Sir Horace. «Wieso habe ich bis heute nie davon gehört?»
«Das war vor mehr als zwei Jahren, und ...»
«Dann ist alles verständlich. Ich hatte damals verteufelte Mühe, mit Angoulême und der ganzen Bande fertigzuwerden. Muss passiert sein, während ich in Toulouse war. Ich könnte es beschwören. Aber als ich voriges Jahr hier war, erwähntest du kein Wort davon, Lizzie.»
Dieser Vorwurf schien ihr ungerecht, und sie sagte ärgerlich: «Ich weiß wirklich nicht, wie ich damals an solche Lappalien hätte denken sollen. Das Ungeheuer war gerade entsprungen, und Champs de Mars und die Zahlungseinstellung der Banken und weiß Gott, was noch alles! Und gerade in einem solchen Moment kommst du ohne leiseste Vorankündigung aus Brüssel und sitzt bloß zwanzig Minuten hier. In meinem Kopf ging alles drunter und drüber, und wenn eine meiner Antworten zu deinen Fragen gepasst hat, so ist das mehr, als ich mir zugetraut hätte!»
Sir Horace ging auf diese Belanglosigkeiten nicht ein, sondern sagte mit so viel echtem Gefühl, wie er nur aufbrachte: «Eine Schmach! Ich will nicht ableugnen, dass bei Ombersley eine Schraube lose ist, es hat auch keinen Sinn, Tatsachen zu verhüllen. Aber einen Menschen einfach aus seinem Testament herauswerfen und seinen Sohn in die Lage bringen, dass er dem Vater den Herrn zeigt ... und das tut der doch gewiss!»
«Aber nicht doch», wehrte Lady Ombersley schwach ab. «Charles ist sich durchaus darüber im Klaren, was er seinem Vater schuldet! Du musst nicht denken, dass er es an Respekt fehlen lässt, bestimmt nicht! Es fällt dem armen Ombersley eben nur ein bisschen schwer, dass Charles jetzt alles in seine Hände genommen hat.»
«Famoser Stand der Dinge!»
«Nun ja, aber einen Trost haben wir: Es ist nicht allgemein bekannt. Und ich will nicht abstreiten, dass es in gewisser Beziehung auch sein Gutes hat. Du wirst es kaum fassen, Horace, aber ich glaube, dass keine unbezahlte Rechnung im Haus ist!» Eine kurze Überlegung bewog sie, diese Behauptung wieder zurückzunehmen. «Ich will mich nicht für Ombersley verbürgen, aber all diese Haushaltsrechnungen, von denen Eckington – du erinnerst dich doch an unseren guten Eckington, Ombersleys Verwalter? Er pflegte so viel Aufhebens zu machen. Und die Kosten für Eton und Oxford! Für alles, mein lieber Bruder, für alles sorgt Charles.»
«Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass Charles so verrückt ist, das Vermögen des alten Matt Rivenhall zum Fenster hinauszuwerfen, indem er alle Spesen dieses voll gestopften Hauses bezahlt!», rief Sir Horace.
«Nein, o nein! Ich habe gar keinen Geldverstand, es hat also keinen Sinn, von mir Erklärungen zu verlangen. Aber ich glaube, dass Charles seinen Vater dazu gebracht hat, ihm zu erlauben, dass er das Vermögen verwaltet.»
«Fein hat er ihn erpresst, das muss ich schon sagen», brummte Sir Horace grimmig. «Prächtige Zeiten, in denen wir leben! Versteh mich recht, ich begreife den Standpunkt des Jungen, Lizzie, aber du tust mir wahrhaftig leid.»
«Bitte, glaube doch nicht, dass es so ist!», rief Lady Ombersley niedergeschlagen. «Ich wollte keinesfalls, dass du denkst ... Ich wollte dir gewiss keinen Anlass geben anzunehmen, dass Charles jemals unangenehm ist! Er ist es wirklich nicht, oder höchstens, wenn er seine Ausbrüche hat. Aber auch da muss man ihm zugutehalten, dass vieles an seiner Geduld zerrt! Darum habe ich eben das Gefühl, lieber Horace, dass ich ihn nicht reizen darf, wenn es ihm nicht passt, dass ich mich um Sophia kümmere.»
«Unsinn! Warum sollte ihm das nicht recht sein?»
«Wir hatten uns vorgenommen, in dieser Saison gar keine Gesellschaften zu geben, oder nur die unvermeidlichen. Unglücklicherweise musste Charles’ Heirat verschoben werden, wegen eines Trauerfalls, der Miss Wraxton betroffen hat. Eine von Lady Brinklows Schwestern. Miss Wraxton wird sechs Monate lang die schwarzen Handschuhe nicht ablegen. Du musst wissen, dass die Brinklows in Sachen korrekten Benehmens ungemein heikel sind. Eugenia besucht nur ganz geschlossene Gesellschaften, und man darf natürlich erwarten, dass Charles auf sie Rücksicht nimmt.»
«Du lieber Gott, Elizabeth, ein Mann muss doch nicht wegen der Tante einer Frauensperson, mit der er noch nicht einmal verheiratet ist, schwarze Handschuhe anziehen!»
«Natürlich nicht, aber Charles scheint es so zu empfinden. Und dann ist da auch noch Charlbury!»
«Was fehlt denn dem wieder?»
«Mumps», sagte Lady Ombersley tragisch.
«Ah!» Sir Horace platzte heraus. «Was kann das für ein Bursche sein, der Mumps bekommt, wenn er Cecilia heiraten soll!»
«Wahrhaftig, Horace, ich muss schon sagen, dass ich das sehr ungerecht von dir finde. Wie hätte er es denn vermeiden sollen? Es ist doch so schrecklich unangenehm für ihn! Und was schlimmer ist, es ist ein grässliches Unheil, denn er hätte Cecilia ohne Zweifel längst an sich binden können – und er hätte es sicher getan, denn er ist der liebenswürdigste Mensch und hat untadelige Manieren, ganz comme il faut! Aber Mädchen sind doch so närrisch, setzen sich romantische Dinge in den Kopf, die verrücktesten Launen. Nun, ich bin nur froh, dass Cecilia keines von diesen grässlich modernen Geschöpfen ist! Natürlich lässt sie sich von ihren Eltern leiten. Trotzdem kann man nicht ableugnen, dass es in diesem Augenblick nichts Unpassenderes gibt als Charlburys Mumps.»
Sir Horace klappte seine Schnupftabakdose auf und betrachtete seine Schwester belustigt und hintergründig. «Und was ist Miss Cecilias besondere verrückteste Laune?», erkundigte er sich.
Lady Ombersley wusste, dass ihr ältester Sohn ihr in diesem Augenblick striktes Schweigen empfohlen hätte, doch der Drang, sich vor dem Bruder die Sorge von der Seele zu reden, war stärker. «Du wirst es doch gewiss nicht weitersagen, Horace! Nun, tatsächlich bildet sich das närrische Ding ein, dass sie Augustus Fawnhope liebt.»
«Einen von diesen Lutterworth-Jungen?», fragte Sir Horace. «Keine sonderlich glückliche Wahl, muss ich schon sagen.»
«Gott behüte, du sollst so etwas nicht einmal erwähnen! Und dabei ist es noch der Jüngste, er hat überhaupt nichts zu erwarten! Aber er dichtet.»
«Sehr gefährlich», räumte Sir Horace ein. «Ich glaube nicht, dass ich dem Burschen jemals begegnet bin. Wie ist er denn?»
«Sehr schön», sagte Lady Ombersley niedergeschlagen.
«Wie, wohl in der Art wie Lord Byron? Der Kerl ist für vieles verantwortlich.»
«Nein. Er ist so hübsch wie Cecilia, und hinkt auch nicht. Obwohl seine Gedichte sehr nett sind, in weißes Kalbsleder gebunden, so scheinen sie doch nicht besonders zu wirken. Ich meine, keineswegs so wie die Lord Byrons. Mir kommt das sehr ungerecht vor, denn es hat, glaube ich, eine Menge Geld gekostet, sie zu drucken, und er musste für das Ganze aufkommen ... oder eigentlich Lady Lutterworth, soviel ich gehört habe.»
«Jetzt fällt es mir ein», sagte Sir Horace. «Ich kenne den Burschen. Er war voriges Jahr mit Stuart in Brüssel. Wenn du etwas auf meinen Rat gibst, dann verheiratest du deine Cecilia so schnell wie möglich mit Charlbury.»
«Nun ja, das möchte ich wohl. Aber du musst einsehen, Horace, dass es einfach nicht in meiner Macht steht, etwas dergleichen zu tun, wenn er mit Mumps im Bett liegt.»
Sir Horace schüttelte den Kopf. «Sie wird diesen Poeten heiraten.»
«Sag doch so etwas nicht! Charles ist bloß der Ansicht, dass es richtig wäre, sie nirgends hinzubringen, wo sie den jungen Menschen treffen kann. Das ist ein weiterer Grund, warum wir jetzt so zurückgezogen leben, und von allen der lästigste. Manchmal meine ich wirklich, alles wäre viel einfacher, wenn der Unglücksbursche gar nicht in Betracht käme. Wenn er nur irgendein Mitgiftjäger wäre, der Sohn eines Kaufmanns oder irgendetwas in der Art! Dann könnte man ihm einfach das Haus verbieten und Cecilia untersagen, mit ihm auf Bällen zu sprechen. Und das wäre nicht einmal notwendig, denn in der guten Gesellschaft würde sie ihn ja doch nicht treffen. Aber den Fawnhopes begegnet man natürlich überall. Das ist ja die reinste Herausforderung des Unheils. Obwohl Charles ihm so kühl wie möglich begegnet, sieht er doch selber ein, dass man nicht so zurückweisend sein darf, seine Familie zu verletzen. Almeria Lutterworth ist eine meiner ältesten Freundinnen.»
Sir Horace, den dieser Gegenstand zu langweilen begann, gähnte und sagte träge: «Ich glaube, deswegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Fawnhopes sind arm wie Kirchenmäuse, und wahrscheinlich wünscht Lady Lutterworth diese Verbindung ebenso wenig wie du.»
«Ganz und gar nicht», antwortete sie unmutig. «Sie ist närrischer, als es einer Frau erlaubt ist, Horace! Was Augustus sich in den Kopf setzt, das muss er bekommen. Sie macht die unmissverständlichsten Andeutungen, so dass ich gar nicht weiß, wo ich hinschauen soll, geschweige denn, was ich antworten soll! Mir fällt nichts ein, außer, dass Lord Charlbury gebeten hat, um Cecilia anhalten zu dürfen, und dass er ihr nicht gleichgültig ist! Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass Augustus so unschicklich handeln könnte, um Cecilia anzuhalten, ohne Ombersley vorher um Erlaubnis zu fragen. Aber denke dir, gerade das hat er getan!»
«Na ja, wenn sie so in ihn vernarrt ist, dann tätest du besser, ihn ihr zu lassen. Eine schlechte Verbindung ist es ja keineswegs, und wenn sie unbedingt die Frau eines mittellosen jüngeren Sohnes werden will, dann ist das schließlich ihre Angelegenheit.»
«Das würdest du wohl nicht sagen, wenn es sich um deine Sophia handelte», bemerkte seine Schwester.
«Sophy ist keine solche Närrin.»
«Cecilia ist auch keine Närrin», erklärte Lady Ombersley gekränkt. «Wenn du Augustus gesehen hast, dann wunderst du dich nicht über sie. Man muss ihm geradezu gut sein. Mir ist es auch so gegangen. Aber Charles hat ganz Recht, das musste ich nachher einsehen. Es würde nicht gut passen.»
«Nun ja, wenn sie ihre Kusine zur Gesellschaft hier hat, dann wird sie zweifellos auf andere Gedanken kommen», meinte Sir Horace tröstlich.
Dieser Gedanke schien Eindruck auf Lady Ombersley zu machen. Ihre Züge hellten sich auf. «Das könnte wohl so sein. Allerdings ist sie ein wenig scheu, weißt du, und schließt sich nicht leicht an jemanden an. Seit ihre beste Freundin, Miss Friston, geheiratet hat und in die Midlands gezogen ist, steht sie kaum mit irgendeinem Frauenzimmer auf vertrautem Fuß. Wenn wir allerdings jetzt die liebe Sophia im Hause hätten ...» Sie versank in Schweigen und erwog offensichtlich den Plan. In diese Gedanken war sie noch versunken, als die Tür aufging und ihr ältester Sohn den Salon betrat.
Der ehrenwerte Charles Rivenhall war sechsundzwanzig Jahre alt. Er hatte aber ein barsches und mürrisches Wesen, das ihn, zusammen mit einem Gehabe, das Selbstsicherheit und Zurückhaltung vereinigte, eher um einige Jahre älter erscheinen ließ. Er war ein hochgewachsener, kräftig gebauter junger Mann, dem man zutraute, dass er lieber über seines Vaters Acker ritt, als im Salon seiner Mutter Höflichkeiten auszutauschen. Fast immer zog er seinen Reitanzug den modischeren Pantalons und Kanonenstiefeln vor. Seine Krawatte band er in denkbar schlechtem Stil, duldete aber zur Not, dass seine sehr bescheidenen Hemdspitzen mit ein klein wenig Stärke gesteift wurden. Accessoires, wie Siegel, Berlocken und Monokel, lehnte er ganz ab und seinen Schneider beleidigte er, indem er darauf bestand, seine Röcke so geschnitten zu bekommen, dass er ohne Hilfe eines Kammerdieners hineinschlüpfen konnte. Er hatte einmal die Hoffnung ausgesprochen, der Himmel würde nicht zulassen, dass man ihn irrtümlich zu der Dandy-Gesellschaft zähle. Wie sein Freund Mr. Cyprian Wychbold ihm in aller Freundlichkeit auseinandersetzte, war der Wunsch nach himmlischem Eingreifen in dieser Sache ganz überflüssig. Dandys wären, so legte Mr. Wychbold sehr ernsthaft dar, durch ihre guten Manieren ebenso ausgezeichnet wie durch ihre gepflegte Erscheinung, sie wären im Allgemeinen eine recht liebenswerte Sorte von Männern und durch ihr tadelloses Benehmen und ihr gewinnendes Wesen in jedem Salon akzeptabel. Mr. Rivenhalls Auffassung dagegen, wie man sich in Gesellschaft angenehm zu machen habe, war die, dass er jeden, für den er keine besondere Vorliebe empfand, mit kalter Höflichkeit behandelte. Zu seinem keineswegs gewinnenden Verhalten gehörte auch ein Trick, Leute, die er missbilligte, mit einem Blick aus der Fassung zu bringen und Bemerkungen fallen zu lassen, die jedes Gespräch zu einem jähen Ende führten. So war er (wenigstens nach Mr. Wychbolds Meinung) eher in Gefahr, für einen groben Lackel gehalten zu werden.
Als er die Tür hinter sich schloss, blickte seine Mutter auf. Sie machte eine jähe Bewegung und sagte mit einem nervösen Unterton, der ihrem Bruder missfiel: «Ach, Charles! Denk dir nur, unser Onkel Horace!»
«Dassett hat es mir schon gemeldet», antwortete Mr. Rivenhall. «Und wie steht Ihr Befinden, Sir?»
Er wechselte einen Händedruck mit seinem Oheim, zog sich einen Stuhl heran, setzte sich und begann ein höfliches Gespräch mit Sir Horace. Seine Mutter hatte zuerst mit den Fransen ihres Schals, dann mit ihrem Taschentuch gespielt. Nun aber unterbrach sie dieses Geplauder: «Charles, du erinnerst dich an Sophia? Deine kleine Kusine?»
Mr. Rivenhall sah nicht aus wie einer, der sich einer kleinen Kusine erinnert, aber er sagte in seiner kühl-höflichen Art: «Gewiss. Sie befindet sich hoffentlich wohl?»
«Sie ist in ihrem Leben noch keinen Tag krank gewesen, von den Masern einmal abgesehen», sagte Sir Horace. «Sie werden sie ja bald selbst sehen. Ihre Mutter wird sich ihrer annehmen, solange ich in Brasilien bin.»
Es lag auf der Hand, dass diese Art, mit der Nachricht herauszuplatzen, Lady Ombersley nicht ratsam schien, und sie beeilte sich einzugreifen. «Nun, es ist natürlich noch nicht entschieden, aber mir scheint, dass mir nichts lieber sein könnte, als die Tochter meines lieben Bruders bei mir zu haben. Und ich dachte auch, Charles, dass es für Cecilia nett sein müsste. Sophia und sie sind, wie du weißt, annähernd gleich alt.»
«Brasilien?», fragte Mr. Rivenhall. «Das muss ja höchst interessant sein. Wahrhaftig. Werden Sie lange bleiben, Sir?»
«Ach, kaum», erwiderte Sir Horace vage. «Vermutlich nicht. Das hängt wohl von gewissen Umständen ab. Ich sagte Ihrer Mutter, dass ich ihr sehr dankbar sein werde, wenn sie einen passenden Gatten für meine Sophy findet. Es ist an der Zeit, dass sie heiratet, und Ihre Mutter scheint, nach allem, was ich höre, in dieser Beziehung eine Meisterin zu sein. Wenn ich mich nicht irre, darf ich Sie beglückwünschen, mein Junge?»
«Danke, ja», antwortete Mr. Rivenhall mit einer leichten Verneigung.
«Wenn es dir nicht unlieb ist, Charles. Ich für mein Teil hätte Sophia gern hier», sagte Lady Ombersley besänftigend.
Er warf ihr einen ungeduldigen Blick zu und erwiderte: «Du wirst, bitte, ganz nach deinem Wunsch handeln. Ich wüsste nicht, was mich das anginge.»
«Ich habe deinem Onkel natürlich auseinandergesetzt, dass wir ein sehr zurückgezogenes Leben führen.»
«Daran stößt sich meine Kleine gewiss nicht», sagte Sir Horace gutlaunig. «Sie ist ein nettes Ding, findet sich immer selbst eine Beschäftigung. Sie war in einer spanischen Stadt genauso glücklich wie in Wien und Brüssel.»
Bei dieser Bemerkung setzte Lady Ombersley sich mit einem Ruck auf. «Du willst doch nicht sagen, dass du sie voriges Jahr in Brüssel mithattest?»
«Natürlich war sie in Brüssel. Wo, zum Teufel, hätte sie sonst sein sollen?», antwortete Sir Horace gereizt. «Hätte ich sie etwa in Wien lassen sollen? Übrigens hat es ihr Vergnügen bereitet. Wir haben eine Menge alter Freunde dort getroffen.»
«Aber die Gefahr!»
«Pah, Unsinn! Gar keine Gefahr, wo doch Wellington den Oberbefehl hatte.»
«Und wann, Sir, dürfen wir meine Kusine erwarten?», unterbrach ihn Mr. Rivenhall. «Hoffentlich wird sie unser eintöniges Londoner Leben nach all den Aufregungen auf dem Kontinent nicht zu enttäuschend finden.»
«Die nicht», entgegnete Sir Horace. «Wenn Sophy nicht sofort irgendeine Beschäftigung für sich findet, dann kenne ich sie schlecht. Lasst sie nur machen! Ich tue das immer, und dabei passiert ihr nie etwas. Genau weiß ich nicht, wann sie hier eintreffen kann. Natürlich möchte sie gern so lange mit mir zusammenbleiben wie möglich, aber sie wird nach London fahren, sobald ich an Bord gehe.»
«Nach London fahren, sobald du – Horace, du wirst sie mir doch selbst herbringen!», rief seine Schwester empört. «Ein Mädchen ihres Alters, und allein reisen! So etwas habe ich noch nie gehört!»
«Allein wird sie ja nicht sein. Sie hat doch ihre Magd bei sich – einen richtigen Drachen. Die ist mit uns durch ganz Europa gezogen! Und John Potton obendrein!» Er bemerkte, dass sein Neffe die Brauen hochzog, und so fühlte er sich verpflichtet, hinzuzufügen: «Pferdeknecht– Bote – Lakai. Hat Sophy betreut, seit sie ein Baby war.» Er zog die Uhr und warf einen Blick darauf. «Schön, da wir ja alles besprochen haben, muss ich wohl gehen, Lizzie. Ich verlasse mich auf dich, dass du auf meine Sophy aufpasst und für eine Heirat sorgst. Es ist wichtig, denn ... Aber ich habe keine Zeit mehr, dir das zu erklären. Sie wird das vermutlich selbst besorgen.»
«Aber, Horace, es ist noch gar nicht alles geregelt», protestierte seine Schwester. «Und Ombersley wird sehr enttäuscht sein, wenn er dich verfehlt. Ich hoffte, du würdest zum Dinner bleiben.»
«Nein, ich kann leider nicht», erwiderte er. «Ich speise im Carlton House, meine Empfehlungen an Ombersley. Ich denke, ich begegne ihm noch dieser Tage.»
Er küsste sie flüchtig, gab ihr einen herzlichen Klaps auf die Schulter und verließ, von seinem Neffen gefolgt, den Salon.
«Sonst habe ich mir gerade nichts gewünscht», sagte Lady Ombersley ärgerlich, als Charles zurückkam. «Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wann das Kind eintreffen soll.»
«Es spielt keine Rolle», sagte Charles mit einem Gleichmut, der ihr auf die Nerven fiel. «Du wirst Anweisung geben, ein Zimmer für sie vorzubereiten, und dann mag sie kommen, wann sie will. Hoffentlich findet Cecilia an ihr Gefallen, denn sie wird sich wohl am meisten mit ihr abgeben müssen.»
«Die arme Kleine!», seufzte Lady Ombersley. «Offen gesagt, ich will sie gern ein wenig bemuttern, Charles. Was für ein sonderbares, einsames Leben muss sie doch führen!»
«Sonderbar wohl, aber einsam kaum, wenn sie bei meinem Onkel Dame des Hauses ist. Vermutlich hat sie irgendeine ältere Dame bei sich gehabt, eine Gouvernante oder etwas dergleichen.»
«Das möchte man wohl annehmen. Aber dein Onkel hat mir eben erzählt, dass die Gouvernante starb, als sie in Wien waren! Ich sage so etwas nicht gern über meinen Bruder, aber Horace scheint völlig ungeeignet, eine Tochter in Obhut zu haben.»
«Äußerst ungeeignet», antwortete er trocken. «Hoffentlich hast du deine Freundlichkeit nicht noch zu bedauern, Mama.»
«Ach nein, das gewiss nicht. Dein Onkel hat von dem Mädchen so gesprochen, dass ich geradezu Sehnsucht danach habe, sie hier zu begrüßen. Die arme Kleine ist es, fürchte ich, nicht gewöhnt, dass ihre Wünsche oder ihre Behaglichkeit berücksichtigt werden! Ich war fast böse auf Horace, als er mir sagte, sie wäre ein nettes Ding und hätte ihm nie die leiseste Sorge bereitet. Er hat niemals jemandem erlaubt, ihm Sorgen zu bereiten, einen selbstsüchtigeren Menschen gibt es wohl kaum. Sophia muss die Sanftmut ihrer Mutter geerbt haben. Ohne Zweifel wird sie eine angenehme Gesellschaft für die arme Cecilia sein.»
«Ich hoffe so. Das erinnert mich übrigens daran, Mama, dass ich eben wieder eine der Blumensendungen jener Zierpuppe an meine Schwester abgefangen habe. Dieses Billett war daran geheftet.»
Lady Ombersley nahm den Brief, der ihr dargeboten wurde, und betrachtete ihn unlustig. «Was soll ich damit tun?», fragte sie.
«Wirf ihn ins Feuer», riet er.
«Ach nein, das könnte ich nicht, Charles! Vielleicht ist es etwas Besonderes! Übrigens kann er auch eine Botschaft seiner Mutter für mich enthalten.»
«Höchst unwahrscheinlich, aber wenn du das meinst, solltest du den Brief eben lesen.»
«Natürlich, ich weiß, es ist meine Pflicht», sagte sie unglücklich.
Er setzte eine geringschätzige Miene auf, äußerte aber nichts. Nach kurzem Zögern erbrach sie das Siegel und entfaltete ein Blatt. «Sieh doch, ein Poem!», verkündete sie. «Und wirklich hübsch, muss ich sagen! Hör nur, Charles! ‹Wenn deiner Augen mildes Blau, o Nymphe, mein rastlos Herze überglänzt –›»
«Vielen Dank, ich finde keinen Geschmack an Versen», unterbrach Mr. Rivenhall sie ärgerlich. «Wirf es ins Feuer und sage Cecilia, dass sie ohne deine Erlaubnis keine Briefe annehmen darf.»
«Nun gewiss. Aber soll ich es wirklich verbrennen, Charles? Bedenke doch, wenn es die einzige Niederschrift des Poems ist? Vielleicht möchte er es drucken lassen?»
«Er wird keineswegs solches Zeug über eine Schwester von mir drucken lassen», sagte Mr. Rivenhall grimmig und streckte herrisch seine Hand aus.
Lady Ombersley, die sich stets jedem stärkeren Willen beugte, wollte ihm eben das Blatt reichen, als eine zitternde Stimme von der Tür her sagte: «Nicht! Mama!»
Kapitel 2
LADY OMBERSLEY ließ die Hand sinken, Mr. Rivenhall wandte sich scharf um, die Stirn gerunzelt. Seine Schwester warf ihm einen Blick bitteren Vorwurfs zu, lief zu ihrer Mutter und sagte: «Gib mir das, Mama! Welches Recht hat Charles, an mich gerichtete Briefe zu verbrennen?»
Lady Ombersley warf ihrem Sohn einen hilflosen Blick zu, aber er sagte nichts. Cecilia riss das offene Papierblatt aus den Fingern ihrer Mutter und drückte es an ihren wogenden Busen. Erst diese Geste brachte Mr. Rivenhall zum Sprechen. «Um Gottes willen, Cecilia, kein Theaterspiel!»
«Wie kannst du dich unterstehen, meine Briefe zu lesen?», fuhr sie ihn an.
«Ich habe deinen Brief gar nicht gelesen. Ich habe ihn Mama gegeben, und ihr wirst du doch das Recht wohl nicht bestreiten, ihn zu lesen.»
In ihren sanften blauen Augen schwammen Tränen. «Nur du bist schuld! Mama würde nie – ich hasse dich, Charles! Ich hasse dich!»
Er zuckte die Achseln und wandte sich ab. Lady Ombersley sagte matt: «So solltest du nicht reden! Du weißt, dass es sich nicht für dich schickt, ohne mein Wissen Briefe anzunehmen. Ich weiß nicht, was Papa davon halten würde, wenn er es erführe.»
«Papa!», rief Cecilia ärgerlich, «Nur Charles macht sich ein Vergnügen daraus, mich ins Unglück zu treiben!»
Er warf ihr einen empörten Blick zu. «Es wäre wohl unnütz, scheint mir, zu betonen, dass es mein ernster Wunsch ist, dich nicht ins Unglück getrieben zu sehen.»
Sie erwiderte nichts, faltete den Brief mit bebenden Händen zusammen, schob ihn in den Ausschnitt ihres Kleides und warf Charles dabei einen herausfordernden Blick zu. Dieser Blick begegnete einem der Geringschätzung; Mr. Rivenhall lehnte seine Schulter gegen den Kaminsims, schob die Hände in die Hosentaschen und wartete mit einem diebischen Lächeln auf ihre weiteren Äußerungen.
Sie aber trocknete nur ihre Augen und versuchte ihr Schluchzen zu meistern. Cecilia war ein sehr hübsches Mädchen. Sie trug die lichtgoldenen Locken in Ringeln um ihr feingeschnittenes Gesicht, dessen zarter Teint im Augenblick, keineswegs zu ihren Ungunsten, von Zornesröte überzogen war. Im Allgemeinen zeigte es den Ausdruck liebenswürdiger Versonnenheit, aber die Erregung hatte einen kriegerisches Funkeln in ihre Augen gezaubert. Sie hatte die Unterlippe zwischen die Zähne gepresst, was ihr etwas Leidenschaftliches verlieh. Der Bruder, dem dieser Reiz nicht entging, bemerkte spöttisch, sie solle sich angewöhnen, öfter aus der Fassung zu geraten, denn es stehe ihr ganz gut und verleihe ihrem Gesicht Leben. Es sei sonst ganz hübsch, aber wirke im Allgemeinen ein wenig schal.
Diese unfreundliche Bemerkung ließ Cecilia kalt. Es konnte ihr unmöglich entgangen sein, dass sie überall Bewunderung erregte. Sie war aber bescheiden, schlug ihre Schönheit nicht hoch an und hätte es bei weitem vorgezogen, wenn sie, der Mode entsprechend, dunkelhaarig gewesen wäre. Sie seufzte, entspannte ihre Lippe, setzte sich neben dem Sofa der Mutter auf einen Schemel und sagte in beherrschtem Ton: «Du kannst nicht leugnen, Charles, dass diese unverständliche Abneigung Mamas gegen Augustus dein Werk ist.»
«Nun aber still», sagte Lady Ombersley. «Du bist im Unrecht, Liebste, ich hege gar keine Abneigung gegen ihn. Ich halte ihn nur eben nicht für einen passenden Ehemann.»
«Darauf kommt es mir nicht an», erklärte Cecilia. «Er ist der einzige Mann, für den ich eine solche Zuneigung empfinden könnte. Ich bitte dich, bilde dir nur ja nicht ein, dass ich jemals Lord Charlburys äußerst schmeichelhaften Antrag annehmen könnte, denn ich werde es nie tun!»
Lady Ombersley brachte einen missmutigen, jedoch wirkungslosen Protest hervor. Mr. Rivenhall aber stellte in seiner prosaischen Art fest: «Wenn ich mich nicht täusche, war dir Charlburys Bewerbung gar nicht so unangenehm, als du davon erfuhrst.»
Cecilia wandte ihm ihren flammenden Blick zu und antwortete: «Damals war ich Augustus noch nicht begegnet.»
Lady Ombersley schien von der Logik dieses Arguments beeindruckt, ihr Sohn aber zeigte sich weniger nachgiebig. «Vergeude nicht deine großen Redensarten auf mich, bitte! Du kennst den jungen Fawnhope seit neunzehn Jahren.»
«Das war nicht derselbe», antwortete Cecilia einfach.
«Damit hat sie aber recht, Charles», sagte Lady Ombersley als Schiedsrichterin. «Er war ein ganz unauffälliger Bursche. Und als er in Oxford war, hatte er entsetzlich viele Sommersprossen – niemand hätte annehmen können, dass er ein so hübscher junger Mensch werden würde! Die Zeit, die er in Brüssel mit Sir Charles Stuart verbrachte, hat ihm über Erwarten gutgetan! Ich hätte ihn selber kaum wiedererkannt.»
«Ich frage mich manchmal», erwiderte Mr. Rivenhall, «ob Sir Charles jemals wieder in Ordnung kommen wird! Wie Lady Lutterworth es mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, einem Manne, der in der Öffentlichkeit steht, einen solchen Einfaltspinsel als Sekretär anzuhängen – nun, das mag sie selber verantworten! Wir wissen wenigstens, dass dein kostbarer Augustus nicht mehr im Amt ist, weder in diesem noch in einem anderen», fügte er schneidend hinzu.
«Augustus ist ein Dichter», sagte Cecilia sanft. «Er ist gewiss ganz ungeeignet für die langweilige Arbeit eines Gesandtschaftssekretärs.»
«Das leugne ich nicht. Und er ist ebenso ungeeignet, eine Frau zu erhalten, liebe Schwester. Bilde dir nur nicht ein, dass ich dich in eine solche Narrheit hineinrennen lasse, denn ich werde es nicht tun, das sage ich dir! Und gib dich nicht der Täuschung hin, dass du die Einwilligung Vaters zu diesem höchst unüberlegten Schritt erlangen wirst. Solange ich ein Wort mitzureden habe, bekommst du sie nicht!»
«Ich weiß schon, dass nur du in diesem Haus etwas zu sagen hast», rief Cecilia, und dicke Tränen traten unter ihren Lidern hervor. «Hoffentlich bist du zufrieden, wenn du mich in Verzweiflung getrieben hast.»
Am Zucken seines Mundes konnte man sehen, dass Mr. Rivenhall sich löblicherweise anstrengte, die Antwort, die gewiss nicht allzu liebenswürdig ausgefallen wäre, zu unterdrücken. Seine Mutter beobachtete ihn ängstlich. Die Stimme, mit der er schließlich antwortete, war fast beunruhigend ausgeglichen. «Willst du so gütig sein, liebe Schwester, deinen tragischen Ton für Augenblicke aufzusparen, in denen ich nicht in Hörweite bin? Und bevor Mama von deinen Übertreibungen beeinflusst wird, möchte ich dich mit deiner freundlichen Erlaubnis daran erinnern, dass du, keineswegs in eine verhasste Heirat hineingedrängt wirst. Du warst nur zu bereit wohlwollend anzuhören, was du nun selbst Lord Charlburys äußerst schmeichelhafte Bewerbung nennst.»
Lady Ombersley neigte sich vor, um eine von Cecilias Händen in die ihre zu nehmen und sie innig zu drücken. «Doch, Liebe, das stimmt», sagte sie. «Auch ich hatte den Eindruck, dass er dir sehr gut gefiel. Du musst dir nicht einreden, dass Papa oder ich auch nur im Entferntesten die Absicht hegen, dich zu einer Heirat zu drängen, gegen die du dich sträubst. Das wäre doch wohl höchst abstoßend! Und auch Charles würde das nicht tun, nicht wahr, lieber Charles?»
«Gewiss nicht. Aber ebenso wenig würde ich einwilligen, dass sie eine solche Zierpuppe wie Augustus Fawnhope heiratet.»
Cecilia erhob herausfordernd das Kinn. «Von Augustus wird man noch lange sprechen, wenn du bereits vergessen bist.»
«Du meinst die Gläubiger? Das bezweifle ich nicht. Wird dich das dafür entschädigen, dass du ein ganzes Leben von Mahnern behelligt sein wirst?»
Lady Ombersley konnte einen Schauder nicht unterdrücken. «Ach, meine Liebe, wie recht er hat! Du kennst diese Pein nicht – aber sprechen wir nicht davon!»
«Es hat gar keinen Sinn, mit meiner Schwester über etwas zu sprechen, was nicht in den Umschlägen einer Leihbibliothek steckt», sagte Charles. «Ich hätte angenommen, dass sie dafür dankbar sein würde, nun doch noch eine respektable Ehe eingehen zu können, nachdem unsere Familie sich so hat einschränken müssen! Aber nein! Da wird ihr eine - nein, nicht eine respektable - eine glänzende Ehe geboten, sie aber benimmt sich wie eine Mondsüchtige und schwärmt einen Poeten an! Ein Dichter! Großer Gott, Mama, wenn diese Talentprobe, die vorzulesen du unvorsichtig genug warst – aber nein, ich bringe nicht die Geduld auf, auch nur dagegen zu argumentieren! Wenn du sie nicht dazu bringen kannst, sich so zu benehmen, wie es ihrer Herkunft entspricht, dann soll man sie lieber nach Ombersley schicken. Mag sie eine Weile auf dem Land leben, vielleicht bringt sie das zu Verstand.»
Mit dieser schrecklichen Drohung verließ er das Zimmer, überließ es seiner Schwester, sich in Tränen aufzulösen, und seiner Mutter, ihre Fassung mit Hilfe des Riechfläschchens wiederzugewinnen.
Schluchzend tadelte Cecilia die Grausamkeit eines Schicksals, das sie mit einem Bruder bestraft, der ebenso herzlos wie tyrannisch war, und mit Eltern, die sich nicht in ihr Fühlen hineindenken konnten. Lady Ombersley hatte zwar Mitgefühl, konnte aber diesen Vorwurf nicht so stehen lassen. So versicherte sie Cecilia, ohne irgendwelche Haftung für ihren Gatten zu übernehmen, dass sie selbst äußerst verständnisvoll sei. Sie ging sogar soweit, die Möglichkeit einzuräumen, dass ihr die Seelenpein einer verbotenen Liebe vertraut sei.
«Als ich ein junges Mädchen war, Liebste, ist mir etwas Ähnliches zugestoßen», sagte sie seufzend. «Er war nicht gerade ein Poet, natürlich, aber ich habe mir doch eingeredet, dass ich ihn furchtbar lieb hätte. Doch es ging eben nicht, und so wurde ich zum Schluss mit deinem Vater verheiratet. Das bedeutete eine glänzende Heirat, denn damals hatte er noch nicht begonnen, sein Vermögen zu vergeuden, und –» sie schien zu fühlen, dass diese Erinnerungen sie in eine ungünstige Richtung führten und unterbrach sich. «Kurz, Cecilia, eigentlich brauchte ich dir das gar nicht zu sagen: Personen unseres Standes heiraten eben nicht zu ihrem Vergnügen.»
Cecilia war zum Schweigen gebracht, ließ nur den Kopf hängen und betupfte ihre Augen mit dem bereits feuchten Taschentuch. Sie wusste gut genug, dass infolge der herzlichen Zuneigung des einen und des wohlwollenden Gleichmuts des anderen Elternteiles bei manchem ein Auge zugedrückt wurde. Sie begriff auch, dass Lady Ombersley, indem sie nach ihrer Meinung fragte, bevor sie Lord Charlbury seine Zuneigung ausdrücken ließ, mehr Rücksicht gezeigt hatte, als die meisten ihrer Zeitgenossinnen. Cecilia las gern Romane, aber es war ihr klar, dass es ihr nicht zukam, das übersteigerte Gehabe ihrer Lieblingsheldinnen nachzuahmen. Was ihr bevorstand, war die Altjüngferlichkeit. Dieser Gedanke war so betrübend, dass sie noch mehr in sich zusammensank und wieder das Taschentuch an die Augen führte.
«Denk dir nur, wie glücklich deine Schwester ist», sprach Lady Ombersley ihr ermutigend zu. «Nichts kann wohltuender sein, als sie in ihrem Heim zu sehen, mit ihrem Kind und mit James, der immer so aufmerksam und zuvorkommend ist. Es ist überhaupt alles, wie man es sich nur wünschen kann. Ich glaube einfach nicht, dass irgendeine Liebesehe besser ausgehen könnte – und damit will ich nun keineswegs sagen, dass Maria James nicht aufrichtig gern hat. Aber sie hatte ihn kaum ein halb Dutzend Mal gesehen, als er sich Papas Erlaubnis erbat, mit ihr zu sprechen, und ihre Gefühle waren gewiss noch nicht gebunden. Natürlich fühlte sie eine ausgesprochene Zuneigung für ihm, wenn ich jemals für so etwas einen Blick gehabt habe. Maria war ein so gutes, wohlerzogenes Mädchen! Sie selbst hat mir gesagt, dass sie es einfach für ihre Pflicht hielt, ein so günstiges Angebot anzunehmen, da Papa doch in solchen Schwierigkeiten war und noch vier von euch untergebracht werden mussten.»
«Mama, ich bin hoffentlich keine unnatürliche Tochter, aber ich möchte lieber tot als mit James verheiratet sein», erklärte Cecilia und hob den Kopf. «Er hat überhaupt nur für die Jagd Gedanken, und wenn sie abends nicht gerade Gäste haben, geht er schlafen und schnarcht.»
Von dieser Eröffnung eingeschüchtert, fand Lady Ombersley zunächst keine Erwiderung. Cecilia schnäuzte sich und fügte hinzu: «Und Lord Charlbury ist noch älter als James.»
«Gewiss, aber uns ist nicht bekannt, dass er auch schnarcht, meine Liebe», machte Lady Ombersley geltend. «Wir können sogar beinahe sicher sein, dass er es nicht tut, denn er hat die Manieren eines vollendeten Gentlemans.»
«Einem Mann, der Mumps bekommt, ist alles zuzutrauen», erklärte Cecilia.
Lady Ombersley fand an dieser Behauptung nichts Unvernünftiges und war eigentlich auch nicht überrascht, dass Seiner Lordschaft unromantisches Wesen Cecilias Widerwillen ausgelöst hatte. Sie selbst hatte eine bittere Enttäuschung erlitten, denn auch sie hatte ihn für einen vernünftigen Menschen gehalten und nicht für einen Mann, der im allerunpassendsten Moment eine Kinderkrankheit bekam.
So fand sie nicht die richtigen Worte, seinen Verstoß zu entschuldigen, und da Cecilia offenbar nichts weiter zur Sache zu bemerken hatte, herrschte eine Weile unbehagliches Schweigen. Cecilia brach es erst, um ziemlich gleichmütig zu fragen, ob es wahr wäre, dass ihr Onkel nachmittags hier gewesen sei. Lady Ombersley freute sich, einen erfreulicheren Gesprächsgegenstand zu finden und atmete auf.
Sie berichtete Cecilia sogleich von der Annehmlichkeit, die ihr hier geboten wurde und sah mit Befriedigung, dass sich die Stirn ihrer Tochter ein wenig entwölkte. Es war nicht schwierig, Cecilias Sympathie für die Kusine zu gewinnen. Gewiss konnte sich Cecilia kaum ein schrecklicheres Geschick vorstellen, als auf unbestimmte Zeit zu Verwandten gesandt zu werden, die man kaum kannte. Warmherzig versprach sie, alles Mögliche zu tun, damit Sophia sich auf dem Berkeley Square zu Hause fühle. Zwar erinnerte sie sich nur sehr undeutlich an ihre Kusine, denn es war Jahre her, seit sie ihr begegnet war. Zuweilen hatte sie gemeint, Europa so zu bereisen, müsse recht aufregend sein, zugleich aber geargwöhnt, dass es höchst unbequem sein möge. Bestimmt, darin war sie mit Lady Ombersley einig, war ein so unkonventionelles Leben kaum die ideale Vorbereitung auf ein Londoner Debut. Der Gedanke, Sophias Kommen werde die fast klösterliche Enge lockern, die Charles’ Sparwut der Familie auferlegte, brachte sie zu dem Entschluss, sich, nun schon viel besserer Laune, zum Dinner umzukleiden.
An diesem Abend waren viele Mitglieder der Familie um den Tisch versammelt, denn Seine Lordschaft hatte sich dazu entschlossen, seine Gattin mit einer seiner so seltenen Anwesenheiten am Familientisch zu würdigen. Er war der einzige Unbefangene in dieser Gesellschaft, denn er erfreute sich der glücklichen Veranlagung, selbst die offenkundigsten Zeichen des Unbehagens seiner Tischgefährten übersehen zu können. Das gleiche Talent ermöglichte es ihm auch, mit erstaunlichem Geschick, ja mit Heiterkeit die Demütigung zu ertragen, dass er eigentlich kaum mehr als der Kostgänger seines Sohnes war. Das Einzige, was er scheute, war der Zwang, in übellaunige Gesichter zu blicken. Darum gestattete er sich selbst niemals, an Unangenehmes auch nur zu denken. Das gelang ihm gut und ermöglichte es ihm, sich sogar in Zeiten großer Besorgnis einzureden, dass alle Peinlichkeit, die ihm durch seine eigenen Narrheiten oder durch die überlegene Willenskraft seines Sohnes aufgezwungen wurde, eigentlich das Ergebnis freien Entschlusses und kluger Berechnung sei. Solange Charles ihm den Respekt des Sohnes zollte, vermochte Seine Lordschaft mühelos zu vergessen, dass ihm die Zügel entwunden waren. Ließ aber sogar der Respekt des Sohnes, wie es zuweilen geschah, zu wünschen übrig, so dauerten diese bedauerlichen Zeiten meist nicht lang an. Für einen Mann seines Temperaments war es deshalb nicht schwer, sie wieder zu vergessen. Er trug seinem Sohn nichts nach, obwohl er ihn für einen öden und witzlosen Burschen hielt. Solange ihm das Glück hold war, und es erwartete ja niemand von ihm, dass er sich in der Führung der Familie überanstrenge, fühlte er sich in seinem Los recht wohl.
Es konnte ihm nicht ganz entgangen sein, dass es Zerwürfnisse in seinem Hause gab. Das Verlangen seiner Frau, er solle seine väterliche Autorität gegenüber Cecilia geltend machen, hatte ihn vor knapp vierzehn Tagen zu einer übereilten Fahrt nach Newmarket bewogen. Doch entlockten ihm jetzt weder die gerunzelte Stirn des Sohnes noch die geröteten Augenlider der Tochter die geringste Bemerkung. Er schien sogar ein gewisses Vergnügen daran zu finden, eine Mahlzeit in der Gesellschaft einer nervösen Frau, einer gekränkten Tochter und eines mürrischen Sohnes in die Länge zu ziehen. «Ja, ja», sagte er, «das muss schon wahr sein, es ist wirklich ein Vergnügen, einmal gemütlich en famille zu speisen! Und die Köchin mag wissen, Lady Ombersley, dass ich ihre Art, eine Ente anzurichten, schätze. So gut bekomme ich eine Ente nicht einmal bei White.» Dann begann er Gesellschaftsklatsch zu erzählen und erkundigte sich wohlwollend, wie seine Kinder den Tag verbracht hatten.
«Wenn du mich meinst, Papa», sagte Cecilia, «so habe ich den Tag so verbracht, wie ich eben jeden verbringe. Erst habe ich Mama bei ihren Einkäufen begleitet, dann war ich mit meinen Schwestern und Miss Adderbury im Park, und dann habe ich Klavier geübt.»
Ihr Ton suchte nicht vorzutäuschen, dass sie diese Amüsements aufheiternd gefunden habe, aber Lord Ombersley sagte: «Hervorragend!», und wandte seine Aufmerksamkeit seiner Frau zu. Sie berichtete vom Besuch ihres Bruders und von seinem Vorschlag, Sophia ins Haus zu nehmen. Sofort gab Lord Ombersley seine wohlmeinende Zustimmung: Nichts könne im Augenblick willkommener sein. Seine Tochter sei nur zu beglückwünschen, da sich ihr da eine reizende Gesellschaft böte. Charles war über all diesen leeren Unsinn so ärgerlich, dass er mürrisch bemerkte, es läge noch gar kein Grund vor anzunehmen, dass Sophia charmant sei. Doch darauf erwiderte Lord Ombersley, in dieser Beziehung hege er keinerlei Zweifel. Sie alle müssten sich vornehmen, der Kusine den Aufenthalt angenehm zu machen. Dann erkundigte er sich, ob Charles die Absicht hätte, morgen zu den Rennen zu fahren. Charles, der genau wusste, dass das Rennen unter der Patronanz des Herzogs von York stattfand und dass dabei für die Freunde dieser jovialen Persönlichkeit mehrere Abende in Oatlands herausspringen würden, an denen Whist mit einem Pfund als Point gespielt wurde, sah abweisender drein denn je und erklärte, dass er für einige Tage nach Ombersley Park fahren wolle.
«Natürlich doch!», stimmte der Vater freudig zu. «Habe ganz vergessen, dass da noch die Sache mit dem Waldstück zu erledigen ist. Gut, gut, ist mir nur recht, wenn du dich darum kümmerst, mein Junge.»
«Das werde ich tun», erwiderte Mr. Rivenhall höflich. Dann warf er der Schwester über den Tisch einen Blick zu und fragte: «Möchtest du mich begleiten, Cecilia? Ich nehme dich sehr gern mit, wenn es dir recht ist.»
Sie zögerte. Das konnte einerseits eine Versöhnungsgeste sein, andererseits aber auch ein hinterhältiger Versuch, ihre Gedanken von Mr. Fawnhope abzulenken. Die Überlegung, dass Charles’ Abwesenheit, wenn man es nur ein bisschen schlau anstellte, eine Möglichkeit bieten würde, Mr. Fawnhope zu begegnen, entschied. «Nein», sagte sie, «ich danke. Ich wüsste nicht, was ich um diese Zeit auf dem Land anfangen könnte.»
«Mit mir ausreiten», gab Charles zu bedenken.
«Da reite ich lieber in den Park. Wenn du Gesellschaft haben willst, könntest du doch die Kinder einladen: Die kämen sicher gern mit.»
«Wie du meinst», erwiderte er gleichmütig.
Das Dinner war beendet, und Lord Ombersley zog sich aus dem Familienkreise zurück. Charles, der keine Verabredung für den Abend hatte, geleitete Mutter und Schwester in den Salon, und während Cecilia auf dem Klavier klimperte, plauderte er mit der Mutter über Sophias Besuch. Zu ihrer großen Beruhigung schien er sich mit der Notwendigkeit abgefunden zu haben, wenigstens eine, wenn auch bescheidene Gesellschaft zu Ehren Sophias zu geben, aber er riet ihr aufs ernsteste davon ab, sich mit der Aufgabe zu belasten, einen passenden Gatten für die Nichte ausfindig zu machen.
«Nun, der Onkel hat zugesehen, wie sie das Alter von zwanzig erreichte, und er hat sich um diese Sache nicht gekümmert. Jetzt setzt er es sich plötzlich in den Kopf, dir dieses Geschäft aufzuhalsen. Ich verstehe so etwas einfach nicht.»