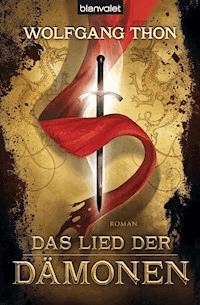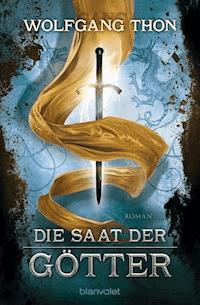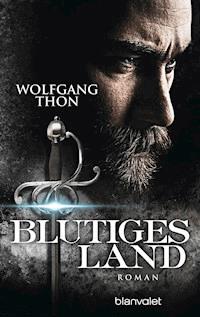Die-drei-Prophezeiungen-Trilogie: - Das Lied der Dämonen / Das Schwert der Drachen / Die Saat der Götter (3in1-Bundle) E-Book
Wolfgang Thon
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Drei Prophezeiungen entscheiden über den Krieg zwischen Göttern und Drachen
Drei Prophezeiungen entscheiden über die Leben von Göttern, Drachen und Sterblichen – doch nur eine wird sich erfüllen …
Band 1 Das Lied der Dämonen:
Götter und Drachen befinden sich im Krieg, und auch wenn die Drachen besiegt scheinen, haben sie noch nicht aufgegeben. Durch ihre Priester, die im Verborgenen handeln müssen, und besonders durch ihre Diener, die Dämonen, nehmen sie weiter Einfluss auf die Geschicke der Menschen. Nun sind sie kurz davor, ihre alte Macht zurückzuerlangen. Dabei soll ihnen ein junger Mann helfen. Er weiß nichts von seiner Bestimmung, doch er hört bereits das Lied der Dämonen…
Band 2 Das Schwert der Drachen:
Drei Prophezeiungen bereiten die Menschen auf die bevorstehende Zeit der Verschmelzung vor. Doch sie widersprechen einander, und Magier, Auguren und Drachenpriesterinnen ringen darum, dass ihre Vision der Zukunft wahr wird. Dem Krieger Broll ist es allerdings egal, was von ihm erwartet wird. Ihm ist im Moment nur der Tod seines Nebenbuhlers wichtig. Denn Lay ist nicht nur ebenfalls Teil der Prophezeiungen. Er ist auch ein Konkurrent um die Hand der Drachenbraut von Alghor – und damit ein Hindernis auf Brolls Weg zur Macht.
Band 3 Die Saat der Götter:
Die Zeit der Verschmelzung steht bevor: Drachen fordern die Götter heraus und verwüsten das Land. Gleichzeitig bereiten sich die Dämonen darauf vor, ihren einstigen Herren in den Rücken zu fallen. Die letzte Hoffnung der Menschen ruht auf der Dritten Prophezeiung. Doch niemand weiß, wie diese erfüllt werden kann – bis der Schwertkämpfer Lay ihre Bedeutung entschlüsselt. Aber kann er dieses Wissen weitergeben? Denn seine eigenen Kinder gehören zu den Verheißenen – und sie würden die Erfüllung der Prophezeiung nicht überleben…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2838
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Autor:
Wolfgang Thon wurde 1954 in Mönchengladbach geboren. Nach dem Abitur studierte er Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Heute ist er als Übersetzer und Autor für verschiedene Verlage tätig. Er ist Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern und lebt, schreibt, übersetzt, reitet und tanzt (Argentinischen Tango) in Hamburg.
Drei Prophezeiungen entscheiden über die Leben von Göttern, Drachen und Sterblichen – doch nur eine wird sich erfüllen …
Band 1 Das Lied der Dämonen:
Götter und Drachen befinden sich im Krieg, und auch wenn die Drachen besiegt scheinen, haben sie noch nicht aufgegeben. Durch ihre Priester, die im Verborgenen handeln müssen, und besonders durch ihre Diener, die Dämonen, nehmen sie weiter Einfluss auf die Geschicke der Menschen. Nun sind sie kurz davor, ihre alte Macht zurückzuerlangen. Dabei soll ihnen ein junger Mann helfen. Er weiß nichts von seiner Bestimmung, doch er hört bereits das Lied der Dämonen…
Band 2 Das Schwert der Drachen:
Drei Prophezeiungen bereiten die Menschen auf die bevorstehende Zeit der Verschmelzung vor. Doch sie widersprechen einander, und Magier, Auguren und Drachenpriesterinnen ringen darum, dass ihre Vision der Zukunft wahr wird. Dem Krieger Broll ist es allerdings egal, was von ihm erwartet wird. Ihm ist im Moment nur der Tod seines Nebenbuhlers wichtig. Denn Lay ist nicht nur ebenfalls Teil der Prophezeiungen. Er ist auch ein Konkurrent um die Hand der Drachenbraut von Alghor – und damit ein Hindernis auf Brolls Weg zur Macht.
Band 3 Die Saat der Götter:
Die Zeit der Verschmelzung steht bevor: Drachen fordern die Götter heraus und verwüsten das Land. Gleichzeitig bereiten sich die Dämonen darauf vor, ihren einstigen Herren in den Rücken zu fallen. Die letzte Hoffnung der Menschen ruht auf der Dritten Prophezeiung. Doch niemand weiß, wie diese erfüllt werden kann – bis der Schwertkämpfer Lay ihre Bedeutung entschlüsselt. Aber kann er dieses Wissen weitergeben? Denn seine eigenen Kinder gehören zu den Verheißenen – und sie würden die Erfüllung der Prophezeiung nicht überleben…
Wolfgang Thon
Die drei Prophezeiungen
Die komplette Trilogie
Das Lied der DämonenDas Schwert der DrachenDie Saat der Götter
Blanvalet
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2014 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
»Das Lied der Dämonen«: Covergestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
»Das Schwert der Drachen«: Covergestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
»Die Saat der Götter«: Covergestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
Satz: Uhl + Massopust GmbH
ISBN: 978-3-641-28539-5V001
www.blanvalet.de
Wolfgang Thon
DAS LIED DER DÄMONEN
KARTE: DAS DRACHENREICH ALGHOR
Für Margarete
DER WEISSE SPIEGEL, GLETSCHER AN DER GRENZE ZWISCHEN ALGHOR UND HELLANDEN
Der Wind peitschte wütend über die zerfurchte Gletscherzunge und trieb Schleier aus nadelspitzen Eiskörnern vor sich her, die auf Schild und Helm des Drachenkämpfers prasselten. Im nächsten Moment gab es ein lautes Scheppern, als sich die Klinge der Streitaxt mit einem schrillen, metallischen Krachen in das Metall fraß, mitten hinein in den aufgemalten blauen Drachenschädel.
Der Hüne, der den gewaltigen Schlag mit nur einer Hand geführt hatte, knurrte und fletschte die Zähne, während er die Axt aus dem Schild zu reißen versuchte. Denn der war von der Wucht des Hiebes nicht zertrümmert worden, sondern die Schneide war darin stecken geblieben. Immerhin hatte der Schlag den Drachenkämpfer, einen Angehörigen der Eisdrachen der Grenzpatrouille Alghors, in die Knie gezwungen. Der Nordling schleuderte ihn rücklings auf das Eis, aber der Soldat ließ den Schild nicht los, sondern versuchte, seinen Gegner mitsamt der Axt ebenfalls zu Boden zu ziehen. In die von glitzerndem Eis bedeckte Eisenspitze des kurzen Spießes hinein, den er mit der Linken umklammerte und dessen stumpfes Ende er zwischen Ellbogen und Körperseite eingeklemmt hatte.
Der Nordling schien allerdings mit dieser Finte gerechnet zu haben. Er machte rasch einen seitlichen Ausfallschritt und bohrte die Eisdorne unter seinem durch dickes Leder und Fell geschützten Fuß fest in das Eis, um einen sicheren Stand zu kriegen. Dann trat er mit dem freien Fuß den Spieß zur Seite. Gleichzeitig packte er mit beiden Händen den lederumwickelten Griff seiner Streitaxt, nutzte sein ganzes Gewicht und drehte den Stiel. Die Schneide durchtrennte den Kettenhandschuh des Drachenkämpfers und fraß sich bis auf den Knochen in seine Hand, bevor sich die Klinge mit einem Knacken aus dem mit gehämmertem Blech verstärkten Holzschild löste.
Der Mann schrie vor Schmerz auf und kroch zurück, wobei er versuchte, den nutzlosen Schild vom Arm zu schütteln. Das Blut aus der Wunde an seinem Handgelenk spritzte durch die Luft und hinterließ rote Punkte auf dem schmutzig grauen Eis. Mit der anderen Hand hielt er immer noch den Spieß vor sich, ohne den Blick von dem Nordling zu nehmen. Der seine Bemühungen regungslos, fast nachsichtig beobachtete.
Man konnte keine Nachsicht in den unbeteiligt blickenden Augen dieser hünenhaften Gestalt erwarten. Der Kämpfer war in Pelze und Eisen gehüllt, seine langen schwarzen Haare waren zu einem Kriegerzopf geflochten und hingen auf seinen Rücken hinab, und sein gerötetes Gesicht glänzte von Fischtran, wie ihn sich die Nordlinge zum Schutz gegen die Kälte auf die Haut zu schmieren pflegten. Er mochte vielleicht vor den eisigen Winden schützen, dafür jedoch stank es bestialisch.
Der Hüne hatte den Kopf zur Seite geneigt, aber er schien nicht auf seinen Widersacher zu achten.
Er lauschte.
Was ihn allerdings nicht daran hinderte, mit seiner Streitaxt ansatzlos einen Schlag gegen den Spieß zu führen. Der Stiel brach mit einem dumpfen Splittern, und das kürzere Ende mit der eisernen Spitze flog durch die Luft und bohrte sich ein paar Schritte von den Männern entfernt ins Eis.
Der Drachenkämpfer hielt das zersplitterte Stielende einen Moment verwirrt in der Hand, bevor er es fallen ließ. Er blinzelte, als ihm der Eisschnee in die Augen biss. Der Nordling rührte sich immer noch nicht. Der Drachenkämpfer krabbelte auf allen vieren weiter zurück und blickte dabei kurz zu einer kleinen Anhöhe hinauf. Dahinter kämpften dem Lärm nach seine Kameraden.
Der Nordling hob den Kopf und sah sich suchend um. Die beiden Drachenkämpfer, die jetzt über die Anhöhe auf ihn zugerannt kamen, konnte er unmöglich übersehen. Aber sie schienen ihn nicht weiter zu kümmern, denn er spie nur in den Schnee und machte sich dann an die Verfolgung seines Gegners.
Der hatte mittlerweile eine kleine Mulde erreicht und war wieder auf die Beine gekommen, während seine beiden Kameraden näher kamen. Sie humpelten.
Der Nordling ging auf den Drachenkämpfer zu, der vergeblich versuchte, das Schwert aus der Scheide zu ziehen.
»Wo, verflucht, hast du denn kämpfen gelernt, Kriegsküken?« Die Stimme des Mannes klang tief und barsch, fast wie das Bellen eines der gefährlichen Weißbären, auf die man am Gletscher gelegentlich stieß und denen man besser aus dem Weg ging. Jetzt hob der Mann ohne sichtliche Mühe die Streitaxt mit einer Hand und tippte mit der flachen Seite des Blattes gegen die Schwertscheide des Jünglings. »Hat man dich nicht gelehrt, bei Eis und Kälte Scheide und Schwert einzufetten, damit sie nicht festfrieren?« Unvermittelt schlug er mit der Streitaxt zu. Der stumpfe Kopf der Klinge knallte gegen die Schwertscheide, und der Drachenkämpfer, der die ganze Zeit an dem Griff der Waffe gezerrt hatte, schrie auf, wurde herumgeschleudert und stöhnte vor Schmerz. Und vor Entsetzen.
Denn er musste mit ansehen, wie seine Kameraden in diesem Moment von mehreren Nordlingen eingeholt und auf der Stelle niedergemetzelt wurden. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance gegen die barbarischen Krieger von jenseits des Gletschers.
Der Drachenkämpfer riss seinen Blick von dem grausigen Geschehen los und richtete ihn wieder auf den Nordling. Einen Moment lang kreuzten sich ihre Blicke, dann legte der Hüne erneut wie lauschend den Kopf auf die Seite. Plötzlich ertönte ein unheilvolles Knacken.
Gefolgt von einem lauten Prasseln.
Der entsetzte Schrei des Drachenkämpfers verklang, als er von dem gähnenden Schlund verschlungen wurde, der sich unvermittelt unter seinen Füßen aufgetan hatte.
Der Nordling hatte die Streitaxt bei dem Schrei gehoben und versuchte jetzt vergeblich, mit seinen Eisdornen festen Halt zu finden. Er senkte den Kopf und starrte in den Schlund unter sich, ohne auf die entsetzten Rufe seiner Kameraden zu achten, die, seinen Namen brüllend, auf ihn zurannten. Dann stürzte auch er in diese tückische Gletscherspalte, von denen es auf dem Weißen Spiegel nicht gerade wenige gab. Schon viele unachtsame Patrouillengänger oder Fallensteller waren von ihnen verschluckt worden und nie mehr aufgetaucht.
Der Nordling fiel … aber nicht wie der Drachenkämpfer unter ihm wild rudernd und kreischend, sondern ruhig, mit ausgebreiteten Armen, die Streitaxt in der Faust, den Blick fest nach unten gerichtet. Das matt schimmernde Grau der Spalte verlor sich tief unter ihm in einem finsteren Schwarz, während ihm der Abgrund entgegenzurasen schien. Unter ihm blitzte neben der wild um sich schlagenden Gestalt des Drachenkämpfers etwas Metallisches auf … das Schwert des Mannes.
Der Nordling hingegen fiel beinahe gelassen. Er presste die Beine zusammen und neigte den Kopf, um zu sehen, wohin die Reise ging. Er stürzte in aufrechter Haltung und mit angespannten Muskeln, wie in Erwartung einer Landung auf eisigem oder vielleicht sogar felsigem Boden. Eine Landung, die sämtliche Knochen in seinem Leib zermalmen, sein Hirn über den Boden verteilen würde und sein Blut …
Plötzlich wurde es heller um ihn herum.
Die Flanken des Gletschers schienen zurückzuweichen, immer weiter, als würde er in eine gewaltige, unermessliche Höhle stürzen. Gleichzeitig wölbte sich unter ihm eine eisige Zunge aus der Wand des Gletschers und bildete eine riesige Schanze, fast wie die ins Groteske angeschwollene Zunge eines Fleckenflosslers, eines dieser riesigen Meeressäuger, welche die Bewohner der Eisinseln an der nördlichen Grenze von Hellanden wegen ihres Fleisches, vor allem jedoch wegen der großen Mengen von Tran mit ihren schlanken Seglern jagten.
Die Eisschanze fiel zwar ebenfalls in die Tiefe ab, bog sich dem Mann jedoch seitlich entgegen, kam ihm immer näher, noch näher …
Er zog die Beine an, drehte den Rücken zu der Eiswand, hob die Arme und hielt die Streitaxt hoch über den Kopf …
Obwohl der Aufprall auf der harten Eiswand gewaltig war, gelang es ihm, die Kontrolle zu behalten, und plötzlich verwandelte sich der Sturz in den sicheren Tod in eine rasende Schussfahrt, die allerdings nicht weniger bedrohlich war und wahrscheinlich ebenfalls tödlich enden würde.
Die Fahrt verlangsamte sich, je weiter sich die Eiszunge waagerecht ausrichtete. Zu beiden Seiten der Schanze gähnte ein Schlund, der sich in der unergründlichen Finsternis verlor. Vor dem Nordling erstreckte sich blankes Eis, über ihm schimmerte die Gletscherspalte, durch die er gestürzt war, nur noch als winziger weißer Punkt, wie ein ferner Stern am ansonsten vollkommen schwarzen Firmament.
Vollkommen schwarz?
Selbst das spärliche Licht, das bis in diese Tiefe drang, ließ das Eis der weit entfernten Wände dieser ungeheuren Kaverne funkeln. Die Eisschanze war mittlerweile breiter geworden und verlief flacher, schien sogar leicht anzusteigen.
Er rutschte geradewegs auf einen Buckel zu, hinter dem die Eiszunge abrupt zu enden schien. Er blickte in den Abgrund neben sich, doch der Boden war immer noch nicht zu sehen. Er versuchte, die Streitaxt in das Eis zu schlagen, um die Geschwindigkeit zu verlangsamen und dann vielleicht von der Schanze herunterklettern zu können.
Der Nordling schüttelte den Kopf, als ein sonderbares Summen die Höhle erfüllte.
Tonn … Vorr … Draak … Sklavv … Draak … Vodder … Wache …
Das Summen ergab für ihn keinen Sinn, wirkte aber einschüchternd, fast drohend.
Dann verschwand das Eis unter ihm schlagartig, und er segelte erneut durch die Luft. Diesmal ruderte der Nordling mit den Armen und stieß einen heiseren Schrei aus. Die schwere Streitaxt drohte ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er ließ sie los, sie flog davon und wurde von der Dunkelheit verschluckt.
Der Aufprall kam vollkommen unvermittelt. Der Nordling wurde von dem harten Stein wie von einer riesigen Faust getroffen und in die Luft hochgeschleudert.
Dann krachte es wieder, und er schrie auf.
Als er erneut auf den Boden prallte, war der Aufschlag so gewaltig, dass er vor Schmerz aufbrüllte. Er rutschte völlig unkontrolliert über den harten Stein, überschlug sich mehrfach und drohte jeden Moment gegen irgendein Hindernis zu krachen und sich das Genick zu brechen.
Dann wurde seine Fahrt gestoppt, abrupt, endgültig und … weich.
Er war gegen etwas Nachgiebiges, Warmes gerutscht, das er in seinem Schwung mitriss, als er weiter über den Boden rollte. Es war ein menschlicher Leib, der seine Landung abgefedert hatte, die Leiche des Drachenkämpfers. Das Gesicht des Soldaten war vollkommen entstellt, der Unterkiefer war weit aufgerissen und hing schief unter dem Oberkiefer. Eine Wange war zerschmettert und das Kiefergelenk offenbar bei der Landung zertrümmert worden. Der Schädel war gespalten, und Blut, Knochen und Hirnmasse verklebten das Haar.
Der Nordling schüttelte den Kopf und richtete sich mühsam auf. Mit etwas wackligen Beinen stand er schließlich da und betastete sich prüfend. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass noch alle Gliedmaßen an Ort und Stelle waren, richtete er seine Aufmerksamkeit von der Untersuchung seines Körpers auf die nähere Umgebung der Höhle.
Zunächst sah er sich suchend nach seiner Streitaxt um, konnte sie jedoch nirgends entdecken. Dann ging er los, und sein Blick zuckte nach unten, als er ein schrilles Kratzen hörte. Der Boden der Höhle bestand nicht aus Eis, sondern aus einem fast schwarzen Stein. Die metallenen Eisdorne unter seinen Füßen, die ihm auf dem Eis Halt gegeben hatten, schlugen auf dem Stein bei jedem Schritt Funken.
Er bückte sich, um die Eisdorne von den Füßen zu schnallen. Im selben Moment stöhnte er schmerzerfüllt auf und presste eine Hand auf die Schulter. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus, richtete sich wieder auf, suchte nach einer Sitzmöglichkeit … und starrte auf die dunkle Masse, die sich in dem dämmrigen Licht der Höhle erhob. Sie hatte eine merkwürdige, auf den ersten Blick ziemlich symmetrische Form, und ihre Silhouette wirkte …
Im Palast unter den Schwingen, dem düsteren Felsendom, leisteten die Jungrecken der Kämpfer Hellandens ihren Treueschwur auf Land und Fahne. Und zwar vor der überlebensgroßen Felsstatue Belphors, des Hauptgottes der Nordlinge, dem Herrscher über Leben und Tod, dessen Tempel dort lag.
Ebenso beeindruckend wie sein Abbild waren die kleineren Statuen in der Gruft der Dämonen. Den Legenden zufolge waren sie einmal Helfer der Götter gewesen, hatten ihre Meister jedoch verraten und sich in der Großen Schlacht den Drachen angeschlossen. Dafür waren sie von den Göttern nach deren Sieg fürchterlich bestraft und zu ewiger Folter im Hellführ, den Feuerschlünden jenseits des Dunklen Schleiers, verurteilt worden, wo sie den Zugang zur Anderwelt zu bewachen hatten. Die Statuen der Dämonen waren zwar kleiner als die von Belphor, aber der Hass, den ein unbekannter Künstler vor endlosen Äonen im Stein verewigt hatte, war immer noch auf den erstarrten Fratzen zu erkennen.
Der Nordling drehte langsam erst den Kopf und dann sich selbst. Diese Höhle … Auch hier schien es von diesen seltsamen Gebilden nur so zu wimmeln.
Sie waren zu perfekt geformt, um ein zufälliges Produkt der Natur zu sein. Der Hüne musterte die Reihen von dunklen Figuren, die sich in der Finsternis verloren.
Der Weiße Spiegel, dieser älteste und größte Gletscher im Norden, an der Grenze zwischen Alghor und Hellanden, hatte schon existiert, lange bevor die ersten schriftlichen Überlieferungen der Nordlinge einsetzten. Falls dies hier ein Tempel war, der noch unter diesem Gletscher lag, stammte er vielleicht sogar aus der Zeit …
Der Mann hob plötzlich den Kopf, als er am Fuß eines dieser dunklen Gebilde etwas liegen sah. Es wirkte wie eine Streitaxt, aber sie schien größer zu sein als die, die er verloren hatte. Sie schimmerte schwach und rötlich, und …
Das Summen war nach der abrupten Landung verstummt, nun aber stieg es zu einem gewaltigen Brausen an.
TONN … VORR … DRAAK … BRUUT … DRAAK … SKLAAVV … DRAAK … VODDER … DRAAK … BLUOTT … DRAAK … MACHT … DRAAK … KROON … DRAAK … THRON … DRAAK … BLUOTT … DRAAK … SKLAAVV … WACHE! WACHE!
Die letzten Silben dröhnten so laut durch die Höhle, dass der Nordling sich die Hände gegen die Schläfen presste und wimmernd auf die Knie sank. Er beugte sich vor, riss den Mund auf, und Speichel lief ihm über das Kinn. Plötzlich wurde es unerträglich heiß.
Er nestelte mit den Händen an seinem Pelz, riss ihn an der Brust auseinander. Aber die heiße Luft, die plötzlich durch die Höhle strömte, drohte seine Haut zu versengen und ließ seinen Mund trocken werden. Tränen traten ihm in die Augen, seine Lippen wurden rissig und spröde. Erneut fiel der Blick des Mannes auf die zweischneidige Streitaxt, die unmittelbar vor ihm lag, direkt vor dieser riesigen steinernen Figur, zu deren Füßen er kauerte.
Er sah genauer hin. Nein, keine Füße. Die Extremitäten dieser Statue wirkten wie Klauen, riesige Klauen, mit langen gebogenen Krallen.
Der Mann versuchte zu schlucken, aber er hatte nicht einmal dafür genug Speichel in seiner Kehle, so heiß war es.
TONN … VORR! WACHE! DRAAK … SKLAAVV! … ERWACHE! BRUT! ERWACHE!
Der Mann schwankte, immer noch kniend, während er nach der Axt tastete. Als seine Finger den Griff der Streitaxt berührten, schrie er auf und zog hastig die Hand zurück. Das Eisenholz des Stiels war sengend heiß, und die Klinge glühte förmlich. »Bei Belphors Arsch!«, brüllte er, richtete sich hastig auf und leckte sich die schmerzenden Finger. Verwirrt hob er den Kopf, bog den Oberkörper ein wenig zurück und betrachtete dieses Gebilde, vor dem die Axt lag, genauer. In dem rötlichen Licht, das die Höhle erfüllte, schien es zu glühen. Der Mann schluckte, als er den Stein betrachtete.
Das Brüllen der Stimmen sank zu einem eindringlichen Flüstern herab, als der Nordling zögernd und vorsichtig die Hand nach diesem merkwürdigen Felsbrocken vor sich ausstreckte. Als seine Finger nur noch einen Daumenbreit von dem Stein entfernt waren, verstummte der Chor urplötzlich, und eine atemlose Stille machte sich in der Höhle breit.
Dann berührten seine Fingerspitzen den Stein.
Er riss die Augen auf, als eine Stimme in seinen Kopf drang. Eine mächtige Stimme, barsch und doch gelassen, klar und deutlich und doch nicht laut … und irgendwie uralt. Das alles fiel ihm auf, bevor er realisierte, dass ihn die Stimme etwas gefragt hatte. In seiner Sprache. Was den Nordling noch mehr verblüffte als die Tatsache, dass dieser Stein … diese Statue überhaupt sprach.
DU BIST
Die Stimme klang ruhig, sich ihrer selbst unendlich sicher.
Er schluckte.
»Ich bin … Ich bin …« Wie war sein Name noch mal?
NEIN, antwortete die körperlose Stimme in seinem Kopf; ruhig, endgültig und sachlich.
Ein Brennen durchlief den Nordling, ausgehend von den Fingern, mit denen er dieses lebendige, vibrierende Wesen in dem Stein berührte, ein ebenso gewaltiges wie gewalttätiges Wesen. Das Brennen strömte durch seinen Arm, seinen Körper, seine Brust, in seinen Leib, seine Lenden. Es strömte weiter, durch seine Adern, in seine Beine, seine Füße und hinauf in seinen Hals, seinen Kopf, raste durch sein Hirn.
Es war ein Brennen, wie kein Feuer je zu brennen vermocht hätte, eine Hitze, die gleichzeitig eiskalt schien und doch alles mit heiligem Feuer verzehrte, was er war, was er dachte, was er fühlte. Nein, diese Flammen fraßen sein Selbst nicht … Sie … Sie schienen es zu reinigen. Als würde er durchs Hellführ wandeln, ohne dass ihn das Feuer der Unterwelt verbrannte, ohne dass es ihm irgendeinen Schaden zufügte.Durch den Verstand des Nordlings drang nur noch der Nachhall einer grausam ungerührten Stimme, bevor seine Essenz, von den züngelnden Flammen umlodert, in einer gleißenden, blendenden Helligkeit aufzugehen schien.
WIR SIND
Im nächsten Moment erloschen die Flammen, als hätte jemand sie mit einem einzigen Schlag erstickt, und hinterließen eine samtige Schwärze, die sich wie wohltuender Honig in seinem Bewusstsein ausbreitete.
Der Wind strich beinahe träge über die einsamen, eisigen Gletscherfelder. Es schien, als wäre er es müde, sich unzählige Äonen in dieser weißen Wüste damit zu vertreiben, den Gletscher zu schleifen, ihn zu formen, Kunstwerke aus Eis zu schaffen. Hohe, spitze Eisnadeln, um deren scharfe Kanten er unheimlich heulte und pfiff. Lang gezogene, geduckte Höhlen, über die er hinwegfegte und in denen Schneeeulen, Gletscherhasen und selbst Weißbären vor ihm Schutz fanden. Oder vor denen ein Rudel Silberwölfe mit gesträubtem Fell lauerte, knurrend und zähnefletschend …
Die Gestalt, die plötzlich aus einer dieser Höhlen trat, wirkte fast so gewaltig wie ein Weißbär, das mächtigste Raubtier hier auf dem Weißen Spiegel und das einzige Lebewesen, vor dem die riesigen Silberwölfe so etwas wie grimmigen Respekt zeigten – falls sie nicht in einem Rudel jagten, so wie jetzt.
Doch diese Kreatur hatte kein dichtes weißes Fell, sondern ein geflecktes, zotteliges, das einmal einem Rayak gehört hatte. Diese Tiere lebten in den weiten Ebenen jenseits des Gletschers, in die sich die Silberwölfe während der Zeit der Dunkelheit zurückzogen. Dort jagten sie Rayaks, wenn es selbst für sie hier am Weißen Spiegel zu unwirtlich wurde und sie nicht einmal mehr Gletscherhasen aufscheuchen konnten.
Dieses Geschöpf aber war kein Rayak. Seinem Gestank nach war es ein Zweibeiner im Fell eines Rayak. Aber etwas an ihm war anders als an jenen Zweibeinern, auf deren Fährte die Silberwölfe vor Kurzem erst gestoßen waren und die sie eine Weile verfolgt hatten. Eher aus Neugier und Jagdinstinkt denn aus Hunger. Trotzdem waren sie mit reichlich schmackhaftem Zweibeinerfleisch belohnt worden.
Diese Zweibeinerkreatur hier in ihrem Rayakpelz jedoch …
Die Wölfe knurrten, fletschten die Lefzen und schnappten mit ihren kräftigen Kiefern, die ohne Mühe das Rückgrat eines Gletscherhasen zermalmen, ja, mit denen sie sogar dem Weißbär gefährlich werden konnten. Dennoch zogen sie sich langsam von dem Höhleneingang zurück, als die Kreatur einen Schritt auf sie zutrat.
Obwohl der Zweibeiner ihnen nicht drohte. Die anderen brüllten für gewöhnlich laut, um ihre stinkende Angst zu übertönen, stießen mit langen, spitzen Stöcken nach ihnen, an deren Enden seltsame und sehr schmerzhafte Dornen saßen. Oder schickten mit kleineren Stacheln bewehrte Stöcke durch die Luft, die einen Silberwolf selbst in vollem Lauf einholen und niederstrecken konnten. Auch Gletscherhasen oder Weißbären töteten sie damit, und sie vermochten sogar die Schneeeule im Flug vom Himmel zu holen.
Nein, dieser in Rayakfell gehüllte Zweibeiner achtete kaum auf sie. Und er schien sich auch nicht vor ihnen zu fürchten.
Der Leitwolf, ein fast gänzlich ergrautes mächtiges Tier hob knurrend die Schnauze und witterte. Dann senkte er den Schädel wieder und zog sich noch weiter zurück. Ein unerfahrener Jungwolf, der sich vielleicht vor den Fähen des Rudels beweisen wollte, machte Anstalten, sich auf den Zweibeiner zu stürzen, um ihn zu einer verräterischen Fluchtbewegung zu zwingen, das Signal, dass die Jagd eröffnet war.
Doch der Graue hob den mächtigen Schädel und blaffte den ungebärdigen Jungwolf wütend an. Der senkte nach kurzem Zögern den Kopf, klemmte den Schwanz ein und ordnete sich dem Leitwolf unter. Allerdings nicht, ohne noch einmal drohend in Richtung des Zweibeiners zu knurren.
Der hatte die Tiere bisher keines Blickes gewürdigt, sondern sich nur umgesehen, nachdem er aus der Höhle getreten war, ruhig, gelassen, scheinbar die Gefahr nicht achtend, die ein solches Rudel Silberwölfe für einen einzelnen Zweibeiner darstellte.
Bei dem Knurren des Jungwolfs jedoch drehte sich der Zweibeiner um und sah zu dem Tier hinüber. Der Jungwolf bemerkte es nicht, weil er bereits dabei war, sich wieder ins Rudel zu trollen, doch der Leitwolf sah es.
Er sah das schwache, spöttische Grinsen dieser Gestalt, die blitzenden Zähne in dem glänzenden geröteten Gesicht und das Aufglühen der eisblauen Augen, die fast so hell waren wie seine eigenen. Ganz kurz schienen sie einen rötlichen Schimmer anzunehmen, als spiegelte sich die eine, dunklere der beiden tief stehenden Sonnen am Abendhimmel in ihnen.
Mit einem heiseren Kläffen drängte der Leitwolf sein Rudel zur Flucht. Die Tiere gehorchten, und während sie über das Eis stoben, drehte der Graue den Kopf noch einmal zu dem Zweibeiner zurück.
Der machte jedoch keine Anstalten, ihnen zu folgen.
»Ahh!« Der Mann atmete tief die kalte Luft ein, streckte die Arme in die Höhe, spreizte die Beine, reckte sich und bog seinen Körper durch.
Sein Blick folgte den Silberwölfen, die über das Eis davonliefen, und er lächelte kurz, bevor er wieder ernst wurde, als würde er sich freuen, sie wiederzusehen.
Er wog die zweischneidige Streitaxt in der Faust, legte die Finger um den Stiel aus Eisenholz und wirbelte sie herum. So schnell, dass die scharfen Schneiden fast einen Kreis aus mattem grausilbrigem Metall in der Luft bildeten.
Er nickte, sichtlich zufrieden.
DRAAK … SKLAAVV … WEILE NIT … WANDER … TIDENDRÄNGET …
Seine Wangenmuskeln zuckten, als der Chor der Stimmen in seinem Kopf ertönte. Er mahlte mit den Kiefern und ließ den Blick noch einmal in Richtung von Belphors gelbem Auge gleiten.
Als er den schwachen Blutgeruch wahrnahm, den der Wind ihm zutrug, blähte er kurz die Nasenflügel. In dieser Richtung lag Ulcar, die Hauptstadt des Reiches von Alghor, des Reiches der Drachenkämpfer.
Der Mann hob eine Braue. Ulcar interessierte ihn nicht. Er hatte eine andere, wichtigere Aufgabe zu erfüllen, die ihn in die entgegengesetzte Richtung führte, in ein Gebiet jenseits des Weißen Spiegels in das Barkaal-Massiv, aus dem der Gletscher einst hervorgegangen war.
Dorthin musste er.
Um jemanden zu schützen. Um jeden Preis.
Bis er ihn töten durfte.
WEILE NIT …
Er biss die Zähne zusammen, trat kurz mit den Füßen auf das Eis, um den Sitz der Eisdorne zu überprüfen, und setzte sich in Bewegung. Beinahe augenblicklich fiel er in einen bedächtigen, gleichmäßigen Trott, der seine Kräfte schonte und ihn dennoch schnell voranbrachte. Die Eintönigkeit der Bewegung versetzte ihn in eine fast meditative Trance, die ihn nicht hinderte, geschickt über Rinnen oder Eisbrocken zu springen, steile Eishänge hinabzurutschen und instinktiv den tückischen Spalten unter Schnee und Eis auszuweichen. Plötzlich schienen Stimmen einen Namen zu flüstern …
Tonnvorr …
Er kannte niemanden, der so hieß, und wusste auch mit den seltsamen Stimmen nichts anzufangen, die immer noch in einem Winkel seines Verstandes zu flüstern schienen.
DRAAKSKLAAV DRAAKBRUT
Er wusste nur, dass er zu diesem Ort im Barkaal-Massiv gelangen musste, und zwar so schnell wie möglich. Und dann …
Er grinste und fletschte die Zähne zu einer bösartigen, fast dämonischen Grimasse.
»Dann werden wir sehen«, knurrte er. »Wir werden sehen.«
BARKAAL-MASSIV, NORDGRENZE VON ALGHOR, FORST UND MONASTERIUM
Echsenschiss!
Der Pfeil grub sich mit einem satten klatschenden Geräusch in den rissigen graubraunen Stamm des Elefantenbaumes. Daraufhin waren Flügelschlagen und ein erschrockenes Gurren zu hören. Die massige Waldtaube ließ sich träge von dem Zweig fallen, auf dem sie gesessen hatte, und breitete ihre Schwingen aus. Angesichts ihrer plumpen Gestalt glitt sie überraschend majestätisch davon.
Lay ließ den Bogen sinken und blickte der Taube hinterher. Sie verschwand zwischen den ausladenden, von herabhängenden grauen Flechten überzogenen Ästen. Kaum zweihundert Schritt weiter landete sie auf dem Ast eines Samtfruchtbaumes und machte sich unverzüglich daran, an den gelblich weißen, wie fette Maden aussehenden Früchten herumzupicken.
»Du verzichtest wohl nicht mal aufs Fressen, wenn’s dir an den Kragen geht, blöder Vogel!«, presste Lay zwischen den Zähnen hervor. Wirklich?, meldete sich eine kühle Stimme in seinem Kopf. Ihr Leben scheint gar nicht so sehr in Gefahr zu sein, so miserabel, wie du schießt.
Er kniff gereizt die Augen zusammen und wartete, bis Wut und Enttäuschung über sein erneutes Versagen abgeklungen waren. Das wenigstens hatten ihn die ermüdenden Lektionen in der Kunst der Versenkung gelehrt.
Beherrsche deine Emotionen, damit du nicht zu ihrem Spielball wirst. Befreie deinen Geist von den Fesseln der Gefühle. Zügle dein Wollen, damit du in deiner Achtsamkeit nicht erlahmst …
Und im Augenblick konnte er sich einfach keine Unbedachtsamkeit leisten. Er balancierte in ziemlicher Höhe auf dem Stamm eines umgestürzten Baumriesen, auf den er geklettert war, um einen besseren Schusswinkel auf die Waldtaube zu bekommen. Wenn er hinunterfiel, konnte er sich leicht die Knochen brechen.
Und genützt hat es dir überhaupt nichts, sagte er sich, schlug die Augen wieder auf und riss sich wütend die Zweige des Elefantenbaumes von den Kleidern und aus seinen dunklen Locken, ohne darauf zu achten, dass er dabei das eine oder andere Haar mit ausriss. Ebenso wenig wie diese verwünschte Tarnung!, dachte er grimmig. Toller Rat von Maahr-kut, wirklich!
Wahrscheinlich saß der alte Waffenmeister in seiner nach Waffenöl, altem Staub und Kammatnuss stinkenden Kammer im Nordturm des Monasteriums und kaute mit den wenigen ihm verbliebenen Zähnen auf dem schwärzlichen, angeblich berauschenden Fruchtfleisch der Nuss herum, während ihm der Saft nur so aus den Mundwinkeln sabberte. Und gackerte dabei vor Vergnügen bei der Vorstellung, wie sein Schützling als Elefantenbaumschössling verkleidet durch den Wildforst kroch, auf der Jagd nach Waldtauben. Wären diese Tiere nicht so dumm und träge, hätten sie sich vermutlich bei seinem Anblick längst totgelacht.
Falls Tauben überhaupt lachen können. Aber wenigstens hättest du dann einen Erfolg vorzuweisen, wenn du heute Abend ins Monasterium zurückkehrst, dachte Lay grimmig. Sein Zorn wich jedoch Zerknirschung, als er sich vorstellte, wie Maahr-kuts Gackern verebbte und sich seine Miene verfinsterte, wenn er von Lays Versagen erfuhr.
Das hier war bereits der dritte Fehlschuss, und einen der fünf Pfeile hatte er unwiederbringlich verloren. Sein Blick zuckte zu seinem ledernen Köcher, den er sich an einem langen Band um den Oberkörper geschlungen hatte, und verharrte auf der blaugrauen Fiederung der Pfeile, die kunstvoll aus den Unterflügelfedern des Schwebvogels gefertigt war. An der Fiederung lag es nicht, dass er vorbeigeschossen hatte, das war ihm klar.
Lay seufzte.
Maahr-kut würde ihn schelten, weil er so sträflich leichtsinnig mit den Pfeilen umging. Der Waffenmeister fertigte sie selbst an, eine mühsame Arbeit, wie er niemals zu erwähnen vergaß, wenn er sie mit kaum verhohlenem Widerwillen herausgab.
Und natürlich muss ich mir dann wieder anhören, was er schon seit Monaten wie eine Anrufung an irgendeine Naturgottheit herunterbetete: »Du bist noch nicht so weit! Für einen Drachenkämpfer bist du längst noch nicht gut genug!«
Andererseits mussten einem wohl erst Haare aus Nase und Ohren wachsen, bis man Gnade in Maahr-kuts Augen fand.
Wie ich diesen Spruch hasse!
Lay spuckte aus und sah sich suchend nach etwas um, gegen das er hätte treten können. Aber auf dem Stamm des gefallenen Baumungetüms gab es nichts, an dem er seine schlechte Laune auslassen konnte. Jedenfalls nichts, was nicht jeden derartigen Versuch gleichgültig und mit einem heftigen Schmerz für ihn selbst vergolten hätte.
Elefantenbäume trugen ihren Namen nicht wegen ihrer Flechten oder der grauen Borke, die an die rissige Haut und das zottelige Fell von Elefanten erinnerten. Nein, sie hießen so, weil ihr Holz unglaublich hart war und sich selbst gegen eine Bearbeitung mit Säge oder Beil zur Wehr setzte. Auch ein vor ewigen Zeiten umgestürzter Baumriese machte da keine Ausnahme!
Lays Blick glitt zu dem mannsdicken Ast hinauf, auf dem die Waldtaube gesessen hatte. Prachtvoll! Natürlich war das Holz auch nicht so hart, dass sein Pfeil von der Borke abgeprallt und hinuntergefallen wäre.
Natürlich nicht! Lay zischte missmutig und schüttelte den Kopf, während er den Pfeil anstarrte, der in dem Ast steckte und dabei noch schwach vibrierte, als würde er sich amüsieren und ihn verhöhnen.
Sinnlos, auch nur zu versuchen, ihn zurückzuholen, stellte Lay nach kurzer Überlegung fest.
Wahrscheinlich würde es ihm gar nicht gelingen, den Pfeil aus der Rinde zu ziehen, ohne dabei die Spitze abzubrechen; aber es war ohnehin unmöglich, an dem mächtigen Stamm des Elefantenbaumes hinaufzuklettern. Bis zur Höhe von mehr als sechs Männern waren nirgends irgendwelche Astlöcher zu sehen, geschweige denn Äste oder Wucherungen, an denen er sich hätte festhalten oder auf die er hätte einen Fuß setzen können.
Er würde wohl oder übel den zweiten Pfeil aufgeben und Maahr-kuts Schelte über sich ergehen lassen müssen. Doch die, wie Lay insgeheim zugab, möglicherweise berechtigte Kritik des Waffenmeisters war nicht das Schlimmste, was ihn erwartete.
Denn natürlich wäre sein Scheitern Wasser auf die Mühlen von Zanth’ra, der Vorsteherin des Monasteriums, die Mutterstelle an Lay vertrat, so lange er denken konnte.
Wahrscheinlich sogar schon vorher, sagte sich Lay, während er Anstalten machte, vorsichtig von dem Stamm hinabzuklettern, um die Waldtaube zu verfolgen.
Angeblich hatte man ihn als hilfloses weinendes Baby auf der Schwelle des Klosters gefunden. Zanth’ra hatte ihn aufgenommen und großgezogen. Sie hatte die Ausbildung des Findelkindes übernommen und seine scharfe Intelligenz und rasche Auffassungsgabe gefördert, wo sie nur konnte. Vor einiger Zeit hatte sie dann begonnen, ihn in der »Kunst der Versenkung« zu unterweisen, einer geheimen mächtigen Kunst, wie die Vorsteherin betonte. Zudem eine Kunst, deren Beherrschung Zeit brauchte und die Lay bislang nicht einmal annähernd erlernt hatte.
Du bist noch nicht so weit!
Wenigstens etwas, worin sich Zanth’ra und Maahr-kut einig sind, dachte Lay gereizt. Er schulterte den Bogen, damit er beide Hände frei hatte, während er über die mächtigen Zweige des umgestürzten Stammes balancierte, den Fuß erreichte und von einer Wurzel zur anderen sprang, bis er schließlich wieder auf dem weichen, süßlich nach Fäulnis duftenden Waldboden stand.
Ansonsten waren diese beiden wichtigsten Menschen in Lays Leben recht gegensätzlicher Auffassung, was seine Zukunft anging. Maahr-kut unterstützte Lays Wunsch, Drachenkämpfer zu werden. Ein Wunsch, der in Lay brannte, seit vor zehn Zyklen diese Karawane im Kloster haltgemacht hatte und dieser beeindruckende Reiter mit seiner schimmernden, wenn auch verbeulten Brustwehr und dem stolzen Drachen auf dem zugegebenermaßen narbigen Schild dem jungen Lay nach etlichen Bechern Wein all diese wundersamen und aufregenden Geschichten von erhabenen Rittern und blutigen Kämpfen erzählt hatte, in denen stets das Gute in Gestalt eines Drachenkämpfers obsiegte, der zumeist ein Angehöriger der »Schilde Prunfors« war, der berühmten und gefürchteten Leibgarde des Drachenfürsten. Unbezwingbar seien sie, hieß es, und ein Dienst in ihren Reihen war den edelsten und vornehmsten Söhnen Alghors vorbehalten. Allerdings gab es eine Ausnahme. Damals hatte er zum ersten Mal von den berüchtigten Ringfechtern gehört, einem Haufen wilder Gesellen, die durch die Lande zogen und sich bei Spektakeln in kleineren Städten und Siedlungen gegenseitig verprügelten, manchmal sogar töteten. Das alles gegen klingende Münze, verstand sich. Und für die Aussicht, am »Tag der Klingen« in Ulcar im »Roten Sand«, der gewaltigen ringförmigen Arena der Hauptstadt, um die »Goldene Schwinge« zu kämpfen, die demjenigen überreicht wurde, der den Endkampf lebend überstand.
Diese Goldene Schwinge war weit mehr als eine kostbare Belohnung, sie war das Abzeichen der Schilde Prunfors, und wer sie errang, dem winkte ein Platz in den Reihen dieser grimmigen und unbesiegbaren Kämpfer.
Lay war zwar im Laufe der Jahre klar geworden, dass diese Geschichten übertrieben sein mussten, aber selbst wenn nur ein Teil davon stimmte … Seit jener Zeit träumte er davon, am Tag der Klingen den Endkampf in Ulcar zu bestreiten und sich die Goldene Schwinge auf die Brust zu heften oder wo auch immer man das Abzeichen befestigte. Denn er war weder edel noch vornehm, sondern nur ein Waisenjunge, der zudem in einem Monasterium am Weißen Spiegel an Alghors nördlichster und entlegenster Grenze aufgewachsen war. Und zu allem Überfluss auch noch unter den Fittichen der Vorsteherin ebendieses Monasteriums.
Einer Vorsteherin, die unbedingt wollte, dass Lay seine Bestimmung erfüllte und sich der Kunst der Versenkung widmete, um … Ja, um was zu tun? In dem Punkt hielt sich Zanth’ra bedeckt. Ganz sicher erwartete sie doch wohl nicht, dass Lay den Rest seines Lebens in einem abgelegenen Monasterium in der hinterletzten eisigen Furche des Arsches eines so gewaltigen Reiches wie Alghor fristete? Immerhin näherte er sich dem Ende seines zwanzigsten Jahreszyklus, und er war kein Junge mehr, sondern ein Mann.
Er schnaubte verächtlich, hob den Kopf und spähte in Richtung des Samtfruchtbaums, auf dessen Zweigen sich die Waldtaube niedergelassen hatte. Er sah, wie der Vogel weiterhin genüsslich an einer der gelblichen Früchte herumpickte. Offenbar hatte die Taube den Pfeil vollkommen vergessen, der sie eben noch von ihrem Sitz auf dem Elefantenbaum vertrieben hatte. Falls es ihm gelänge, unter diesen Baum zu kommen, hätte er eine perfekte Schussposition. Er ging weiter und schob dabei möglichst lautlos und vorsichtig die überhängenden Zweige der Dornsträucher zur Seite, damit die spitzen giftigen Dornen seine Haut nicht ritzten. Sie erzeugten heftig juckende, schwärende Wunden, die zudem auch noch übel stanken. Und darauf konnte er gut verzichten. Er lächelte.
Mochten die beiden Zukunftspläne für ihn schmieden, wie sie wollten, er jedenfalls hatte ganz andere Vorstellungen. Und zwar seit jenem Tag kurz vor dem Ende der Zeit der Ermattung und dem Beginn der Zeit der Dunkelheit mit ihren Schneestürmen, die das Monasterium von der Welt abschnitten. Damals hatte die Karawane nicht nur Vorräte und dringend benötigte Materialien und Stoffe gebracht, sondern auch Theija …
Lay grinste über beide Backen wie ein Bachlurch und war froh, dass ihn niemand sehen konnte.
Theija.
Sie war der Grund dafür, dass er in den letzten Monaten beim Fechtunterricht des Öfteren blaue Flecken kassiert hatte und immer wieder böse, knurrende Bemerkungen des Waffenmeisters hatte einstecken müssen. Und dass er Zanth’ra beim Unterricht in der Kunst der Versenkung mit seiner Zerstreutheit zur Weißglut brachte. Weil er zwar versank, aber in die Gedanken an eine rothaarige Schönheit, an Haut, so weich wie die Früchte des Samtfruchtbaumes …
»Ah, bei Belphors Hörnern!« Er fluchte, als er unvorsichtigerweise in ein Loch im Boden trat, taumelte und mit lautem Krachen und Rascheln in einen Busch stürzte. Zum Glück war es kein Giftdorn.
Er rappelte sich hastig auf, hob den Kopf und stöhnte, als er sah, wie die Taube, von dem Lärm aufgescheucht, aufflatterte und wegflog. Wenigstens verkündeten das Prasseln von Zweigen und ein lautes, kehliges Gurren, dass sie nicht allzu weit geflogen war.
Pass gefälligst auf, du Narr!, schalt er sich beim Weitergehen. Sonst kannst du gleich umkehren und die Steinkaninchen aus den Fallen klauben!
Dabei hatte er Theija versprochen, Waldtauben zum Abendessen zu schießen. Genug für sie alle! Er verzog das Gesicht. Er würde sie schwerlich beeindrucken, wenn er nicht Wort hielt. Und wenn du dich weiterhin so ungeschickt anstellst …
Seine Laune trübte sich, als er daran dachte, dass seine Zukunftspläne noch einen Haken hatten. Und zwar einen ziemlich großen. Denn Theija wusste noch nichts von ihrer bedeutsamen Rolle in seinem Leben.
Lay folgte dem Gurren der Taube, die Augen auf den Boden gerichtet. Bisher habe ich eben einfach noch nicht den richtigen Moment erwischt, es ihr zu sagen, dachte er und schüttelte dann entmutigt den Kopf. Wem willst du hier etwas vormachen?, fragte er sich. Du hast einfach Angst, dass sie dich vielleicht auslacht, wenn du sie fragst, ob sie …
Er blieb stehen, holte tief Luft und straffte die Schultern. Zweifellos wäre es außerordentlich hilfreich, wenn er mit fetten, schmackhaften Waldtauben in der Hand vor sie trat, bevor er sie fragte, ob sie sich vorstellen könnte, die ihr zugedachte Rolle einzunehmen. Das wirkte bestimmt überzeugender, als wenn er ihr ein paar jämmerliche Steinkaninchen präsentierte, deren Felle zudem vom Eisen der Fallen übel zerfetzt waren. So bewies er ihr wenigstens, dass er ein Mann war, der zu seinem Wort stand.
Also!
Er ging weiter. Genau das hatte er vor, koste es, was es wolle. Du wirst diese vermaledeite Waldtaube erlegen, selbst wenn du auf den Baum klettern und sie mit bloßen Händen erwürgen musst!
Das war natürlich Unsinn, aber der Gedanke munterte ihn ein wenig auf. Er nahm den Bogen von der Schulter und betrachtete ihn skeptisch.
Gewiss, ein Ringfechter brauchte weder Pfeil noch Bogen, auch am Tag der Klingen nicht, wie der Name ja schon vermuten ließ. Ein wahrer Drachenkämpfer jedoch musste sich selbstverständlich im Umgang mit allen Waffen auszeichnen, seien es Messer, Streitaxt, Streitkolben, Lanze oder Spieß. Ebenso wie im Gebrauch von Pfeil und Bogen. Und darin musste Lay seine Fähigkeiten, wie Maahr-kut es ausdrückte, tatsächlich »dringend vervollkommnen«.
Lay seufzte erneut und stieg auf einen bemoosten Fels, um einen besseren Überblick zu bekommen.
Zwei verlorene Pfeile, und meine Beute hat nicht mal eine verdammte Feder eingebüßt! Mürrisch strich er sich die widerspenstigen Locken aus dem Gesicht und beschattete mit einer Hand die Augen, während er zu den beiden Sonnen über Alghor hinaufblickte. Sie standen beide schon ziemlich tief über dem Horizont, die gelbe, in Belphors Ruh, über den düsteren Wipfeln des Dunkelforsts, die rote, in Richtung Belphors Schlaf, dicht über dem gewaltigen fernen Gletscher, dessen Eis sie in einem spiegelnden Gleißen erstrahlen ließ. Und mir bleibt auch nicht mehr allzu viel Zeit, das zu ändern, setzte er seinen Gedankengang gereizt fort. Noch fünf Sonnenstriche vielleicht, dann würde sich Belphors gelbes Auge schließen, und das rote würde nicht mehr allzu lange sein blasses Licht spenden, bevor es hinter dem Weißen Spiegel verschwand und sich die Dunkelheit über das Land senkte. Besser, ich beeile mich ein bisschen und bringe diese verdammte Waldtaube endlich zur Strecke!
Leichter gesagt als getan.
Lay sah sich um. Der Forst umgab die kleine Hügelkette, auf deren höchster Anhöhe das Monasterium lag, wie eine grüne Flut eine Insel. Er kannte ihn wie seinen Handrücken und hatte vor der darin herrschenden Dunkelheit keine Angst. Er musste sich jetzt, in der Zeit der Erweckung, nur vor den Dornenschweinen in Acht nehmen. Sie hatten gerade geworfen und hüteten ihre Brut eifersüchtig. Mit ihren gewaltigen Hauern und den scharfen Dornen an Kopf, Schultern und Hufen konnten sie einen Menschen mit Leichtigkeit in Stücke reißen. Ein solider Spieß war gegen diese Tiere eine weit wirksamere Waffe als Pfeil und Bogen. Vor allem, Lay verzog die Lippen, wenn man nicht so recht damit umgehen kann.
Noch nicht!, versprach er sich dann und umklammerte den Bogen fester. Wenigstens waren Dornenschweine sehr laut und verkündeten ihr Nahen schon frühzeitig. Und von den Graubären, die ebenfalls hier im Forst heimisch waren, ging keine allzu große Gefahr für ihn aus. Diese Tiere waren zwar riesig und mit gewaltigen Krallen und einem Furcht einflößenden Gebiss ausgestattet, aber sie waren friedfertig und eher scheu. Was vielleicht daran lag, dass Graubären im Gegensatz zu den Weißbären, ihren bösartigen und mörderischen Verwandten am Weißen Spiegel, kein Fleisch fraßen, sondern nur bestimmte Pflanzen und Pilze, die tief im Boden verborgen wuchsen und die sie mit ihren gewaltigen Krallen ausgruben.
Lay tastete nach seinem Köcher. Er hatte noch drei Pfeile und würde auf keinen Fall ohne Beute ins Monasterium zurückkehren. Er lauschte kurz. Wohin genau war der Vogel geflogen? Zum Glück waren diese Tiere groß und schwer und flogen deshalb nicht gern weitere Strecken. Sie hausten zumeist in recht übersichtlichen Revieren, von denen sie sich nur selten weit entfernten. Das war der Vorteil bei der Jagd auf Waldtauben. Der Nachteil war, dass sie sich gern im dichten Blattwerk verbargen und zudem ihre Nester weit oben in den riesigen Elefantenbäumen bauten. Schießen konnte man sie meist nur, wenn sie zur Futtersuche herunterkamen, um von den von ihnen heiß geliebten Früchten der Samtfruchtbäume zu naschen. So wie die Taube, die Lay bereits zweimal verfehlt hatte.
Ein drittes Mal passiert mir das nicht, versprach er sich, und seine Stimmung wurde zusehends besser, als er zwischen dem Rascheln der Blätter und dem Murmeln irgendeines entfernten Bachlaufs Flügelschläge hörte. Diesmal erwische ich dich!, dachte Lay und setzte sich in Bewegung.
Der schmale Wildpfad stieg sanft an. Lay folgte ihm mit der Geschmeidigkeit einer Bergkatze, stieg über schenkeldicke Wurzeln, zwängte sich zwischen bemoosten Felsbrocken hindurch und duckte sich vorsichtig unter den Ästen der Stachelbäume mit ihren giftigen Blättern hinweg. Außerdem achtete er darauf, keinen Lärm zu verursachen, um seine Beute nicht aufzuschrecken oder gar zu verscheuchen. Die vertrauten Geräusche des Waldes nahm er nur unbewusst wahr; das Rascheln kleiner Nager, das Krächzen und die Schreie der Vögel hoch oben in den Ästen der gewaltigen Bäume, die zwar mit gelegentlichen Rufen sein Auftauchen meldeten, aber nicht sonderlich beunruhigt schienen. Was bedeutete, dass keine größeren Raubtiere in der Nähe waren, die ihm hätten gefährlich werden können.
Wie erwartet, musste er nicht weit gehen.
Nach kaum fünfhundert Schritt, auf der Kuppe einer kleinen Anhöhe, hörte er das Flügelklatschen, das Rascheln von Blättern und das unverkennbare freudige Glucksen einer Waldtaube, die sich auf einem Samtfruchtbaum niederließ.
Lay kannte die Stelle. Hinter dieser Erhebung schnitt die Wolfsschlucht tief in die Flanke des Berges. Die Kluft führte bis hinab zum Wolfstal. Wäre Lay noch ein paar Schritte weitergegangen, hätte er das fruchtbare grüne Tal überblicken können. Hinter dem Höhenzug, der das Wolfstal auf der gegenüberliegenden Seite begrenzte, lag auf einer felsigen Anhöhe das Monasterium, das von hier aus jedoch nicht zu sehen war.
Allerdings hatte er im Augenblick keinen Blick für die Landschaft übrig. Er kletterte vorsichtig über den umgestürzten, grünweiß gescheckten Stamm einer Eisenbirke. Die Taube saß zwanzig, vielleicht dreißig Schritt vor ihm auf dem Ast eines reich mit Früchten behangenen Samtfruchtbaumes und fraß gierig und anscheinend arglos; sie schien die drohende Gefahr nicht zu spüren. Lay wusste zwar nicht genau, ob es sich um jene Taube handelte, die er gerade verfehlt hatte, aber das spielte auch keine Rolle. Er tastete nach einem Pfeil im Köcher und zog ihn vorsichtig heraus. Die Entfernung war zwar recht groß, aber er konnte sich seiner Beute nicht weiter nähern, ohne den Vogel auf sich aufmerksam zu machen. Es gab keine Deckung zwischen ihm und dem Samtfruchtbaum, und wenn er einen Bogen schlug, um sich der Waldtaube aus einer anderen Richtung zu nähern, kostete ihn das zu viel Zeit. Außerdem riskierte er damit, dass sie sich satt gefressen hatte und aufflog, bevor er seinen neuen Standpunkt bezogen hatte. Er musste es einfach wagen!
Lay duckte sich, befeuchtete die Lippen und nockte den Pfeil auf die Sehne. Diesmal werde ich treffen!, sagte er sich, spannte die Sehne, bis sie Nase und Lippen berührte, kniff ein Auge zu und visierte mit dem anderen am Pfeil entlang sein Ziel an. Die Fiederung des Pfeils kitzelte ihn am Ohr. Noch einen Fehlschuss konnte und durfte er sich nicht leisten.
Atmen. Ein und aus. Ein und aus. Einatmen und Atem anhalten. Anvisieren.
Verflucht! Er atmete zischend aus.
Es gelang ihm einfach nicht, sich so auf sein Ziel zu fokussieren, wie Maahr-kut es ihn gelehrt hatte. Lays Hand, die den Bogen hielt, zitterte leicht. Ob vor Anspannung oder aus Angst, wieder zu versagen, wusste er nicht. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls wirst duauf diese Weise niemals treffen! Über eine solche Entfernung würde jedes Zittern, jede noch so leichte Bewegung der Hand die Flugbahn des Pfeils entscheidend verändern.
Konzentriere dich!
Einatmen.
Ausatmen.
Er fixierte mit einem Auge die auf dem Ast sorglos vor sich hin fressende Waldtaube, gut zwanzig Schritt vor ihm, und kniff das andere zu, als plötzlich Zanth’ras weiche, monotone Stimme in seinem Kopf ertönte.
Lass alles fallen. Lass alles geh’n. Überlass dich dem Strom. Du bist alles. Alles ist du. Ohne Willen wollen.
Es klang wie eine Beschwörung.
Einatmen.
Die Kunst der Versenkung.
Lay kniff das Auge, mit dem er die Taube anvisierte, zu einem schmalen Spalt zusammen und atmete langsam aus, während er die Sehne ein klein wenig entspannte. Das Holz des Bogens knarrte, und die Sehne vibrierte leicht. Sie … summte. Er ließ die Waffe etwas sinken. Die Waldtaube hatte ihn immer noch nicht bemerkt und fraß weiter genüsslich die saftigen Früchte.
Unter der strengen Anleitung der Vorsteherin übte sich Lay schon seit Jahren in der Kunst der Versenkung, dem konzentrierten und doch willenlosen Dahingleiten auf dem »Strom des Seins«, wie Zanth’ra es nannte. Bis vor ein paar Monaten hatte Lay die Einstellung Maahr-kuts geteilt, der diese Übungen verächtlich als »Scharlatanerei« und »Zeitverschwendung« abtat. Lay war am Anfang sogar dabei eingeschlummert und hatte die langen Sitzungen benutzt, um sich von der anstrengenden Arbeit im Monasterium zu erholen. Doch dann, vor etlichen Monaten, hatte er eine neue, verstörende Erfahrung gemacht. Es war ein merkwürdiges Gefühl gewesen, so als würde die Zeit langsamer verstreichen und seine Wahrnehmung sich schärfen. Als er Zanth’ra davon berichtete, hatte sie ihn scharf gemustert und ganz genau wissen wollen, was er getan hatte, um diesen Zustand der Versenkung zu erreichen. Lay war es aber, sehr zu Zanth’ras Ärger, nicht gelungen, sich an irgendwelche Einzelheiten zu erinnern.
Seitdem jedoch unterwies sie ihn täglich in dem kleinen Lesezimmer des Monasteriums, in dem Bücher und Handschriften aufbewahrt wurden, und übte mit ihm die verschiedenen Techniken dieser Kunst. Dabei machte Lay, seiner Meinung nach jedenfalls, recht gute Fortschritte. Allerdings war es ihm nicht mehr gelungen, dieses erste intensive Erlebnis ein weiteres Mal hervorzurufen.
Zanth’ra hatte ihm eingeschärft, diese Techniken nur unter ihrer Anleitung anzuwenden.
Einatmen.
Als er den Grund dafür wissen wollte, hatte sie ihn mit ihren dunklen Augen durchdringend angesehen und dann mit den Schultern gezuckt. »Für einen ungeschulten Anfänger kann es gefährlich sein, sich zu tief zu versenken«, hatte sie erwidert. Mehr hatte sie ihm trotz seines neugierigen Drängens nicht verraten wollen, hatte ihm aber das Versprechen abgenommen, es niemals heimlich zu versuchen.
Natürlich hatte das Verbot Lays Neugier geweckt, und er hatte sich gefragt, was an einer einfachen Versenkung in diesen »Strom des Seins« so gefährlich sein sollte. Aber er hatte bisher nie den Drang verspürt, gegen das Verbot zu handeln, um es herauszufinden.
Ausatmen.
Und auch hier im Wald war ihm nicht daran gelegen, irgendwelchen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Er wollte nur diesen Zustand der Ruhe und Fokussierung erlangen, in den er sich versetzen konnte, wenn seine Versenkungsübungen gut liefen.
Vielleicht half ihm das, den Bogen ruhiger zu halten, sich ganz auf das Ziel zu konzentrieren und alle störenden Gedanken auszuschließen.
Lay hob die Waffe, spannte die Sehne erneut, presste sie an Nase und Lippen und atmete langsam und tief ein, ließ beim Ausatmen die Luft sacht über die leicht geöffneten Lippen gleiten und summte leise …
Wie damals, als er sich zum ersten Mal wirklich versenkt hatte, tauchte die Melodie plötzlich in seinem Kopf auf. Sie war anders als jede Musik, die er bisher gehört hatte, aber er überließ sich wiederum den Klängen in seinem Kopf und summte leise mit.
Aber … Er versuchte, den Gedanken nicht weiterzuverfolgen, weil klare, deutliche Gedanken die Versenkung verhinderten. Dennoch, er spürte, dass diesmal etwas anders war als sonst. Die Melodie schien nicht nur in seinem Kopf zu erklingen, sondern war irgendwie … um ihn herum. Hatte Lay beim ersten Mal die Augen geschlossen und sich ausschließlich auf seine Atmung konzentriert, seinen Herzschlag, das Gefühl seines Körpers, so ließ er sich jetzt mit offenen Augen von der Melodie führen, hielt den Blick starr auf sein Ziel gerichtet …
Auch diesmal hörte er seinen Herzschlag, der langsamer wurde, dumpfer, aber lauter. Er hörte wieder das schwache Zischen, mit dem die Luft beim Ausatmen über seine Zähne strich, das schwache Rauschen in seiner Nase, wenn er einatmete. Er spürte das Vibrieren in seinem Hals, in seiner Kehle, während er leise die Melodie summte.
Diesmal jedoch machte er all das mit offenen Augen, visierte sein Ziel an und sah …
Der Wald um ihn herum schien zu einem undeutlichen grünbraunen Schemen zu verschwimmen. Sein Blickfeld verengte sich, beschränkte sich auf den Pfeil, den Bogen in seiner Faust, die dunkel schimmernde Eisenspitze des Pfeils, und dann …
Sein Ziel. Die Taube. Lay nahm sie als eine dunkle Gestalt am Ende eines von leuchtenden Fäden durchzogenen Tunnels wahr. Sie pickte eine Samtfrucht auf; langsam, ganz langsam hob und senkte sie den Kopf. Lay erkannte jedes Detail ihres Halsgefieders, die grünblauen Federn, die sich übereinanderschoben, wenn die Taube sich bewegte. Er sah einen Faden, der von der Spitze des Pfeils ausging und zu einer Stelle dicht neben der Taube führte …
Lay summte unwillkürlich lauter und korrigierte unmerklich den Schusswinkel, bis die Spitze des Fadens direkt auf den massigen Leib der Taube zeigte, dorthin, wo er unter ihrem Gefieder sehen konnte, wie ihr Herz schlug, ganz langsam schlug; er konnte das leichte, dumpfe Pochen hören …
Jetzt. So müsste es passen …
Lay ließ die Sehne los.
Er sah, wie sich der Pfeil um seine eigene Achse drehte, als er von der Sehne unvorstellbar langsam vom Bogen wegkatapultiert wurde. Der Schaft des Pfeils schabte am Holz des Bogens entlang, bog sich federnd durch, wippte, während er sich langsam um sich selbst drehend vom Bogen weg durch die Luft glitt. Träge, aber unaufhaltsam.
Unglaublich! Lay hütete sich, den Pfeil aus den Augen zu lassen. Wie kann das …? Er unterbrach den Gedankengang, als die Linien zu flackern begannen.
Die Versenkung funktionierte, nur darauf kam es an. Über das Wie und Warum konnte er nachdenken, wenn die Taube erlegt war. Jetzt durfte er sich auf keinen Fall in seiner Konzentration stören lassen.
Die Melodie schwoll an, wurde immer lauter, und Lay summte mit, während er ungläubig den Flug des Pfeils verfolgte. Die hellen, strahlenden Linien zwischen der eisernen Spitze und der Taube schienen zu pulsieren, als der Pfeil auf sie zuflog, so langsam, dass er eigentlich hätte zu Boden fallen müssen.
Lay wollte den Bogen sinken lassen, die Arme und Hände entspannen, aber es gelang ihm nicht. Jedenfalls nicht so schnell, wie er wollte.
Er wunderte sich jedoch nicht darüber, sondern konzentrierte sich, gebannt von dieser neuen Erfahrung, auf den Pfeil, auf die Taube, auf die grünlich schimmernden Linien. Auf die Melodie. Er summte lauter, als er sah, dass der Pfeil sich auf einer Linie befand, die ein Stück an der Taube vorbeiführte.
Ich schieße vorbei! Der Gedanke durchzuckte ihn, aber er unterdrückte ihn auf der Stelle, klammerte sich an die Melodie, versuchte, den Pfeil … Er versuchte, den Pfeil zu beeinflussen, seine Richtung zu ändern. Zur Taube hin und weg von der dunklen Rauchwolke, die am Horizont aufstieg, hinter den Bäumen, auf der anderen Seite des Wolfstals.
Eine Rauchwolke?
Lays Blick zuckte von dem Pfeil und der Taube zurück zu der Wolke. Sie wirkte drohend und düster, und sie war vor wenigen Minuten noch nicht da gewesen. Jedenfalls hatte er sie nicht bemerkt. Sie steigt etwa an der Stelle auf, wo das Monasterium liegen müsste …
Lay schrie auf, als die Melodie abrupt und mit einem scharfen Stich in seinem Kopf abbrach und die grünen Linien flackerten und erloschen. Sein Blick hing noch einen Moment länger an dem Pfeil, der gut zwei Schritte an der Taube vorbeiflog. Er zischte zwischen den dicht belaubten Zweigen des Samtfruchtbaumes hindurch, scheinbar direkt auf die schwarzgraue Wolke zu, die über den Bergkamm quoll. Dann beschrieb seine Flugbahn einen Bogen, und er verschwand über den Rand des Grats im Wolfstal.
Lay kämpfte auf dem feuchten Moos des Felsens um sein Gleichgewicht, als ihn plötzlich der Schwindel packte. Die Welt um ihn herum schien zu schwanken, und ihn überkam eine Welle von Übelkeit. Noch während er von dem Felsbrocken fiel, kam ihm das Frühstück hoch, Brotkrumen, fette Hühnerbrühe und dazu das bittere Dunkelbier des Monasteriums. Bevor er auch nur schlucken konnte, um es in sich zu halten, landete er mit einem lauten Krachen auf dem von Wurzeln und Steinen übersäten Waldboden. Sein Schmerzensschrei wurde von dem Erbrochenen erstickt, und als er nach Luft rang, verschluckte er sich.
Hustend und spuckend kam er wieder auf die Beine, gerade noch rechtzeitig, um die Taube auffliegen zu sehen. Sie gab ein missbilligendes Kreischen von sich, während sie mit gebieterischen Flügelschlägen an Höhe gewann und zwischen den Elefantenbäumen verschwand.
Lay achtete nicht mehr auf die Taube, und er dachte auch nicht an den verlorenen Pfeil, den dritten, den er verschossen hatte. Er hielt sich an dem rauen Stein fest, während er darauf wartete, dass das Schwindelgefühl abebbte. Er würgte noch einmal, erbrach diesmal aber nur bittere Galle. Dann richtete er sich auf und wischte sich Speichelfäden vom Kinn.
Offenbar war es nicht ratsam, überhastet aus der Versenkung aufzutauchen, die Konzentration einfach fahren zu lassen. Vermutlich hatte die Vorsteherin ihn deshalb davor gewarnt, die Übungen allein zu machen.
Doch das spielte jetzt keine Rolle. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass er immer noch mit leeren Händen dastand. Über das, was er gerade eben erlebt hatte, konnte er später nachdenken. Jetzt war etwas anderes vordringlicher.
Lay hatte schon mehr als einmal den Wald brennen sehen, in der Zeit der Glut, wenn die Erde vollkommen ausgetrocknet war und alles Leben den nächsten Regen herbeisehnte. Aber jetzt war die Zeit der Erweckung, der Zyklus hatte begonnen, alles war grün und fruchtbar. Diese Rauchwolke stammte nicht von brennenden Bäumen.
Sie war jetzt deutlicher zu erkennen. Die Wolke quoll wie eine träge, ölige schwarzgraue Faust über die gegenüberliegende Flanke des Tals. Was auch immer dort brannte, es musste etwas wirklich Großes sein.
Lays Mund wurde plötzlich trocken, und in den schalen, scharfen Geschmack des Erbrochenen mischte sich das metallische Aroma nackter Angst. Er holte tief Luft, um sie unter Kontrolle zu bringen.
Denn das einzige wirklich Große hinter diesem Hügelkamm, das nicht nur aus Holz bestand … war das Monasterium.
Sein Heim.
Lay streifte sich den Bogen über den Kopf, zog ihn fest auf den Rücken und rannte los.
Der Mann saß auf einer bewaldeten Anhöhe, mit dem Rücken zum Gletscher, den Blick starr auf das gelbe Auge Belphors gerichtet, das knapp eine Handbreit über den zerklüfteten Gipfeln des Barkaal-Massivs stand. Er war den ganzen Vormittag und bis in den frühen Nachmittag ohne Pause getrottet und brauchte dringend eine längere Rast. Seinem Aufzug nach handelte es sich um einen Nordling, aber auch wenn er Bärenkräfte besaß, war er nur ein Mensch und dementsprechend menschlichen Gesetzen unterworfen. Er musste ausruhen, selbst wenn sein Geist keine Ruhe brauchte …
Plötzlich hob der Mann den Kopf. Ein schwacher, heller Ton hatte ihn aus seiner Versunkenheit gerissen. Der Ton klang, als hätte jemand in großer Ferne einen gigantischen kristallenen Gong angeschlagen; er waberte, wurde höher, schärfer, dann verklang er.
Der Dunkle Schleier.
Der Nordling stand, bevor dieses seltsame Geräusch vollkommen verklungen war.
Der Mann knurrte fauchend, ein fast unmenschlicher Laut, und umklammerte seine Streitaxt fester.
Er schüttelte den Kopf und blickte erneut auf die Sonnen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sich das gelbe Auge Belphors schloss und nur sein rotes Auge noch glühte …
Ein Summen ertönte, waberte durch die Luft wie zuvor der glockenhelle Klang. Das Summen jedoch war dunkler, dumpfer, vielstimmiger. Und es klang drohend.
draak sklaav, weile nit, tonnvorr, tidendränget …
»Ist ja gut.« Der Nordling hatte sich bereits den Hügel hinab in Bewegung gesetzt und schob die Axt, die er der Bequemlichkeit halber beim Sitzen auf seinen Schoß gelegt hatte, wieder in die Schlaufe auf seinem Rücken. »Wir haben’s gehört, was glaubt ihr wohl?« Offenkundig rechnete er nicht mit einer Antwort. Und er bekam auch keine.
Seine eisblauen Augen glühten auf, und er fletschte die Zähne zu einem Grinsen. Es war eine Furcht einflößende Grimasse, die sein Gesicht in eine bedrohliche Fratze verwandelte.
Er hatte den Fuß der Anhöhe erreicht, drehte sich um in Richtung des Auge Belphors und verfiel in einen gleichmäßigen, raumgreifenden Trott.
»Nein! NEIN! NEIIIN!«
Lay stürmte zwischen den Bäumen hervor und sank keuchend auf die Knie. Die felsige Bergkuppe, auf der das Monasterium stand, lag vor ihm. Belphors gelbes Auge war bereits hinter den zerklüfteten Gipfeln zu seiner Linken untergegangen, und nur sein blutig rotes Auge tauchte die Welt in ein blassrotes Licht.
Das rötliche Flackern jedoch, das über die Hügel kroch, kam von den Flammen, die aus den Fensternischen und Toren des Monasteriums loderten. Sie fraßen die Reetdächer, leckten gierig mit gelben und roten Zungen daran. Der Wind peitschte die Funken hoch in den Himmel. Dichter, öliger Rauch quoll aus dem Haupthaus, aus der Lagerscheune, dem Vorratshaus, den Schlafsälen, den Stallungen …
Das Monasterium war nicht mehr zu retten, so viel war auf den ersten Blick klar.
Der Lärm war fast genauso widerlich wie der Gestank.
Lay würgte erstickt, als ihm der Gestank in die Nase stieg und sich ihm die Kehle zuschnürte; ein Gestank nach verbranntem Fleisch, den Lay für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen würde. Er war dabei gewesen, als sie vor zwei Zyklen in der Zeit der Glut fast die Hälfte ihrer Felsschafe hatten töten und anschließend verbrennen müssen; die Tiere waren an einer rätselhaften ansteckenden Seuche erkrankt, gegen die Zanth’ra kein Heilmittel hatte finden können. Um wenigstens die noch nicht befallenen Schafe zu retten, war ihnen nichts anderes übrig geblieben. Der Gestank, als Fell, Fettschicht und Fleisch verbrannten, war nahezu unerträglich gewesen.
Aber es gab einen großen Unterschied zwischen damals und heute.
Die Felsschafe waren schon tot gewesen, als man sie verbrannt hatte.
Die Schreie der Kreaturen, die aus den Stallungen des Monasteriums bis zu Lay drangen, verrieten jedoch, dass ihnen diese Gnade nicht zuteilgeworden war. Die Tiere verbrannten bei lebendigem Leib.
Und …
Lay wich das Blut aus dem Gesicht, als er zwischen dem panischen Kreischen von Schafen, Rayaks und Schlammschweinen Schreie hörte, die genauso verzweifelt klangen, aber aus anderen Kehlen stammten. Aus den Kehlen von Menschen.