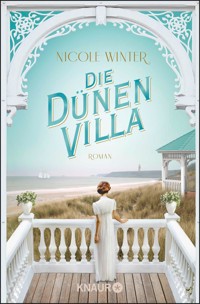
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo Träume eine neue Chance bekommen: die opulente Auswanderer-Saga um eine deutsche Arzt-Familie auf Marthaʼs Vineyard, dem »Sylt der US-Ostküste« Marthaʼs Vineyard 1884: Weil ihn die langen Sandstrände und sanften Dünen an die heimische Ostsee erinnern, wählt der deutsche Arzt Friedrich Böhm die Insel vor der Ostküste der USA als Standort für sein Sanatorium. Hier will der Auswanderer seiner Familie eine neue Zukunft aufbauen. Doch Böhms Sohn Thomas hat nur widerwillig Medizin studiert, viel lieber würde er sich der aufstrebenden Psychologie zuwenden. Und seine Tochter Sophia sieht mit ihrem gelähmten Bein keine Perspektive im Leben – wozu könnte sie schon nützen, und welcher Mann sollte eine behinderte Frau lieben? Als sie sich jedoch in den Naturforscher Scott verliebt, wird ihr Mut erneut auf eine schwere Probe gestellt, denn Scott will keinesfalls auf Marthaʼs Vineyard bleiben. Sein Herz gehört dem auf immer verlorenen alten Westen der USA mit seinen riesigen Büffelherden und Schwärmen von Wandertauben, die den Himmel verdunkeln. Kann die Zukunft eine Chance haben, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann? Nicole Winter ist selbst mit 24 Jahren nach Kanada ausgewandert. Die Auswanderer-Saga um die deutsche Familie Böhm ist ihr erster Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nicole Winter
Die Dünenvilla
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Marthaʼs Vineyard 1884: Weil ihn die langen Sandstrände und sanften Dünen an die heimische Ostsee erinnern, wählt der deutsche Arzt Friedrich Böhm die Insel vor der Ostküste der USA als Standort für sein Sanatorium. Hier will der Auswanderer seiner Familie eine neue Zukunft aufbauen. Doch Böhms Sohn Thomas hat nur widerwillig Medizin studiert, viel lieber würde er sich der aufstrebenden Psychologie zuwenden. Und seine Tochter Sophia sieht mit ihrem gelähmten Bein keine Perspektive im Leben – wozu könnte sie schon nützen, und welcher Mann sollte eine behinderte Frau lieben?
Erst als Sophia im Sanatorium aushelfen muss, entdeckt sie ihre wahre Bestimmung. Als sie sich jedoch in den Naturforscher Scott verliebt, wird ihr Mut erneut auf eine schwere Probe gestellt, denn Scott will keinesfalls auf Marthaʼs Vineyard bleiben. Sein Herz gehört dem auf immer verlorenen alten Westen der USA mit seinen riesigen Büffelherden und Schwärmen von Wandertauben, die den Himmel verdunkeln.
Kann die Zukunft eine Chance haben, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann?
Inhaltsübersicht
Untergang
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Neubeginn
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Zukunftswege
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Untergang
1
Sophia Böhms Koffer verweigerte den Dienst. Mehr als randvoll mit Romanen, Gedichtbänden, Malblöcken, Pinseln, Aquarell- und Ölfarben, Zeichenkohle und immerhin auch zwei Kleidern, wollte das lederne Ding seinen Deckel partout nicht schließen lassen, selbst als sie sich daraufsetzte. Mit ausgestreckten Beinen auf einem Koffer zu thronen war zwar alles andere als damenhaft, aber es sah sie ja niemand. Ein paar Zimmer weiter trugen ihr Vater und Bruder sicherlich ähnliche Kämpfe aus. In der Ecke hakte die Standuhr mit dem Buntglaseinsatz die Minuten bis zum Abschiedsessen ab. Beim Gedanken an die Zukunft krampfte sich Sophias Magen zusammen.
Besser nicht mehr grübeln. Sie zwang ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Koffer und versuchte, das Knirschen unter sich zu ignorieren. »Du Biest!«
»Sprichst du mit mir?« Ihre Zwillingsschwester Julia, die sich vor dem Spiegel die dunkelroten Haare für die Reise hochsteckte, drehte sich zu ihr um.
»Nein, mit mir selbst. Mit dem Koffer.« Sie betastete ihre am Morgen nur nachlässig zu einem Dutt zusammengeschlungenen Haare. Aber wenn sie sich von der Droschke direkt in ihre Kabine auf dem Dampfer begab, könnte das Frisieren bis dahin warten. Im Grunde spielte es auch keine Rolle, denn sobald sie einen Fuß vor den anderen setzte, sah ihr ohnehin niemand mehr auf den Kopf. Stattdessen hefteten die Blicke sich sofort auf ihren Rock, dann auf den als Sonnenschirm getarnten Gehstock, und sie wurde für andere unsichtbar.
Julia zog eine Augenbraue hoch. »Und was sagt dein Koffer?«
»Dass ich zu viel eingepackt habe.«
»Warum lässt du nicht die Hälfte der Bücher hier? Den Koffer kann ja kein Mensch tragen. Die Bücher kann Onkel Heinrich uns doch mit dem Rest vom Hausrat nachschicken, wenn wir in Savannah ein Haus gefunden haben. Und willst du wirklich sämtliche Malsachen mit an Bord nehmen?« Julia steckte die letzte Haarnadel fest. Energisch scheuchte sie ihre Schwester ein Stück zur Seite, lüpfte den Rock ihres taubengrauen Reisekleids und ließ sich neben Sophia auf den Kofferdeckel plumpsen. Der ächzte erschöpft und senkte sich um weitere zwei Zentimeter.
»Zum Umpacken ist nun keine Zeit mehr«, wich Sophia ihr aus, um eine weitere fruchtlose Diskussion über das Malen zu vermeiden. Julia würde entsetzt sein, wenn sie ihr gestand, was sie vorhatte, und sie war die Gespräche müde, in denen alle auf sie einredeten wie auf ein krankes Pferd. Ihr Blick schweifte durch das Gästezimmer, das Onkel Heinrich und Tante Emily ihnen so behaglich eingerichtet hatten. Kahl wirkte es jetzt. Das Schränkchen mit der Glasfront war ausgeräumt, der Kirschholztisch im Fenstererker abgeräumt, und Julias Koffer stand bereits neben der Tür.
»Komm, stärker, gleich haben wir den Deckel zu«, sagte Julia. Die Standuhr surrte, wie sie es kurz vor dem Gongschlag immer tat. Im Flur wurden Stimmen laut.
Die Schwestern stießen sich ein Stück vom Boden ab und ließen sich im selben Moment erneut auf den Kofferdeckel fallen, in dem die Uhr die Stunde schlug und es an der Tür klopfte. Mit einem Stoßseufzer klappte Sophia die Kofferschnallen zu.
»Julia! Sophie!«, rief ihr Vater. »Mittagessen, und lasst die Tür offen, dass der Kutscher eure Koffer holen kann.«
»Wenn die Köchin und die Magd mit anfassen, bekommt er deinen vielleicht sogar die Treppe hinuntergewuchtet«, murmelte Julia, stand auf und zog Sophia auf die Beine.
Unten im Esszimmer saßen bereits alle in Abschiedsstimmung bei Tisch: Ihre sechzehnjährige Cousine Clara wirkte blass, Onkel Heinrich zupfte an den Manschetten seines Hemds herum, und Tante Emily sah mit einem Lächeln zu Sophia auf, das ihre Augen nicht erreichte. Sophias Vater und Bruder hatten gerade erst Platz genommen und nestelten noch an den Servietten.
Es roch nach Muschelsuppe. Sophia wusste nicht, ob sie auch nur einen Löffel davon hinunterbringen würde. Sie biss sich auf die Lippe und setzte sich neben Julia auf ihren Stammplatz.
»Na, habt ihr alles gepackt?«, fragte Onkel Heinrich auf Englisch. Sein Seefahrerbart, der unmodern den Kiefer und das Kinn umrahmte, senkte sich auf seine Brust, als er einen Blick in die Runde warf.
Sophia nickte und lehnte sich zur Seite, damit Grace, das schwarze Dienstmädchen, die Suppe servieren konnte. »Friedrich, sobald du telegrafierst, schicke ich euch die restlichen Sachen nach«, sagte Heinrich.
Obwohl er noch nichts gegessen hatte, tupfte Sophias Vater sich den Mund mit der Serviette ab und zog sie danach mehrmals durch seine Finger, bevor er sie beiseitelegte. Die gewichsten Enden seines Schnurrbarts zitterten. »Das wird wohl bald sein. Mir scheint das Stadthaus, von dem Dr. Hall sprach, jetzt doch geeigneter als das mit Garten zu sein. Es wäre nicht so weit, um zu den Patienten zu fahren, und es ist auch günstiger.« Er atmete hörbar ein.
Tante Emily nickte freundlich in die Runde, und die Häupter senkten sich mit leisem Löffelklirren über die Suppenteller. Durch die hohen Fenster fiel Januarlicht bleich auf die Tafel.
»Das billigste Haus zu nehmen ist nicht unbedingt zu empfehlen, wenn ich dir noch mal zu etwas raten darf«, meinte Heinrich. »Du willst in Savannah ja einen gewissen Eindruck machen. Man schaut auch hierzulande durchaus, was der Arzt hermacht. Und gerade weil du neu im Land bist und du Englisch mit starkem Akzent sprichst – das ist ein Nachteil. Wenn du dann noch ein Haus hast, in dem die ersten Kreise nicht verkehren würden, wird es schwierig, Patienten zu halten, die entsprechend bezahlen können. Hall hat sich die Praxis mühsam aufgebaut, glaub mir das.«
Konnte er denn nicht aufhören, darüber zu reden? Unruhig sah Sophia an Julia vorbei zu ihrem Vater, der mit einer langsamen, konzentrierten Bewegung seinen Löffel niederlegte. Unter seinen blauen Augen lagen Schatten. Sophia überlegte krampfhaft, wie sich das Gespräch von der Arztpraxis abwenden ließ, die ihr Vater unten in South Carolina von Dr. Hall übernehmen wollte. Wobei von Wollen eigentlich nicht die Rede sein konnte. »Falls noch ein Brief von Meta kommt …«, brachte sie auf Englisch hervor und spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Dank Tante Emily und Clara, die kaum Deutsch sprachen, hatte sich ihre Aussprache in den vergangenen zwei Monaten etwas verbessert, aber das »th« war ihr noch immer ein Gräuel. Schon daheim in Wismar hatte sie ihre englische Mamsell damit an den Rand der Verzweiflung gebracht. Sie starrte in die dicke cremefarbene Suppe.
»Dann schicke ich ihn natürlich gleich weiter«, versprach Onkel Heinrich.
»Ich muss mir das Haus ja erst ansehen, Heiner«, sagte ihr Vater tonlos. »Noch habe ich die Entscheidung nicht gefällt.«
»Wohl wahr, wohl wahr. Nur du siehst ja, wie weit man es hier mit etwas Geschick als Arzt bringen kann.« Onkel Heinrich machte eine ausladende Handbewegung, die die Tapete über der dunklen Wandvertäfelung, die stilvollen Möbel, das Haus und ganz Boston einzuschließen schien. »Du schaffst das auch. Was gewesen ist, ist gewesen. Hier fängt jeder neu an.«
Draußen waren Pferdegetrappel und das Rattern eines Wagens über Kopfsteinpflaster zu hören. War das bereits der Kutscher? Doch nein, die Geräusche wurden leiser und verklangen. Grace kehrte ins Esszimmer zurück, um die Suppenteller abzuräumen – wie ihr Vater hatte auch Sophia die kleine Portion kaum angerührt –, und trug Hähnchen, Kartoffeln und Kürbis auf.
»Thomas wird mir tüchtig zur Seite stehen«, sagte Sophias Vater mit etwas festerer Stimme und nahm sich Fleisch und Kartoffeln. »Nicht wahr, mein Sohn? Jetzt heißt es, mit anzupacken. Die Zeit für Flausen im Kopf ist vorbei.«
»Psychologie würde ich durchaus nicht als Flausen bezeichnen, Vater«, sagte Thomas. Auch er kam Sophia heute bleicher als sonst vor; mit seinen blonden Haaren und dem spärlichen Vollbart machte er in seinem weißen Hemd einen verwaschenen Eindruck.
»Psychologie ist keine Wissenschaft, sondern Papperlapapp! Mir ist das Medizinstudium damals auch lang geworden – Heiner, dir doch auch? Das geht den meisten so. Und mit ein bisschen mehr Erfahrung wird dir auch nicht mehr übel werden, wenn du Blut siehst. Mit zweiundzwanzig Jahren vertrödelt man seine Zeit nicht damit, irgendwelchen neu erfundenen Humbug zu studieren.« Wie zur Betonung quietschte sein Messer über den Teller, als er eine Kartoffel durchschnitt. »Besonders nicht auf seines Vaters Kosten.«
Sophia krallte die Hand zusammen und warf ihrer Tante über den Tisch hinweg ein schwaches Lächeln zu. Wie froh musste sie sein, dass nach dem zweimonatigen Besuch nun wieder Ruhe in ihr Haus einkehrte. »Es schmeckt ausgezeichnet, Tante Emily.«
»Danke, mein Kind. Esst nur alle kräftig, wer weiß, wie das Essen auf dem Schiff ist und wie stark der Dampfer schaukelt.«
»Sophia macht das nichts aus«, warf Julia ein. »Bei der Überfahrt von Deutschland haben alle andern in ihren Kojen gelegen, es wurde gebrochen und gebetet, nur …«
»Julia! Nicht bei Tisch!«, kam die Rüge ihres Vaters.
»Ach, Papa«, begann sie, widersprach dann aber doch nicht, sondern stopfte sich ein großes Stück Huhn in den Mund.
Sophia fing ihren Seitenblick auf. Dass Julia die auf der Hammonia grassierende Seekrankheit nicht erwähnen durfte, obwohl ihr Vater gerade von Blut geredet hatte! Mit Schaudern erinnerte sie sich an die Wintersturmwogen, graue, gewaltige Berge von Salzwasser, die Gischtperlen wie Schleppnetze hinter sich hergezogen und in deren Talsohlen der Überseedampfer immer wieder fast verschluckt worden wäre. Taumelnd wie ein Heer von Lahmen waren die Passagiere zwischen ihren Kabinen und dem Salon hin- und hergewankt. Und trotzdem war es Sophia vorgekommen, als seien alle außer ihrer Familie frohen Mutes gewesen, als herrschte ein Unterton von Abenteuerlust auf dem Schiff. Wie hatten diese Menschen es nur geschafft, alles zurückzulassen und freudig nach vorn zu sehen? Denn diejenigen, die ihre Heimat, Freunde und Verwandten, ihr gesamtes altes Leben nur widerstrebend aufgaben, musste der Verlust doch schmerzen.
Beim Auswandern verlor man alles, was einem lieb war. Sophias Blick huschte über die Gesichter am Tisch. Ihre Geschwister und ihren Vater hatte sie noch, ja. Aber sie waren nicht mehr ganz dieselben. Hatten die Emigranten an Bord, die wie ihre Familie vor der Vergangenheit flüchteten, tatsächlich eine solch rosige Zukunft vor sich gesehen, die alles überwog? Sie schob das orange leuchtende Kürbisgemüse mit der Gabel auf dem Teller herum und legte schließlich ihr Besteck nieder.
»Deine selige Mutter hätte solche Worte beim Essen auch nicht gutgeheißen«, beharrte ihr Vater. Darauf ließ sich nichts erwidern, und Schweigen senkte sich über die Tafel, das nur vom Schaben des Bestecks auf den Tellern unterbrochen wurde. Tante Emily versuchte mit ein paar Bemerkungen über das warme Klima von Savannah ein neues Gespräch anzufangen, aber die Antworten blieben einsilbig. Als das Dienstmädchen die Ankunft des Kutschers meldete und Schritte auf der Treppe polterten, wurde Sophia gegen ihren Willen leicht ums Herz.
In der Droschke war es kalt. Sophia vergrub ihre Hände im Muff, einer Leihgabe von Clara für die Reise, und studierte das bräunliche Streifenmuster der Sitzpolster. Die anderen wechselten noch Abschiedsworte, obwohl bereits alles gesagt worden war. Was nützte es, die Bemerkungen über das Wetter sowie die Wünsche für eine gute Reise zu wiederholen, wenn alle in Gedanken bereits woanders waren?
»Miss Sophie! Miss Sophie!«, durchschnitt ein Ruf das Stimmengewirr.
Sophia beugte sich vor, sah aber nur die Schultern und hutbedeckten Köpfe ihrer Verwandten. Was hatte sie bloß vergessen? Tante Emily trat einen Schritt beiseite, und dort kam Grace, den Rock ihres schlichten schwarzen Dienstkleides gerafft, mit flatternder Schürze über das Pflaster gerannt. Sie schwenkte einen Umschlag hoch in der Luft. »Miss Sophie! Post!«
Das musste von Meta sein! Aufgeregt streckte sie die Hand aus und nahm den Umschlag entgegen.
»Von deiner Busenfreundin?«, fragte Thomas.
»Ja.« Sophia strich mit dem Finger über die vertrauten Schriftzüge und steckte den Brief in die Tasche ihres Mantels, um ihn später auf dem Schiff in Ruhe zu lesen. Wenigstens etwas Gutes an diesem Tag! Bei der Vorstellung, sich nachher in Gedanken zu Meta flüchten zu können, wurde ihr etwas wohler.
Tante Emily lächelte ihr zu und legte ihren Arm um die fröstelnde Clara. »Telegrafiert uns kurz, wenn ihr in Savannah angekommen seid, ja?«
»Wenn sie nicht endlich losfahren, können sie sich das sparen, weil der Dampfer weg ist«, meinte Onkel Heinrich. »Also dann, eine gute Reise! Schön war’s, euch nach all den Jahren wiederzusehen. Gute Fahrt, kommt gesund an!«
Sophia stimmte in das »Auf Wiedersehen« ihrer Geschwister und des Vaters ein, Onkel Heinrich klappte die Droschkentür zu, und die schweren Rappen zogen an. Sophia winkte aus dem Fenster, bis die Straße einen Bogen schlug und die dicht ans Pflaster gedrängten braunen Sandsteinhäuser ihr die Sicht nach hinten versperrten. Kutschen ratterten in der Gegenrichtung an ihnen vorbei, vor den Hauseingängen fegten Dienstmädchen den Unrat in den Rinnstein, und dick vermummte Herren eilten die Gehwege entlang. Über den Dächern hing eine Dunstglocke aus Schornsteinrauch. Die Häuser, die sich im Stadtzentrum enger und enger aneinanderdrückten, verwischten vor Sophias Blick.
Was sollten sie nur sagen, wenn jemand auf dem Schiff, oder auch später in Savannah, nach dem Grund für ihre Auswanderung fragen würde? Sie konnten doch den Menschen nicht einfach Theater vorspielen, nur weil sie hier niemand kannte. Sie grub ihre Fingernägel in die Handflächen.
Als sie sich dem Hafen näherten, verlangsamten die Pferde ihren Schritt. Gespanne, die schwer beladene Wagen zogen, schnauften mit zitternden Flanken an ihrer Droschke vorbei. Sophia drückte ihre Nase in den Schal, um sich vor dem Geruch von Schlick und Teer, der, mit dem fauligen Abwassergestank der Stadt vermischt, durch die Türritzen drang, zu schützen. Dann lag der Nicholson Kai vor ihnen: Ein Wald von Masten und Schornsteinen stach in den Winterhimmel, Rufe gellten durch die Luft, und Sophia beobachtete, wie zwei Männer mit voll beladenen Schubkarren durch die Menschenmenge rannten.
»Das ist die City of Columbus«, rief Thomas und zeigte auf einen langen Dampfer. Schritt für Schritt schoben sich Passagiere über einen langen Steg an Bord. Der massive Schornstein spie bereits schwarzen Rauch in die Luft.
»Tja, da sind wir«, sagte Friedrich Böhm mit der verzerrten Grimasse, die er seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren statt eines Lächelns zeigte. Sophia konnte diesen Anblick nicht ertragen. Sie wandte sich ab und tastete nach Metas Brief in ihrer Tasche, rieb das Papier zwischen ihren Fingern wie einen Glücksbringer. Immerhin hatte sie ihre unordentlichen Haare als Entschuldigung, um sofort in der Kabine verschwinden zu können. Der Kutscher öffnete die Tür, und kalter Wind, Fischgeruch und Stimmengewirr schlugen ihnen wie eine Wand entgegen.
2
Der Dampfer war trotz der zwei kahlen Segelmasten, die wie Relikte noch nicht ganz vergangener Zeiten vor und hinter dem Schornstein aufragten, hochmodern. Sophia fühlte sich von der Einrichtung der beiden Erste-Klasse-Kabinen, die ihr Vater auf das Drängen seines Bruders hin gebucht hatte, fast eingeschüchtert. Dunkelrote Teppiche zierten den Boden, in den Ecken standen echte Palmen, auf den Betten glänzten Seidendecken, und es war angenehm warm.
»Hier, seht nur, elektrisches Licht!« Thomas knipste die Tischlampe an. Obwohl durch die Bullaugen fahler Sonnenschein in die Kabine fiel, wirkte das künstliche Licht grell. »Vater und ich sind direkt nebenan. Habt ihr alles?«
Sophia warf ihren Muff auf das Bett, neben dem ihr Koffer stand, und machte die Lampe wieder aus. Das Schiff zitterte unter ihren Füßen, als sei es begierig, auszulaufen. Ein lautes Tuten ertönte, das ihr in Mark und Bein widerzuhallen schien, und das Stampfen der Maschinen wurde stärker. Auf der anderen Seite des Bullauges schoben sich vertäute Schiffe ins Blickfeld, während die auf dem Kai winkenden Menschen kleiner wurden. Sophia atmete tief durch und rieb sich die Arme. Sie waren unterwegs. »Ja, das Gepäck ist hier.«
»Dann bis nachher, Vater meint, wir sollten erst in Ruhe auspacken«, sagte er.
»Der Brief!«, zischte Julia, kaum dass Thomas aus der Tür war. Sie ließ sich auf die grau gestreifte Chaiselongue fallen und klopfte mit der Hand aufs Polster, damit Sophia sich neben sie setzte. »Komm, was schreibt sie?«
Sophia musste lachen. Metas Schilderungen der Académie Colarossi übten eine unwiderstehliche Faszination auf Julia aus, auch wenn sie sich hauptsächlich für das skandalös anmutende Leben in Paris und weniger für Metas Kunststudium interessierte.
Sophia setzte sich zu ihrer Schwester und knüpfte sich die Schuhbänder auf. »Gleich. Ich habe eiskalte Füße.« Mit den Händen hob sie ihr gelähmtes Bein in eine komfortable Position, öffnete den Umschlag und begann vorzulesen.
»Allerliebste Sophie, GIB DIESEN BRIEF WEDER DEINEM BRUDER NOCH DEINEM VATER ZU LESEN!«
Sophia wechselte einen Blick mit Julia und überflog die nächsten Worte: »… vielleicht finden diese Zeilen Dich bereits im schwülen Grün von Savannah … inmitten prunkvoller weißer Häuser … verschiedenartiger Menschen mit den wunderbarsten satten Hautfarben … Exotischer Motive … Versprich, mir Miniaturen zu malen …«
Sophia merkte, wie ihre Stimme unwillkürlich immer leiser wurde. Was nützten ihr exotische Motive? Mehr als eine ungelenk malende alte Jungfer würde aus ihr nun nicht mehr werden.
»Komm, lies weiter. War sie wieder in diesem Kabarett? Dem Chat au noir?«, drängte Julia.
»Le chat noir? Hm, nein …« Sophia überflog still die Zeilen, die sich hauptsächlich mit Metas Schwierigkeiten beschäftigten, auf Wasser reflektierendes Sonnenlicht mit Farben wiederzugeben, bis ihr Blick an einem Satz hängen blieb. Unwillkürlich zog sie die Augenbrauen hoch.
… Auf ganz andere Weise frustrierend – Du darfst dies Deinem Vater und Bruder um Gottes willen nicht vorlesen! – war das Aktzeichnen diese Woche. Sophie, wir hatten zum ersten Mal einen Mann Modell sitzen!
»Sie hat einen nackten Mann gezeichnet«, informierte Sophia ihre Schwester, die sich prompt die Hand vor den Mund schlug.
»Nein!«, brachte Julia mit großen Augen hervor und rückte näher heran. Ihr Gesicht war gerötet, vielleicht nicht nur durch die Wärme der Kabine.
»Doch«, sagte Sophia, holte tief Luft und las laut weiter: »Es war zuerst so unangenehm, ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen sollte. Besonders da wir mit einer stehenden Pose anfingen. Ich habe mich sehr auf den Kopf und Oberkörper und dann die Füße konzentriert, aber Thompson – er leitet das Aktzeichnen – stand auf einmal hinter mir und fragte, warum ich den Mittelteil des Körpers nur leicht angedeutet habe. Er sagte, ich solle so tun, als sei das Modell – Jules übrigens, das machte es noch peinlicher; er malt ja auch mit uns – eine Statue. Der hatte gut reden, denn an einer Statue bewegt sich nichts! Sophie, ich kann es nicht über mich bringen, es Dir wirklich zu beschreiben, aber ein Teil von Jules’ Anatomie blieb nicht ganz still. Ich hätte im Boden versinken können!« Sophia unterdrückte ein Lachen, während Julia zu kichern begann. Sie hatten mehr in den Fachbüchern ihres Vaters gelesen, als sich geziemte, und Sophia konnte sich auch ohne eine Detailschilderung vorstellen, was sich da genau bewegt hatte. Ihre Stimme schwankte, als sie weiterlas: »Ich muss förmlich geleuchtet haben, mein Gesicht wurde so heiß. Und alle andern schienen davon ganz unberührt zu bleiben. Thompson verlor schließlich die Geduld, nahm mir die Kohle aus der Hand und skizzierte den Rest selbst auf meinem Blatt. Insgesamt kann ich Dir sagen, dass ich Frauen aus vielen Gründen leichter zu zeichnen finde: Der weibliche Körper hat mehr Kurven, interessantere Linien aufzuweisen, und vor allem verändert sich an der einmal eingenommenen Pose nichts mehr.«
Julias Kichern war inzwischen zu Gelächter angeschwollen, und beim letzten Satz ließ sie sich hilflos vor Lachen nach hinten auf die Chaiselongue zurückfallen und wedelte sich mit beiden Händen Luft zu. »Ich kann nicht mehr!«, krächzte sie und wischte sich Tränen vom Gesicht. »Es verändert sich nichts mehr! O Gott, Meta ist zu köstlich!«
Sophia ließ den Brief sinken und spürte, wie sich ihre Mundwinkel langsam wieder senkten. Vielleicht wäre sie für die Académie Colarossi sowieso ungeeignet gewesen. Die Vorstellung, mit einer Staffelei vor einem splitternackten Mann zu sitzen … Kein Wunder, dass nur eine kleine Handvoll von Kunstakademien Frauen zuließ, wenn man sich dort solchen Situationen ausgesetzt sah! Aber ebendeshalb gab es kaum bekannte weibliche Malerinnen – als Frau sollte man nicht das wahre Leben malen, sondern nur eine dem Anstand entsprechende, dekorative Version davon. Und anständig-dekorativ wollte sie nicht malen. Sie würde überhaupt nicht mehr malen. Ihre Kehle war wie zugeschnürt.
»Was schreibt sie noch?«, fragte Julia mit schwacher Stimme, wischte sich die Augen und setzte sich wieder auf. Wortlos reichte Sophia ihr den Brief und schaute auf ihren Koffer, der unter dem Bullauge an der vertäfelten Wand stand. Auf den Koffer voller Malutensilien, die kein Weg mehr in die Freiheit waren. Dank ihres Vaters würde sie nun niemals lernen, wahre Kunst zu schaffen und trotz ihres gelähmten Beins ein eigenständiges Leben zu führen. Mühsam kämpfte sie die aufkeimende Wut nieder. Es war ungerecht und unwürdig, ihm die Schuld zu geben.
Noch vor dem Abendessen wollte sie den Schlussstrich unter ihr altes Leben ziehen.
Die Küste von Massachusetts war im Dunkeln verschwunden, und im Salon sammelte man sich in Erwartung des Abendessens: Eine vornehme Affäre von vier Gängen, so hatte Sophias Vater gesagt. Der Lichtstrahl eines Leuchtturms erfasste eine auf dem Wasser tanzende Boje, erlosch, blitzte wieder auf. Hinter der Boje duckte sich eine Insel schemenhaft in den Atlantik.
Sophia klammerte sich an die Reling der City of Columbus und starrte in die Dunkelheit, wie betäubt von den schwarzen Wellen, dem Leuchtfeuer irgendwo im Osten und dem Stampfen des Dampfers. Sie sah auf das an der Schiffswand entlangstrudelnde Wasser hinunter. Schwarz war es, undurchdringlich. Wie die Laune ihres Vaters. Trotz des Auswanderns wurde es nicht besser mit ihm, eher im Gegenteil. Wären sie doch in Wismar geblieben oder wenigstens irgendwo im Deutschen Reich! In irgendeinem Herzogtum, wo man nie von Dr. Böhm gehört hatte.
Eine große Welle spülte am Dampfer vorbei. Sophia beugte sich vor, bis die Reling ihr kalt gegen die Brust drückte. Wie es wohl wäre, ins Wasser zu springen? Aufzuschlagen. Wenn einem die Luft aus den Lungen gedrückt würde wie damals, als sie mit Julia und Thomas in den Apfelbaum geklettert und vom Ast gefallen war. Damals, vor der Kinderlähmung. Aber das Meer würde einen nicht mehr loslassen, sondern hinunter in die Tiefe ziehen, bis man selbst ein Teil davon war, schwerelos hochtrieb und nichts mehr spürte … Ihr Herz hämmerte so stark, dass es das Dröhnen der Schiffsmaschinen ertränkte. Hatten sich im Kopf ihres Vaters auch solche Gedanken abgespielt, als er auf der Überfahrt nach New York mit versteinerter Miene aufs Meer hinausgeschaut hatte?
Der Wind heulte in der Abspannung der Segelmasten auf, riss den Qualm aus dem Schornstein und drückte ihn beißend rußig zu ihr herunter. Sie zuckte zusammen und presste ihr Gesicht in die Schulter, hustete. Blinzelnd warf sie einen Blick in die grelle elektrische Beleuchtung hinter sich. Das Deck war immer noch leer. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen, der Stoff ihres grauen Handschuhs rau und feucht von der Gischt wie ein Waschlappen.
Mit der Hüfte zur Balance gegen den Seegang an die Balustrade gedrückt, nahm Sophia ihr Skizzenbuch aus der Rocktasche. Das Licht reichte aus, ihr die Zeichnungen und Miniaturaquarelle undeutlich zu zeigen, die der Wind durchblätterte, aber sie wollte keinen Blick mehr darauf werfen – Stillleben, Impressionen von der Ostseeküste, Porträts von Julia, Meta und Thomas. Sie hielt das Büchlein über die Reling, spürte, wie es in ihrer Hand flatterte, und ließ es los. Vom Windstoß erfasst, wirbelte es auf, schwebte empor wie ein Vogel, stürzte dann kreiselnd aufs Wasser zu, stieß gegen die weiße Schiffswand unter ihr und wurde im nächsten Moment von einer Welle in die Tiefe gerissen. Das Leuchtfeuer im Osten blitzte auf und erlosch.
Sophia starrte ins Meer hinunter, bekam auf einmal kaum noch Luft. Ihre Finger krampften sich um die Reling. Ihr Mund arbeitete, ohne einen Ton hervorzubringen. Mühsam wandte sie den Blick vom Wasser ab, drehte sich um, bis sie mit dem Rücken an der Balustrade lehnte und keuchend in die blendende Deckbeleuchtung starrte. So. Das Schlimmste war vollbracht. Die Farben und das Papier konnten an den nächsten Abenden folgen. Sie würde nicht als verhinderte Künstlerin an Land gehen. Sie würde ihr Leben neu beginnen.
3
Thomas’ Blick glitt über die Wandvertäfelungen und das Walnuss- und Rosenholzmobiliar des Salons zur Tür. Wo blieb nur Sophia? Oder war sie bereits hier? Er reckte den Hals. Der 30 Meter lange Salon – wie die Kabinen erster Klasse nahe der Schiffsmitte gelegen – war voller Menschen. Auf den mit dunkelrotem Plüsch bezogenen Sesseln und Sofas saßen grüppchenweise andere Passagiere, vornehmlich dunkel gekleidete Herren. Hie und da stand ein einsamer Mann vor den Stichen, Gemälden und Seekarten, die die Wände zierten, und glich mit den Hüften das kräftige Schaukeln des Dampfers aus. Eine Frau in schlichtem dunkelgrünem Kleid saß mit zwei Kleinkindern neben einem hoch aufgeschossenen Mann auf einem Sofa; außer Julia die einzige Frau im Salon. Das Stimmengewirr überdeckte fast das regelmäßige Stampfen der Schiffsmotoren.
Nein, von seiner Schwester keine Spur. Thomas fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Hoffentlich hatte Metas Brief Sophia nicht erneut in Verzweiflung gestürzt.
Er warf seinem Vater, der neben ihm an einem der Fenster stand, einen finsteren Blick zu. Diese Auswanderung nach Savannah war doch das reinste Narrentum! Und wenn in Savannah wieder etwas passieren würde – wo würde er sie dann alle hinbeordern? Es war unverantwortlich, dass sein Vater weiterhin als Arzt praktizierte. Thomas’ Magen zog sich zusammen.
Die beiden Brüder, die vor ihnen an Bord gegangen waren und in Florida nach Arbeit suchen wollten, obwohl sie nicht älter als siebzehn und elf aussahen, marschierten an Thomas vorbei auf das Klavier zu. Eltern hatten die zwei anscheinend nicht mehr. Unter den Seitenblicken der Erste-Klasse-Passagiere fuhren sie mit ihren Händen über das in der Ecke stehende Instrument, zeigten einander irgendetwas auf einer der Seekarten an der hinteren Wand und schlenderten dann zu der Tür, die aufs Deck hinausging.
Eine windumwehte Gestalt in blauem Kleid trat ein, den kleinen Hut mit einer Hand auf die roten Haare gedrückt.
»Sophia!«, rief Thomas und winkte, bis sie seinen Blick auffing und zu ihnen herüberkam. Wie immer bemühte sie sich, ihr Humpeln durch einen betont langsamen Gang zu kaschieren. Ihr Gesicht war kreidebleich.
»Eine frische Brise, nicht wahr, Sir?«
Thomas zuckte zusammen. Doch der alte Herr, der sich auf zwei Stöcke stützte, sprach mit seinem Vater. »Da könnten sie fast die Maschinen runterfahren und die Segel hissen. Kohle sparen.«
»Das stimmt.« Thomas’ Vater nickte ihm zu und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, als wollte er damit eine nähere Bekanntschaft vermeiden.
»Wobei ich durchaus für einen ordentlichen Kohleverbrauch bin«, vertraute der Alte ihm mit seitlich geneigtem Kopf an. Seine Hängebacken wurden durch den eisengrauen Bart betont, der sich an den Seiten seines Gesichts bauschte. »Ich war im Kohlehandel, wissen Sie. Aber nun werde ich mich in Florida zur Ruhe setzen. Batchelder ist mein Name, übrigens.« Er nahm den einen Stock in die linke Hand und reichte Thomas’ Vater die rechte.
»Dr. Böhm. Sehr angenehm«, sagte er. Thomas konnte auf dem blassen Gesicht ihres Vaters jedoch keinerlei Interesse oder Freude über die neue Bekanntschaft entdecken.
»Mein Sohn Thomas und – ach, hier kommt sie endlich! Meine Tochter Sophia und ihre Schwester Julia.«
»Zwillinge! Nein, das ist ja … Darf ich Ihren reizenden Töchtern meine Bewunderung aussprechen?«
Nachdem Thomas ihn begrüßt hatte, beugte der alte Batchelder sich über die ausgestreckten Hände der Zwillinge, hauchte mit bebendem Bart einen Kuss in die Luft darüber und wandte sich wieder Dr. Böhm zu. »Ich höre Ihrer Aussprache an, dass Sie aus Europa kommen, Sir.«
»Aus Wismar im Deutschen Reich. An der Ostseeküste. Wir haben alle noch einmal Englischunterricht genommen.«
»Ah! Ganz frisch eingewandert?«
Thomas’ Vater begann unruhig mit den Füßen zu scharren und sah sich im Salon um, als suchte er jemanden. »Nun ja, relativ. Wir sind im November nach Amerika gekommen. Wir wollen uns in Savannah niederlassen.« Er zog die Uhr aus der Westentasche, wohl in der Hoffnung, dass sie vor dem redseligen Alten in den Speisesaal entkommen konnten.
Thomas presste die Lippen zusammen. Wie konnte ihr Vater nur so abweisend sein? Er wechselte einen Blick mit Sophia, die sich zu Julia aufs Sofa gesetzt hatte. Wieder fiel ihm auf, wie bleich sie war. Aber vielleicht lag es am Seegang.
»Savannah! Auch ein schönes Städtchen. Seit dem Kriegsende geht es dort tüchtig voran, kann ich Ihnen verraten. Kein schlechter Absatzmarkt für Kohle, wenn auch nicht mit der Wirtschaft der Nordstaaten zu vergleichen.«
»Nun ja, ich bin Arzt, da betrifft mich die Wirtschaftslage nur indirekt.«
»Arzt! So. Ja, als Arzt wird man wohl immer gebraucht. Sie sehen in Amerika für sich und Ihre Kinder bessere Möglichkeiten als daheim, was? Amerika ist das Land der Zukunft. Davon bin ich überzeugt, Sir.«
»Nun, wir hoffen doch alle, dass die Zukunft bessere Möglichkeiten mit sich bringt.« Thomas fiel auf, wie dünn die Stimme seines Vaters klang. Ausgelaugt. Sein Vater räusperte sich. »Und wenn ich mir meinen Bruder ansehe, der vor fünfzehn Jahren als Schiffsarzt nach Boston kam und inzwischen eine sehr rentable Praxis hat … ja, das lässt mich hoffen. Aber wenn Sie uns nun entschuldigen wollen – das Abendessen …« Seine Stimme verlor sich. Er reichte Sophia die Hand zum Aufstehen.
»Selbstverständlich, sehr angenehm, Sir! Wir sind ja noch gut drei Tage unterwegs, da können wir uns sicher noch ein andermal etwas unterhalten. Meine Damen! Sehr angenehm!« Mit dieser Aufwartung wandte er sich ab.
Eins der beiden Kleinkinder lief wankend auf Thomas zu. Die Entschuldigungen murmelnde Mutter fing es wieder ein, woraufhin es sich prompt die halbe Hand in den Mund steckte und zu Thomas hochlachte. Ein Kindermädchen war nirgendwo zu sehen.
Das war kein guter Anfang, fuhr es Thomas durch den Kopf. Er legte seinem Vater, der bereits mit den Zwillingen in Richtung des Speisesaals aufgebrochen war, von hinten eine Hand auf die Schulter. Er spürte das leichte Zucken unter seinen Fingern.
»Vater!« Thomas’ Herz schlug ihm bis zum Halse, aber er konnte es nicht länger ertragen. »Was sollen wir denn sagen, wenn jemand nach deiner Praxis in Wismar fragt?«, stieß er heiser hervor.
Sein Vater wurde so blass wie Sophia und sah ihn fassungslos an.
»Irgendwann werden wir doch Bekanntschaften knüpfen und Freunde finden«, sprach Thomas weiter. »Was sollen wir sagen?«
»Hast du eben nicht zugehört?«, fragte sein Vater barsch. »Wir sind hergekommen, um eine bessere Zukunft zu haben.«
»Ja, aber … wenn er weiter gefragt hätte? Wenn uns jemand wirklich kennenlernen möchte?« Sie konnten doch nicht ständig vor den Menschen davonlaufen.
Ihr Vater setzte sich wieder in Bewegung. Thomas fing einen vorwurfsvollen Blick von Sophia auf, die leicht den Kopf schüttelte. Sein Puls raste noch immer, als er neben seinem Vater und den Zwillingen herlief.
»Ich muss mich nur erst etablieren können. Einen guten Ruf und Vertrauen aufbauen. Deshalb baue ich darauf, dass ihr fürs Erste derartigen Fragen auszuweichen wisst. So, das müsste die richtige Tür sein. Ich kann das Essen schon riechen.«
Mit hängenden Schultern stieß Thomas den Atem aus.
Ein Scheppern riss Thomas aus dem Schlaf. Er setzte sich im Bett auf. Wie lange er gelegen hatte, wusste er nicht, aber das Mondlicht zeigte ihm, dass sein Vater im gegenüberliegenden Bett fest schlief. Die hinter den Ohren festgehakte Bartbinde leuchtete fahl im Dunkeln, und über dem Dröhnen der Motoren konnte Thomas ein leises Schnarchen hören. Der Sturm musste schlimmer geworden sein, denn das Schiff schwankte von Seite zu Seite, und die Topfpalme in der Ecke war umgefallen. Irgendwo trappelten Schritte. Es würde wohl doch eine ebenso wilde Fahrt wie mit der Hammonia werden.
Mit einem Seufzer sank Thomas zurück auf sein Kopfkissen. Plötzlich riss ihn ein harter Ruck fast aus der Koje. Die City of Columbus erzitterte, die aufgeklappten Deckel der Koffer fielen zu, und die Palme rollte im zerbrochenen Topf quer durch die Kabine.
»Was zum Teufel?« Thomas griff nach der Bettkante. Sein Herz hämmerte gegen seine Rippen.
Sein Vater setzte sich ebenfalls auf und starrte zu ihm herüber. »Thomas? Was ist?«
»Hast du das nicht gespürt?« Die Maschinen stampften anders, schien ihm. Er horchte angestrengt. Schaukelte es jetzt weniger? Auf einmal fuhr das Schiff rückwärts oder gar nicht mehr? Dann verstummten die Maschinen. Thomas’ Mund war wie ausgetrocknet. Gedankenfetzen wirbelten durch seinen Kopf, ohne dass er einen einzigen zu fassen bekam. Türen knallten, Stimmen und noch mehr Schritte wurden laut. Im Halbdunkel sah er, wie sein Vater nach der Nachttischlampe tastete, aber sie schien sich nicht anschalten zu lassen. »Steh auf, wir sehen besser nach den Mädchen.«
»Meinst du, es ist etwas passiert?« Thomas schlug die Bettdecke zurück und setzte die Füße auf den Boden. Er konnte noch die hellgrauen Streifen seines dunklen Pyjamas erkennen. Dann plötzlich sackte das Schiff zur Seite. Er schrie auf, stützte sich mit der Hand im Bett ab, um nicht umzukippen. Draußen wurden Rufe laut.
Sein Vater stand schon, hatte sich die Bartbinde vom Gesicht gerissen und zog sich mit fahrigen Händen an. Seine grau melierten Haare standen links am Kopf zu Berge.
Thomas starrte ihn an, suchte in seinem Blick nach etwas, an dem er sich festhalten konnte. »Komm, schnell!«, rief sein Vater. »Zieh dir alle warmen Sachen an – und nimm Hosen, Gehröcke, Schals, alles Warme für die Mädchen mit!«
»Hosen?« Thomas wühlte in seinem Koffer, konnte keinen klaren Gedanken fassen, zog sich das Erstbeste an, das ihm unter die Finger kam.
»Falls wir … ins Wasser müssen.«
»Du meinst, wir sinken?« Ein hoher Piepton summte in Thomas’ Ohren. Er begann zu schwitzen.
»Ich hoffe nicht, aber wenn …« Sein Vater warf Kleidung aufs Bett und lief zu ihm herüber, suchte Hemden und Hosen aus Thomas’ Koffer heraus. »Hier, nimm die für deine Schwestern!«
Das Schiff erzitterte, schwankte jetzt wieder stärker. Im Gang schlugen erneut Türen.
Thomas schnürte sich mit bebenden Händen die Schuhe zu. Sein Vater war schon zur Tür hinaus.
»Sophie! Julia! Wacht auf!«, hörte er ihn im Gang mit unnatürlich hoher Stimme rufen.
Thomas warf sich die warmen Kleidungsstücke über den Arm und rannte ihm hinterher. Der Boden neigte sich in schrägem Winkel. Gedankenfetzen fuhren ihm durch den Kopf, die sich zu nichts Vollständigem zusammenreihen ließen.
Die Tür zur Kabine seiner Schwestern wurde von Julia im Nachthemd aufgerissen. »Papa, was ist …«
Das Schiff neigte sich zur Seite, und Thomas stolperte hinter seinem Vater in die Kabine. Sophia, die noch im Bett saß, schrie auf.
»Schnell, nehmt eure wärmsten Sachen! Irgendwas ist passiert! Beeilt euch! Sophie!« Mit drei Schritten war sein Vater an ihrem Bett. »Thomas, du hilfst Julia«, rief er ihm zu. Draußen gellten Pfiffe und Rufe, und irgendwo begannen schrille Glocken zu läuten.
»Keine Röcke! Julia, hörst du? Thomas, gib ihr eine Hose! Hier, Sophie, du auch – es geht nicht um Anstand. Zieh die Hose über. Schnell.«
Thomas sah, wie Sophia ihr gelähmtes Bein hineinzwang, dann das andere. Ihr Vater redete weiter, irgendetwas von Rettungsbooten, schwimmen und Auftrieb, aber Thomas’ Verstand kapitulierte. Wie aus weiter Entfernung hörte er seine Zähne klappern und Sophia und seinen Vater miteinander sprechen, Laute, die sich in seinem Kopf nicht zu Worten zusammenfügen wollten.
Julia warf sich seinen Chesterfield über ihren wattierten lila Morgenrock und zog eine seiner Filzhosen an.
»Sinken wir?«, brachte sie heraus; ein Flüstern nur, mehr nicht. Durch die offene Tür sah Thomas Menschen durch den dunklen Gang rennen. Sein Vater kniete sich vor Sophia hin und schnürte ihr hastig den rechten Schuh zu, während sie die Schuhbänder am linken stramm zog.
»Ich weiß nicht«, wisperte Thomas.
»Ich habe Angst«, sagte Julia. Ihre blauen Augen waren weit aufgerissen.
Thomas’ Vater zog Sophia auf die Beine, hakte sie unter und drückte ihr ihren Stock in die andere Hand. »Los jetzt! Wir bleiben zusammen, Thomas, hörst du? Du lässt Julia nicht von deiner Seite. Wir dürfen uns nicht verlieren!«
Thomas nahm Julia bei der klammen Hand und lief dem Vater und Sophia über den schwankenden Boden hinterher zur Tür.
Ein Besatzungsmitglied drängte sich durch die Menschenmenge. »Alle nach achtern an Deck! Alle Mann nach achtern an Deck! Befehl des Kapitäns!«
»Wo ist achtern?«, schrie die Frau, die Thomas mit ihren kleinen Kindern im Salon gesehen hatte. Sie war im Nachthemd und hatte nur einen Schuh an. Die beiden Kinder klammerten sich an ihre Hände und weinten.
»Hinten! Alle Mann nach hinten an Deck!«, warf der Mann über seine Schulter zurück und verschwand rufend im Gedränge. Das Schiff ruckte und senkte sich plötzlich noch stärker zur Seite. Thomas taumelte und sah, wie Sophia gegen die Wand fiel. Schreie hallten durch die Menge, und dann begannen alle zu rennen. Irgendwer rempelte Thomas an, und er zerrte Julia näher zu sich heran, hörte sie keuchen, lief mit ihr über den Plüschteppich des Gangs, auf dem verstreute Kleidungsstücke, umgestoßene Topfpflanzen und von der Wand gerissene Bilder lagen. Thomas spürte einen Schwall kalte, feuchte Luft auf sich zukommen und roch Ruß und Öl. Sein Kopf war wie leer, alle Sinne auf die aufs Deck führende Tür konzentriert, vor der sich die Menschen stauten. Ein Greis, der sich auf zwei Stöcke stützte, schlurfte vor ihnen her und zwang sie, ihre Schritte zu verlangsamen – der Kohlehändler Mr Batchelder.
Thomas sah, wie sein Vater Sophia an dem Alten vorbeizerrte. Er zögerte, hin- und hergerissen, ihm zu helfen. Sie konnten ihn doch nicht einfach seinem Schicksal überlassen? Julia drängte nach vorn.
Sein Vater drehte sich zu Thomas um »Komm! Wir müssen an Deck!«
Thomas fielen die beiden kleinen Kinder ein. Wo war deren Vater gewesen? »Komm!«, rief auch Julia und riss an seiner Hand. Ihre Stimme überschlug sich.
»Los, zur Tür!«, schrie sein Vater.
Zur Tür! Thomas setzte sich wieder in Bewegung, rannte mit Julia an Mr Batchelder vorbei, taumelte, fing sich, bis sie das Gedränge vor der Tür nach draußen erreichten. Er schnappte nach Luft, hörte jetzt das Pfeifen des Windes und das nasse Klatschen von Wellen über den Rufen. Menschen drückten sich gegen seinen Rücken, schoben, bis er an den dicken Mann vor sich gepresst wurde, doch es ging nur noch schrittweise voran. Wo waren sein Vater und Sophia? Ein Kleinkind, stumm und mit riesengroßen Augen, wurde über die Köpfe nach vorne zur Tür gereicht. Der Schrei einer Frau durchschnitt die Rufe und das Weinen: »Lasst mich raus!«, rief sie durch eine verkantete Tür. »Um Gottes willen, lasst mich raus!« Von irgendwo kam der Geruch von Urin.
Zentimeter für Zentimeter wurden sie auf die Tür zugeschoben, und als sie endlich hindurch waren, wehrte sich etwas in Thomas mit solcher Vehemenz gegen den Untergang, dass er seinen Lebenswillen fast greifbar in sich spürte, etwas, das wie ein gefangenes Tier um sich schlug. Schreiend boxte er sich mit Julia durch die Menge auf das nasse Deck hinaus.
4
Das Schiff lag mit starker Schlagseite schief im Wasser. Friedrich Böhm sah das Mondlicht auf den aufgepeitschten Wellen zucken, die sich an der City of Columbus brachen. Das Brüllen des Sturms ertränkte die Hilferufe der auf dem Achterdeck zusammengedrängten Passagiere. Fünf oder sechs Besatzungsmitglieder hieben mit Messern auf die Vertäuung der Rettungsboote ein, als der Dampfer sich mit einem grauenhaften Krachen tiefer ins Meer senkte. Friedrich zerrte Sophia näher an sich heran und packte Thomas am Arm, der endlich mit Julia wieder neben ihnen aufgetaucht war.
»Zum Geländer!«, schrie Friedrich ihm über den Lärm hinweg zu. Sie kämpften sich zwischen den Menschen zum Geländer an der Außenwand des großen Salons durch. Das Schiff schwankte unter dem Druck der Wellen, geriet in eine immer prekärere Schieflage. »Festhalten!«, brüllte Friedrich und stellte sich schützend hinter Sophia, die irgendwo ihren Stock verloren hatte. Rettungsringe – sie hatten keine Rettungsringe! Verzweifelt suchte er mit den Augen das Deck ab und entdeckte an der Reling den wild gestikulierenden Kapitän. Er gab vermutlich Anweisungen, denn Friedrich sah, wie sein Mund sich bewegte. Doch die Worte wurden vom Wind auf die brüllende See hinausgerissen.
Plötzlich sackte das Achterdeck tiefer ins Wasser ab. Eine Welle brach sich über dem Schiff, riss Menschen um, die wie Gliederpuppen über das nasse Deck rollten und gegen die schon halb im Wasser versunkene Backbordreling geschleudert wurden. Sophia schrie auf und streckte an Friedrich vorbei die Hand aus, als zwei kleine Kinder an ihnen vorbeirutschten.
Für einen Sekundenbruchteil lockerte Friedrich seine Finger am Geländer, wollte den Kleinen helfen, aber es war schon zu spät. Die hellen Kleidchen trieben kurz im Wasser und waren im nächsten Moment verschwunden. Fast gewaltsam drehte Friedrich Sophias Kopf in die andere Richtung, zur Außenwand des Salons, damit sie diese Schreckensbilder nicht mehr sah.
Sie konnten hier nicht bleiben! Aber das Geländer loszulassen wäre Selbstmord. Sich selbst könnte er das noch verzeihen – endlich zu kämpfen aufzuhören, dieses gottverdammte Leben los zu sein, diese ganze Sinnlosigkeit des Auswanderns oder Davonlaufens, wie man es auch nennen wollte … Mit nassem Gesicht starrte Friedrich in die aufgewühlte See. Aber seine Kinder …
Sie mussten zu den Rettungsbooten! Er sah auf das glitschige, schiefe Deck, an dessen unterem Ende das Meer leckte, und die Angst packte ihn an der Kehle. Seine Finger lösten und schlossen sich um das Geländer, ohne dass er den Mut fand, loszulassen.
Mit brennenden Augen sah Friedrich eine Welle heranbranden, das zu Wasser gelassene Rettungsboot erfassen und umwerfen. Gleichgültig spie es die Menschen darin ins Meer. Gesichter und Hände flackerten in den Wogen auf und waren im nächsten Moment verschwunden.
Und dann existierte nur noch Wasser. Friedrich wurde von den Beinen gerissen, seine Finger vom Geländer gezerrt. Er griff nach Sophia, verfehlte sie, fiel zu Boden, suchte auf dem abschüssigen Deck nach Halt und bekam nur glitschiges Holz unter die Finger. Seine Lungen rangen nach Luft. Salz brannte in seinen Augen, und immer noch spülte der Wasserberg über ihn hinweg. Er prallte gegen etwas Hartes, griff fieberhaft danach und bekam die Reling zu fassen. Die Welle sog an ihm, wollte ihn ins Meer ziehen.
»Sophia! Sophia!«, schrie er, als der Druck nachließ und der Wind ihm schmerzhaft die Lungen füllte. Aber es kam nur ein Flüstern heraus. Wild tastete er um sich, blinzelte gegen das Meerwasser in seinen Augen an. Dort, ganz verschwommen: etwas Helles auf der anderen Seite der Reling in den Wellen. Er streckte den rechten Arm aus, klammerte sich mit der anderen Hand fest. Bekam etwas Nasses, Kaltes zu fassen; zog. Doch das Meer zog von der anderen Seite.
»Sophia!« Er schaffte es nicht.
Plötzlich war jemand bei ihm: einer der beiden Brüder, die nach Florida gewollt hatten. Gemeinsam streckten sie ihre Hände aus und bekamen das nasse Bündel nun zu fassen, zogen es näher ans Schiff heran, und dann endlich lag Sophia wie leblos mit offenen Augen neben ihm. Friedrich tastete nach ihrem Hals und sah, dass ihre Brust sich hob und senkte.
Er hob Sophia auf die Beine, legte sich einen ihrer Arme um die Schulter, der junge Amerikaner nahm den andern. Erneut brach eine Welle über Deck, jedoch mit weniger Wucht, und Friedrich bekam Thomas’ Hand zu packen, bevor das Wasser sie umspülte. Zwei Sekunden später hatten sie das Geländer am Salon erreicht.
Keuchend drückte Friedrich seine Tochter an sich und starrte mit weit aufgerissenen Augen um sich. Aus nicht allzu weiter Ferne fiel das Feuer eines Leuchtturms auf das aufgewühlte Meer, in dem Möbel, zerbrochenes Holz und reglose Menschen trieben. Bitte, Gott, bitte, liebe Edith, wenn du im Himmel bist und etwas ausrichten kannst, dann lass Rettung kommen, begann Friedrich zu beten und sah ins Mondlicht hinauf, wo sich die Wolkenfetzen jagten.
Vor den Sternen zeichneten sich schwarz die Masten ab, die schief über dem Wasser hingen. Und auf den Masten saßen … Menschen? Um Gottes willen, auf den Masten?
Immerhin konnten sie dort nicht von den Wellen erfasst werden, erkannte er.
»Zu den Masten«, schrie er. Thomas nickte ihm zu. Vom Geländer am Salon waren es gut vier, fünf Meter bis zum Mast. Das Schiff schwankte unter dem Druck der Wellen. Der jüngere der amerikanischen Brüder ließ das Geländer los und stürzte darauf zu, stolperte, fing sich und schaffte es. Auf der Rah über ihm rückten die dort Sitzenden bereits zur Seite.
»Los!« Friedrich nickte dem jungen Mann zu, ihm mit Sophia zu helfen. Vornübergebeugt, um vom schiefen Deck nicht ins Meer zu rutschen, rannten sie auf den Mast zu, der sich über das aufgewühlte Meer neigte. Die zwei Brüder hangelten sich die daran befestigte Metallleiter ein Stück hoch und streckten ihre Hände nach Sophia aus.
»Du schaffst das«, rief Friedrich ihr ins Ohr. »Ich klettere mit dir, ich bin gleich hinter dir! Halte dich an den Sprossen fest, die Jungs da oben können dich an den Armen fassen!«
Schrecklich langsam erklommen sie den schwankenden Mast. Sophias Haare peitschten ihm nass ins Gesicht. Wie aus weiter Ferne nahm er wahr, dass Thomas und Julia sich unter ihm an die Leiter klammerten. Über ihm ragte der Querbalken, an dem das Segel zusammengerollt war, in den Himmel. Seine Arme kamen ihm schwer wie Blei vor.
Er spürte eine Hand an seinem Fuß und wagte einen Blick nach unten. Das im Mondlicht glänzende Deck schien in weiter Ferne zu liegen. Thomas war direkt unter ihm, hing schützend hinter Julias Rücken an der Leiter.
»Gleich haben wir’s geschafft, Papa!« Sein Gesicht verzerrte sich zu etwas wie einem Lächeln.
Tapfer – sein Sohn war tapfer, erkannte Friedrich. Am Mast auf dem schwankenden Schiff hängend, durchgefroren und nass bis auf die Knochen, wurde er plötzlich von etwas erfüllt, das er schon so lange nicht mehr gespürt hatte. So lange, dass er es erst nach ein paar Sekunden erkannte: Liebe. Er lächelte zurück, hätte Thomas, alle seine Kinder am liebsten in seine Arme geschlossen. Was für ein Narr er doch gewesen war! Er hatte alles auf dieser Welt, für das es sich lohnte zu leben. Sie würden es schaffen, verdammt noch mal!
Noch eine Sprosse, und sie hatten die Rah erreicht. Friedrichs Hände waren bereits gefühllos, die Finger steif vor Kälte. Mühsam schlang er seinen Schal um den Mast und Sophias Taille, stellte fest, dass er nicht lang genug für ihn selbst war, und zwang seine Finger, einen Knoten zu machen, sodass wenigstens Sophia gesichert war. Er setzte sich so eng an seine Tochter, wie es ging, Brust an Brust, durchweichter Gehrock auf nassem Ulster, und steckte hinter ihr seinen rechten Arm zwischen ihrem Rücken und dem Mast durch den Schal, um mehr Halt zu gewinnen.
In der Richtung, aus der der Lichtstrahl des Leuchtturms kam, hoben sich schemenhaft weißliche Klippen vom Meer ab. Erschöpft senkte Friedrich den Kopf auf Sophias Schulter, und das Wellen- und Windtosen verschmolz zu einem einzigen Brüllen.
Rufe holten ihn zurück in seinen Körper, der so kalt und steif war, dass er sich nicht bewegen lassen wollte. Es war hell geworden, aber der Sturm tobte mit unverminderter Heftigkeit.
»Sophie?«, brachte er heraus und spürte eine leichte Bewegung an seinem Hals.
»Sie haben uns gesehen!«, schrie ein Mann hinter ihm. Seine Stimme überschlug sich. »Das Leuchtfeuer! Sie schicken uns Signale!«
Mühsam wandte Friedrich sein Gesicht den Klippen und dem Leuchtturm zu, wo sich nun die Umrisse einer größeren Insel ausmachen ließen. Tatsächlich: Das Licht verschwand, war wieder zu sehen und verschwand, als hielte jemand wiederholt etwas davor.
»Julia, Thomas – sie haben uns entdeckt!« Friedrich merkte, wie er nuschelte. Ihm war so kalt, dass ihm die Lippen und der Kiefer nicht gehorchen wollten. Er zwang sich, seinen linken Arm auszustrecken, ein gefühlloses Ding wie aus Holz, und um den Mast herumzutasten. Hatte das Schiff noch mehr Schlagseite bekommen? Ihm war, als würde er jeden Moment in die Tiefe fallen. »Der Leuchtturmwärter hat – signalisiert.« Eine neuerliche Windböe ließ den Mast ächzen und schleuderte Friedrich Wassertropfen ins Gesicht; Gischt oder Regen, er wusste es nicht. Der Himmel war bleigrau von Wolken. Mechanisch streichelte er Sophia über die feuchten Haare. Das Leben, dieses letzte bisschen Körperwärme und seine nur mühsam zu lenkenden Gedanken, der Geruch seiner Tochter, erschienen ihm mit einem Mal als das Kostbarste überhaupt. Ein so zerbrechliches Geschenk.
Wie lange er mit der Hand auf Sophias Haaren dasaß und gegen die Schwerkraft ankämpfte, wusste er nicht. Rufe rissen ihn aus seinem Dämmerzustand: »Ein Schiff!«
Lauter noch als vorher beim Blinken des Leuchtturms brandeten die Rufe auf, und Friedrich spürte eine geradezu elektrische Spannung. In Richtung Insel konnte er nichts erkennen, aber als er den Kopf drehte, sah er es: Ein großes Schiff schaukelte hinter ihnen, von dem zwei kleine Rettungsboote in die Wellen gelassen wurden. Sein Herz hämmerte ihm schmerzhaft gegen die Rippen, und so etwas wie Wärme breitete sich für einen Moment in seinem Körper aus.
»Julia! Thomas!« Plötzlich hatte seine Stimme wieder Kraft. »Sie kommen uns retten! Thomas!«
»Ja, Papa«, kam die schwache Antwort seines Sohns.
Friedrich spürte eine Berührung an seinem Rücken und sah sich vorsichtig um: einer der beiden Brüder, die ihm mit Sophia geholfen hatten. Hinter ihnen drängten sich die anderen fünf Menschen, die dort auf dem Querbalken saßen. »Wir werden springen müssen«, meinte der junge Mann und zeigte mit dem Kinn auf das aufgewühlte Wasser unter ihnen. »Die Leiter runter und übers Deck ist zu gefährlich. Die kommen nicht nah genug ran.«
Friedrich sah, dass die vier Männer, die das kleine Boot ruderten, tatsächlich Abstand hielten. Planken und Taue, noch halb mit dem Unglücksschiff verbunden, hoben und senkten sich in den Wogen. Aber springen?
Noch während er den bloßen Gedanken als Selbstmord abtat, regnete der Mast Menschen. Die Wellen spritzten auf, verschlangen die Leiber, und das Rettungsboot kämpfte sich mit wilden Ruderschlägen näher heran. Und dann tauchten die hellen Flecken der Gesichter im grauen Wasser wieder auf. Hände streckten sich den Schiffbrüchigen über die Reling entgegen, und nach und nach wurden die Menschen aus dem Wasser gezogen. Voll beladen entfernte sich das Boot, doch die nächste große Welle hob eine zweite Nussschale in die Höhe.
Ihnen blieb keine andere Wahl.
»Thomas, lass dich nicht von Julia trennen! Wir müssen springen!«, schrie Friedrich. Hastig zerrte er den Knoten des Schals auf, mit dem er seine Tochter am Mast gesichert hatte. »Hab keine Angst«, flüsterte er wieder und wieder, halb zu sich selbst.
Und dann ließ er sich mit Sophia fallen. Der Wind schlug ihm wie eine Faust ins Gesicht, sein rechter Arm, mit dem er seine Tochter festhielt, wurde brutal nach hinten gerissen, und das Wasser traf ihn hart wie Kopfsteinpflaster. Alles war gedämpft und dunkel, zog ihn in die Tiefe. Der Druck schien ihm das Trommelfell und die Brust zu zerdrücken. Er strampelte, krampfte seine Hand um Sophias Arm, und dann trieben sie der trüben Helligkeit entgegen. Gischt mischte sich in die Luft, als sie die Oberfläche durchbrachen, und im nächsten Moment sah er das Rettungsboot auf den Wellen tanzen. Es verschwand, wurde von der nächsten Woge wieder emporgehoben. Es gelang ihm, sich vorwärts zu kämpfen, und als sie es endlich erreichten, trat er Wasser und hob Sophia, so weit er konnte, den ausgestreckten Händen entgegen. Er fühlte noch jemanden nach seinem Arm greifen, und dann wurde alles schwarz.
5
Dunkelhäutige Gesichter beugten sich über ihn. Friedrich starrte an den Menschen vorbei zur Decke empor – dunkle Dachsparren und Bretter – und spürte seinen Puls in den Ohren schlagen. Ihm war kalt. Fröstelnd rieb er seine Füße aneinander. Wie aus weiter Entfernung hörte er Stimmen, unverständliche Laute, die keinen Sinn ergaben. Seine Glieder waren wie Blei. Es roch nach Rauch.
»Mister? Können Sie mich hören?«, setzte sein Gehirn einige der Wörter zu einem englischen Satz zusammen.
Englisch. Warum sprach hier jemand Englisch? Und wo war er? Friedrich sah in das gebräunte Gesicht über ihm – dunkle, leicht schräg gestellte Augen, breite Wangenknochen, schwarze Haare. Ein Mann. Friedrich runzelte die Stirn.
Ein gewaltiger Druck breitete sich in seinem Bauch aus, presste ihm gegen die Lungen und schnürte ihm die Kehle zu. Irgendwo in seinem Hinterkopf versuchten Bilder aufzusteigen – Geräusche – ein Tosen … alles nass, es schwankte …
Plötzlich fuhr er hoch. Schwere Decken fielen von seiner Brust. Das Schiffsunglück! Die schwarzhaarigen Menschen, drei oder vier Männer und ein paar Frauen, wichen vor ihm zurück. Er sah, dass er in einem Bett saß. Thomas – die Zwillinge! Friedrich warf die Wolldecken von seinen Beinen und wollte aufstehen, aber die hell gestrichenen Wände begannen sich zu drehen. Haltsuchend klammerte er sich an die Bettkante. »Wo sind … meine Kinder?«, stammelte er auf Englisch.
»Er spricht«, sagte eine Männerstimme.
»Ganz ruhig. Hier.« Eine Frau, die Augen schmal vom Lächeln, hielt ihm eine dampfende Tasse hin. Kräutertee, dem Geruch nach zu urteilen.
»Children … Meine Kinder«, wiederholte Friedrich auf Englisch und lehnte sich zur Seite, um an den Menschen vorbeisehen zu können. Gab es noch ein Bett in diesem Raum? Wo war er? »Zwei Mädchen, Zwillinge – zwanzig Jahre alt mit dunkelroten Haaren, mein Sohn, zweiundzwanzig und blond? Ein bisschen Bart?«
Seine Worte wurden den Männern weitergesagt, die weiter hinten im Zimmer standen. Irgendwo klappte zweimal eine Tür.
»Kommen Sie.« Ein breitschultriger Mann, dessen unmodern lange schwarze Haare im Nacken zusammengebunden waren, drängte sich zwischen den andern hindurch und half ihm auf die Beine. »Können Sie stehen? Die meisten Geretteten sind an Bord der Dexter.«
»Der Dexter?« Friedrich wollte der Name des Schiffes, mit dem sie Boston verlassen hatten, nicht einfallen, aber war es nicht ein längerer gewesen? Hatten sie es etwa wieder flottmachen können? Wie lange hatte er hier gelegen? Er packte den Mann am Arm und schob sich an dessen Seite auf unsicheren Beinen an den Menschen vorbei. Seine Füße waren ohne jegliches Gefühl. Wo waren Sophia und Julia?
»Ein Schiff, das zu Hilfe kam. Wir haben die meisten, die wir retten konnten, dort an Bord gebracht, aber am Ende wurde der Sturm zu stark. Außer Ihnen sind noch fünf Menschen hier an Land geblieben.«
»Meine Töchter? Mein Sohn?« Er schlurfte schneller. Durch die verschmierte Fensterscheibe fiel ein Rechteck Licht auf den Holzfußboden, und er erkannte in der Ecke ein Lager mit in Decken eingehüllten Gestalten. Sein Herz begann zu rasen.
»Das sind die drei anderen Männer.« Sein Begleiter führte ihn näher heran, wollte ihn stützen, aber Friedrich riss sich los, fiel beinahe hin, fing sich gerade noch. Er beugte sich über das Lager und tastete mit zitternden Fingern nach den halb verdeckten Köpfen.
»Aber sie … leben?«, fragte er und erkannte Thomas, der mit geschlossenen Augen dalag und die Lippen kaum merklich bewegte.
Friedrich strich seinem Sohn über die Wange, spürte die Bartstoppeln unter seinen Fingern. Er war eiskalt. Und neben ihm – die beiden jungen Brüder, die nach Florida gewollt hatten? Die ihm mit Sophia geholfen hatten? »O Gott, danke, danke«, flüsterte er. »Thomas!« Sanft rüttelte er ihn, aber sein Sohn runzelte nur leicht die Stirn. »Meine Töchter. Haben Sie denn keine Mädchen retten können?«
»Zwei Mädchen. Nebenan. Die Frauen kümmern sich um sie.«
»Wo?« Das Blut pochte ihm so laut im Kopf, dass er nicht verstehen konnte, was der Mann sagte. Er zeigte auf eine Tür.
Ohne den Mann an seiner Seite loszulassen, schlurfte Friedrich auf tauben Füßen darauf zu. »Wie ist es mit Verletzungen?«, fragte Friedrich. »Ich bin Arzt. Wie lange liegen wir schon hier?«
»Arzt!« Der Mann sah ihn mit großen Augen an. »Wunderbar! Vor einer halben Stunde haben wir die drei jungen Männer reingebracht, das waren die letzten. Auf den ersten Blick keine schwer Verletzten, aber mehr weiß ich nicht. Mein Name ist übrigens Moses Cooper. Ich bin mit den anderen zusammen rausgerudert, als Horatio die Alarmglocke schlug.«
»Sie haben uns gerettet?« Friedrich brachte die Worte kaum heraus. Wie bedankte man sich bei einem Menschen, der in diesen Wellen sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben musste, um ihnen zu Hilfe zu kommen? »Böhm, Friedrich Böhm«, erinnerte er sich dann an seine Manieren. Herrgott, stellte man sich auch in solchen Situationen noch höflich vor? »Ich … kann Ihnen nicht sagen, wie dankbar ich bin. Unendlich dankbar.«
»Ich war ja nur einer von vielen. So, ich hoffe …« Moses öffnete die Tür. Das Zimmer war kleiner, aber wärmer. Fünf schwarzhaarige Frauen mittleren Alters standen in der Ecke um ein Bett herum und drehten sich zu ihnen um.
Friedrich deutete den Frauen gegenüber eine Verbeugung an und wurde sich jetzt erst seiner seltsamen Kleidung bewusst: Er trug schwere graue Wollhosen, ein kratziges Hemd und eine viel zu kleine blau-weiße Strickjacke, die er noch nie gesehen hatte. Offenbar hatte man sie mit trockenen Sachen eingekleidet, die gerade zur Hand waren.
»Er sucht seine Töchter«, erklärte Moses, und die Frauen zogen sich ein Stück von dem Bett zurück, in dem ein in Decken gehülltes junges Mädchen sich mit beiden Händen an eine dampfende Tasse Tee klammerte. Die dunkelroten Haare klebten nass am Kopf.
»Julia!« Selbst seine tauben Füße konnten Friedrich nicht daran hindern, auf sie zuzulaufen. Ihm war, als wollte ihm das Herz aus der Kehle springen. Er hörte sich irgendwelche Laute gurgeln. Neben Julia zeichnete sich eine zweite unter einem Federbett liegende Gestalt ab.
»Papa!« Seine Tochter schüttelte das Federbett neben sich. »Sophia, Papa ist da!«
Aber Friedrich war schon am Bett und hielt sie in den Armen, Julia, deren Tee sich über die Decken ergoss, und Sophia, die blass unter dem Federbett auftauchte. Sie redeten und weinten durcheinander, ohne dass sie auch nur ein Wort verstanden. Doch das brauchten sie auch nicht; es reichte, sich einfach halten zu können.
Als Friedrich sich wieder fasste, merkte er, dass sie allein im Zimmer waren. »Seid ihr verletzt? Sophia, was ist mit deinem Bein? Thomas ist nebenan, ich muss gleich wieder rüber und nach ihm gucken.«
Sophia brachte mit klappernden Zähnen ein wässriges Lächeln zustande. »Uns ist immer noch so kalt, Papa. Und ich glaube, ich habe mir die Rippen geprellt.« Sie zeigte auf ihre linke Seite.
»Vielleicht ist das auch vom Schal. Den hatte ich dir ja so fest umgebunden.« Er untersuchte sie und Julia kurz, konnte aber keine Brüche feststellen, nur leichte Erfrierungen an den Ohren, Fingern und Zehen. Beide Mädchen fühlten sich insgesamt noch sehr kalt an – wie er selbst auch. Ob wohl noch andere Frauen überlebt hatten? Er schloss einen Moment lang die Augen und dankte still seinem Bruder. Frauen ertrinken bei Schiffsunglücken nicht, weil sie nicht schwimmen können, war stets seine Rede gewesen, sondern weil ihre Röcke und Kleider sie ertränken. »Bleibt unter den Decken. Ich werde fragen, ob euch jemand ein paar Ziegel warm machen und ins Bett legen kann. Sophia, du solltest auch etwas Heißes trinken.« Er küsste beide auf die Stirn. »Wisst ihr, wo wir hier überhaupt sind? Diese Leute sehen alle aus wie …«
»Indianer«, fiel Julia ihm ins Wort. »Sind es auch. Wampanoag heißen sie, glaube ich. Das hier ist ihr Reservat, haben sie gesagt. Wir sind auf Martha’s Vineyard, auf einer Insel, oder, Sophie? Aber da leben nicht nur Indianer.«
»Mhm.« Sophia nickte und wischte sich die immer noch fließenden Tränen vom Gesicht.
»Martha’s Vineyard. Aha.« Der Name sagte Friedrich nichts. Er zog seine Töchter enger an sich heran, als könnte er damit die Bilder, die immer wieder in seinem Kopf hochstiegen, zur Seite drücken. Die kleinen Kinder, die über Bord gespült wurden, die Welle, die über Bord brach … Er hörte seinen schweren Atem. »Ich … muss dringend nach Thomas sehen«, sagte er schließlich und stand auf. Aber noch bevor er die Tür erreicht hatte, wurde sie aufgestoßen, und sein Sohn stand vor ihm.





























