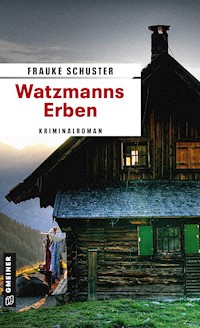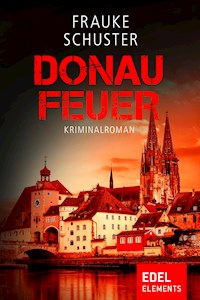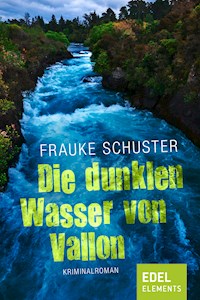
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Toskana-Krimi
- Sprache: Deutsch
Die reißenden Fluten der Ardèche und ihr finsteres Geheimnis. Eigentlich wollte Claudia Trentini nach Südfrankreich fahren, um ihren Freund Darius beim Kajakrennen durch die Schlucht der Ardèche anzufeuern. Doch als sie am Campingplatz von Vallon ankommt, ist Darius spurlos verschwunden. Zunächst befürchtet man einen Unfall im unwegsamen Buschwald, doch es scheint mehr hinter der Sache zu stecken. Warum zeigen Darius' Trainingspartner kein Interesse daran, nach dem Vermissten zu suchen? Mit wem trifft sich der undurchsichtige Kajakfahrer Angel nachts heimlich an den dunklen Wassern des Flusses? Und weshalb ergeht sich die maghrebinische Kräuterfrau Marie in geheimnisvollen Andeutungen? Und plötzlich liegt am Ufer der wilden Ardèche eine Leiche ... Vor dem faszinierenden Hintergrund der südfranzösischen Karstberge mit ihren gähnenden Schluchten und den unheimlichen Höhlensystemen entfaltet sich ein Drama um gewissenlose Geschäfte, finstere Begierden und den Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Die reißenden Fluten der Ardèche und ihr finsteres Geheimnis.
Eigentlich wollte Claudia Trentini nach Südfrankreich fahren, um ihren Freund Darius beim Kajakrennen durch die Schlucht der Ardèche anzufeuern. Doch als sie am Campingplatz von Vallon ankommt, ist Darius spurlos verschwunden. Zunächst befürchtet man einen Unfall im unwegsamen Buschwald, doch es scheint mehr hinter der Sache zu stecken. Warum zeigen Darius' Trainingspartner kein Interesse daran, nach dem Vermissten zu suchen? Mit wem trifft sich der undurchsichtige Kajakfahrer Angel nachts heimlich an den dunklen Wassern des Flusses? Und weshalb ergeht sich die maghrebinische Kräuterfrau Marie in geheimnisvollen Andeutungen? Und plötzlich liegt am Ufer der wilden Ardèche eine Leiche ...
Vor dem faszinierenden Hintergrund der südfranzösischen Karstberge mit ihren gähnenden Schluchten und den unheimlichen Höhlensystemen entfaltet sich ein Drama um gewissenlose Geschäfte, finstere Begierden und den Tod.
Frauke Schuster
Die dunklen Wasser von Vallon
Ein Toskana-Krimi
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Frauke Schuster
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Lianne Kolf Agentur
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-073-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Sie weinte mit dem Abendtau,
Sie weinte, wenn das Frühlicht schien,
Sie sah nicht mehr des Himmels Blau,
Nicht Abendrot noch Morgenglühn.
Wenn nach der Fledermäuse Schwirren
In Dunkelheit die Welt versank,
Dann saß sie auf der Fensterbank
Und ließ den Blick ins Dunkel irren.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Glossar
Quellen
1. Kapitel
Südfrankreich
Dunkelheit. Und Stille. Eine Stille, so absolut, wie man sie nicht mal mit dem besten Gehörschutz der Welt erreichen würde. Nein, halt, ein Geräusch gab es doch, das ab und an diese leere Stille unterbrach, ein Geräusch, das der Mann erst nach minutenlangem Nachdenken als das eines irgendwo auftreffenden Wassertropfens identifizierte.
Sein Kopf dröhnte, fühlte sich an, als hätte ihn jemand mit einem Beil zu spalten versucht. Hatte jemand? Der Mann wusste es nicht, wusste nicht einmal, wo er sich befand. Mühsam kramte er in seinem Gedächtnis – konnte ein Gedächtnis schmerzen? – und bekam doch nur heraus, dass er Darius Thanner war. Vor drei Wochen nach Südfrankreich gekommen, um mit zwei Kumpeln für einen Kajak-Wettbewerb zu trainieren. Warum aber saß er dann nicht in seinem flotten, gelben Boot, die glutheiße Sonne des Südens über sich und das kristallklare Wasser der Ardèche unter dem Hintern? Warum hockte er stattdessen …? In diesem Moment wurde ihm klar, dass er eben gerade nicht hockte, sondern – schwebte? War er vielleicht im Himmel? Quatsch! Erstens wäre es dort nicht zappenduster, und zweitens würden die göttlichen Türhüter bei einem Typen wie ihm von vornherein entsetzt abwinken. Wer hatte das gleich wieder geschrieben, diese wahnsinnig aufmunternde Story mit den diversen Höllenfriesen für jede Verfehlung? Dante, wenn er sich recht entsann …
Nein, so viel begriff Darius selbst mit dem übelsten Brummschädel, den er je gehabt hatte: Der Himmel war das nicht, und die Hölle ebenso wenig; dafür war es eindeutig zu frostig. Er zwang sich, die Hände zu bewegen, dann die Arme. Vor ihm: nichts. Neben ihm: nichts. Und hinter ihm, in seinem Rücken: etwas Kaltes, Glattes, Hartes …
Doch das war nicht das Schlimmste: Unter seinen Füßen, nämlich da, wo sich solide Erde hätte befinden sollen oder freundlich-weiches Gras oder wenigstens ein simpler, rauer Zementboden – war gar nichts. Na ja, ein paar Luftmoleküle sicher, Sauerstoff, Stickstoff, verirrte Edelgase, aber sonst nichts. Darius schwebte nicht, er hing!
In Panik drehte er den Kopf eine Spur zu rasch, spürte einen Stich in der Schläfe wie von einem Stilett und verlor erneut das Bewusstsein …
Sie hörte die Uhr schlagen, dumpf und tief, und ihre Angst wuchs. Wäre Gastons Tag nach Wunsch gelaufen, wäre er längst hier! Er hätte seinen Job – was immer der sein mochte – erledigt, im Squale Bleu vorbeigeschaut, seinen Roten getrunken und wäre nach Hause gekommen. Müde oder aufgekratzt, mit freundlichen Worten oder Flüchen, aber er wäre gekommen. Doch jetzt …
Farida saß still, absolut still, horchte hinaus auf die Straße. Seinen Wagen würde sie unter Tausenden erkennen, so oft hatte sie schon auf ihn gewartet. So oft Angst gespürt … Aber sie hörte keinen Automotor, lediglich das trunkene Lachen einiger später Gäste des Blauen Hais, eine Stimme, die in krächzenden Tönen zu singen anhub, in einer Sprache, die die junge Araberin nicht kannte, Deutsch vielleicht. Viele Deutsche reisten nach Vallon, zum Kajakfahren oder auch bloß, um den Pont d’Arc zu bewundern, den monumentalen natürlichen Felsbogen, der hier in der Nähe den Fluss überspannte und als bevorzugtes Motiv neunzig Prozent aller Postkarten zierte.
Natürlich schrieb Farida keine Karten. Auch nicht an die daheim. Daheim, das war Nordafrika, das Dorf am Rand der Wüste, von wo sie geflohen war, um der Kargheit des Lebens und dem übermächtigen Einfluss der Männer zu entkommen. Eine Stelle als Haushaltshilfe, Zimmermädchen oder Bedienung, davon hatte sie geträumt, zu Hause im bled aber dann … Manchmal konnte Farida sich des Eindrucks nicht erwehren, das Leben sei ausschließlich für Männer gemacht. Die Frauen jedenfalls hatten nicht viel davon. Weder daheim im bled, noch hier. Frauen wie sie zumindest nicht. Für Frauen wie sie bot das Leben nur Arbeit und Warten und Leid. Im bled hatte sie gearbeitet, unter der Armut gelitten und darauf gewartet, fortgehen zu können. Und hier arbeitete sie und wartete auf Gaston und wusste schon jetzt, dass er sie leiden lassen würde, wenn sich der Tag nicht seinen Plänen gemäß entwickelt hatte …
Still hockte sie da, schaltete nicht einmal den Fernseher an, grübelte besorgt darüber nach, ob sie alles aufgeräumt, nichts zu putzen vergessen habe, denn wenn Gaston in dunkler Stimmung war, konnte sich sein Zorn an jeder Kleinigkeit entzünden. Und als Farida endlich den Wagen hörte, als das Brummen des Motors vor dem Haus erstarb, als der Schlüssel sich im Türschloss drehte, verkrampfte sich ihr Magen zu einem Klumpen der Angst …
Als Darius wieder zu sich kam, hing er noch immer. Aber die Dunkelheit hatte sich gelichtet, war einem fahlen Dämmergrau gewichen, und als er seinen schmerzenden Kopf zwang hochzublicken, sah er über sich ein winziges Stück Morgenhimmel. Und um sich herum erblickte er Nadeln. Riesige Felsnadeln, mal dick, mal dünn, in Grau, in Braun, in fleischig wirkendem Rosa. Stalagmiten und Stalaktiten, zum Teil von gigantischer Höhe, rund und glatt. Und ein riesiger Stalagmit war es auch, an dem Darius hing, an dessen Spitze sich seine Jacke verfangen haben musste, als er durch das Loch in der Decke in diese Höhle gestürzt war und um ein Haar beziehungsweise eher um einen Stalagmiten dem Tod entgangen war. Denn unter ihm, wie er jetzt sah, war der Boden der Höhle noch weit entfernt, zehn Meter bestimmt. Drei Meter nach oben, zehn Meter nach unten. Allmählich hörte Darius auf, sich zu wundern; sein praktischer Verstand kehrte zurück. Nach oben konnte er nicht, so gern er wieder ans Licht geklettert wäre, aber der Stalagmit, der ihn aufgefangen hatte, stand zu weit von seinen von der Decke hängenden Kameraden entfernt, ganz abgesehen davon, dass die alle zu glatt waren, um an ihnen emporzuklettern. Außerdem wuchs keiner der Tropfsteine nahe genug an dem kleinen Loch in der Höhlendecke, das sich also ohnedies nicht erreichen lassen würde. Blieb die Option abwärts, aber wenn Darius hinunterblickte, schauderte ihn. An diesem rutschigen Ding in seinem Rücken, das seine Hände nun so weit wie möglich abtasteten, konnte er unmöglich hinabklettern! Und wenn er sprang, brach er sich bestenfalls die Beine, schlimmstenfalls das Genick.
Rutschen, dachte er, ich muss mich aus der Jacke winden und hinabrutschen! Mit den Armen und Beinen als Bremse … Doch dann, wenn er erstmal unten wäre? Wie sollte er je das Loch zur Freiheit erreichen, je wieder herauskommen aus dieser überdimensionierten Fallgrube, von der er nicht einmal wusste, wie er überhaupt hineingeraten war? Egal, er konnte schließlich auch nicht den Rest seines Lebens schlapp hängen bleiben wie ein Mantel am Kleiderhaken …
Farida fiel es schwer, ihren zerschlagenen Körper aus dem Bett zu schieben. Sie musste vorsichtig sein, durfte ihn nicht wecken, nicht bevor sie zurechtgemacht und das Frühstück am Tisch war. Auf bloßen Füßen schlich sie ins Bad, schloss so leise wie möglich die Tür, bevor sie das Licht anknipste, das Nachthemd zu Boden rutschen ließ. Auf und über ihren Brüsten hatten sich bereits blaue Flecken gebildet, die der von Halogenlampen angestrahlte Spiegel erbarmungslos deutlich zeigte. Farida holte die Kräutersalbe gegen Blutergüsse aus ihrem Versteck hinter den Handtüchern hervor und schloss für einen Moment die Augen.
Aber es war nicht der Anblick ihrer geschundenen Brüste, den sie nicht ertragen konnte, es war ihr geradezu jungfräulich flacher Bauch, den sie an solchen Tagen nicht betrachten konnte, ohne sich schmerzhaft an einen anderen Tag zu erinnern, an dem er sie geschlagen hatte. Brutal zusammengeschlagen, weil sie Fragen stellte, die er nicht beantworten wollte. Und am Nachmittag jenes fatalen Tages hatte ein Strom aus Blut ihre liebste Hoffnung aus ihrem Körper davongetragen. Und jetzt …? Farida seufzte, ganz leise, denn Gaston durfte es nicht hören, sonst … Sorgsam salbte sie ihre malträtierten Brüste, gelegentlich zusammenzuckend, wenn der Schmerz zu stark wurde, tastete ihre Rippen ab und stellte erleichtert fest, dass nichts gebrochen schien. Sie hätte sich geschämt, wieder um Hilfe bitten zu müssen, die wissenden Augen der alten Heilerin zu sehen und ihren Blick nicht offen erwidern zu können.
Mit vorsichtigen Bewegungen stieg Farida in Slip und Kleid – den BH konnte sie heute nicht tragen – und wollte eben aus dem Bad schleichen, als ihr siedendheiß das Nachthemd einfiel, das sie fast auf dem Boden hätte liegen lassen, eine Vergesslichkeit, die sie sich absolut nicht leisten durfte! Zitternd tapste sie zurück, hängte das Hemd sorgsam auf den dafür vorgesehenen Bügel, ging in die Küche und holte die Packung Kaffee aus dem Schrank. Während die Maschine ihre Filterarbeit begann, lief Farida leise die Treppe hinab und nach draußen, zur boulangerie. Gaston liebte frische Croissants am Morgen und seine Zeitung, die sie ebenfalls noch besorgen musste.
Als die junge Frau zurückkam, so leise wie möglich die Wohnungstür aufschob, stand er gerade im Flur, auf dem Weg ins Bad. Sie schlug die Augen nieder, aber das Flattern ihres Herzens ließ sich nicht besiegen. Doch er sagte mit ganz normaler Stimme: »Der Kaffee riecht gut.« Und ihre Erleichterung war derart, dass ihr fast schwindlig wurde.
Darius lag auf dem Felsboden, Tränen des Schmerzes in den Augen. »Scheiße! Scheiße! Verdammte Scheiße!« Er schrie es hinaus, und die Wände schrien zurück, sodass Darius erschrocken verstummte. Hatten sich die ganzen verfluchten Berge gegen ihn verschworen? Im nächsten Moment kam der Trotz, der für einen kurzen Moment alle anderen Gefühle beiseite drängte: »Ich will hier raus, hört ihr? Ich will aus dieser verdammten Höhle raus!«, brüllte er ins Nichts, und wieder brüllten die geisterhaften Stimmen das Echo, und zugleich hörte er irgendwo im Hintergrund ein Rumpeln, das er sich im ersten Moment nicht erklären konnte, bis er begriff: Da fielen Steine! Eine Felslawine?! Konnte sein unüberlegtes Schreien sie ausgelöst haben? Nun lag er mucksmäuschenstill, die Hände um den Knöchel gekrampft, den er sich beim Abrutschen von dem Stalagmiten verletzt hatte. Das fehlte gerade, dass er jetzt von einer Steinlawine erschlagen wurde, nachdem er in diese blöde Höhle gestürzt war! Gestürzt … Darius konnte sich an keinen Fall erinnern, oder doch …?
Sein Schädel schmerzte weiterhin oder schon wieder, und das Denken artete in Arbeit aus. Vielleicht sollte Darius seine Kraft eher den Möglichkeiten widmen hier herauszukommen? Vorsichtig ließ er den Knöchel los, wälzte sich auf den Rücken. Weit, weit über ihm das Licht. Sein geliebtes Sonnenlicht! Seinetwegen hatte er vor Jahren beschlossen, weiterhin in der Toskana zu leben anstatt nach dem Tod seiner italienischen Frau ins kühle, regnerische Deutschland zurückzukehren. Und jetzt? Sah er die Sonne von tief unten … Wie aus einem Grab, fiel ihm ein, und der Gedanke trug absolut nicht dazu bei, ihn heiterer zu stimmen.
Um sich abzulenken, blickte er sich in der Höhle um, soweit sie durch das kaum quadratmetergroße, größtenteils von Gestrüpp verdeckte Loch im Fels erhellt wurde. Der Boden der Grotte konnte es an Weite mit jedem Tanzsaal aufnehmen. In der Längsrichtung vermochte Darius kaum die Wände zu erkennen. Und überall wuchsen riesenhafte Tropfsteine empor, in dem offensichtlichen Bestreben, mit ihren von der Decke hängenden Kollegen in Kontakt zu treten. An manchen Stellen war ihnen dies bereits gelungen, und zierliche Säulen verbanden Boden und Decke. Darius’ Sinn für Ästhetik sagte ihm, dass dies, wenn es denn sein Grab werden sollte, auf jeden Fall eine ungewöhnlich schöne, geradezu feenhafte letzte Ruhestätte wäre …
Aber noch war es kein Grab! Aufstehen und herumlaufen konnte er nicht, dazu schmerzte sein Knöchel zu sehr. Er konnte nur hoffen, ihn nicht gebrochen, sondern lediglich verstaucht zu haben. Doch wenigstens auf allen vieren konnte er sich umsehen, nach einem Weg suchen, der ihn aus diesem verfluchten, unterirdischen Verlies entkommen lassen würde. Realistisch wie er war, ahnte Darius schon jetzt, dass sein Fluchtweg nicht durch das Loch in der Decke führen würde; das blieb unerreichbar, zumindest für jemanden, der kein Weltmeister im Freeclimben war. Aber er wusste, dass diese Karsthöhlen sich unterirdisch oft kilometerweit erstreckten und dass sie an mehreren Stellen Verbindung zur Außenwelt haben konnten.
Als Vierfüßler krabbelte er über den mit Geröll übersäten Boden, tapste durch eine Pfütze, die er zu spät bemerkt hatte und deren Wasser seine Jeans begierig aufsogen. Und fand als erstes, nicht weit von der Rückseite der Säule, an der er gehangen hatte, seinen Rucksack, seine durch den Sturz zertrümmerte Staffelei und zwei zerfetzte Plastiktüten, die ihren Inhalt – Konservendosen, Brot, Müsliriegel und zerbrochene Flaschen – unschön über den Höhlenboden verteilt hatten, was der Zaubergrotte an dieser Stelle das Aussehen einer Müllhalde verlieh.
Die Staffelei. Unter ihm das Flusstal, im Abendlicht … Die Tüten, vom Supermarkt in Vallon. Essen für ihn und die Kajakkumpel … Die Erinnerung kehrte zurück, langsam und in Bruchstücken. Darius fand den Malblock, das begonnene Aquarell mit der Ruine im Vordergrund … Hörte Männerstimmen, zornig und gedämpft, sah die Frau durch die Büsche huschen, ihren Korb am Arm. Und dann? Ein Schmerz in seinem Kopf, Schwärze, das Nichts. Und nun die Höhle …
Egal! Der Rucksack war da, und darin bestimmt das Handy! Darius zog ihn zu sich heran, leerte den Inhalt auf die ebenste Stelle des Bodens, warf beiseite, was er hier nicht brauchen würde: Pinsel, Farben, Sonnenöl, die Scherben einer Flasche Roten, deren Geruch ihn beinahe betäubte und ihm einen Fluch entlockte. Warum hatte er keine Plastikflasche gekauft, dann könnte er sich wenigstens ein bisschen über seine Scheiß-Lage hinwegtrösten?! Und wo, zum Teufel, war das verdammte Handy?! Er suchte und wühlte, hektischer und hektischer, bald in absoluter Panik. Kein Handy! Nirgends! Und damit – keine Hoffnung auf schnelle Rettung! Als die schreckliche Wahrheit nach und nach in jede Pore seines Gehirns drang, fing er an zu schreien, um Hilfe zu brüllen – keine Reaktion!
Am liebsten hätte er geheult. Und zwang sich stattdessen zur Ruhe. Als Erstes würde er das herumliegende Essen einsammeln, ehe sich irgendwelches Getier darüber hermachen konnte. Während er über den Boden kroch, sich allzu sehr bewusst, dass er hier unten weder Restaurant noch Supermarkt finden würde, merkte er plötzlich, wie hungrig er war. Wie lang mochte er an dieser blöden Felsnadel gehangen haben? Eine Nacht, zwei? Er schaute auf die Uhr, doch sie war stehen geblieben; natürlich, es war eine dieser Automatik-Fliegeruhren, und obwohl er sie seit Jahren besaß, hatte er keine Ahnung, wie groß die Gangreserve war, wie lang er sich also schon mindestens in der Höhle befand.
Darius schüttelte seinen Arm, um das Werk aufzuziehen und beschloss, die Uhr am Abend, zum Zeitpunkt der absoluten Dunkelheit, auf halb elf zu stellen, was in etwa korrekt sein dürfte. Das Gefühl, die Zeit messen zu können, schien ihm ein Stück Normalität zurückzugeben und besserte seine Laune ein klein wenig. Er fischte einen glücklicherweise wasserdicht verpackten Müsliriegel aus einer Pfütze, verspeiste ihn im Liegen, schöpfte mit der hohlen Hand Wasser und trank gierig. Ungeduldig – warum war er ungeduldig, hier drinnen eilte doch nichts?! – sortierte er endlich seine Schätze, fand einen dünnen Pullover, nass und nach Rotwein riechend, fragte sich, wie er ihn in dieser Unterweltsumgebung je trocken kriegen sollte. Und als würde ihm erst dadurch die Kälte bewusst, begann er zu frösteln.
Er hatte keine Decke, keine warme Kleidung, nichts. Die Jeans, die er trug, klebten eklig feucht an seinen Beinen. Wie kalt mochte es sein? Darius dachte an die Madeleine-Grotte, die er mit der Clique besichtigt hatte. Fünfzehn Grad? Hatte der guide damals nicht von fünfzehn Grad gesprochen? Sicher wusste Darius es nicht, hatte mit den Kumpeln herumgeblödelt anstatt zuzuhören. Andererseits, in das Loch, in dem er lag, konnte tagsüber die warme Außenluft dringen, sodass es ihm vermutlich eher aufgrund seines maroden Zustands so eisig vorkam. Und überhaupt, eigentlich war es scheißegal, bei welcher Temperatur er fror! Wenigstens waren da noch drei verknautschte Päckchen Zigaretten, mitten unter den Gesundheitsriegeln. In der Außentasche des Rucksacks entdeckte Darius eine fast leere Packung Zündhölzer, riss eins an, und bereits der erste Zug Marlboro ließ seine Situation hoffnungsvoller erscheinen. Gut, er besaß nichts, was ihn wärmen konnte, also musste er sich eben Bewegung verschaffen! Rasch stopfte er alles, was er an Esswaren zusammengerafft hatte, in den ausgeleerten Rucksack, streifte den Pullover über und fühlte sich in eine Wolke Alkoholdunst gehüllt.
Den schmerzenden Knöchel hochhaltend, krabbelte er weiter durch die Höhle, um einen breiteren Tropfstein herum, hinter dem etwas Helles lag, vielleicht noch etwas, das sich brauchen ließ? Ein großer Plastiksack war es, sechs oder sieben Kilo schwer; Darius konnte sich nicht erinnern, ihn je gesehen zu haben, knotete ihn hoffnungsvoll auf. Im nächsten Moment erstarrte er in der Bewegung – und ihm wurde schlecht.
Abends lag Darius auf dem Rücken, den Blick unverwandt auf das winzige Stück Himmel über sich gerichtet. Das magere Feuerchen, das er aus seiner zerschlagenen Staffelei und ein paar abgebrochenen Ästen, die wohl zu verschiedenen Zeiten in die Grube gefallen waren, errichtet hatte, war längst zu einem entmutigt glimmenden Aschehaufen herabgebrannt, aber es hatte ausgereicht, den Pullover und die Jeans zu trocknen. Survivalregel Nummer eins: Schutz vor Wetter und Unterkühlung sichern, sonst sinken die Überlebenschancen immens! Doch den Rauch, den Darius als Notsignal in die Oberwelt hatte hinaufschicken wollen, hatte ein plötzlich aufkommender Mistralableger fast schneller verweht, als er aus dem Loch gestiegen war – zusammen mit der Hoffnung, die Feuerwächter der Buschwälder herbeilocken zu können. Wie sollte es weitergehen? Darius besaß keine Streichhölzer mehr, um am nächsten Tag ein neues Feuer zu entfachen; selbst die Zigaretten würde er kauen müssen anstatt sie zu rauchen. Abgesehen davon gab es in der Höhle sowieso kein Brennmaterial mehr, und sein bisschen Ausrüstung war in seiner Lage viel zu kostbar, um es abzufackeln. Natürlich konnte er nachts versuchen, mit dem Taschenlampen-Schlüsselanhänger Lichtsignale zu senden, aber erstens war das Lämpchen eine müde Funzel, und zweitens trieb sich hier bei Dunkelheit sicher niemand in der Wildnis herum, dem das Licht, sollte es überhaupt ausreichend stark sein, auffallen könnte. Wie lange würde Darius also in dieser blödsinnigen Fallgrube ausharren müssen? Würde ihn überhaupt jemand finden? Bestand die Möglichkeit, dass jemand zufällig hier vorbeitrapste, an diesem Privatloch, jemand, der Hilferufe hören würde? Darius hatte sich den ganzen Nachmittag immer wieder die Seele aus dem Leib gebrüllt. Mit dem einzigen Erfolg, dass er einen über dem Loch kreisenden Raubvogel verscheucht hatte. Seine Gedanken glitten ab. Konnte man Geier essen? Irrsinnig lang würden die paar Müsliriegel und Sardinenbüchsen nicht reichen, egal wie sorgfältig er sie rationierte … Und nach wie vor hatte er nicht die geringste Ahnung, wie und warum er hier unten gelandet war …
Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte, als der Donnerschlag ihn weckte. Blitze zuckten, tauchten für Sekundenbruchteile sein Gefängnis in grelles, weißes Licht. Im nächsten Moment spürte er die ersten Tropfen auf dem Gesicht, kroch fluchend zur Seite, das verletzte Bein nachziehend, bis er in einen trockneren Bereich der Höhle gelangte. Die Götter zürnten, würde Peter Selmann sagen und erzählen, wie die Etrusker aus Blitzen die Zukunft weissagten. Aber warum? Warum zürnten die Götter? Warum ausgerechnet ihm?
Toskana, Italien.
Der Mann war so in seine Arbeit vertieft, dass er Claudias Schritte nicht bemerkte, was ihr Gelegenheit verschaffte, den Archäologen in Ruhe zu betrachten und sich wieder einmal zu wundern, wieso sie sich nicht in ihn verliebt hatte, sondern stattdessen in seinen unzuverlässigen Freund Darius Thanner.
Peter Selmann war groß, mit eckigen Schultern und Augen vom gleichen intensiven Blau wie der toskanische Sommerhimmel, unter dessen Gewölbe er hingebungsvoll nach Zeugnissen aus der Etruskerzeit suchte.
»Wollten Sie nicht längst Ihren Urlaub antreten?«
Claudias Frage schreckte den Archäologen aus seinen Träumen, wie einen Schlafwandler, den man zu rasch weckt. Doch als er die Besucherin erkannte, legte er mit einem Lächeln sein Werkzeug – Kelle und Bürstchen – beiseite und kletterte aus der lang gestreckten Grube.
»Urlaub?« Sein Blick schweifte über das sonnenüberflutete Grabungsgelände, das bereits jetzt, Mitte Juli, völlig ausgedörrt wirkte. »Das hier ist besser als jeder Urlaub! Was könnte schöner sein?«
Nun, da wäre Claudia Trentini eine Menge eingefallen … Ein Nachmittag am Strand, ein Cappuccino in Cecina … Eine Nacht mit Darius auf dem Paradiso, seinem toskanischen Landgut …
Doch ihre bissig gesprochene Antwort lautete anders: »Ein paar Tage Erholung in Südfrankreich zum Beispiel. Oder haben Sie vergessen, dass wir zusammen mit Darius’ Neffen an die Ardèche fahren wollten?! Das Kajakrennen ansehen?«
Peters Lächeln verflüchtigte sich. »Noch immer keine Nachricht von Darius?«
Sie hörte das Mitgefühl in seiner Stimme und ärgerte sich. »Er würde anrufen, wenn er könnte!«, schnappte sie, und der Archäologe sah in die Ferne – ohne zu antworten.
»Ich habe am Campingplatz angefragt.« Claudias Fußspitze scharrte im Sand, ohne Rücksicht darauf, dass die teuren schwarzen Sandalen Kratzer bekamen – ein sicheres Zeichen dafür, wie ernst ihr die Lage schien. »An der Rezeption hat man ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen … Seit fünf Tagen, um genau zu sein!«
»Vielleicht macht er einen längeren Ausflug?«
»Das hätte er mir gesagt!«
Peter musste die Antwort überdenken, schüttelte endlich den Kopf. »Wir sollten uns nichts vormachen! Darius war nie der konventionelle Typ, der ständig im Voraus plant! Er wird irgendwo herumziehen und sein Handy vergessen haben, das ist alles.«
»Nein«, sagte Claudia. »Das ist nicht, was Sie wirklich denken!« Es kostete sie ungeheure Überwindung auszusprechen, was sie nicht hören wollte, von ihm nicht und erst recht nicht von sich selbst. »Sie meinen, er hat eine andere Frau.«
Peters betretenes Schweigen – er hatte sich nie leicht verstellen können – war Antwort genug; wortlos wandte sich Claudia ab und stelzte davon.
»Aspetti! Warten Sie!«
Der Archäologe holte sie rasch ein; seine kräftige Hand hielt sie an der Schulter fest. »Sie machen sich wirklich Sorgen, nicht wahr?«
»Natürlich!«, fauchte Claudia, aber als sie in seine freundlichen Augen blickte, konnte sie ihm nicht länger böse sein. »Wir wollten ja sowieso in den nächsten Tagen rüberfahren. Darius anfeuern. Dann können wir doch genauso gut jetzt gleich …«
»Vielleicht ist der Wohnwagen noch nicht frei«, murmelte Peter.
»Das lässt sich mit einem einzigen Anruf klären!« Langsam wurde Claudia wieder ungeduldig. Peter, der Italiener mit einem Südtiroler Vater, war nicht gerade ein Meister der Spontanentschlüsse, im Gegenteil. Und sein Beruf, der ständige Vorsicht und Geduld erforderte, eignete sich keineswegs dazu, ihm die Vorteile rascher Entscheidungen näherzubringen.
»Hier!« Sie streckte dem Archäologen ihr Handy hin, und er starrte es an, als habe er nie im Leben ein derartiges Gerät gesehen, geschweige denn benutzt; zu sehr weilte sein Geist im Altertum.
»Rufen Sie an, Dio mio! Es ist Ihr Freund, der den Wohnwagen vermietet, oder?«
»Sie wollen wirklich, dass wir …?«
»Madonna!« Claudia verdrehte die Augen. »Ihre alten Knochen und Scherben sind Tausende Jahre hier gelegen, die können ruhig ein paar Wochen länger warten! Ich nicht!«
2. Kapitel
Südfrankreich.
Farida wagte nicht, die Wohnung zu verlassen, obwohl sie sich danach sehnte, unter Menschen zu gehen; im bled war sie nie so allein gewesen, so isoliert. Selbst in der Abgeschiedenheit des oueds hatten ihr wenigstens die Ziegen Gesellschaft geleistet …
Trotz ihrer Schmerzen und obwohl sie sich kaum zu bücken vermochte, wischte Farida zum zweiten Mal das Esszimmer, sorgfältig bemüht, jedes zu Boden gefallene Krümelchen zu entfernen, und polierte die Tischplatte, bis sie glänzte wie ein schwarzer Spiegel. Abends, als der Wohnungsputz erledigt war, wagte sie immer noch nicht, sich Ruhe zu gönnen, schleppte die Trittleiter aus dem Abstellraum und begann, die Wohnzimmervorhänge abzunehmen – mit Gastons Raucherei hatten sie sowieso eine Reinigung nötig. Den ersten Schal in der Hand öffnete sie das Fenster, denn jetzt legte sich die Hitze des Tages, und bald würde die kühlere Nachtluft die Schwüle aus dem Raum vertreiben. Von unten, von der Straße, klangen Stimmen herauf, fröhliche Stimmen. Farida ließ den Vorhang zu Boden fallen, beugte sich vor. Zwei junge Pärchen schlenderten vorbei; der eine Mann legte gerade den Arm um sein Mädchen, und alle vier lachten und unterhielten sich. Die Mädchen zogen die Männer zu den Schaufenstern, ihre Begleiter protestierten im Scherz. Farida spürte, wie ihr Tränen aufstiegen. Warum konnte es so etwas nicht für sie geben, ein Leben mit einem Mann, der abends mit ihr bummeln ging? Ein Leben, in dem sie und er gemeinsam Kinder großzogen und im Sommer mit dem das Jahr über ersparten Geld ans Meer fuhren! Einmal, im letzten Winter, hatte Gaston davon gesprochen, Farida nach Marseille mitzunehmen, aber zuletzt war er doch wieder allein gefahren … Wie gebannt blieb Farida auf der Leiter stehen, beobachtete die jungen Leute, hörte die vergnügten, angstfreien Stimmen und fragte sich, ob sie jemals ohne Furcht würde leben können.
Erst als die beiden Pärchen aus ihrem Gesichtsfeld verschwunden waren, besann die junge Maghrebinerin sich auf ihre Vorhänge, nahm den nächsten Schal herunter, schob die Leiter weiter zum zweiten Fenster. Als sie fertig war und die Waschmaschine einschalten wollte, klingelte es, und sie erstarrte in ihrer Bewegung. Gaston würde kaum läuten, oder? Es sei denn, er hätte den Schlüssel vergessen. Farida schluckte, schlich barfuß, wie sie war, in den Flur, starrte auf die Wohnungstür, als könne sie hindurchsehen, wenn sie es nur lange genug versuchte. Und wenn es nicht Gaston war? Sondern vielleicht – die Polizei? Letzte Woche erst hatten die flics im Blauen Hai eine Razzia durchgeführt, und Farida erinnerte sich, wie ihr Herz gepocht hatte, schnell wie das eines Vogels, als der eine Typ, der mit dem arroganten Kinn, ihren Ausweis verlangte … Sie wünschte, sie hätte das Klingeln überhört, aber dazu war die Wohnung zu klein. Unschlüssig blieb die junge Frau stehen, schrak zusammen, als es erneut läutete, lang anhaltend diesmal.
»Farida! Farida, bist du da? Ich bin’s!«
Erleichterung und neue Sorge wechselten in rascher Folge. Es war nicht Gaston und zum Glück nicht die Polizei! Die Araberin sperrte auf, ließ den Mann herein, nahm den Geruch von Öl und Schmierfett wahr, der ihn umgab.
»Gaston wird bald kommen«, murmelte sie, ein paar Schritte zurückweichend.
»Was heißt ›bald‹?«
»Ich weiß nicht.« Es gab so vieles, was sie nicht wusste, zum Beispiel, wie dieser Mann wirklich zu ihr stand, zu ihr stehen würde, wenn … Er trat an ihr vorbei ins Wohnzimmer, ließ sich auf die Couch fallen. »Bring mir was zu trinken!«
Sie holte eine Karaffe Wasser und eine Flasche Rosé. Er trank immer Rosé.
»Ich muss … die Waschmaschine.« Wie so oft fühlte Farida sich hin- und hergerissen in seiner Gegenwart, schwankend zwischen Furcht und – ja, was eigentlich? Freude? Manchmal befürchtete sie, gar nicht mehr zu wissen, was Freude war.
»Hat er dich wieder geschlagen?« Wahrscheinlich merkte er es an ihren Bewegungen, an der vorsichtigen Art, wie sie sich aufrichtete, nachdem sie das Glas vor ihm abgestellt hatte.
Sie sagte nichts, doch eine Träne zog eine nasse Spur über ihre Wange.
»Wir bringen das zurück! Subito! Jetzt!« Peter Selmann mühte sich, seine Stimme fest, aber nicht zornig klingen zu lassen.
Der fünfzehnjährige Ken starrte auf die Hasche in seiner Hand. Er sagte nichts, aber seine Miene verriet Gewitterstimmung.
»Wenn du mit mir unterwegs bist, gibt’s so was nicht!«, setzte der Archäologe hinzu.
Claudia räusperte sich. »Peter! Wir müssen weiter! Wenn er die Flasche zurückträgt, kann uns das eine Menge Ärger bescheren! Und wir haben keine Zeit!«
Peter wusste, dass sie in gewissem Sinn Recht hatte. Er warf einen Blick auf den Raststellenshop, den sie soeben verlassen hatten, mit drei Tüten Chips, drei Flaschen Wasser und einem Bündel leicht überreifer Bananen. Und, fatalerweise, einer Flasche Bacardi-Coke, die wie ein Schachtelteufel plötzlich aus Kens weitem grauen T-Shirt aufgetaucht war. Wenn die Verkäufer Verdacht schöpften, der Junge habe nicht vergessen zu bezahlen, sondern – wie es den Tatsachen entsprach – schlichtweg geklaut, konnten sie schlimmstenfalls die Polizei rufen!
»Steigen Sie ein! Peter!« Demonstrativ riss Claudia die Autotür auf. »Sie sind dran mit fahren!«
Es geht nicht!, dachte der Archäologe. Ich kann nicht stillschweigend zusehen, wie der Junge stiehlt! Ihm war durchaus klar, dass sich Kens Neigung, sich fremdes Eigentum ›bargeldlos zu beschaffen‹, unter Stress verstärkte. Und dass Kens Onkel, Darius Thanner, der den verwaisten Jungen bei sich aufgenommen hatte, im Moment verschollen war, musste für den Fünfzehnjährigen bedrohlich wirken. Einen Schrei nach Aufmerksamkeit würden Psychologen den Diebstahl nennen, und vielleicht stimmte das sogar. Aber der Schrei brach nicht nur ein von Menschen gemachtes Gesetz, sondern verletzte zudem Peters ausgeprägtes Gefühl für Ehrlichkeit.
Und doch! Sollte Darius etwas zugestoßen sein, kam es möglicherweise auf jede Stunde an! Nach längerem inneren Kampf entschied sich der Archäologe für einen Kompromiss, der, wenn er auch nicht dem Gesetz Genüge tat, pädagogisch wenigstens nicht völlig zu verurteilen war: Er nahm Ken die Flasche aus der Hand, marschierte zur nächsten Abfalltonne und warf das Corpus Delicti hinein.
»Moralapostel!«, murmelte Claudia, als Peter einstieg, doch so leise, dass der Junge, der auf dem Rücksitz bereits wieder die üblichen Stöpsel im Ohr hatte, es nicht hörte.
Peter hütete sich zu argumentieren. Die Reise mit einem gestörten Teenager und einer Frau, deren Nerven gespannt waren wie überdehnte Violinsaiten, glich dem Transport von tausend Tonnen Dynamit. Und er wollte keinesfalls derjenige sein, der das Feuer unter die Lunte hielt.
Gerade als er den Motor startete, hämmerte jemand an sein Fenster: eine Touristin mittleren Alters, in hellen Shorts, mit Beinen und Armen, deren blasse Haut an tauende Tiefkühlhähnchen erinnerte. »Sie haben versehentlich eine volle Flasche weggeworfen!«, rief sie, als Peter die Scheibe herabließ, und streckte ihm das Getränk entgegen. Kens Hand schoss vor und Claudia grinste.
Vier Stunden später saß wieder Claudia Trentini am Steuer; Peter neben ihr war eingenickt. Hinten, auf dem Rücksitz, hockte Ken, die Minikopfhörer des Walkmans in den Ohren, den Rhythmus der Musik mit den Schuhen gegen Claudias Sitz schlagend. Sie hatte längst aufgegeben, es ihm zu verbieten, denn spätestens nach zehn Minuten vergaß er ihre Ermahnung sowieso und fing erneut an.
Die Straße war keineswegs ideal für Wohnwagen; schmal und kurvig schlängelte sie sich auf den gestrüppdurchsetzten Felsen hoch über der Ardèche dahin und zwang Claudia zu einem für sie ungewohnt langsamen Fahrstil. Sie überlegte, ob sie Peter wecken solle – schließlich war ihre Schicht zu Ende –, unterließ es dann doch, denn so konnte sie besser ihren Gedanken nachhängen, den Gedanken an die Achterbahnbeziehung zu Darius Thanner, die sie seit etwa einem Jahr pflegte. Wie hatte sie sich ausgerechnet in jemanden wie ihn verlieben können? Einen Mann, der sich das Rauchen nicht einmal ihr zuliebe abgewöhnen konnte, der sich gelegentlich mit dem besten Chianti der Toskana bis zur Besinnungslosigkeit betrank und der mit seinen Pferden effektiver kommunizieren konnte als mit jedem Menschen. Einen Mann, von dem sie nicht einmal genau wusste, ob er ihr überhaupt treu war. Und für ihn hatte sie einem ihrer Arztkollegen den Heiratsantrag ausgeschlagen? Auch wenn sie Peter gegenüber – um ihrer Selbstachtung willen – stur behauptete, Darius habe keine andere, so war es Claudia klar, dass es hierbei keine hundertprozentige Sicherheit gab. Vielleicht nicht mal fünfzigprozentige, dachte sie mit einem Anflug masochistischer Selbstironie.
Endlich, endlich traten die karstigen Berge vom Fluss zurück, die Schlucht begann sich zu weiten, die Straße führte näher an der Ardèche entlang, bot einen Blick auf den berühmten Pont d’Arc, den mehr als sechzig Meter hohen steinernen Bogen, der sich jetzt, im Sommer, weit über der Wasseroberfläche wölbte. Gelb gedörrte Wiesen tauchten auf, Weinfelder mit ihrem dunklen Laub, vereinzelte Häuser. Wir müssen fast da sein, dachte Claudia, und obwohl sie sich seit Stunden danach sehnte, endlich anzukommen, aus dem Autositz raus zu können, packte sie die Angst, wünschte sie, die Fahrt am Fluss würde ewig so weitergehen, mit Peter, der ruhig neben ihr schlief, und mit dem fast ebenso stillen Jungen auf dem Rücksitz.
Doch ihr blieb nicht viel Zeit nachzudenken, denn schon warben die ersten Schilder links und rechts für Hotels, Bootsverleih-Stationen, Kajakschulen und Campingplätze, und Claudia rüttelte Peter, damit er ihr suchen half; keinesfalls wollte sie auf diesen engen Sträßchen mit dem Gespann wenden müssen, falls sie sich verfahren sollten.
»L’Aigle«, murmelte Peter. »So heißt der Platz. Camping L’Aigle.« Er warf einen Blick nach hinten, zu Ken, der sich nach wie vor um nichts kümmerte als um seine Musik, setzte sich dann gerade hin, wobei er mit dem Kopf fast an die Decke des Jeeps stieß, rückte die silberfarbene Metallbrille zurecht und vertiefte sich in die Karte.
»Wohin jetzt?« Im Kriechschritt steuerte Claudia den Wagen in den Kreisel. »Rechts nach Vallon oder geradeaus?«
»Geradeaus«, entschied Peter erfreulich rasch. »Der Platz liegt direkt am Fluss, und die Ardèche ist links von uns.«
Er sollte Recht behalten. Höchstens hundert Meter weiter verwies ein Schild zur Linken auf den Platz L’Aigle. Claudia ließ den Wagen vor der Rezeption ausrollen und fühlte plötzlich, wie sie jeder Rest von Mut verließ. Was jetzt? Was, wenn sie zu Darius’ Zelt lief, und dort hockte er, den Arm um eine peroxidblonde Touristin gelegt, seine gebräunte Wange rot von den Flecken ihres Lippenstifts? Oder, wenn er nicht mal vor dem Zelt saß, sondern gerade drinnen zugange war, und sie stand wie eine Idiotin davor und musste sich sein Stöhnen anhören, unter Peters mitleidigem Blick? Auf einmal wollte Claudia nur eins: Aus dem Platz wieder hinausfahren, die gesamte, elendige Kurvenstrecke längs der Schlucht zurück. Oder nicht ganz zurück. Irgendwo halten, da, wo die Schlucht am tiefsten war, und sich hinunterstürzen …
Nur am Rande bekam Claudia mit, dass Peter ausstieg; wie immer hatte er begriffen, wie sie sich fühlte und übernahm mit der ihm eigenen Rücksicht ungefragt den Part, zu dem sie sich nicht mehr imstande fühlte: Er meldete den Wohnwagen an, ließ sich erklären, wo die Sanitäranlagen zu finden waren und wann die Schranke für die Mittags- und Nachtruhe geschlossen wurde.
Wenig später schaukelte der Jeep, jetzt mit Peter am Steuer, den von Pappeln beschatteten Hauptweg entlang, einer Art Golfwägelchen folgend.
»Wir haben Glück«, erklärte der Archäologe. »Wir bekommen einen Stellplatz gleich gegenüber von der Parzelle, die Darius und sein Freund gemietet haben!«
Claudias Herz schien einen Sprung zu machen. Nur ein, zwei Minuten, und sie würde – ja, was? Darius sehen? Sie spürte, wie Peter sie mitfühlend von der Seite anblickte, und herrschte ihn wütend an: »Verdammt, schauen Sie auf den Weg! Sie hätten fast den Baum dort gerammt!«
Doch im nächsten Moment vergaß sie Peter, vergaß ihn vollkommen, denn das Gespann bog in einen kleineren Seitenweg, und nun entdeckte Claudia das oliv-blaue Kuppelzelt, das sie erst kürzlich auf dem Paradiso gesehen hatte, als Darius es aufstellte, um zu checken, ob die Nähte noch regendicht waren oder der Ausbesserung bedurften. Darius’ Zelt, mit den von ihm selbst aufgemalten, steigenden Pferden zur Linken und Rechten des Eingangs. Nach dem ersten Blick schaute sie zur Seite, mit klopfendem Herzen, um nicht sehen zu müssen, wie er mit irgendeinem Weib herauskroch, doch dann brachte sie es nicht fertig, den Blick abgewandt zu halten, sah wieder hin, und alles war still und verlassen.
Peter hielt den Wagen an, betrachtete die Parzelle, um zu überlegen, wie er den Wohnwagen am günstigsten hineinmanövrieren könnte. Claudia war ihm keine Hilfe, starrte auf das Zelt, als befürchte sie, es könne sich jeden Moment in Luft auflösen, und Ken kam gar nicht auf den Gedanken, die Stöpsel aus dem Ohr zu nehmen. Glücklicherweise war Peter ein geschickter Fahrer, und wenige Minuten später stand der Wohnwagen perfekt eingeparkt, und der Archäologe holte die Kabeltrommel, um den Strom anzuschließen.
Zögernd, fast mit dem Gefühl, als wolle sie einbrechen, betrat Claudia die Parzelle gegenüber. Das oliv-blaue Zelt unter einer Gruppe schattenspendender Brotbäume war verschlossen, die Abspannleinen perfekt gestrafft. Daneben lag Darius’ gelbes, verkratztes Einmannkajak, dessen Bug ein in Rot aufgepinselter Saluki zierte; unter der Spritzwasserabdeckung lugte ein Stück einer orangefarbenen Sicherheitsweste hervor.
Claudia räusperte sich. »Darius?« Sie fragte in die Stille, ohne den Zelteingang zu öffnen und ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Nachdenklich sah sie sich um: Auf der gleichen Parzelle ein weiteres Zelt, in verblasstem Graublau, vermutlich von Darius’ Freund. Von dem Bewohner keine Spur, aber auf einer zwischen den Bäumen gespannten Leine hingen zwei Handtücher so schlapp, als sei ihnen die nachmittägliche Hitze zu viel geworden.
»Niemand da?« Peter, hinter ihr, aber Claudia wollte nicht mit ihm sprechen.
»Nein.« Sie bellte es so unfreundlich heraus, wie sie konnte, wandte sich um und marschierte zum Wohnwagen zurück. Ken, in blauer Badehose, seine giftgrünen Taucherflossen in der Hand, flitzte an ihr vorbei in Richtung Fluss. Claudia stieg in den Wagen, holte eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und setzte sich auf die schmale Bank. Was jetzt?, fragte sie sich. Was sollen wir jetzt verdammt noch mal tun?
Peter zerrte den Reißverschluss von Darius’ Zelt auf, blickte hinein. Im hinteren Eck eine geöffnete Reisetasche, aus der eine schlampig hineingestopfte Jeans zur Hälfte wieder herausquoll. Davor ein lose zusammengerollter, dunkelblauer Mumienschlafsack auf einer unbequem dünnen Isomatte. Auf der anderen Seite eine verschlossene Kunststoffbox, eine durchsichtige Plastiktüte voll leerer Flaschen, eine Papiertüte mit einem angebrochenen Baguette und einer Menge geschäftig knabbernder Ameisen. Gleich neben dem Eingang eine zerknitterte Flusskarte, ein grauer Kajakhelm, blechernes Essgeschirr, eine Flasche Spülmittel. All das, was man im Zelt eines Mannes erwarten konnte. Nichts Außergewöhnliches.
Während Peter sich fragte, was er eigentlich zu finden gehofft hatte – einen Zettel etwa, mit der Aufschrift: Hallo, Leute, bin da und dahin gefahren! – fühlte er plötzlich, wie jemand von hinten sein Hemd packte, ihn rückwärts aus dem Zelt zerrte. Er versuchte sich umzudrehen, zu langsam: Alles, was er erkennen konnte, war ein dunkler Bart, dann krachte bereits eine Faust in sein Kinn, sandte ihn auf den von der Sonne steinhart gebackenen Erdboden.
Im nächsten Augenblick saß jemand auf seiner Brust; Hände griffen nach seinem Hals; Peter wollte sie wegdrücken, vergeblich!
»Was hast du in dem Zelt gesucht, Sauhund?!« Selbst wenn der Gegner ihn nicht kräftig gewürgt hätte, hätte Peter nichts zu antworten vermocht, denn er wusste es ja selbst nicht. Allmählich wurde sein Blick wieder klar, der Bart vor ihm scharf, und Peter erkannte, dass ein Paar wütend blitzender, brauner Augen dazugehörten.
»Du wolltest klauen, gib’s zu!«
Endlich schien der Angreifer zu merken, dass sein Opfer nicht ohne Luft sprechen konnte; er gab Peters Hals frei, hielt dem Archäologen aber die geballte Faust dicht vor die Augen: »Spuck’s aus, was wolltest du?!«
Normalerweise hätte es Peter verblüfft, dass der Typ ihn auf Deutsch anherrschte, hier in Südfrankreich, aber im Moment war er zu geschockt, um irgendetwas seltsam zu finden.
»Darius!«, stieß er hervor. »Ich wollte schauen, ob Darius …«
Die maronenfarbenen Augen blickten zweifelnd; allerdings nicht mehr ganz so feindselig. »Darius Thanner? Was weißt du von ihm?«
»Er ist … mein Freund«, murmelte Peter.
»Wie heißt du?«
Peter krächzte seinen Namen, wagte jetzt, seinen geschundenen Hals zu massieren und sah mit Freuden, dass sein Peiniger aufstand, was die Brust des Archäologen angenehm entlastete.
»Peter Selmann? Er hat erwähnt, dass du aufkreuzen würdest.« Unerwartet streckte der Fremde Peter die Hand hin, um ihm aufzuhelfen. »Übrigens, ich bin der Angel!«
»Todesengel, nehme ich an«, mutmaßte Peter, während er sich mühsam erhob und anfing, seine Kleider abzuklopfen.
»Knapp daneben.« Der Bärtige grinste. »Engelmar Finke. Alle nennen mich Angel. Darius und ich sind Konkurrenten auf dem Fluss.«
Hinter dem schlagkräftigen Himmelsboten waren mittlerweile ein hellhaariger, schlanker Mann und eine ebenfalls blonde junge Frau herangekommen, die abwartend schwiegen.
»Paula und Arni«, stellte Angel mit großartiger Geste vor.
»Auch Kajakfahrer?«, fragte Claudia, die inzwischen aus dem Wohnwagen geklettert war.
»Arni fährt«, sagte Paula, die ihr halblanges Haar hinter den Ohren zu zwei straffen Zöpfen geflochten hatte, die ihr zusammen mit ihren üppigen Brüsten das Aussehen eines frühreifen Schulmädchens verliehen.
Peter nickte den beiden zu. »Weiß einer von Ihnen, wo wir Darius finden können?«
Jäh verdüsterten sich sämtliche Mienen. Angel zuckte die Achseln. »Wir haben ihn seit Tagen nicht gesehen.«
»Trainieren Sie nicht zusammen?«
»Normalerweise schon …«
»Aber?«
»Nichts aber. Er ist weg.«
»Es scheint Sie nicht sonderlich zu beunruhigen«, schaltete sich Claudia ein, die ihrer Beziehung zu Darius hervorragende Deutschkenntnisse verdankte.
»Darius ist Darius.« Damit schien für Angel alles erklärt.
Nicht so für Claudia. »Hat er das öfter gemacht? Dass er tagelang das Training geschwänzt hat?«
Angel kratzte sein struppiges Haar. »Ab und an, ja. Weil – der Darius, der ist ziemlich impulsiv.«
Wem sagst du das?, dachte Claudia.
»Sie machen sich also keine Sorgen?«, hakte Peter nach. »Immerhin wäre es denkbar, dass er einen Unfall gehabt haben könnte!«
Die Kajakclique tauschte unruhige Blicke. »Denkbar ist vieles«, gab der blonde Arni zu, der im Gegensatz zu dem ruppigen Angel in Lacoste-Shirt und perfekt geschnittener sommerheller Leinenhose eher playboyhaft wirkte. Claudia erinnerte sich, von Darius gehört zu haben, dass Arndt Ritter und seine Lebensgefährtin Paula Thiersch seit ein paar Jahren in Südfrankreich wohnten, in Vallon ein Haus besaßen.
»Was sollen wir tun?«, fragte Paula. »Die Polizei verständigen? Vielleicht ist Darius bloß im Tal der Ibie, in einem dieser verwinkelten, romantischen Dörfer, um ein paar Tage in Ruhe zu malen. Uns schien jedenfalls, als habe hier seine verschüttete Liebe zur Malerei glorreiche Wiederauferstehung gefeiert!«
»Ist er zum Malen weggefahren?«
Sie war sich nicht sicher, wusste aber, dass er seinen Farbkasten stets im Wagen gehabt hatte. Und dass mit Darius auch dessen Range Rover abgängig war.
»Wenn er bloß malen wollte«, sagte Claudia, »warum hat er dann nicht zwischendurch mal angerufen? Ich meine, wozu besitzt er ein Handy?«
»Darius ist Darius«, wiederholte Angel achselzuckend.
Ken tauchte in das sonnenwarme Wasser des Flusses, ohne sich um die anderen Badenden zu kümmern. Es war ein angenehmes Gefühl, nach der langen, heißen Fahrt zu spüren, wie die Strömung den Schweiß von seinem Körper spülte. Der Junge ließ sich in eines der zahlreichen, aus losen Steinen aufgeschichteten Felsbecken treiben, spürte, wie der Fluss an ihm zog und zerrte, ohne ihn jedoch mit sich nehmen zu können. Wo würde man hingelangen, wenn man die Bucht verließ, sich diesem fremden Fluss anvertraute? Ken versuchte, sich an das zu erinnern, was Peter erzählt hatte: Zuerst würde man durch die berühmten Schluchten schwimmen, später in die Rhône. Und die wiederum führte ins Mittelmeer …
Eine Gruppe Kajakfahrer in grünen Booten paddelte den Fluss hinunter; Ken wandte sich ihnen zu, beobachtete, wie sie mehr oder weniger geschickt versuchten, sich an den von den Campern errichteten Dämmen und Becken vorbeizuwinden. Bereits das zweite Kajak stellte sich quer, noch ehe es Kens Bucht erreicht hatte, das nächste Kajak fuhr auf; die Flusstouristen kreischten und lachten abwechselnd, ein Badegast versetzte dem ersten Boot einen kräftigen Stoß, der es wieder mit dem Bug voran in die Strömung beförderte. Ein kleiner Junge im Heck winkte Ken zu, das winzige Gesicht unter dem Sicherheitshelm kaum zu erkennen.
Ken winkte nicht zurück, sah dem Boot jedoch nach, wie es den Fluss hinab verschwand, in Richtung Pont d’Arc. Die Fröhlichkeit des Kindes stimmte den Teenager finster, denn plötzlich fragte er sich, was aus ihm werden würde, sollte Darius nicht zurückkommen. Würde er nach Deutschland verfrachtet, wieder in ein Heim? Ihn schauderte bei der bloßen Vorstellung, nach der Freiheit, die er auf Darius’ toskanischem Landgut genoss, erneut eingesperrt zu werden. Ob Peter ihn aufnehmen könnte? Mit dem ruhigen Archäologen verband Ken seit langem eine beständige Freundschaft, aber ob die Behörden erlauben würden, dass er zu Peter zog? Ken hievte sich auf einen Felsblock hinauf, schlang die Arme um die Knie und fühlte die tröstende Wärme der Sonne auf seinem Rücken. Er konnte gut verstehen, dass Darius lieber im Süden lebte als im kalten Deutschland. Schon nach diesem einen Jahr, das er selbst in der Toskana verbracht hatte, ging es ihm genauso … Er würde nicht zurückwollen, niemals …
»Squale Bleu?«, fragte Claudia stirnrunzelnd.
»Ein Lokal in Vallon. Wir waren oft mit Darius dort«, erklärte Paula. »Unsere Lieblingskneipe sozusagen.«
»Das Essen ist erstklassig, auch wenn man’s der Bude nicht ansieht«, versicherte Arni. Angel sagte nichts.
»Dann gehen wir dorthin«, stimmte Claudia zu. Peter und Ken wurden gar nicht erst gefragt, grinsten einander an.
Der Squale Bleu, der Blaue Hai, in der Rue du Miarou, wirkte mit dem allzu grellblauen Schild über dem Eingang von außen in der Tat wie eine billige Spelunke, erwies sich jedoch als im Innern überraschend geräumig und gemütlich. Weitmaschige Netze und präparierte Fische an den Wänden, ein Hai, der an Schnüren von der Decke baumelte und die speisenden Gäste aus tückischen Augen neidvoll betrachtete. Dunkle Holztische mit Papiersets, die zugleich als Dessertkarten dienten; in einer Vitrine eine Sammlung alter nautischer Instrumente, die Peters Blicke magisch anzog. Über allem der Duft von Kaffee und der Geruch von gebratenem Fisch, gemischt mit dem unvermeidlichen Zigarettenqualm.
»Dort, im Eck«, wies Arni. »Das ist unser Stammtisch.«
Kaum dass sie saßen, tauchte ein dunkelhäutiges, junges Mädchen mit nicht mehr ganz weißer Schürze über hautengen Jeans auf, stellte einen Krug Wasser auf den Tisch, der in der Wärme des Lokals sofort beschlug.
»Vous désirez?«
Claudia war nach Wein. Wenn sie ehrlich war, nach viel Wein. Am liebsten so viel, dass sie so lange schlafen könnte, bis Darius wieder auftauchte und alle Probleme gelöst waren …
»Haben Sie die Gegend abgefahren, um nach Darius’ Wagen zu suchen?«, fragte Peter die Kajakclique.
Angel zuckte die Achseln. »Natürlich. Aber habt ihr euch mal ne Karte von der Umgebung vorgenommen? Richtig angeschaut, meine ich? Da ist überall Wald, Buschwald, so eine Art Cevennen-Macchia. Um die zu durchkämmen, bräuchte man Hundertschaften, Suchhunde, was weiß ich alles!«
»Er hat Recht.« Arni pickte an seinem Shrimps-Salat. »Hier findet ihr niemanden, wenn er nicht gefunden werden will!«
Claudia starrte auf ihr Glas und ihren halb gegessenen Fisch mit seinen toten Augen. Plötzlich wollte sie allein sein, niemanden mehr sehen. Mit einer gemurmelten Entschuldigung flüchtete sie in die Damentoilette.
Sie lehnte an der Wand, über sich das rhythmische Scheppern eines Ventilators; die Stimmen aus dem Lokal als gedämpfte Hintergrundgeräusche. Und wenn sie tatsächlich Recht hatten, sie alle? Wenn Darius nicht gefunden werden wollte? Vielleicht machte sie sich längst lächerlich, vielleicht lachten alle über sie, die drei fremden Deutschen und innerlich sogar Peter …? Der Wunsch zu weinen wurde übermächtig; sie legte ihre heiße Stirn gegen die schmuddeligen Fliesen und ließ den Tränen freien Lauf.
»Vous allez pas bien? Geht es Ihnen nicht gut?«
Sie hatte die Frau nicht kommen gehört; eine junge Frau mit arabischen Gesichtszügen, in rotem Minifähnchen, einen blauen Fleck auf dem linken Wangenknochen.
»Je peux vous aider? Kann ich Ihnen helfen?« Die Stimme klang vorsichtig, als hätte die Frau Angst vor Claudias Zorn.
Claudia schüttelte stumm den Kopf; es war ihr peinlich, sich von einer völlig Fremden heulend in der Toilette ertappen zu lassen. Sie suchte nach einem Taschentuch, fand keins, griff sich ein Papiertuch aus dem Spender und tupfte heftig an ihren Augen herum.
Als sie in die Gaststube zurückkehrte, stand Peter am Tresen der Bar, ein Foto von Darius in der Hand, und unterhielt sich – natürlich in fließendem Französisch – mit den einheimischen Gästen. Hatte jemand der Anwesenden den Mann auf dem Bild gesehen? Ja, hier! Wann zum letzten Mal?
Claudia sah zu ihrem Tisch: Arni und Angel beobachteten Peter mit Mienen, die keinesfalls als freundlich einzustufen waren. Lediglich die blonde Paula stützte den Kopf auf den Ellbogen, ignorierte die Annäherungsversuche eines Kellners und starrte mit für Claudias Begriffe allzu begehrlichem Blick auf den hochgewachsenen Archäologen. Jeglicher Rest der vorherigen Anwandlung zu weinen verflog: Was wollte das verdammte Weib von Peter? Gehörte sie nicht zu diesem schnöseligen Arni?! Hatte sie mit diesem Blick einer auf Beute lauernden Spinne vielleicht auch Darius angeglotzt?! Claudia überrann es heiß: Und wenn wirklich? War Darius … empfänglich gewesen für diese blonden Zöpfe über dem strammen Busen, diesen sexgierenden Lolitaverschnitt? Claudias Blick glitt zurück zu Arni. Merkte der Typ überhaupt, dass seine Begleitung einen anderen Mann angaffte wie eine Frau, die sich nach einem überaus fleischlichen Dessert sehnt?
Peter kam zum Tisch zurück, steckte das Foto ein. »Niemand weiß genau, wann Darius das letzte Mal …«
»Natürlich nicht!«, blaffte Angel.
»Das haben wir Ihnen doch längst gesagt!« Arni schien genauso sauer wie sein Kumpan, und Peter merkte, dass er es viel zu schnell geschafft hatte, sich unbeliebt zu machen. Was ihn zu einer hastigen Entschuldigung veranlasste.
Inzwischen war die fremde Frau aus der Toilette gekommen, sah sich suchend in der Gaststube um, warf einen fragenden Blick zum Barkeeper. Der schüttelte stumm den Kopf. Die Frau, vermutlich eine Maghrebinerin, fasste sich an den blauen Fleck an der Wange und bewegte sich unsicher zur Tür. Claudia fiel auf, dass Peter ihr etliche Sekunden zu lang nachblickte.
Sie erwachte, als sie den Alarm hörte. Sie war spät eingeschlafen und wusste zunächst nicht, wo sie lag. Jedenfalls weder in ihrem Bett noch in Darius’ Schlafzimmer im Paradiso! Ihr Arm ertastete eine Wand; von irgendwoher drang das Schnarchen eines Mannes an ihr Ohr, und sie fuhr hoch. Nur der schwache Lichtschein einer Campingplatzlampe erhellte notdürftig den Raum, doch nun begriff die Ärztin: Sie war an der Ardèche, in diesem klapprigen Wohnwagen, dem Sondermodell für Schrottblechfreunde! Vorsichtig stand sie auf, streifte einen Jogginganzug über, öffnete die Tür. Peter, der sich abends im Vorzelt einquartiert hatte, war nirgends zu entdecken. Claudia trat hinaus auf den Weg. Hier rasselte das Schnarchen lauter, kam von der Parzelle gegenüber, wo Angel schlief. Aber wo steckte Peter? In Kens Zelt vielleicht?
Die Nacht war lau und warm, roch schwül nach einem mitternächtlichen Gewitterschauer. Claudia lief den Hauptweg entlang, zwischen schlafenden Wohnwagen und Wohnmobilen hindurch vor zur längst geschlossenen Rezeption. Auf der Straße erneut die Sirene. Ein Feuerwehrwagen raste vorbei, in Richtung Osten.
Ein Laut hinter Claudias Rücken, ein winziger Laut, ein Schuh, der ein Steinchen zermalmte! Claudia wandte den Kopf, ein Baum bewegte sich, nein, kein Baum! Es war ein Mann, der aus dem Dunkel trat, und sie schrie auf, wollte zurückstürzen, weglaufen, doch er packte ihren Arm!
»Claudia! Io sono, Peter!«
»Sind Sie verrückt, mich so zu erschrecken?!« Wie schaffte er es immer wieder, sie auf die Palme zu bringen? »Was machen Sie überhaupt draußen, um diese Uhrzeit? Es ist erst vier!«
Er lachte leise, und sein Lachen ärgerte sie nur noch mehr. »Dasselbe wie Sie. Ich wollte schauen, ob etwas passiert ist.«
»Und? Haben Sie was gesehen?«
»Es brennt irgendwo …«
Zu dem Schluss war Claudia längst selbst gelangt!
»Gut, dass es geregnet hatte«, sagte Peter. »Sonst … In diesen Wäldern und in diesem heißen Sommer …«
Claudia sah ihn an, und im Halbdunkel des Platzes wirkte sein Gesicht seltsam fremd. Ein Feuer. Sie kannte Sommerbrände in der Toskana oder im Süden Italiens, wo ihre Eltern lebten. Sie wusste, wie rasch staubtrockene Bäume oder ausgedörrtes Macchiagestrüpp durch einen Funken geradezu explodierten … Und ihr schauderte, obwohl das Feuer weit weg schien.
Sie schlief weiter, bis gegen acht Uhr, als ringsherum der Platz erwachte: von irgendwoher Angels Stimme, der jemandem etwas zubrüllte. In der Nähe rangierte ein Wagen. Claudias Bett bebte, als ein schweres Gefährt vorbeirumpelte, ein Wohnmobil vielleicht. Kinder kreischten in entnervender Lebensfreude; ein Hund übte sich darin, lauter und lauter zu kläffen. Claudia fühlte sich todmüde, aber an Schlaf war bei der Lärmkulisse, die Dutzende unternehmungslustiger Urlauber zustande brachten, nicht zu denken. Nie mehr Camping!, schwor Claudia sich grimmig. Selbst wenn das bedeutete, dass Darius und sie für den Rest ihrer Tage getrennt Urlaub machen müssten!
Als die Ärztin von den Waschräumen zurückkam, zurrten Arni und Angel wasserdichte Bootstonnen auf zwei aus dem Nichts aufgetauchten Kajaks fest. Beide Männer trugen Neoprenschuhe, Badeshorts und knallig orangefarbene Rettungswesten.
»Aber …« Claudia starrte auf Paula, die lächelnd neben den Männern wartete und Arnis Paddel hielt wie eine Trophäe. »Aber wir müssen doch Darius suchen!«
Arni richtete sich auf. Sein jungenhaft hübsches Gesicht verriet Unmut. »Wir müssen ein Rennen gewinnen, so ist das!«
»Sie wollen am Qualifikationslauf für die Klasse zwei teilnehmen.« Paula erklärte, dass die Männer dafür die Schlucht in weniger als zwei Stunden bewältigen müssten. »Wenn sie’s schaffen, sind die Preisgelder für den eigentlichen Wettkampf viel höher als bei den üblichen Touristenklassen.«
»Hier geht’s nicht um Geld, hier geht’s um Darius!« Claudia schrie es hinaus, und die Familie auf der Parzelle nebenan, die um einen wackligen Campingtisch herum beim Frühstück saß, wandte neugierig fünf Köpfe. Von irgendwoher tauchte Peter auf, zog Claudia weg.
»Lassen Sie«, murmelte er. »Wir können selbst ja schon mal anfangen zu suchen.«
»Und wo?«
»Am Campingplatz.« Peter sagte, dass Darius ein kommunikativer Typ sei; bestimmt habe er mit vielen Leuten gesprochen und vielleicht irgendjemandem erzählt, was er vorgehabt hatte, bevor er verschwand. »Und wenn das nichts bringt, können wir in dieses Flusstal fahren, das Darius’ Freunde erwähnten …«
Mit finsterer Miene sah Claudia zu, wie Arni und Angel ihre Boote zu Wasser ließen. Paula stand am Ufer und blickte auf die Uhr. »Dieses Rennen bedeutet den Männern sehr viel«, sagte sie entschuldigend.
»Und mir bedeutet Darius noch viel, viel mehr!«, schnappte Claudia und bedauerte die Worte, kaum dass sie sie ausgesprochen hatte. Niemand, nicht einmal Peter sollte ahnen, wie viel Darius ihr wirklich bedeutete. Er, der in ihr Leben die Leichtigkeit gebracht hatte, an der es ihr, der nüchternen Augenärztin, sonst eher mangelte.
Nachdenklich blickte sie den beiden gelben Kajaks nach, die sich rasch flussabwärts entfernten, und fragte sich, was ihr lieber wäre: Dass Darius eine andere gefunden hatte oder dass ihm etwas zugestoßen war …
»Dieser Mann. Haben Sie in den letzten Tagen diesen Mann gesehen?«
Peter hatte das Foto gezückt und fing entschlossen gleich bei der Familie auf der Nachbarparzelle mit seinen Nachforschungen an. Die Eltern, beide zu üppig gebaut für ihre zierlichen Campinghocker, schüttelten einmütig und gleichmäßig ihre Frühstücksbrötchen weiterkauend die Köpfe, während die drei strohblonden Jungen im Alter von circa sechs bis zwölf den Archäologen ungeniert anstarrten.
»Wir sind erst seit drei Tagen hier«, erklärte die Frau endlich, Neugier im Blick. »Ist etwas passiert?«
Rasch wiegelte der Archäologe ab, ging mit dem Bild weiter.
Bei dem teuren Wohnmobil mit der Münchner Nummer gleich hinter ihrem eigenen Stellplatz hatten er und Claudia mehr Glück. Zwei Männer um die vierzig frühstückten dort in bequemen Klappsesseln mit hohen Rückenlehnen, auf dem Tisch einen geschmackvoll arrangierten Strauß aus Schneckenklee und Oleanderzweigen.
»Natürlich kennen wir ihn, ihm gehört das Zelt dort drüben«, sagte der Camper mit dem schütteren sandfarbenen Haar, und sein dunkelhaariger Gefährte fügte hinzu: »Ein netter Mann, immer hilfsbereit. Und ein begabter Zeichner obendrein.«
Wann sie Darius das letzte Mal gesehen hatten? Vor einer Woche etwa, meinte der Dunkle. Aber wo er hingefahren sein konnte? Keine Ahnung. »Wir haben nicht viel miteinander geredet.« Es klang entschuldigend. Keiner der beiden fragte, warum sich Peter nach Darius erkundigte, und Claudia fand diese Zurückhaltung erfreulich.
»Der Kerl neben uns?! Der ist schon lang nicht mehr hier aufgetaucht«, knurrte der magere Mann, der mit seiner Frau und zwei halbwüchsigen Töchtern die Parzelle neben Darius’ und Angels Zelt bewohnte. »Und es ist bestimmt kein Schaden, dass er fort ist!« Streng musterte er Peter über seine Metallbrille hinweg, während die Mädchen einander verstohlen angrinsten.
»Hatten Sie Streit mit ihm?«, fragte der Archäologe rasch.
»Noch nicht, aber lange hätte ich nicht mehr den Mund gehalten! Laut waren die zwei, er und sein Zelt-Kumpan, das können Sie sich gar nicht vorstellen!!« Der Mann geriet in Fahrt, während seine unscheinbare Frau fest einen Fleck auf der Tischplatte fixierte. »Bis in die Nacht hinein haben die gestritten, manchmal! Sich angebrüllt, dass der halbe Platz nicht schlafen konnte! Und erst diese Ausdrücke!« Sein Blick glitt zu den Mädchen, die hastig nach ihren Nutellabroten griffen. »Hier sind Kinder, verstehen Sie?«
Doch worum es bei den Auseinandersetzungen gegangen war, wusste der selbsternannte Sittenwächter nicht zu sagen.
Nach und nach fragten sich Claudia und Peter durch den gesamten unteren Platzteil, und fast jeder, mit dem sie sprachen, kannte Darius zumindest vom Sehen. Vor allem die Frauen, wie Claudia bedrückt feststellte. Über Darius’ Pläne, wo er hingefahren sein könnte, vermochte allerdings niemand Auskunft zu geben.
Deprimiert machte sich Claudia auf den Rückweg zum Wohnwagen, während Peter noch zum Campingplatzladen wollte, Obst und Baguette holen.
Mittlerweile war der Großteil der Touristen zu ihren Tagesvergnügungen aufgebrochen oder zum Baden. Wohnwagen und Wohnmobile ruhten still und verschlossen, die Jalousien heruntergelassen, um die sich stündlich steigernde Hitze auszusperren.
Am Eingang von Angels Zelt schnüffelte ein Hund herum, als ob er Futter suche, eins dieser Minitiere in Rattengröße. Auch er war allein, ohne seine Menschen, und Claudia beobachtete ihn eine Weile, ehe sie den Wohnwagen aufsperrte, um sich eine Flasche Saft und eins der blinden Kunststoffgläser zu holen, die zum Inventar des Wagens gehörten. Als sie wieder herauskam, kniete eine Frau mit rötlichblondem, schulterlangem Haar bei dem Tier und fütterte es mit Bröckchen von irgendetwas aus ihrer Hand.
»Il a faim«, sagte sie erklärend, als Claudia zu ihr herübersah. »Er hat Hunger, der arme Kerl.«
»Gehört er Ihnen?«
»Non. Er gehört niemandem, der Kleine.« Sie lockte ihn auf ihren Schoß, und er kam willig, nicht mehr hungrig nach Essen jetzt, sondern begierig nach der Zärtlichkeit, welche ihm die streichelnden Hände versprachen.
Claudia goss sich Saft ein und überlegte, wie sie und Peter weiter vorgehen sollten. Auf einmal fiel ein Schatten über sie, und die fremde Frau stand dicht vor ihr, den Hund auf dem Arm, ihn abwesend liebkosend. »Haben Sie mein Kind gesehen?«, fragte sie, und in ihren Augen lag die gleiche Sehnsucht, die bis vor kurzem das Tier ausgestrahlt hatte.
»Es gibt viele Kinder am Platz«, sagte Claudia. »Es tut mir Leid, ich weiß nicht, welches zu Ihnen gehört. Ist es ein Mädchen oder ein Junge?«
Der Blick der Französin schien sich zu verschleiern, und plötzlich wandte die Frau sich ab und ging ohne Antwort davon.
3. Kapitel
Die Nacht war von jeher Kens Zeit gewesen, schon in jenen Tagen, als er noch im Heim wohnte, dort, wo man tagsüber nie allein sein konnte. Dort hatte er sich angewöhnt, nachts aufzustehen, sich an das vergitterte Fenster zu stellen und von einem Leben in Freiheit zu träumen. Und die Nacht war seine Zeit geblieben, als Darius, den er selten Onkel nannte, ihn in die Toskana geholt und ihm eine neue Heimat gegeben hatte. In jener ersten Zeit auf Darius’ Paradiso, als Ken alles und jeder fremd war, hatte er sich regelmäßig nachts aus dem Haus geschlichen, um seinen privaten Vergnügungen nachzugehen, und diese Gewohnheit ließ sich nicht mehr ausrotten.
Glücklicherweise schlief er in seinem eigenen Zelt – ein Geschenk Peters –, und so hatte Ken keine Mühe, in der Dunkelheit ungesehen und ungehört aufzustehen. Wie damals in den ersten Tagen auf dem Paradiso wusste er nicht wohin, aber jetzt stahl er sich nicht aus Verzweiflung hinaus, sondern aus Neugier und dem wohl immer ungestillt bleibenden Drang nach gitter- und grenzenloser Freiheit, die sich nirgendwo anders als unter der Weite des Sternenhimmels finden ließ.
Zuerst wählte er den Weg zum Fluss, kletterte vorsichtig über die vom Mond schwach beleuchteten Felsen zum dunklen Wasser hinab, wo er sich ans Ufer kauerte und auf die Geräusche der Nacht lauschte: das Rauschen der kleinen Stromschnellen, das Klatschen, mit dem ein springender Fisch wieder im Wasser landete, das Kläffen eines Hundes in der Ferne.