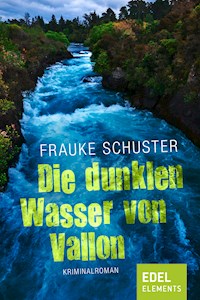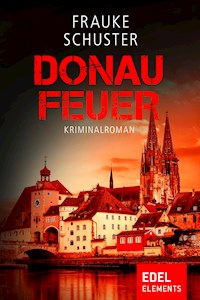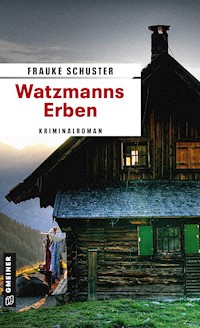
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalist Paul Leonberger
- Sprache: Deutsch
Paul Leonberger kehrt nach vielen Jahren in seinen Heimatort Bad Reichenhall zurück, wo er einst des Mordes an seiner Schwester verdächtigt wurde. Doch anstatt die traumatische Vergangenheit begraben zu können, wird er erneut mit dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau konfrontiert und muss zur eigenen Entlastung den Mörder finden. Aber bald gibt es einen weiteren Toten, und fast scheint es, als sei der brutale König aus der alpinen Sagenwelt in furchtbarer Form wieder zum Leben erwacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauke Schuster
Watzmanns Erben
Kriminalroman
Zum Buch
Sagenhaft Vor über zwanzig Jahren hat Paul Leonberger der Stadt seiner Kindheit erbittert den Rücken gekehrt. Nun kommt er als erfolgreicher Journalist nach Bad Reichenhall zurück und hofft, die Gespenster seiner Vergangenheit endgültig begraben zu können. Doch dann findet ausgerechnet Paul die unbekleidete Leiche einer jungen Frau am Saalachwehr und wird, wie schon als Siebzehnjähriger, des Mordes verdächtigt. Als auch noch die Schwester der Ermordeten ungefragt bei ihm einzieht, vermischen sich in Pauls Gehirn Vergangenheit und Gegenwart in alptraumhafter Weise. Erst allmählich entwickelt sich zwischen dem kratzbürstigen Journalisten und der jungen Trinkerin eine vorsichtige Freundschaft. Doch dann gibt es einen weiteren Toten. Um sich selbst zu entlasten, versucht Paul zu ermitteln. Und seine Suche nach dem grausamen Mörder führt ihn in die Einsamkeit der Berge: dahin, wo einst der sagenhafte König Watzmann sein brutales Regime ausübte.
Frauke Schuster, Jahrgang 1958, verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Ägypten, wo sie eine deutsch-arabische Begegnungsschule besuchte. Zurück in Deutschland studierte sie Chemie an der Universität Regensburg und arbeitete anschließend mehrere Jahre für eine Chemie-Fachzeitschrift. Neben der Liebe zum Orient und den Naturwissenschaften spielt die Schriftstellerei eine Hauptrolle in ihrem Leben. Frauke Schuster schreibt Kriminalromane sowie Kurzgeschichten auf Deutsch und Englisch. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und einer Unzahl Bücherregale in einem kleinen Ort in Südbayern. In ihrer Freizeit liebt sie es zu reisen und wandert u.a. gern im Berchtesgadener Land.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Luke-SX / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5344-1
Prolog
Der Junge lehnte am Stamm einer hohen Fichte und blickte hinab ins Tal, ohne es bewusst zu sehen. Im Lauf seines 20-jährigen Lebens hatte er etliches einstecken müssen, sich aber nie zuvor derart mies gefühlt, derart wertlos. Und das Schlimmste war, dass ihm niemand aus dieser Situation heraushelfen würde. Heraushelfen konnte. Gab es überhaupt noch eine Chance für ihn nach allem, was geschehen war? Mutlos rieb er sich über die Stirn, setzte sich auf einen Felsblock.
Obwohl er selten in die Berge ging, empfand er die Stille als beruhigend, und nach einer Weile regte sich trotz allem ein Funke Hoffnung. Sicher, er hatte viele Chancen leichtfertig vertan, nie kapiert, wie wertvoll sie waren. Aber vielleicht hatte es diesen Schock gebraucht, damit er endlich eine davon ergriff? Falls man ihm noch eine gewährte, eine allerletzte … Er schwor sich, diesmal würde sich alles ändern. Sein Leben würde sich ändern. Nein, er würde es ändern. Verantwortung übernehmen. Die Vergangenheit hinter sich lassen. Für immer.
Er bückte sich nach der bereitliegenden Flasche, verschloss sie mit einem Stopfen aus Moos und Blättern. Mit Hilfe eines Aststücks grub er ein Loch in den lockeren Boden, bettete den gläsernen Behälter behutsam hinein und schob mit dem Schuh Erde und Reisig darüber, als verstecke er einen Schatz fürs Geocaching. Eine Ära ging zu Ende. Musste zu Ende gehen, selbst wenn damit schmerzliche Abschiede verbunden waren.
Als er die Erde festtrat, beschloss der Junge, als Symbol für den neuen Weg seines Lebens auch für den Abstieg ins Tal einen ihm bis dahin unbekannten Pfad zu wählen. Verlaufen konnte er sich kaum, schließlich musste er im Prinzip einfach immerzu abwärts gehen.
Eine halbe Stunde später erschienen wie von Geisterhand gewebt erste Nebelschwaden zwischen den Bäumen. Der Junge fröstelte in seinem rot karierten Flanellhemd. Warum hatte er keinen Pullover mitgenommen, keine Jacke? Jeder Depp, selbst der dämlichste Tourist wusste, dass das Wetter in den bayrischen Bergen unberechenbar war. Sein Leichtsinn gehörte zu jener Vergangenheit, die der Junge abzustreifen gedachte. Und der Nebel wurde unbarmherzig dichter, dämpfte sämtliche Geräusche.
Irgendwann wurde dem Jungen klar, dass er sich doch verirrt hatte. Egal, sagte er sich trotzig, es war Juli, nicht die Jahreszeit, in der man am Berg erfror. Außer im Hochgebirge natürlich. Doch der Weg, den er genommen hatte, schien sich in Nichts aufgelöst zu haben, und der Junge wusste, dass das Gelände bei der schlechten Sicht nicht ungefährlich war. Steile Felswände, Steinschlag und rutschige Pfade hatten schon manchen Wanderer unsanft ins Jenseits befördert.
Als er vorsichtig weiterging, immer darauf bedacht, nicht in einen zu spät erkannten Abgrund zu stürzen, meinte er plötzlich, das Lied einer Flöte zu hören. Eine leise, traurige Melodie, halb erstickt durch den Nebel. Oder einfach weit entfernt? Trotzdem stahl sich ein Lächeln auf die Miene des Jungen. Er war nicht allein, auch noch ein anderer später Wanderer war unterwegs. Vermutlich jemand, der sich gut in der Gegend auskannte, sonst würde er nicht seelenruhig in dieser Nebelsuppe spielen.
Der Junge drehte den Kopf, versuchte zu erraten, aus welcher Richtung die Töne herandrifteten. Von hinten? Oder von links? Sollte er versuchen, den Flötenspieler zu treffen? Möglicherweise kannte der einen schnellen Weg ins Tal?
Nach kurzem Überlegen nickte sich der Junge selbst zu und wandte sich nach links. Sein Fuß blieb in einer Dornenranke hängen, er stürzte, und als er sich wieder hochrappelte, verstummte die Melodie. Und der Nebel schien näher zu rücken, als wolle er den Jungen zwischen undurchsichtigen weißen Wänden einsperren.
»Hallo?« Die Stimme des Jungen klang heiser. Eben noch hatte er sich zuversichtlich gefühlt, jetzt spürte er eine unbestimmte Angst. Knackte da nicht ein Ast schräg hinter ihm? Er fuhr herum, sah nur Nebel und fühlte, wie die Feuchte durch sein Hemd kroch.
»Ist da jemand?«
Ein Husten, halb unterdrückt, irgendwo zwischen den Bäumen.
»Warum versteckst dich?« Der Junge wurde ärgerlich. Hörte einen halblauten Knall und spürte einen schmerzhaften Schlag am linken Oberschenkel, der ihn gegen einen Felsen warf. Entsetzt starrte er auf das Blut, das durch seine Jeans sickerte, und begriff, dass ihn ein Schuss getroffen hatte. Aus einer Waffe mit Schalldämpfer.
»Bist narrisch? Hör auf mit dem Scheiß! Ich bin doch kein Viech!«
Heiseres Lachen. Im nächsten Moment hörte der Junge das Knallen erneut. Diesmal allerdings hatte der Schütze das anvisierte Ziel verfehlt, und der Junge versuchte zu rennen, wollte blindlings den Hang hinab fliehen. Doch sein Bein machte nicht mit, er fiel zwischen die Fichten, kämpfte sich mühsam hoch und stolperte mit zusammengebissenen Zähnen vorwärts.
Der nächste Schuss streifte seine linke Seite.
»Was bist du für ’n Irrer? Warum sagst nichts?« Zorn und Furcht machten sich im Kopf des Jungen breit, doch der andere antwortete nicht. Stattdessen knallte eine Kugel auf den Felsen neben dem Verletzten, der sich rasch zur Seite warf.
Der will mich umbringen! Der Verrückte will mich erschießen! Die Silhouetten der Bäume flimmerten vor den Augen des Jungen. Halb ohnmächtig vor Schmerz und Schock schaffte es der Gejagte mit äußerster Mühe, sich hinter den Felsen zu ziehen. Obwohl er wusste, dass er sich auch dort nicht lange würde sicher fühlen dürfen.
Er presste die Lippen aufeinander, um das Zittern, das seinen Körper zu vereinnahmen drohte, zu stoppen, und schob die Hand in die Jeanstasche. Zog das Butterflymesser heraus.
»Zeig dich, du feiger Arsch!« Er merkte, dass seine Stimme nicht so kraftvoll wie gewohnt rüberkam. Aber vielleicht war das nicht schlecht. Denn seine beste Chance bestand darin, den Schützen so nah an sich heranzulocken, dass er ihn mit der Klinge außer Gefecht setzen konnte.
Lange schreckliche Minuten blieb alles still. Bis auf ein gelegentliches Knacken im Unterholz, das den Jungen befürchten ließ, dass der andere versuchte, hinter den Felsen zu gelangen. Und schließlich verstummten selbst diese Laute. Was war geschehen? Hatte der Jäger einen neuen, für seine perversen Zwecke besser geeigneten Standort gefunden? Wartete nun darauf, dass der wabernde Nebel sich um das Opfer herum ein wenig lichtete?
Der Junge ärgerte sich, sein Smartphone nicht mitgenommen zu haben. Ausgerechnet an diesem Tag hatte er es absichtlich zu Hause gelassen, hatte nicht in Versuchung geraten wollen, es zu benutzen. Wollte sich nicht ablenken lassen, wollte wirklich etwas ändern. Wirklich.
Und jetzt? Als die Flötenmelodie erneut einsetzte, meinte der Junge verrückt zu werden. Welcher Irre würde seinem Opfer Musik vorspielen, ehe er es tötete? Ein Fünkchen Hoffnung flammte auf. Sollte es sich bei dem Schützen um einen echten Irren handeln? Einen geistesgestörten Wilderer, der ab und an vergaß, was er eigentlich tun wollte, und deshalb zur Flöte griff?
Die Hand des Jungen krampfte sich um das Messer. Bestand die Möglichkeit, sich nun, da der andere mit seinem Instrument beschäftigt war, heimlich davonzustehlen? Doch als ihn eine Woge der Schwäche überflutete, begriff der Junge, dass er es nicht schaffen würde aufzustehen und fortzurennen. Für einen Moment fragte er sich, ob er um Hilfe schreien sollte. Aber damit würde er unweigerlich die Aufmerksamkeit des Schützen wieder auf sich lenken.
Nein, die einzige Chance bestand wirklich darin, dem Angreifer so nahe zu kommen, dass man ihm das Messer in den verdammten Leib rammen konnte. Und wenn der Schütze sich nicht heranlocken ließ, sei es aus Vorsicht oder weil er eben schwachsinnig war, musste sein Opfer es wagen, zu ihm zu robben. Was schwierig sein würde. Erstens wusste der Junge nicht genau, wo der Flötenspieler steckte. Zum anderen dürfte es sich als unmöglich erweisen, sich über Laub und Zweige am Boden zu ziehen, ohne Geräusche zu verursachen und damit sein Vorhaben zu verraten.
Während er hin und her überlegte, merkte der Junge, dass die Musik lauter wurde. Der andere rückte näher. Würde er sich endlich zeigen?
Ich muss mich tot stellen, schoss es dem Jungen durch den Kopf. Oder zumindest ohnmächtig. Bestimmt beugt er sich dann über mich und ich kann …! Die Hand, die das Messer umklammerte, schmerzte vor Anspannung.
Es fiel schwer, die Augen zu schließen und den Kopf abgewandt zu lassen, als die Melodie ein zweites Mal verstummte, sich dafür aber Schritte näherten. Vorsichtig und langsam.
Ich hab nur eine einzige Chance, wusste der Junge. Der erste Stich muss sitzen, den anderen so schwer treffen, dass er mich nicht mehr abknallen kann.
»Stell dich nicht an! Die zwei Kugeln bringen keinen um!« Die Stimme klang nicht wütend. Kalt eher. Was dem Jungen einen Schauer über den Rücken jagte.
»Schau mich an, wenn ich mit dir red! Oder ich jag dir augenblicklich eine Kugel durchs Hirn!«
Der Junge wollte herumwirbeln, das Messer werfen. Doch jäher Schmerz in seiner Seite, ausgelöst durch die heftige Bewegung, ließ alles vor seinen Augen verschwimmen.
Das Messer flog zu kurz, der Angreifer lachte, und der Junge wusste, er hatte seine Chance vertan. Möglicherweise für immer.
Kapitel 1
Das Gesicht schwebte über Paul wie ein blasser Mond. Eine weiße Hand kam auf ihn zu, berührte seine Wange. Nass und eiskalt. Als Paul in die Höhe fuhr, klang ihm ein Schrei im Ohr nach, und er brauchte eine lange Minute, um zu begreifen, dass er nur geträumt hatte. Er rollte sich aus dem Bett, wollte das Fenster aufschieben und stellte fest, dass das nicht ging. Und erinnerte sich erst jetzt, dass er nicht mehr im dritten Stock über der Rue Pigalle wohnte, sondern im Haus seiner Kindheit im Berchtesgadener Land.
Mit bebenden Fingern öffnete er den Riegel, stieß beide Fensterflügel weit auf und vermisste augenblicklich den Lärm des nächtlichen Paris, der ihm in den letzten Jahren so vertraut geworden war. Hier, am Ortsrand von Bad Reichenhall, regierte nachts die Stille. Falls nicht gerade jemand schrie, weil ihm die Weiße Frau von Großgmain erschienen war. Oder ein anderes weibliches Wesen.
Während er in die Nacht hinausblickte, sah Paul die Frau aus dem Traum klar vor sich: jung, mit Hunderten von Sommersprossen und langem blonden Haar, das ihr Gesicht zur Hälfte verdeckte. Haar, in dem sich grüne Algenfäden verfangen hatten. Paul schauderte und schloss das Fenster so heftig, dass ein paar Blättchen des weißen Lacks absprangen. Die alte Bude gehörte dringend renoviert. Aber es widerstrebte ihm, damit anzufangen. Weil eine Renovierung etwas Endgültiges schien. Ein Beweis dafür, dass er in Zukunft hier zu leben gedachte. Und Paul hatte nicht die geringste Ahnung, ob er das aushalten würde.
Zuhause. Sollte das Wort nicht anheimelnd klingen statt abschreckend? Wie ein eingesperrter Wolf lief Paul in dem Schlafzimmer, das einst seinen Eltern gehört hatte, auf und ab. Bis er die Enge nicht mehr ertrug und sich ankleidete. Im Flur riss er eine Jacke vom Haken und trat in die stille Straße hinaus.
Hinter dem Dach konnte er die massive Silhouette des Predigtstuhls erkennen, des Hausbergs von Reichenhall, dessen Pfade er früher in- und auswendig kannte. Anderen mochte der nächtlich finstere Berg bedrohlich erscheinen, für Paul war er ein Vertrauter, ein Fixpunkt in einer unruhigen Welt. Paul zögerte einen Moment und machte sich dann auf den Weg zum Fluss. Den Weg, den er in seiner Kindheit oft gegangen war, und den er seit seiner Rückkehr beharrlich gemieden hatte. Weit hinter ihm schlug eine Uhr Mitternacht. Geisterstunde, dachte Paul. Doch in einer Kleinstadt wie dieser gingen wohl selbst die Geister früh zu Bett. Jedenfalls begegnete er keinen.
Das Rauschen des Saalachwehrs ließ sich schon von Weitem vernehmen. Wenigstens ein Laut, der die Stille unterbrach. Doch plötzlich mischte sich etwas anderes in das Brausen des Wassers: Fetzen rhythmisch hämmernder Musik. Paul trat an das Geländer, das die Straße vom Abhang zum Fluss trennte, und blickte zu der Gruppe junger Leute hinab, die auf der Kiesbank zwischen Wehr und Brücke hockte, die Boombox zur vollen Lautstärke aufgedreht.
Mit dem Lärm des mehrstufigen Wehrs auf der einen und dem hämmernden Metal-Sound auf der anderen Seite mussten sie gewiss schreien, wenn sie einander etwas mitteilen wollten. Oder wollten sie gar nicht?
Paul kam die Jugend in den Banlieues in den Sinn, die zornigen jungen Menschen in den Pariser Vorstädten, über die er als Journalist oft geschrieben hatte. Nachdenklich fragte er sich, wie das Leben dieser Mädchen und Jungen hier unten sein mochte. Trafen sie einander öfter an dieser Stelle? Feierten sie? Einen Ausbildungsabschluss etwa oder einen Geburtstag? Unter dem Schatten eines alten Baums, dessen üppige Krone ihn vor den Blicken der jungen Leute verbarg, studierte Paul die Gruppe, als wolle er sie porträtieren.
Sie saßen in einem losen Halbkreis vor einem Feuer, das ihnen die Polizei auf dem Kies kaum verbieten würde: zwei Männer und zwei junge Frauen. Ein Stück abseits, auf der anderen Seite des Feuers, stand ein drittes Mädchen, den Kopf im Nacken. Im Schein der Flammen rieselte ihr langes Haar wie ein goldener Wasserfall über ihren Rücken. Selbstvergessen, ohne die anderen zu beachten, die eine Flasche kreisen ließen, begann sie zu tanzen. Langsam, dem hämmernden Sound der Boombox trotzend, nach einer Melodie, die sie nur in ihrem Kopf zu hören vermochte. Auch vor ihr lag eine Flasche, und die junge Frau nahm sie zum Zentrum ihres selbst erfundenen Tanzes.
Mit wiegenden Hüften und erhobenen Armen näherte sie sich der Flasche, entfernte sich wieder von ihr, drehte eine Pirouette. Einer der Jungs klatschte und schrie »Bravo!« mit einer Zunge schwer vom Alkohol.
»Zeig uns was! Geil uns auf!«, brüllte der andere, nicht ganz so betrunken wie sein Kumpan.
Paul biss sich auf die Lippen. Was zuerst wie eine idyllische Feier erschienen war, drohte mit einem Mal hässliche Züge anzunehmen. Er sagte sich, dass er besser verschwinden sollte, dass ihn die jungen Säufer nichts angingen, und blieb dennoch. Vielleicht, weil er die berufliche Neugier nie ganz abzustellen vermochte?
Zunächst tat das Mädchen, als höre es die Worte des Mannes nicht, vernahm in ihrer Entrücktheit vielleicht wirklich nichts außer dem Lied im Kopf. Doch nach ein paar Minuten begann sie an ihrem weißen Top zu ziehen und zu zerren, bis sie es schaffte, es abzustreifen. Beifallsschreie aus der Clique. Das Mädchen ignorierte sie, tanzte weiter, nur in dem Minirock und einem Büstenhalter in Rosa und Weiß. Erst jetzt fiel Paul auf, dass sie keine Schuhe trug. War sie barfuß gekommen, oder lagen die Schuhe hinter den wenigen Sträuchern? Oder sogar im kalten Wasser des Bergflusses?
Die Arme jetzt auf Schulterhöhe ausgebreitet, den flachen Bauch vorgestreckt, umtanzte das Mädchen die Flasche zweimal, dreimal, ehe ihre Finger am Verschluss des BHs zu nesteln anfingen. Doch es gelang ihr nicht, ihn zu öffnen, und so zog sie auch den Büstenhalter über den Kopf, ließ ihn neben das Top und die Flasche fallen, als ob er zu einer Opferstelle gehörte.
Die Musik wummerte und dröhnte, das Wehr rauschte. Die Jungs am Feuer beachteten die Tänzerin kaum mehr, der Alkohol stumpfte sie ab.
Paul wandte für einen Moment den Blick ab, fühlte sich wie ein Spanner. Als er wieder zu der Gruppe sah, stand eines der anderen Mädchen auf und hielt der Tänzerin bittend das weiße Top hin. Doch die schlug den Arm der Gefährtin beiseite. Langsam, entweder, weil sie durch den Alkohol nicht mehr sicher auf den Beinen war, oder weil die groben Flusskiesel das Gehen erschwerten, kehrte das zweite Mädchen zum Feuer zurück.
Der Busen der Tänzerin leuchtete orangerot im Feuerschein, und Paul schluckte, als die Frau den Gürtel ihres Minirocks löste. Wollte sie sich weiter ausziehen? Komplett? Hör auf!, hätte Paul am liebsten gerufen. Geh heim, leg dich ins Bett und schlaf deinen Rausch aus! Doch er schwieg und sah zu, wie der Rock zu Boden glitt. Darunter trug die Tänzerin einen winzigen rosafarbenen Tanga.
Das Mädchen tanzte weiter, strich sich mit lasziven Bewegungen über die Kluft zwischen den Brüsten, streichelte die dunklen Warzen. Plötzlich fühlte sich Paul abgestoßen. Von der Szene, der Säuferclique und von sich selbst, weil er sie beobachtete wie ein schmieriger Voyeur. Abrupt wandte er sich ab, um nach Hause zu gehen. Und während er die Metal-Musik immer weiter hinter sich ließ, meinte er plötzlich das zarte Spiel einer Flöte zu hören. Doch als er sich in der Straße umsah, konnte er niemanden entdecken.
Später, als Paul sich auf der durchgelegenen Matratze in seinem Elternhaus ausstreckte, empfand er unbestimmte Trauer. Denn tief im Innern spürte er, dass die junge Tänzerin nicht glücklich war. Genauso wenig wie er selbst, der 38-jährige Journalist, in dieser Bruchbude am Rande einer bayrischen Kleinstadt.
Am nächsten Morgen stellte Paul wieder einmal fest, dass der edle Tagesrucksack, den er in Paris verwendet hatte, für eine Wanderung in den Bergen zu klein war. Er sollte sich endlich einen anständigen Tourenrucksack besorgen. Für diesmal musste die Cityversion allerdings reichen. Eine Flasche Wasser flog hinein, eine Packung Waffeln, die Regenjacke. Und natürlich das Messer. Kein Schweizer Messer, wie er es früher mit sich getragen hatte, sondern das edle Lieblings-Laguiole mit den Griffschalen aus Wacholderholz. Das Smartphone wanderte in die Hosentasche, auch wenn Paul sicher war, er würde jeden Weg, jeden Steig auch ohne GPS mit geschlossenen Augen finden.
Er warf den Rucksack in den Wagen, schaute kurz zum Himmel. Plante keine lange Tour, wollte mit der Gondelbahn auf den Predigtstuhl und von dort weiter zum Karkopf, um den eigenen Kopf freizukriegen. Viele Touristen würden ihm nicht in die Quere laufen. Es hatte den ganzen Morgen über penetrant genieselt, sollte aber laut Internet bald aufklaren.
Als er die Saalachbrücke erreichte, bei der der Fluss über das Wehr rauschte, trat Pauls Fuß wie von selbst auf die Bremse. Die Tänzerin der Nacht. Wann mochte sie nach Hause gegangen sein?
Überzeugt davon, dass er gleich weiterfahren werde, sperrte er den Wagen nicht ab. Warum es ihn überhaupt an den Fluss hinab zog? Vielleicht, weil er sich vergewissern wollte, dass die nächtliche Party eine unbedeutende Episode gewesen war? Sodass er sie abhaken und den freien Samstag unbeschwert würde genießen können? Oder weil ihn die Tänzerin an jemanden erinnerte?
Entgegen der Vorhersage nahm der Regen zu. Paul stand auf den hellen Steinen, zu seinen Füßen die Reste des erloschenen Feuers. Er ließ den Blick über die Kiesbank schweifen und stutzte: Dort hinten, das rote Ding! War das nicht ein Schuh?
Das Mädchen lag hinter einem kümmerlichen Weidenbusch, als schliefe sie, doch ihre Augen blickten zum Fluss. Sie war vollkommen nackt, trug lediglich ein geflochtenes Lederarmband am linken Handgelenk. Paul fiel neben ihr auf die Knie. Nachts, in der Dunkelheit, hatte er ihr Gesicht nur vage sehen können, doch jetzt …
»Sonja!« Der Name drängte heiser über seine Lippen, während seine Rechte dem Mädchen das blonde Haar aus der Stirn strich und dann nach einem Puls tastete, von dem er befürchtete, dass er ihn nicht finden würde.
»Verdammt!« Paul ergriff die Hand der jungen Frau, fühlte die Kälte. Außer den Würgemalen am Hals ließen sich an dem schlanken Körper keine Spuren von Gewalt erkennen. Langsam stand Paul auf, sah sich um. Von den Kleidern des Mädchens keine Spur, nur der rote Ballerina lag einsam auf dem Kies. Und der Regen ließ die Tote aussehen, als habe sie geweint. Weine noch immer.
»He, Sie! Was treiben S’ denn da?«
Erschrocken fuhr Paul herum, hatte über dem Tosen des Wassers niemanden kommen gehört. Der Mann, der hinter ihm auftauchte, war mittelgroß, mit zu langem fettigem Haar, Stoppelbart und schiefer Nase. Er mochte zwischen 40 und 50 sein, schleppte mindestens 15 Kilo Übergewicht mit sich herum, und weder seine abgewetzten Jeans noch das verwaschene schwarze T-Shirt mit dem Raptoren-Aufdruck zeugten von Reichtum.
»Ich …« Paul begriff, wie schwierig seine Anwesenheit zu erklären sein würde. »Ich hab grade eben das Mädel hier gefunden.«
»Ist s’ besoffen?« Der andere trat näher. Rasch streifte Paul seinen nassen Pullover ab und warf ihn über den Unterleib der jungen Frau, obwohl ihn die Polizei dafür anpfeifen würde. Als Journalist hatte er zu wissen, wie man sich beim Auffinden einer Leiche verhalten musste.
»Sie ist tot!« Er konnte den Blick kaum von dem sommersprossigen Gesicht der jungen Frau abwenden. Sie mochte so um die 20 bis maximal 25 sein. Zu jung, um ihr Leben gelebt zu haben. So wie Sonja mit ihren 15 Jahren zu jung gewesen war … Bloß nicht an Sonja denken, jetzt nicht an Sonja denken!
»Haben S’ schon die Polizei gerufen?«
Während der Dicke das Mädchen anstarrte, ging Paul zum Ufer hinab. Die leeren Flaschen des Vorabends lagen zwischen den Steinen verstreut, eine davon zerbrochen. Wodka, Gin, Bier. Wann immer Paul mit Sonja hier gewesen war, hatten sie ihren Müll mit heimgenommen …
»Latschen S’ doch nicht überall rum! Sie zertrampeln alle Spuren«, schimpfte der vermutlich vom Tatort gebildete Dicke. Paul gab vor, nicht zu hören. Als Journalist musste er in einem solchen Fall immer auch an die Story denken, die sich hinter diesem Tod verbarg. Und wie stets empfand er dabei ein leises Gefühl von Scham, zwang sich jedoch routiniert, es zu vertreiben und ein paar Handyaufnahmen zu schießen.
Der andauernde Regen ließ ihn schließlich unter den Bogen der Luitpoldbrücke flüchten, wohin sich der Dicke, der Paul vage bekannt vorkam, längst begeben hatte. Gemeinsam sahen sie zu, wie zwei Uniformierte auf den Kiesstrand herunterstapften, gefolgt von einem gut genährten Mann in Zivil.
»Bin ich Ihnen schon irgendwo begegnet?« Xaver Porant, der glatzköpfige Kommissar, runzelte die Stirn, während er Paul von oben bis unten musterte. »Sind S’ ein Hiesiger?«
»Paul Leonberger. Wahrscheinlich haben Sie mein Foto in der Zeitung gesehen. Ich arbeite für ›Reichenhall heute‹.« Paul fröstelte in seinem nassen Hemd, und er zog seinen Ausweis aus der Tasche, in der Hoffnung, das übliche Prozedere abkürzen zu können. Und damit der einen oder anderen unangenehmen Frage zu entgehen. Was leider nicht klappte.
»Was haben S’ denn überhaupt hier getrieben, bei dem Regen?«, fragte Porant, nachdem er sich die Tote angesehen und dann dem eben anrückenden Spurensicherungsteam überlassen hatte. Zusammen mit Pauls Pullover.
»Ich hab den Kerl von der Brücke aus entdeckt«, sagte der Dicke. »Weil, ich geh fast jeden Morgen hier lang.«
»Sie hab ich nicht gemeint, Jakob.« Porant sah Paul an, und der sagte so leichthin wie möglich: »Mir war einfach danach, zum Wehr runter zu schauen.« Er schob den Ausweis zurück in die Geldbörse. »Ich hab ein paar Jahre im Ausland gelebt. Versuche gerade, in Reichenhall wieder heimisch zu werden. Erinnerungen aufzufrischen.«
Porant betrachtete ihn. Lange. Ließ seinen Blick erneut an Paul hinauf- und hinabwandern. »Und das probieren S’ ausgerechnet heute. Bei dem Sauwetter.«
»Laut Internet hätte der Regen schon vor einer Stunde aufhören sollen.« Paul entschloss sich zum Gegenangriff. »Hören Sie, ich bin klatschnass, und der Wind ist kalt. Sie kennen meinen Namen und meine Arbeitsstelle. Kann ich also heim und mich umziehen? Eh ich mir den Tod hol?«
»Machen S’ nicht auf dramatisch. Sagen S’ mir lieber, ob Sie die Kleine kennen!«
Paul schüttelte den Kopf. Nein, diese Tote kannte er nicht. Auch wenn sie ihn noch so sehr an jemand anderen erinnerte.
Als er zu seinem Wagen hinaufging, kam der Kommissar hinterher.
»Sie wollten in die Berge? Was dagegen, wenn ich Ihren Rucksack anschaue?«
Paul stieg ein und blickte den Mann lediglich an. Porant hob in übertrieben entschuldigender Geste die Hände. »Ist mir selbst unangenehm, aber als Reporter wissen S’ ja, wie’s läuft: Wenn ich irgendwas versäume, zerreißt mich die Klatschpresse am nächsten Tag in der Luft.«
Ohne auf Antwort zu warten, setzte sich der Kommissar auf den Rücksitz neben den Rucksack. »Teures Modell, aber nur bedingt wetterfest.«
»Sie machen unnötig meine Sitze nass.«
»Über das ›unnötig‹ reden wir vielleicht ein andermal.« Porant wischte sich mit dem Ärmel über die feuchte Glatze und studierte den Inhalt von Pauls Marschgepäck.
»Waffeln? Eine anständige Brotzeit schaut anders aus.«
»Dann besorgen Sie mir eine!«
»Und das Messer hier …« Porant hielt Pauls Laguiole in die Höhe. »Das kostet mindestens 150.«
»Neidisch?« Paul drehte sich um und nahm dem Kommissar sein Lieblingsmesser aus der Hand. »Beschlagnahmen dürfen Sie’s trotzdem nicht.«
»Und wieso glauben S’ das?«
»Weil ich als Reporter auf jede Kleinigkeit achte. Und deshalb vermute, dass das Mädchen erwürgt wurde. Nicht erstochen.«
Der Kommissar stieg aus, beugte sich jedoch noch einmal zum Fenster und klopfte gegen die Scheibe, die Paul widerwillig hinabließ.
»Wir sehen einander gewiss bald wieder, Herr Leonberger!«
»Va te faire foutre!«, knurrte Paul. Aber erst, nachdem er das Fenster geschlossen hatte. Denn leider wusste er nur zu gut, dass die Polizei ihn jetzt im Visier hatte. Und sich mit seiner Vergangenheit befassen würde.
Trotzdem noch in die Berge? Paul tendierte zu einem Ja. Jetzt hatte er das Durchatmen in sauberer Höhenluft doppelt nötig. Außerdem riss die Wolkendecke auf, der Regen hatte aufgehört. Aber Pauls Hemd klebte feucht an seinem Rücken, und sein Pullover war konfisziert. Er würde sich vor dem Ausflug tatsächlich umziehen müssen.
Zu Hause zerrte er ein trockenes Shirt aus dem Schrank und wählte, noch ehe er es überstreifte, die Nummer seines Assistenten. Der Schorsch hockte sowieso ständig am PC, würde problemlos zu erreichen sein, Wochenende hin oder her. Außerdem wollte Paul auf keinen Fall selbst über die Sache schreiben müssen. Eine Sache, die zu viele alte Emotionen wachzurütteln drohte.
Als er dem Schorsch die Eckdaten des Falls sowie die Fotos übermittelt hatte, holte er sich einen Pullover und fuhr in den Nachbarort Gmain. Für die Tour zum Karkopf wäre es zwar noch nicht zu spät, aber Paul verspürte keine Lust mehr, mit fröhlichen Touristen in die Kabinenbahn gepresst zu werden, die »Oh!«-Schreie zu hören, wenn die Gondel bei der Fahrt über die Pfeiler schaukelte. Er wollte allein sein. Allein mit sich und den Bergen, die er im flachen Paris so sehr vermisst hatte.
Doch auch wenn er wenig später tatsächlich allein durch Nadelwald und über Almwiesen marschierte, wollte sich die Ruhe der Landschaft nicht auf sein aufgewühltes Inneres übertragen lassen. Paul wusste, dass seine DNA auf dem Gesicht der Leiche zu finden sein würde, allerdings zum Glück nicht auf ihrem Unterleib. War sie missbraucht worden, die junge Tote?
Und was würde der schmierige Typ namens Jakob der Polizei erzählen? Hatte er von der Straße aus beobachtet, wie Paul das Mädchen geradezu liebkoste? Paul runzelte die Stirn. Ob der Mann wirklich jeden Tag diesen Morgenspaziergang unternahm? Oder behauptete er das nur, um sich selbst zu schützen?
Als er über den Dicken nachgrübelte, stieg eine Erinnerung auf: ein stämmiger Junge auf dem Schulhof, ein paar Jahre älter als Paul selbst. Ein Junge namens Jakob, den auch in den unteren Klassen alle kannten, weil er eine Vielzahl kleiner Geschäfte tätigte, um sein Taschengeld aufzubessern. Sofern er überhaupt eins bekam. Konnte der Mann vom Fluss der Pausenhofhändler von einst sein? Möglich wäre es.
Dann jedoch drifteten Pauls Gedanken in eine andere Richtung. Ihm war klar, dass er dem Kommissar von der nächtlichen Fete hätte erzählen müssen. Vom Tanz des Mädchens, den jungen Männern, dem Alkohol. Aber damit hätte er, gerade er mit seiner problematischen Vorgeschichte, sich erst recht verdächtig gemacht. Man hätte ihn für einen Voyeur gehalten, womöglich gar einen Stalker. Niemand würde ihm glauben, dass er die Tänzerin nicht ihrer erotischen Ausstrahlung wegen beobachtet hatte. Nicht, um sich bei ihrem Anblick einen runterzuholen. Wütend kickte er einen Stein beiseite und setzte sich auf einen Felsblock, der in der Sonne bereits abgetrocknet war.
Erst jetzt fiel Paul auf, dass er eine sanft geneigte, mit Felsen und Blumen gesprenkelte Almwiese erreicht hatte. Ein idyllisches einsames Fleckchen Erde wie die, von denen er in Frankreich geträumt hatte. Der Wind legte sich, die Sonne brannte vom Himmel, wie es sich für August gehörte, und einzelne Schmetterlinge tanzten in der klaren Luft. Ohne die Sache mit dem Mädchen hätte es ein wundervoller Sommertag werden können, doch so …
Glücklicherweise hatte sein Smartphone Empfang, sodass er erneut seinen Assistenten anrufen konnte. Zwar hatte Paul offiziell frei, aber in der Redaktion würde man es seltsam finden, wenn er, als Chef der Online-Präsenz des Blatts, nicht informiert sein wollte. Triumphierend berichtete der Schorsch, dass er der Polizei den Namen der jungen Toten entlockt hatte: Nina Bernhardt, 22, ohne Job. Ein Streifenpolizist, der die Clique vom Saalachwehr des Öfteren wegen Ruhestörung verwarnen musste, hatte das Mädchen erkannt.
Obwohl Pauls Instinkt ihm davon abriet, sich näher mit dem Mord zu befassen, ließ sich die journalistische Neugier nicht abstellen. Er loggte sich bei facebook ein, suchte die Seite des toten Mädchens. Erkannte ihre Kumpel vom Vorabend auf den eingestellten Bildern wieder: Die Jungs nannten sich Boris und Quiri, die Mädchen Kat und Eva. Paul fiel auf, dass ausgerechnet der fb-Freund, der am häufigsten auf den Fotos der Toten auftauchte, nicht an der nächtlichen Party teilgenommen hatte. Ein Junge namens Basti, der dasselbe Lederarmband trug wie die ermordete Nina.
Paul wechselte zur Seite des Jungen, der nicht besonders fleißig postete. Sein letzter Eintrag lag circa vier Wochen zurück. Und lautete kurz und präzise: Ich fühl mich scheiße. Hoch drei. Nachdenklich schob Paul das Handy in die Tasche. Auf der stillen Almwiese glitzerten die Regentropfen im Gras wie Swarovski-Steine. Der Anblick war so schön, dass es fast schmerzte. Dass Paul sich kaum davon losreißen konnte. Und dennoch fragte er sich, ob er nicht besser sofort nach Paris zurückfliegen sollte, ehe der dämliche Kleinstadtkommissar es ihm verbot.
Im Haus seiner Eltern fand Paul den Anrufbeantworter vollgepflastert mit Nachrichten des Vaters. Und zuletzt einem Anruf der Seniorenresidenz, in dem er gebeten wurde, sich zu melden. Paul loggte sich kurz bei seiner Bank ein, um die Aktien eines Solarpanel-Produzenten abzustoßen, der seinem Gefühl nach auf einen absteigenden Ast geriet, und fuhr dann zum »Rosenpark«. Vor etwa einem Jahr war der Vater aus eigenem Antrieb in die Anlage für betreutes Wohnen gezogen, aber er schien dort nicht glücklicher, als er es in dem alten Haus am Ortsrand gewesen war.
»Wenn’s nach dir gehen tät, könnt ich krepieren, und du würdest keinen Finger rühren!«, überfiel ihn der Vater schon im Flur. Kilian Leonberger saß nach seinem Schlaganfall immer noch am liebsten im Rollstuhl, obwohl er längst gelernt hatte, kürzere Strecken mit dem Rollator zurückzulegen. »Mein Herz macht wieder Probleme.« Die Stimme hatte den quengligen Klang, den Paul hasste. »Wahrscheinlich sterbe ich.«
»Wir sterben alle«, sagte Paul ohne Mitgefühl. Zu oft hatte er diese Szenen erlebt.
»Ja, aber nicht alle hier und jetzt.«
»Das würde auch euer Personal in schlechtes Licht rücken«, murmelte Paul.
»Du könntest wenigstens einmal Mitleid mit deinem alten Vater zeigen. Nach allem, was passiert ist.«
»Bei Herzproblemen kann ich dir nicht helfen, ich bin kein Arzt.«
Eine Schwester, die mit einem Tablett den Gang entlangeilte, zwinkerte Paul zu, und Kilian runzelte verärgert die Stirn.
»Die meinen immer, dass ich simuliere. Alle meinen s’ das. Aber die werden schon sehen, wenn ich erst mal tot umkippe, direkt vor ihren Augen.«
»So rasch stirbst du nicht.« Paul wendete den Rollstuhl und steuerte ihn in die Cafeteria, wo sich der Vater am schnellsten beruhigen würde.
Während er an der Theke um Marmorkuchen und Getränke anstand, schob sich eine der Pflegerinnen an ihm vorbei und flüsterte dramatisch: »Gut, dass Sie da sind. Ihr Vater hat heut einen besonders üblen Tag.«
»Die Leich’ am Flussufer«, sagte der Vater, als Paul mit Kaffee und Kuchen zum Tisch zurückkehrte, »du hast sicher von der gehört?«
Paul nickte.
»Das waren welche von auswärts. Bestimmt Rumänen.« Der Vater nahm den Kuchen in Angriff. »Ich sag immer, was das für ein Gschwerl ist, aber keiner will’s hören.«
»Welche Rumänen?«
»Na, die Bettlerbanden. Die Männer, die auf der Straße knien und kein Wort Deutsch verstehen.«
»Ich hab keine Bettler im Ort gesehen.«
»Zu Ostern waren s’ da. Eine ganze Horde.«
»Mittlerweile haben wir August.« Paul merkte, dass er den für den Vater bestimmten koffeinfreien Kaffee erwischt hatte, verschwieg es aber.
»Mir ging’s furchtbar, als ich in den Nachrichten von dem Mädel gehört hab.« Der Vater hatte den Kuchen in Windeseile verputzt und kehrte zu seinen eingebildeten Herzproblemen zurück. »Ich hatte so ein Bumpern in der Brust. Die Sache hat vieles wieder wachgerufen … Auch deine Mutter wär nie so früh gestorben, wenn …« Er seufzte tief, schüttelte tragisch den Kopf und warf aus den Augenwinkeln einen Blick zu seinem Sohn. Der sich in diesem Moment wünschte, für immer und ewig in Paris geblieben zu sein.
Und er wünschte es sich noch viel mehr, als sein Handy klingelte und sich Kommissar Porant meldete.
»Wo stecken S’ denn, Herr Leonberger? Immer noch auf dem Berg?«
»Ich stecke in meinem Privatleben.«
»Das Sie morgen früh bittschön verlassen, um am Präsidium vorbeizuschauen. Punkt zehn.« Obwohl der Kommissar es als Bitte formulierte, wusste Paul, dass es keine war. Was ihm den gesamten Abend verdarb.
»Und worum geht’s jetzt so Wichtiges?«, knurrte Paul, nachdem er sich am Sonntagmorgen erstens überhaupt nicht beeilt und zweitens seinen Gruß beim Eintreten auf ein wenig freundliches Nicken beschränkt hatte.
»Um ein Alibi vielleicht?« Der Kommissar lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und wies Paul mit einer Handbewegung an, ihm gegenüber Platz zu nehmen.
Paul starrte ihn an. »Wessen Alibi?«
»Ihres natürlich.«
»Und wieso sollte ich eins brauchen?« Kampfbereit schob Paul das Kinn vor, doch durch sein Inneres schwappte eine Welle der Furcht.
»Weil S’ mir gestern nicht alles erzählt haben, zum Beispiel.«
»Was wollen Sie denn noch wissen, außer, was für eine Jause ich in die Berge mitnehme? Wie oft ich unterwegs pinkeln muss?«
Porant lachte. Gekünstelt. Und Paul befürchtete das Schlimmste.
»Was ich von Ihnen wissen möcht, ist, was Sie in der Nacht, als die junge Frau ermordet wurde, so alles angestellt haben. Und erzählen S’ mir nicht, Sie seien die ganze Zeit im Bett geblieben!«
Paul stand auf, ging zum Fenster. Unten auf der Straße lief eine Gruppe Teenies vorbei, kichernde Mädchen in knappen Tops und Shorts, die kaum die Hintern bedeckten. In wenigen Jahren würden sie so alt sein wie die Tote am Fluss.
»Also?«, fragte der Kommissar.
»Ich bin spazieren gegangen«, sagte Paul. Eines der Mädchen blickte zu ihm hinauf und schnitt ihm eine Grimasse. »Ich nehme an, jemand hat mich dabei gesehen?«
»Interessanter wäre, was Sie gesehen haben.« So plump ließ sich Porant seine Informationsquellen nicht entlocken. »Waren S’ zum Beispiel auch am Fluss?«
Blitzschnell dachte Paul nach. Wenn er sich jetzt rauszureden versuchte und der Zeuge ihn nachts auf der Loferer Straße beobachtet hatte, machte er sich extrem verdächtig. »Unter anderem bin ich bei der Luitpoldbrücke vorbeigekommen.«
»Und haben was dort gesehen?«
»Eine Party«, sagte Paul. »Eine Gruppe junger Leute beim Feiern.« Er brachte es nicht über sich, vom Tanz des Mädchens zu erzählen, von dessen Nacktheit. Aber ihm wurde speiübel bei der Vorstellung, Porant könnte auch das herausfinden.
Der Kommissar blickte ihn an. Schweigend. Als warte er. Doch Paul kannte die Taktik, lehnte sich ans Fensterbrett und starrte mit unbewegter Miene zurück.
»Bevor ich nach Reichenhall gekommen bin, habe ich in München gearbeitet«, sagte Porant endlich.
»Und warum wurden Sie hierher strafversetzt? Ins Kaff?«
Der Kommissar lief rot an. »Ihre Frechheiten werden Ihnen noch vergehen. In München habe ich schon mal einen Mädchenmörder gestellt. Solche stehen in der Gefängnishierarchie verdammt weit unten, das können S’ mir glauben.«
»Ist wohl nicht mein Bier.« Paul wollte zur Tür gehen, doch der Kommissar erhob sich und verstellte ihm den Weg.
»Andere Insassen haben den Kerl vergewaltigt.« Porants Stimme nahm einen drohenden Unterton an. »Und raten S’ mal, was sie ihm abgeschnitten haben?« Sein Blick wanderte an Paul hinab, zu dessen Unterleib. Paul fühlte sich plötzlich beschmutzt. Gedemütigt. Ohne ein Wort schob er den Kommissar beiseite und verließ den Raum.
Kapitel 2
Die Flammen schlugen hoch in den Himmel, bildeten für einen Moment einen orangefarbenen Feuerball.
»Idiot!«, schrie Eva. »Du bringst uns alle um mit deinem blöden Spiritus!«
»Halt die Fresse, ja?«, brüllte Boris zurück, aber Eva ließ sich nicht beeindrucken.
»Du bist der Erste von uns, dem der Alk ’s Hirn zerfrisst. Oder – wahrscheinlich hast nie eins gehabt?«
»Hört auf zu streiten!« Katrin brach in Tränen aus. »Die Nina ist tot. Und ihr zofft euch wegen … Spiritus.«
»Entspann dich, Mädel. Heulen hilft nichts. Zumindest der Nina hilft’s nicht mehr.« Der Quirin drückte Katrin eine fast leere Wodkaflasche in die Hand. »Trink lieber ’nen Schluck, das hätt die Nina auch getan an deiner Stelle.«
Eine halbe Stunde später waren die Mädchen allein. Eva lag auf dem Rücken, hatte die hochhackigen Schuhe abgestreift und die Jacke unter dem Kopf zusammengerollt. Katrin saß neben ihr, die Arme um die aufgestellten Knie geschlungen.
»Glaubst du, dass es irgendwas gibt, nach dem Tod? Ich meine, für die Nina?«
»Quatsch«, sagte Eva. »Da ist nix. So wie wir jetzt schon nichts sind. Nullen eben.« Die Jungs waren abgezogen, um mehr Alk zu holen, und Eva zeigte sich, solange sie nicht ihr gewohntes Quantum intus hatte, reizbar.
»Warum leben wir dann überhaupt?«, fragte Katrin weiter.
»Keine Ahnung. Weil unsere Alten Lust zum Vögeln hatten, ohne Gummi?«
»Magst du Sex?«
Eva antwortete nicht gleich. »Wenn er genug Kohle bringt«, sagte sie schließlich gleichgültig.
»Und was ist mit Spaß?« Katrin zögerte, ehe sie hinzufügte: »Oder Liebe?«
»Siehst ja, wo die Nina damit gelandet ist.«
»Solang sie mit dem Basti beisammen war, war sie glücklich.«
»Und was hat der Arsch gemacht? Sie fallen gelassen.« Langsam richtete sich Eva auf. »Wo zum Teufel bleiben die anderen?«
Und die Flaschen, dachte Katrin. »Denkst du manchmal an später?«, fragte sie die Freundin.
»Wie, später? Morgen oder was?«
»Ganz später. Wenn wir 40 sind oder so. Richtung Midlife halt. Wie siehst du dich dann?«
Eva lachte. »Reich. Bis dahin hab ich mir irgendeinen geldigen Sack geangelt, der mir vollen Zugang auf sein Konto lässt. Mir zum Geburtstag ’n Cabrio schenkt. Oder ’ne Villa auf Mallorca, mit Putze und Swimmingpool, das tät mir noch besser gefallen.«
Katrin schwieg. Für Eva schien die Welt einfach. Und für sie selbst? Sie schrak zusammen, als sie einen Mann gewahrte, der gemächlich den Saalachstrand heraufwanderte. Wer mochte das sein? Katrin wollte sich einreden, dass sie keine Angst verspürte, aber in Wahrheit fürchtete sie sich entsetzlich. Allein mit Eva, ohne die Jungs, die sie im Notfall beschützen würden. Konnte es der Typ sein, der Nina … auf dem Gewissen hatte? Nein, suchte sie sich zu beruhigen, wahrscheinlich war es nur wieder ein Polizist. Wie die Bullen, die am Nachmittag bei ihr zu Hause aufgekreuzt waren, 25-mal die gleichen Fragen gestellt hatten.
Nur wenige Meter unterhalb des Platzes, an dem die Mädchen saßen, kurz vor dem Feuer, blieb der Mann am Ufer stehen. Er wandte sich zum Fluss, trank einen langen Schluck aus der Aluflasche in seiner Rechten.
Eva stand auf. Rückte den Ausschnitt ihres Tops zurecht, dass der Spalt zwischen den Brüsten besser zu erkennen war.
»Bleib da!«, flüsterte Katrin beschwörend. Eva grinste nur. Der Mann drehte sich um, ließ die Flasche sinken und blickte zu den Mädchen. Katrin schluckte. »Lass ihn, Ev! Geh nicht hin!«
Doch die Freundin hörte nicht. Ihre schmalen Hüften wiegten hin und her, als sie mit leicht zurückgeworfenem Kopf, um Hals und Busen zu betonen, die Kiesbank hinunterspazierte.
»Gibst mir was ab, Kumpel?« Während sie fordernd eine Hand nach der Flasche ausstreckte, strich sie mit der anderen eine blonde Haarsträhne zurück. Wieder einmal wunderte sich Katrin, wie Eva in die simple Geste so viel Laszivität zu packen verstand.
Der Mann betrachtete das Mädchen aus zusammengekniffenen Augen. »Weshalb sollte ich?«
»Weil sich gute Taten auszahlen? Spätestens im Himmel?« Eva lächelte. Verführerisch. »Und vielleicht sogar schon früher? Falls wir uns überreden lassen, dir ein bisserl Gesellschaft zu leisten?« Sie winkte in Katrins Richtung, und halb widerwillig erhob sich auch Katrin, wollte die Freundin nicht im Stich lassen.
Die Blicke des Mannes wanderten zwischen den Mädchen hin und her. Schließlich nickte er trotz Evas offensichtlicher Anmache eher kühl und reichte ihr die Flasche. Eva setzte sie an die Lippen, nahm einen Schluck und spie ihn sofort wieder aus. Vor die Füße des Fremden, der zornig beiseite sprang.
»He, was soll das? Bist du verrückt geworden?«
»Verrückt bist selber!« Eva schleuderte die Flasche auf den Boden, trat so heftig darauf, dass sie in der Mitte einknickte. »Was war da überhaupt drinnen?«
»Wasser. Aus der Leitung in meiner Küche. Und was soll ich jetzt trinken?«
»Sauf halt Saalachwasser, du Arsch!«
Ehe der Fremde reagieren konnte, standen Boris und Quirin, jeder mit einem Bier in der Linken, neben den Mädchen.
»Schleich dich, wer immer du bist!«, knurrte Boris den Wassertrinker an. »Du störst.«
»Bei einer Trauerfeier?« Der Fremde war mittelgroß, schlank und trug zu teuren Markenjeans ein schwarzes Shirt und eine ebenfalls schwarze Lederjacke. Katrin schätzte ihn auf circa 35. Jetzt, aus der Nähe, fiel ihr die ungewöhnliche Farbe seiner Augen auf. Sie schimmerten in einem tiefen dunklen Grün, ähnlich wie die Flasche auf dem Boden.
»Was geht’s dich an, was wir feiern?« Der Quirin stellte sein Bier ab, zog einen brennenden Ast aus dem Feuer und hielt ihn drohend nach vorn, als wolle er ihn dem Fremden ins Gesicht stoßen. Vorsichtshalber wich der Mann einen Schritt zurück. Seine Augen wurden schmal.
»Deine Freundin hat meine Flasche ruiniert.« Er wies auf Eva, und im nächsten Augenblick sauste der Ast haarscharf an ihm vorbei, sodass er sich instinktiv duckte. Gleich darauf fassten ihn vier kräftige Männerhände, zerrten ihn Richtung Fluss.
»Loslassen! Lasst mich verdammt noch mal los!« Der Fremde trat nach Boris, versuchte sich zu befreien, hatte aber keine Chance. Im Nu flog er ins eisige Wasser, kam wieder hoch, doch seine Schuhe rutschten auf den glitschigen Steinen, sodass er Mühe hatte, sein Gleichgewicht zu halten. Und dann landete eine Faust in seinem Magen, dass er in der Saalach zusammenbrach.
»Das sind unsre Mädel! Wenn du Wichser noch mal wagst, sie anzubaggern, dann –!« Als sich der Fremde mit schmerzverzerrtem Gesicht aufrappelte, blitzte ein Messer in Boris’ Hand. »Ich schneid dir die Eier ab und fütter die Fisch’ damit, hast kapiert?«
Beide Hände auf den Magen gepresst, stolperte der Fremde zum Ufer. Kaum hatte er es erreicht, als Boris ihn erneut zu Boden schlug.
»Boris! Quiri! Spinnts jetzt?« Katrin erwachte aus ihrer Starre. »Der Mann hat überhaupt nichts getan. Die Ev hat bloß geglaubt, er hätte Alk und stattdessen …«
Aber Eva versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. »Lass doch! Der Arsch hat sich über uns lustig gemacht mit seinem Scheißwasser. Und jetzt lachen wir über ihn, wenn die Jungs ihn z’sammknicken.«
»Das ist nicht lustig.« Katrin riss sich los, und zu ihrer Überraschung kam der Quirin ihr zu Hilfe.
»Hör auf, Boris, die Kat hat recht! Die Bullen haben uns eh auf der Abschussliste, wegen der Sache mit der Nina. Im Moment sollten wir ein bisserl vorsichtig sein.«
Widerwillig ließ Boris die Fäuste sinken. Der Fremde versuchte, auf die Knie zu kommen, schüttelte das Wasser aus seinen Haaren.
»Ist August, Mann. Erfrieren wirst nicht.« Mitgefühl zählte nicht zu Evas Stärken. Obwohl sie wusste, dass das Wasser aus den Bergen selbst im Sommer eiskalt war.
»Tut uns leid. Wirklich«, hörte Katrin sich sagen und neben sich Evas verächtliches Schnauben. »Die Jungs haben halt gemeint, du wolltest uns an die Wäsche.«
Paul blickte sie an. Erkannte das Mädchen, das in der Nacht zuvor der Tänzerin das Top hatte reichen wollen. »Die Nina – war die deine beste Freundin?«
Quirin, der das Feuer aufschürte, hielt in der Bewegung inne. Boris, der sich bei den Getränken zu schaffen gemacht hatte, richtete sich auf.
»Was weißt von der Nina, du Dreckskerl?« Eva hielt Katrin, die sich zurückziehen wollte, am Arm fest. »Was hast du Scheißwichser mit der Nina zu schaffen gehabt?«
Paul hielt Evas Blick stand. Lange. Dann sah er zu Katrin. »Ich hab sie auf der Kiesbank entdeckt, gestern«, sagte er ruhig. Katrin brach in Tränen aus und vergrub das Gesicht an Evas Schulter.
»Hier.« Paul fummelte in der Innentasche seiner Jacke und förderte eine an den Rändern aufgeweichte Visitenkarte zutage, die er Katrin in die schlaffe Hand drückte. »Mein Name ist Paul Leonberger. Ich hab deine Freundin dort liegen gesehen und … ihr Gesicht geht mir nicht aus dem Kopf. Deshalb bin ich hier.«
Katrin ließ Eva los, setzte sich ans Feuer und starrte in die Flammen. »Die Nina«, ihre Stimme kam nur als Flüstern, »die Nina … war meine Schwester.« Sie legte den Kopf auf die angezogenen Knie und schluchzte auf.
»Kannst du sie nicht, verdammt noch mal, in Ruh lassen?«, schrie der Quirin den Journalisten an. »Ihr geht’s scheiße, kapierst das nicht?«
Paul ignorierte ihn, wollte sich neben Katrin setzen, doch der Boris riss ihn hoch.
»Hast Wasser in den Ohren, oder was? Du sollst sie in Ruh lassen! Dich endlich verpissen!« Er stieß Paul fort, und der Journalist wandte sich wortlos um und marschierte zur Treppe, die zur Straße hochführte. Und als er von oben über die Schulter zurücksah, fragte er sich, was die Clique getrieben hatte, während Nina auf der Kiesbank starb. Warum hatten sie das Mädel allein gelassen? Waren sie so zugedröhnt gewesen, dass sie Nina einfach vergaßen? Oder hatten sie in irgendeiner Weise mit ihrem Tod zu tun? Paul dachte an die Aggressivität, die Boris und Quirin ausstrahlten, und ihn schauderte nicht nur von der Nässe in seinen Kleidern.
Der Platz, an dem er die Leiche gefunden hatte, war auch am nächsten Tag noch mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Paul hatte eigentlich nicht ans Saalachufer gehen wollen, aber schließlich hatte ihn der Gedanke an die junge Tote doch wieder hergetrieben. Mitten in dem gesperrten Areal lag ein Strauß weißer Moosröschen. Frische Blumen, von einem rosa Band zusammengehalten.
»Schon wieder Sie!«
Paul wandte sich um. Er hätte den Dicken sofort erkannt, auch wenn der nicht sein Raptoren-Shirt getragen hätte. Und wieder schoss die Erinnerung an den Jakob vom Schulhof durch Pauls Gehirn. »Sie sind ja auch da«, sagte er jedoch nur.
»Ich hab ’ne Kneipe, gleich da oben. ›Saalach-Bar‹.«
»Und die machen Sie schon so früh auf?«
»Muss putzen.« Jakob, dessen Stimme von reichlichem Alkohol- und Zigarettengenuss zeugte, wies mit dem Kinn zu dem abgesperrten Bereich. »Die Bullen haben natürlich keinen Schimmer, wer’s war.«
»Und Sie?« Paul war sicher, dass der Mann seine ganz eigene Meinung zu dem Thema haben würde. Er sah Jakob an und wartete. Stumm. Die meisten Menschen konnten solche Stille schlecht aushalten, wurden nervös, wenn ihr Gesprächspartner zu lange schwieg. Und plapperten dann Dinge aus, die sie gar nicht hatten verraten wollen. Das konnte man sich als Journalist zunutze machen.
»Die Saufburschen, die sich abends am Fluss treffen.« Der Kneipier rieb sich über das stopplige Kinn. »Das ist ’ne ganz üble Bagasch.«
Paul nickte, ohne sich zu äußern.
»Neulich, da haben s’ mir in der Nacht Hundescheiße an die Tür geschmiert. Gestunken hat’s wie nur was.«
»Sie können nicht beweisen, dass die’s waren, oder?«
»Wer sonst sollt’s gewesen sein?«
»Und weshalb haben die was gegen Sie?«, erkundigte sich Paul interessiert.
»Weil ich sie nimmer anschreiben lass, die Saubande. Mein Laden ist nicht die Caritas. Aber jetzt muss ich arbeiten. Die Kneipe putzt sich nicht von allein.« Jakob stapfte davon, und Paul fragte sich, weshalb der Mann überhaupt an den Fluss herunter gekommen war. Aus Sensationsgier? Oder hatte er die Tote besser gekannt, als er zugeben wollte? Paul war nie in der »Saalach-Bar« eingekehrt und überlegte, ob er das in Zukunft ändern sollte.
Das Mädchen entdeckte er erst, als er eben gehen wollte. Katrin Matieser: Ihren vollen Namen hatte ihm der Schorsch gemailt. Sie kauerte hinter einem Busch, musste die gesamte Szene mit angehört haben. Paul blieb stehen, sah demonstrativ zu ihr, und schließlich stand sie auf.
»Hast du die Blumen gebracht?«, fragte Paul.
»Haben dir die Jungs gestern nicht gesagt, dass du uns in Frieden lassen sollst?« Ihre Stimme klang aggressiv, aber ihr Gesicht wirkte so kindlich-traurig, dass es Paul schmerzlich anrührte.
»Warum …« Er zögerte, wusste, dass er ein sensibles Thema berührte. »Warum hat deine Schwester so viel getrunken, in jener Nacht?«
Katrin stieg über das rot-weiße Band und setzte sich neben die Rosen, den Rücken zu Paul. »Sie war nicht richtig meine Schwester«, sagte sie nach einer langen Pause. »Nur meine Halbschwester.«
Auch das wusste Paul bereits von seinem Assistenten, und sein Gefühl sagte ihm, dass das Mädchen Wert auf diese Feststellung legte. »Und warum hatte Nina also so viel getrunken?«, wiederholte er seine vorige Frage.
Endlich sah Katrin ihn wieder an. »Wegen dem Basti.«
Paul erinnerte sich an das fb-Foto. Der fremde Junge mit dem Lederarmband, der auf der Party am Fluss gefehlt hatte. »Wer genau ist der Basti?«
Ihr Fuß scharrte im Uferkies. Paul wusste, dass sie nicht dort sitzen sollte, innerhalb des gesperrten Bereichs. Aber er war kein Polizist und wollte es sich nicht mit ihr verderben. Nicht jetzt, wo sie zu reden anfing.