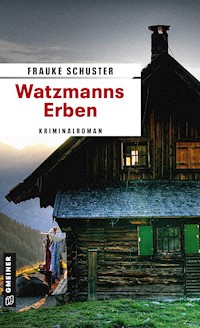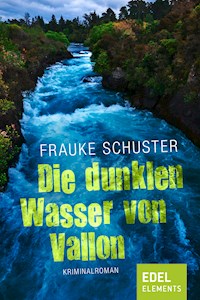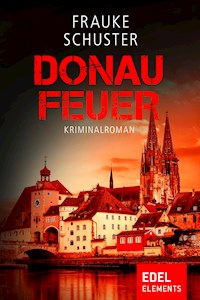4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine brutale Mordserie erschüttert eine abgelegene Benediktinerabtei. Als Commissario Luca Manaro fieberhaft nach einem Motiv für die grauenvollen Taten sucht, stoßen er und sein deutscher Kollege Lasse auf eingeschüchterte Mönche, einen alttestamentarisch-strengen Abt und eine Mauer des Schweigens. Je tiefer die Ermittler in die finsteren Geheimnisse der Klosterwelt eindringen, desto mehr scheinen sich die Fäden des Falls zu verwirren: Wohin geht der Mann, der sich regelmäßig nachts aus dem Kloster schleicht? Schießen die Gotchafanatiker, die in der finsteren Pineta hinter dem Kloster ihre martialischen Kampfspiele abhalten, wirklich nur mit Farbmunition? Und wer veranstaltet das grausame Femegericht im Morgengrauen? Als sich Luca und Lasse endlich kurz vor der Lösung des Falls wähnen, geraten sie urplötzlich selbst ins Visier des skrupellosen Mörders - und in eine schier ausweglose Situation ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Frauke Schuster
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München
Originalausgabe © 2008, KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-73-2
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
www.fraukeschuster.de
Vergeltet, wie auch sie vergalten
Eine brutale Mordserie erschüttert eine abgelegene Benediktinerabtei. Als Commissario Luca Manaro fieberhaft nach einem Motiv für die grauenvollen Taten sucht, stoßen er und sein deutscher Kollege Lasse auf eingeschüchterte Mönche, einen alttestamentarisch-strengen Abt und eine Mauer des Schweigens. Je tiefer die Ermittler in die finsteren Geheimnisse der Klosterwelt eindringen, desto mehr scheinen sich die Fäden des Falls zu verwirren: Wohin geht der Mann, der sich regelmäßig nachts aus dem Kloster schleicht? Schießen die Gotchafanatiker, die in der finsteren Pineta hinter dem Kloster ihre martialischen Kampfspiele abhalten, wirklich nur mit Farbmunition? Und wer veranstaltet das grausame Femegericht im Morgengrauen?
Als sich Luca und Lasse endlich kurz vor der Lösung des Falls wähnen, geraten sie urplötzlich selbst ins Visier des skrupellosen Mörders - und in eine schier ausweglose Situation ...
Für Kerstin und Hans, die wichtigsten Menschen in meinem Leben.
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillt
Je des Geängstigten?
(Johann Wolfgang von Goethe,
Kapitel 1
Über dem uralten Pinienwald herrschten Finsternis und tiefste Stille, als sei die gesamte Welt dabei, in einem schwarzen Loch zu versinken. Nur vereinzelt brannte hinter den Fenstern des Klosters noch Licht; die winzigen hellen Flecken wirkten eigenartig verloren inmitten der schier allumfassenden Dunkelheit.
Das Auto, das sich auf der schmalen Asphaltstraße der Abbazia San Benedetto näherte, fuhr ohne Licht, als wolle es sich der allgemeinen Düsternis unterwerfen; oder hatte der Fahrer einfach vergessen, die Scheinwerfer einzuschalten? Ungewöhnlich langsam, fast im Schritttempo, bog es kurz vor der langen, mit Zypressen gesäumten Klosterzufahrt in einen Feldweg ein, rollte weiter bis zum Anfang der verschwiegenen Pineta, wo es unter den ersten Baumschirmen, die jegliches verbliebene Licht zu schlucken schienen, stehen blieb. Eine Gestalt, trotz der Lauheit der italienischen Sommernacht in eine dunkle Kapuzenjacke gehüllt, stieg aus, stapfte durch schwarzes Gras zur Mauer des Klostergartens. Hände tasteten die schmalen Backsteine ab, fanden Halt in Rissen und Spalten, und dann saß die Gestalt rittlings auf der Mauerkrone, starrte zu den gedrungenen Gebäuden mit den spärlichen Lichtflecken hinüber, malte sich aus, was in diesen beleuchteten Zimmern geschehen mochte. Sah, obwohl sie sie nicht wirklich sehen konnte, die Mönche im schwarzen Habit, wie sie sich über ihre Bücher beugten, sich zu den Texten, die sie studierten, Notizen machten, wie sie gelegentliche Blicke zu den Fenstern warfen und nur Schwärze wahrzunehmen vermochten. Das Dunkel, in dem die Zukunft verborgen lag. Eine schreckliche, grausame Zukunft, die dort drinnen, in der ruhigen Sicherheit der Zellen, niemand erahnen konnte … Unverwandt, ohne zu blinzeln, starrte die Gestalt auf das Kloster, bis ihr vor Anstrengung die Augen tränten. Und plötzlich, wie so oft in ihrem Leben, überfiel sie das Gefühl, nicht allein zu sein, das Gefühl einer unsichtbaren Präsenz an ihrer Seite. Sie biss sich hart auf die Lippen, so fest, dass sich auf ihrer schmalen Unterlippe ein Blutstropfen zeigte, schwarz in der Nacht. Jetzt wusste die einsame Gestalt, was diese Empfindung bedeutete, dass sie kein Zeichen einer beginnenden Schizophrenie war, wie sie so lange befürchtet hatte! Nein, sie war keinesfalls psychisch krank; sie war vollständig gesund. So gesund, wie sie es für die Aufgabe, die sie sich zu erfüllen geschworen hatte, sein musste! Und in ihren Augen, deren Tränen unter der Kapuze glänzten wie dunkle Perlen, tanzten dämonische Feuer.
Heftiger, vom Meer aufkommender Wind rüttelte zornig an den Bäumen, als die einsame Gestalt zu ihrem Wagen zurückkehrte. Nur gelegentlich drang ein schwacher Schimmer des fahlen Mondlichts durch Lücken in der Wolkendecke, erhellte schwach das Gelände: den gepflasterten Vorhof des Klosters mit seinen Pinien und Zypressen, links hinten den dunklen Wald, die Pineta, der das angrenzende Sumpf- und Schilfgebiet der Pialassa Baiona verdeckte. Die Wipfel der höchsten Bäume schwankten im Sturm, dahinter lauerte tiefste Schwärze. Eine Schwärze, die an die Hölle gemahnte … Ihr werdet eure Apokalypse bekommen, dachte die Gestalt, während sie noch einmal zum Kloster zurückblickte. Früher, als ihr denkt! Sie stieg in das Auto und fuhr nach Ravenna zurück.
Als der Wagen die Via Cimitero erreichte, hatte der Wind sich verstärkt, peitschte schwere, regenschwangere Wolken vor sich her. Die in ihre dunkle Jacke gehüllte Gestalt zog die Kapuze wieder über den Kopf, als erwarte sie im nächsten Moment einen Gewitterschauer. Das schmiedeeiserne Tor des Cimitero war abgesperrt, mit einem Vorhängeschloss gesichert. Mit einem raschen Blick über die Schulter vergewisserte sich die Gestalt, dass die Straße leer war, kletterte dann katzengleich an dem Gitter hoch und sprang auf der anderen Seite ins Friedhofsgelände hinab.
Im Schein einer trüben Lampe warfen die Kopfsteine der kastenförmigen, mit schweren Steinplatten verkleideten Gräber lange, düstere Schatten. Irgendwo in der Ferne pfiff jemand laut und falsch. Die Kapuzengestalt kauerte sich hinter eine Grabwand und wartete bewegungslos, bis die schrägen Töne verklangen. Erst dann lief sie einen schmalen Weg entlang, in der Hand eine unförmige Plastiktüte. Als sie schließlich vor einem gepflegten, sandfarbenen Grab stehen blieb, blickte sie kurz über ihre Schulter und sank auf dem groben Kies auf die Knie. Aus der Tüte holte sie einen Strauß weißer Lilien, den sie sorgsam in die steinerne Vase auf der Grabplatte ordnete. Eine Weile verharrte sie stumm und reglos, zog sich schließlich in den Schatten einer Mauer zurück, und – im nächsten Augenblick zerriss die muntere Melodie eines Handys die nächtliche Stille! Hastig suchte die Gestalt in ihrer Tasche, sich nervös umblickend.
»Bist du verrückt geworden?! Warum rufst du an?!«
Das telefonino ans Ohr gepresst, schloss die Gestalt für ein paar Minuten die Augen, während sie sich vorstellte, wie sie den Rest der Nacht verbringen würde: Sie sah sich an dem mit Zeitungspapier abgedeckten Tisch sitzen, im abgedunkelten Licht einer Schreibtischlampe, sah sich die Waffe überprüfen, laden und in der unauffälligen Reisetasche versenken. Die Lippen der Gestalt verzogen sich zu einem befriedigten Lächeln. Sie brach das Gespräch ab, blieb jedoch an die Friedhofsmauer gelehnt stehen, und sah zum Himmel hinauf, wo sich die dicken, schwarzen Wolken unheilverkündend zusammenballten. Ein passender Anfang, dachte die einsame Gestalt, aber erst der Anfang! Das Lächeln verweilte noch auf ihrem Gesicht, als sie auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war, vom Friedhof verschwand.
Als Luca Manaro erwachte, war es tiefe Nacht, doch durch die leichten Voile-Vorhänge der Balkontür fiel das gedämpfte Licht einer entfernten Straßenlampe. Im ersten Moment freute sich Luca nur, dass er noch nicht aufstehen musste. Gleich danach allerdings bestanden zwei überaus negative Gedanken darauf, sich gewaltsam in das Bewusstsein des Commissario zu drängen: erstens, dass er am Vortag vergessen hatte, Kaffee einzukaufen, und zweitens, dass morgen – nein, vermutlich schon heute, denn höchstwahrscheinlich war es bereits lange nach Mitternacht! – der Tag sein würde! Der, von dem Luca immer gehofft hatte, dass er irgendwie aus dem Kalender gestrichen werden würde.
Luca tastete nach dem Wecker, fand ihn nicht sofort und stieß ihn schließlich versehentlich vom Nachttisch. Das Batteriefach sprang auf, und die Batterie rollte unter das Bett. Luca fluchte, und von der Via Bixio her erklang trunkenes Lachen. Der Commissario tastete unter dem Bett nach der Batterie, zwängte sie in ihr Fach zurück, trat auf den Balkon und sah zu dem vergnügten Nachtschwärmer hinab. »Spar' dir deine Freude!«, murmelte Luca zwischen den Zähnen. »Einen Scheißtag wie diesen hast du nie erlebt!«
Der Weinselige unten, der die Worte glücklicherweise nicht hatte verstehen können, legte für den nächtlichen Zuschauer eine bühnenreife Stepptanzeinlage hin, ehe er sich gemächlich Richtung Piazza Duomo entfernte.
»Scemo! Trottel!«, brummte der Commissario ihm hinterher und ließ sich trotz des stürmischen Windes auf einen der beiden Korbstühle sinken. Erst jetzt sah er auf die Uhr: Drei Uhr morgens. Ja, der gefürchtete Tag hatte bereits begonnen! Der Tag, an dem er kommen sollte. Lucas neuer Assistent. Der tedesco. Der Polizist aus Deutschland, von dem Luca so gut wie nichts wusste, weil er die Akte, die man ihm geschickt hatte, in der untersten Schublade seines Schreibtisches begraben und nie angesehen hatte. Er brauchte keine Akten, um zu wissen, was ihn am Morgen erwarten würde; die Kollegen in Verona, denen dieses neue EU-Programm schon vor einem halben Jahr einen tedesco aufgenötigt hatte, hatten Luca genauestens geschildert, auf was man gefasst sein müsse. Zum Beispiel darauf, dass deutsche Polizisten pünktlicher waren als Atomuhren sowie mit sklavischer Unterwürfigkeit jegliche Dienstvorschrift bis ins unsinnigste Detail befolgten und – erschreckenderweise – dasselbe von ihren italienischen Kollegen erwarteten. Doch die Ankunft des ungeliebten Neuen war nicht der einzige Albtraum, dem Luca sich würde stellen müssen! Und keinesfalls der Schlimmste!
Wie soll ich den Tag durchstehen? Wie soll ich den verdammten Tag durchstehen?! Der Commissario, obwohl gerade erst vierzig, spürte eine schmerzhafte Enge in der Brust. Rasch lief er ins Bad, wo er das Licht anschaltete und hektisch, mit zitternden Fingern, in dem Kästchen neben dem Waschbecken zu wühlen begann. Dann, plötzlich, schlug er das schief hängende Türchen zu, flüsterte mit zusammengebissenen Zähnen: »Nein, nein!« und trank einen Schluck Wasser aus der Leitung. Als er den Kopf hob, sah er im Spiegel ein schmales und für das Sommerwetter zu blasses Gesicht, aus dem ihn ein Paar dunkler Augen mit wenig Begeisterung anblickte.
»Ein Scheißtag, verlass dich drauf! Aber ich werde ihn durchstehen. Weil sie es gewollt hätte«, sagte Luca zu dem unglücklichen Mann im Spiegel und ging wieder zu Bett. Wo er den Rest der Nacht damit zubrachte, sich ruhelos von einer auf die andere Seite zu drehen.
Wenige Stunden später saß der Commissario missgelaunt und unausgeschlafen am Schreibtisch und stapelte Akten um, von links nach rechts, ohne die Papiere überhaupt anzuschauen. Er wollte nicht nachdenken. Weder über die zwischen den Aktendeckeln konservierten Schlechtigkeiten der Welt, noch über die wenig verlockende Zukunft, und erst recht nicht über das, was vor genau einem Jahr geschehen war. Ebenfalls am ersten August.
»Schon da, Chef?« Ispettore Massimo Borghini, Lucas rechte Hand, manövrierte sich mit zwei Bechern Latte Macchiato durch die Tür. Der junge Massimo mit seinem Allerweltsgesicht gehörte zu jenen Menschen, die auf den ersten Blick völlig durchschnittlich wirken, jedoch bei näherer Bekanntschaft an Profil gewinnen. Vor allem die absolute Ergebenheit gegenüber seinem direkten Vorgesetzten sowie seine Verschwiegenheit gegenüber Questore Zingara, einem pathologischen Aktenfetischisten und Hobbymaler, hatten Luca von jeher für den Polizisten eingenommen.
»Sie sind ja auch Stunden früher als sonst. Haben Sie Schlafstörungen, oder hat Ihre Schwester Ihnen versehentlich den caffè mitten in der Nacht ans Bett gebracht?« Der Commissario befingerte den Saum seines schwarzen Hemdes und mühte sich ein Gähnen zu unterdrücken, während er sich fragte, ob er nicht besser eine Krawatte umgebunden hätte. Andererseits – er wollte dem tedesco von Anfang an klarmachen, dass er ihn nicht als Ehrengast, sondern als aufgezwungenen Mitarbeiter betrachtete.
»Luisa ist bei der mamma in Verona. Und auf den Gedanken, mir Kaffee ans Bett zu servieren, ist sie leider bisher nie gekommen. Nein, ich hab einfach gedacht … Heute ist der Tag!« Massimo stellte die Becher ab, schob einen zu seinem Chef. »Und er ist ein tedesco! Der kreuzt bestimmt gleich um sieben auf.«
Automatisch warf Luca einen Blick auf die Uhr. Fünf vor sieben. So früh waren sie beide sonst nie im Büro – außer in Notfällen, wenn eine dringende Ermittlung anstand, natürlich. Normalerweise wusste er um diese Zeit nicht einmal, dass ein Büro existierte. Er runzelte die Stirn, als der Computer piepste, den er gewohnheitsmäßig angestellt hatte. »Fehlt bloß, dass ausgerechnet jetzt irgendein Irrer einen Touristen überfallen hat!«
Massimo ging in die Hocke, las die eingegangene Mail, las sie ein zweites Mal, und zwischen seinen Brauen bildete sich eine senkrechte Falte. »Irrer ja, Tourist nein.«
Luca beugte sich vor, starrte auf den kurzen Text: Vergeltet, wie auch sie vergalten, und zahlt ihnen das Vielfache heim entsprechend ihren Werken.
»Was soll das bedeuten?« Massimo schüttelte den Kopf.
»Klingt biblisch.« Luca sah auf den Absender. Cyberworld. Das riesige Internetcafé in der Via Squero, beim Stadthafen. Offenbar war die Mail bereits am vorigen Abend losgeschickt worden und möglicherweise aufgrund eines Serverproblems erst jetzt im Büro gelandet.
»Na ja.« Massimo klickte die Nachricht in den Ordner Diverses. »Wünscht uns mal eben wieder jemand die sieben Plagen an den Hals. Und die erste ist der Neue! Wozu brauchen wir den überhaupt? Nur, damit der Questore sein globales Denken unter Beweis stellen kann?«
Luca stand auf und trat ans Fenster. Der Bibelspruch war vermutlich bloß der Scherz irgendeines verärgerten Idioten. Eines Parksünders etwa, der sich über seinen Strafzettel aufregte. Solcher oder ähnlicher Schrott kam häufig herein; das gehörte zu den Folgen der totalen Kommunikation. Kein Grund zur Sorge also. Nein, der Knoten, der sich plötzlich in Lucas Magen formte, musste von etwas anderem herrühren, sagte sich der Commissario: Zum Beispiel davon, dass er mit dem Neuankömmling sein Büro würde teilen müssen! Grimmig starrte er auf den leeren, dunklen Schreibtisch, der am Vorabend geliefert worden war, und dessen linkes hinteres Bein Massimo mit Pappe unterlegt hatte, damit das Möbel nicht wackelte. Doch in den Tiefen von Lucas Gehirn, das sich das Denken nicht verbieten lassen wollte, nistete sich die Mailbotschaft ein wie ein bösartiger Parasit …
Der weiße Lieferwagen bog von der Straße ab, holperte einen gekiesten Weg entlang und hielt schließlich hinter einem Gebüsch aus mannshohen Blasensträuchern am Rande eines Wäldchens. Die tief hängenden, schwarzen Wolken hatten sich so dicht zusammengeschart, dass nur für winzige Momente ab und an ein Sonnenstrahl hindurchblitzte, den die Gestalt hinter dem Lenkrad nicht einmal bemerkte. Suchend sah sie sich um, stieg endlich aus dem Wagen und holte aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz eine Plastiktüte hervor, aus der sie ein Paar uralte Basketballstiefel zog. Sie wechselte ihre Schuhe gegen die Stiefel, blickte sich erneut forschend um, öffnete die Hecktüren. Im Laderaum des Wagens stand eine dunkle Reisetasche, zur Sicherheit in eine Decke gewickelt. Die Gestalt schlug die Decke auseinander, zerrte den Reißverschluss der Tasche auf. Jetzt oder nie! Sie hatte alles sorgfältigst geplant, es durfte, es würde nichts schiefgehen!
Ohne das geringste Zittern ergriff ihre Hand die Mauser, hob sie heraus, strich über den Lauf. Leise schloss die Gestalt den Laderaum, zog die Kapuze ihrer dunklen Jacke über den Kopf, studierte noch einmal die Umgebung: Der Sturm fegte über die Bäume des Wäldchens hinweg, verursachte in den Wipfeln ein wildes Rauschen und Brausen, doch hier unten, hinter dem Lieferwagen, war es fast windstill. Und weit und breit niemand zu sehen. Kein Auto, kein Radfahrer, kein Wanderer. Kein Wunder bei dem Wetter! Die Kapuzengestalt fühlte, dass die höheren Mächte, wenn es denn welche geben sollte, auf ihrer Seite standen. Der Gedanke stärkte ihr Selbstvertrauen. Das Gewehr im Arm marschierte sie in das Gehölz hinein, und das Geräusch jedes Tritts wurde vom weichen Gras geschluckt.
Die Kapuzengestalt ging etwa drei Minuten geradeaus, bis sie den entgegengesetzten Rand des Waldes erreichte. Vor ihr dehnte sich die grüne Ebene des Podeltas mit ihren Schilf- und Wasserlandschaften aus; davor führte ein von Gebüsch gesäumter, wenig benutzter Feldweg vorbei.
Etwa eine Viertelstunde später zockelte ein schwarzer Peugeot gemächlich den Weg entlang, bremste vor einer Kurve ab, rollte noch langsamer weiter, bis er gleich darauf nahe einer schlichten, aus Backstein gemauerten Wegkapelle stehen blieb. Keiner der beiden Insassen bemerkte den Heckenschützen, der bestens getarnt hinter dem Unterwuchs aus jungem Holunder am Waldsaum kauerte, das Gewehr im Anschlag. Gerade als der Beifahrer die Tür des Wagens von innen aufschob, brach der Regen los wie die Sintflut: Heftig prasselte und trommelte er auf das Dach des Peugeots, als wolle er die Insassen warnen. Die Gestalt hinter den Sträuchern hielt den Finger am Abzug. Sie verspürte keinerlei Angst, eher etwas wie Jagdfieber. Die zwei Männer im Wagen, durch den Schleier des Regens nur als grobe Schemen zu erkennen, schienen das Ende des Schauers abwarten zu wollen, denn die Tür des Fahrzeugs schloss sich wieder.
Die verborgene Gestalt fluchte zwischen den Zähnen hervor, als der Platzregen ihre Hose durchnässte und vom Rand der Kapuze schwere Tropfen auf den Lauf der Mauser fielen. Langsam senkte sie die Waffe, ohne jedoch das Versteck zu verlassen oder auch nur den Blick von dem Auto abzuwenden. Sie wartete geduldig. Sie hatte so lange gewartet, sich so lange vorbereitet, auf diesen Tag!
Endlich, endlich kündigte das hellere Grau im Osten das baldige Ende des Schauers an. Erneut spannten sich die Muskeln des Heckenschützen, und er hob das Gewehr. Schon fing der Regen an nachzulassen, der stürmische Wind jagte die Wolken weiter Richtung Binnenland. Die Fahrertür des Peugeots schwang wieder auf, und ein in ein kuttenartiges Gewand gekleideter junger Mann stieg aus. Seine Augen suchten die Kapelle; er bekreuzigte sich mit der Rechten. Die verborgene Gestalt konnte durch das Zielfernrohr sehen, wie sich die Lippen des Mannes bewegten, als spräche er ein kurzes Gebet. Gleich darauf ging der Mönch um den Wagen herum, sorgsam darauf bedacht, nicht in die Pfützen zu treten, und der Gewehrlauf, den er nicht sehen konnte, folgte seinem Weg.
Wie ein perfekter Chauffeur öffnete der junge Mann die Beifahrertür, und ein beleibter, älterer Mönch quälte sich heraus. Im selben Moment, als sein kahler Kopf über dem Wagendach sichtbar wurde, zog der Heckenschütze den Abzug durch.
Kapitel 2
»Commissario!«
Obwohl Massimo sich um einen ruhigen Ton bemühte, wusste Luca sofort, dass etwas passiert war, etwas Ernstes.
»Commissario, wo waren Sie? Ich hab Sie überall gesucht!«
»Bei unserem Questore. Um mich zum hundertsten Mal über den korrekten Umgang mit tedeschi belehren zu lassen! Und seine neueste Ölkreation, Marke hellbraune Sprenkel auf dunkelbraunem Grund, zu bestaunen. – Gibt's was Besonderes?«
»Saverio hat angerufen. Der Junge aus dem Kloster! Er konnte nur kurz sprechen, dann war die Verbindung weg.« Massimo griff nach den Autoschlüsseln auf Lucas Schreibtisch. »Wir haben einen Toten!«
»Und wo? Hat Saverio nähere …?« Der Commissario brach ab. Nach kurzem, ungeduldigen Klopfen flog die Tür auf, und ehe die notorisch langsame Sekretärin eine Chance hatte, etwas zu sagen, platzte ein drahtig aussehender Mann um die dreißig ins Zimmer, mit den grünsten Augen unter dem dunkelblonden Haar, die Luca je gesehen hatte.
»Buongiorno, signori!«, trompetete der Fremde munter. »Ist einer von Ihnen Commissario Luca Manaro?«
»Wir haben im Moment keine Zeit. Lassen Sie sich von der Sekretärin einen Termin für Ihr Anliegen geben«, sagte Massimo unwirsch. »Commissario, wir sollten uns beeilen!«
Sie drängten sich an dem Mann vorbei, liefen zum Wagen. Der Fremde rannte hinterher, riss die rückwärtige Tür des Alfas auf, hechtete hinein, bevor Massimo starten konnte. Luca, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, drehte sich um. »Ich fürchte, ich weiß, wer Sie sind.«
Der Mann grinste breit. Er roch nach Sonne und Meer, und sein Haar glänzte feucht. Fröhlich streckte er seine Rechte nach vorn, zwischen deren Fingern eine leere Bananenschale hing. »Lasse von der Müllkippe.« Er wedelte fröhlich mit der Schale. »Sorry, eigentlich wollte ich das Ding im Commissariato entsorgen, aber auf die Schnelle hab ich keinen Papierkorb gefunden.«
Luca konnte ihn nur anstarren, und Massimo hätte fast den Bürgersteig gerammt, so fasziniert hingen seine Blicke am Innen-Rückspiegel.
Ohne dass sein Grinsen erlosch, zuckte der Fremde die Schultern und in seinen grünen Augen tanzten mutwillige Lichter. »Hab mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt? Allora, zweiter Versuch: Ich bin Lasse Wolafka, bis letzte Woche Kommissar im Morddezernat in München. Monaco di Baviera.«
Luca ergriff die Hand, die den Müll mittlerweile in den Aschenbecher gestopft hatte, nicht. Er nickte langsam. »Sie haben einen schlechten Zeitpunkt für Ihren Einstand gewählt, Signor Wolafka. Wir sind gerade unterwegs zu einem Einsatz.«
»Klasse. Muss ich mich an meinem ersten Tag nicht langweilen! Worum geht's denn?«
Eine winzige Kapelle aus rötlichem Backstein am Wegesrand, mit funkelnden Regentropfen auf dem geschmiedeten Türgitter, das den Madonnenaltar im Innern vor Vandalen schützte. Etwa fünf Meter weiter ein schwarzer Peugeot. Im nassen Gras daneben, auf dem Boden liegend, eine massige Gestalt in dunkler Kutte. Unter der höher steigenden Sommersonne begann die Erde zu dampfen. Die aufsteigenden Nebel wirkten wie Weichzeichner, verschleierten die Figur des jungen Mönchs, der hinter seinem Mitbruder kniete, den Kopf gesenkt.
Luca sprang aus dem Wagen, warf lediglich einen kurzen Blick auf den beleibten Mann mit dem Loch in der Schläfe und die über und über blutgetränkte Kutte, rannte zu dem Jungen. »Saverio! Saverio, bist du in Ordnung?! Ist dir etwas passiert?!«
Der Mönch hob das Gesicht, nass von Tränen und Regen. »Er ist tot.« Seine Stimme klang brüchig, als hätte auch sie einen Schuss abbekommen. »Tot … Der Herr sei seiner Seele gnädig …«
»Aber du? Was ist mit dir? Bist du verletzt?«
Die Lippen des Jungen bebten. Er konnte nicht mehr sprechen, schüttelte stumm den Kopf. Der Commissario legte ihm für einen Moment die Hand auf die Schulter, und der Mönch heulte auf und schlug die Hände vor die Augen.
Luca wandte sich an Massimo. »Wir brauchen die Spurensicherung. Und den Doktor.«
Lasse Wolafka war mit seinen italienischen Kollegen ausgestiegen, hielt sich jedoch am Rand des Geschehens, betrachtete zunächst die Umgebung. Sie befanden sich nur knapp jenseits des nordöstlichen Stadtrands von Ravenna, in der Ebene des Po-Deltas, inmitten von Wiesen, Feldern, Wäldern, Kanälen und Sümpfen. Eine einsame Gegend, in der es unwahrscheinlich war, dass sich jemand finden lassen würde, der die Tat beobachtet hatte. Einziger Zeuge blieb also vermutlich der vor Entsetzen fast nicht ansprechbare Junge, mit dem Luca Manaro zu reden versuchte. Lasse dachte bei sich, dass der Commissario, groß, schlank und mit dem unbewegten, asketischen Gesicht, zumindest nach außen hin einen ebenso guten Mönch abgeben würde wie der zitternde Junge mit den weichen, mädchenhaften Zügen.
Er zwang sich, seine Gedanken von seinem neuen Chef ab- und wieder dem Fall zuzuwenden, in den er so unversehens hinein katapultiert worden war.
»Woher kommen die Mönche?« Er richtete die Frage an Massimo, da er das Gefühl nicht loswurde, dass sein neuer Chef ihm nicht besonders wohlwollend gegenüberstand. Der Italiener holte eine Karte aus dem Wagen, breitete sie auf der Motorhaube aus. »Sehen Sie, hier ist Ravenna. Hier die Kapelle mit diesem Feldweg. Und dort, etwa sieben Kilometer weiter nördlich, im Bereich der Pineta von San Vitale«, er deutete auf ein schwarzes Kirchensymbol, »liegt die Abbazia San Benedetto del Pino, das Benediktinerkloster. Saverio lebt dort.«
»Sie kennen den Jungen?«
Massimo nickte.
»So, wie der Tote gestürzt ist, würde ich sagen, die Schüsse kamen von dort drüben.« Lasse wies auf den Ausläufer des nahen Wäldchens. Er sah, wie Luca zu ihm herüber schaute, tat, als bemerke er es nicht, redete weiter zu Massimo. »Sowohl die Salve in die Brust als auch der Kopfschuss müssen tödlich gewesen sein. Warum hat dem Täter oder den Tätern nicht eines von beiden genügt? Bewusster Overkill? Das würde auf einen Mord mit starken persönlichen Emotionen als Motiv deuten. – Wir können nur hoffen, dass der junge Mann uns Näheres zum Hergang erzählen kann, aber ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis er vernehmungsfähig ist … Armer Hund!« Etwas anderes fiel ihm ein. »Wenn Sie den Jungen kennen, dann vielleicht auch den Toten?«
Der Polizist schüttelte den Kopf. Langsam kehrte der Commissario zu den beiden zurück.
»Das ist Pater Paolo. Siebenundsechzig Jahre. Der Prior von San Benedetto.« Luca blickte erst zu der Madonna, deren traurige Augen das Geschehen mitleidsvoll zu verfolgen schienen, danach wieder zu dem jungen Mönch, der die Hände zum stummen Gebet faltete. Lasse konnte sehen, dass der Benediktiner am ganzen Körper zitterte. Sein Habit war durchnässt, im unteren Teil voller Schlammspuren.
»Der kippt Ihnen gleich aus den Sandalen, voll in die nächste Pfütze.« Lasse verfluchte sich im nächsten Moment für seine flapsige Ausdrucksweise; vielleicht wäre es von Vorteil gewesen, nicht so gut Italienisch zu können …
Der Commissario sandte ihm einen unergründlichen Blick. »Notieren Sie alles, was Ihnen auffällt, Wolafka.« Vermutlich ließ er den Signore mit Absicht weg. »Und dann warten Sie mit Massimo auf die Spurensicherung. Ich werde unterdessen Saverio zum Kloster zurückbringen.«
Wie ein Schlafwandler folgte der Benediktiner dem Commissario zu dessen Wagen. Die Sonne hatte die Wolken mittlerweile vollständig verdrängt, und nach dem morgendlichen Schauer wirkte der zurückbleibende Peugeot wie mit Tausenden glänzender Tränen überzogen.
»Willst du gleich zurück zum Kloster, oder möchtest du erst irgendwo einen Caffè trinken? Um deinen Kreislauf zu stabilisieren?«, fragte der Commissario seinen Begleiter, der wie ein Häufchen Lumpen auf dem Beifahrersitz in sich zusammensackte. Als er keine Antwort erhielt, startete Luca den Wagen und lenkte das Auto auf die Straße zur Abtei.
»Bist du soweit in Ordnung, Saverio?«
Wieder Schweigen.
»Ich kann dich zu einem Arzt bringen. Vermutlich wäre das das Vernünftigste. Du stehst unter Schock«, schlug Luca vor, und endlich erwachte Saverio aus seiner Starre.
»No! Nein, danke. Wenn Sie mich zum Kloster fahren könnten … Ich hätte längst dort anrufen müssen, aber … nach dem Notruf in die Questura war der Akku leer.«
»Bist du sicher, dass du keinen Arzt benötigst?«
Den Blick gesenkt, knetete der Mönch seine Hände. »Ein Arzt kann mir nicht helfen.« Leiser setzte er hinzu: »Vielleicht, wenn der Herr sich meiner erbarmt, finde ich Hilfe im Gebet.«
»Kannst du mir erzählen, was genau passiert ist, Saverio? An was du dich erinnerst?«
Der Junge unterdrückte ein Schluchzen. »Es ging so schnell, Commissario!«
»Hast du etwas gesehen? Woher die Schüsse kamen, zum Beispiel?«
»Halten Sie! Halten Sie an! Mir wird schlecht!«
Saverio übergab sich in eine Binsengruppe, während Luca im Wagen nach Massimos Pfefferminzkaugummis suchte. »Hier. Vielleicht hilft das.« Er gab sich Mühe, ein Lächeln für den Jungen zu finden. »Deine Mitbrüder werden dir sicher helfen, über – diese schwierige Zeit hinwegzukommen.«
»Sì. Ja …« Der junge Mönch blickte aus dem Fenster. »Und Er. Unser Gott. Er ist ein gütiger Gott. Nur – der Weg, der zu ihm führt, ist voller Steine …«
Luca biss sich auf die Lippen. Vermutlich war das nicht der passende Moment, davon anzufangen, wie sehr er diese Sprüche hasste. Er dachte an Wolafka mit seiner blöden Bemerkung. Der Deutsche war ein ganz anderer Typ als Luca und Massimo erwartet hatten. Man würde sehen, wie er sich weiter entpuppte.
Sowohl der Commissario als auch sein Begleiter waren froh, als der Wagen vor dem Tor der Benediktinerabtei anhielt. Auf einer Lichtung im einsamen Pinienwald gelegen, mit dem unwegsamen Sumpfgebiet der Pialassa Baiona in nur etwa einhundert Metern Entfernung, wirkte das Kloster wie ein Relikt aus einer früheren Welt. Wie eine mittelalterliche Burg fast, mit der mannshohen Einfriedung aus rötlich-gelbem Backstein und dem fast vierzig Meter hoch aufragenden Glockenturm. Die hinter dem alten Komplex liegende moderne Klostergärtnerei mit ihren Glashäusern war erfreulicherweise so geschickt hinter Baumreihen versteckt, dass sie den Eindruck der Zeitlosigkeit nicht zu stören vermochte.
Luca stieg aus und öffnete seinem Begleiter die Tür. Die Blässe des jungen Mönchs hatte sich kaum gemildert, und der Commissario stützte den Jungen, als sie unter die von weißen Säulen getragenen Arkaden des Eingangsbereichs traten, wo Luca an der Pforte läutete.
»Danke«, flüsterte Saverio. »Möge Gott Ihnen Ihre Freundlichkeit vergelten, Commissario.«
Luca blickte ihm nach, wie er mit gebeugten Schultern, die alle Last der Welt niederzudrücken schien, fortging, und er fragte sich, ob der Gott des Jungen ihn selbst nicht längst als hoffnungslosen Fall aufgegeben hatte. Dann sagte er dem Pförtner, dass er den Abt sprechen müsse.
»Was hat er Ihnen erzählt, dieser Junge?«, erkundigte sich Lasse. Als der Commissario zurück in die Questura gekommen war, hatte zunächst Massimo berichtet, was Spurensicherung und Arzt, die beide Lasse Wolafkas Anwesenheit gründlich ignoriert hatten, herausgefunden hatten: Nämlich so gut wie nichts. Der Täter hatte in dem Wäldchen mit dem feuchten Gras keine verwertbaren Fußabdrücke hinterlassen, und die Wege, die er vermutlich benutzt hatte, waren erst kürzlich gekiest worden, so dass sich trotz des Regenschauers kein Reifenprofil erkennen ließ. Und Todeszeitpunkt und Todesursache von Prior Paolo waren schließlich ohnedies klar.
»Hat er überhaupt etwas beobachtet, der kleine Mönch?«
»Er steht unter Schock. War zu keiner Aussage fähig.« Luca setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Die ganze Sache muss rasend schnell abgelaufen sein. Die Schüsse fielen, und dann lag der Prior am Boden. An mehr erinnert sich der Junge nicht.«
»Sie kaufen ihm das ab?«
»Ich kenne Saverio seit Jahren. Er ist ein übernervöser, äußerst religiöser junger Mann, der uns kaum mit Absicht belügen würde. Im Übrigen wird er heute Nachmittag ins Commissariato kommen. Dann können wir ihn ausführlicher befragen.«
»Und die anderen Klosterleute? Haben Sie mit denen gesprochen?«
»Selbstverständlich.« Lucas Miene verriet nichts. »Niemand kann sich erklären, warum jemand den Prior ermorden sollte.«
Lasse nickte.
»Da ist noch etwas, von dem wir allerdings nicht wissen, ob es überhaupt von Bedeutung ist.« Luca gab Massimo einen Wink, und der Ispettore holte den Ausdruck der Mail, die am Morgen im Commissariato eingegangen war.
Lasse las und seine Augen wurden schmal. »Von der Thematik her würde es zu der Tat passen.«
»Richtig. Allerdings – und das ist in Germania vermutlich kaum anders als bei uns – kriegen wir fast täglich irgendwelchen ähnlich lautenden Mist herein.« Luca legte die Mail zur Seite. »Natürlich habe ich jemanden ins Internetcafé geschickt, aber …«
»Aber es wird nichts dabei herauskommen«, wusste Lasse. Eine Weile herrschte Schweigen. Schweres Schweigen.
»Wie gefällt Ihnen das Büro, Signor Wolafka?«, fragte Massimo endlich.
Lasse blickte auf die dunklen Möbel, den dunklen Holzboden, die der Hitze wegen geschlossenen Läden. Die modernen Gemälde in Grau, Braun und Schwarz, für die er Titel wie ›Hundespucke auf Linoleum‹ passend gefunden hätte … »Wunderbar. Stellen Sie einen Sarg rein und es ist die perfekte Familiengruft«, murmelte er. Unglücklicherweise nicht leise genug. Luca Manaro stand auf, ging hinaus und knallte die Tür zu.
»Mist! Das wollte ich eigentlich gar nicht laut sagen …«
Massimo überlegte eine Minute. »Sie konnten es nicht wissen«, erklärte er endlich.
»Was? Was kann ich nicht wissen?«
»Dass die Frau des Commissario heute vor einem Jahr tödlich verunglückt ist.«
»Heilige Scheiße!« stöhnte Lasse. »Ich muss gestehen, es ist eine Eigenart von mir, dass ich selbst in das winzigste Fettnäpfchen problemlos hinein stolpere.«
Niemand sprach, bis Luca zurückkehrte, einen Stapel Post im Arm. Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, öffnete den ersten Umschlag, las.
»Mann, tut mir leid. Das Büro ist ganz in Ordnung, ehrlich!«, sagte Lasse, der sich äußerst unwohl fühlte. »Ich habe oft in scheußlicheren Ecken gehockt.«
Der Commissario zeigte keine Reaktion. Wieder regierte Schweigen.
»Eure Kaffeemaschine da drüben, ist die bloß Deko?« Lasse gefiel nicht, wie die Dinge sich entwickelten, aber er wusste nicht, was er dagegen tun sollte.
Massimo erhob sich und brachte ihm einen Espresso.
»Grazie … Das wäre nicht nötig gewesen. Ich hätte ihn mir selbst holen können.«
Luca Manaro nahm ein Blatt Papier, hielt es Massimo hin. »Der Neue soll seine Adresse aufschreiben. Wo er abgestiegen ist. Wie wir ihn telefonisch erreichen können.«
Gehorsam trug Massimo den Zettel zu Lasse.
»Ich hab noch keine Adresse«, sagte der. Die Mitteilung zeigte den gewünschten Erfolg. Stirnrunzelnd sah Luca jetzt doch direkt zu ihm hinüber.
»Aber Sie müssen irgendwo geschlafen haben, letzte Nacht?«
»Am Strand. Bei Lido di Dante.«
Vier dunkle Augen starrten Lasse an, als sähen sie ein exotisches Tier.
»Am Strand? Sie meinen in einem Hotel am Strand?«
Lasse zog die leeren Schubladen seines Schreibtisches auf und schloss sie wieder. Eine nach der anderen. »Nein, kein Hotel. Ich sagte doch, ich hab am Strand gepennt.«
»Einfach so? Im Sand?« Massimo konnte es nicht fassen, vermutete ein Sprachproblem.
»Die Nacht war warm. Und trocken. Trotz des Sturms.« Lasse sagte es, als erkläre es alles. Und augenblicklich drifteten seine Gedanken zurück, zu dem Morgen unter freiem Himmel, dem roten Hund, der die Möwen jagte, dass sie empört kreischend aufstoben, zu dem rhythmischen Spiel der schäumenden Wellen, vor und zurück, vor und zurück, zu der orangefarbenen Krabbe, die auf ihren winzigen Beinen ins Meer hastete … In diesem Moment ging die Tür auf, ohne dass angeklopft worden wäre.
Questore Zingara stand auf der Schwelle, sein sonst so verquältes Gesicht zu einem künstlich wirkenden Lächeln verzogen. »Benvenuto, caro Signor Wolafka! Äh … benvenuto!«
Mit einem verständnislosen Blick erhob sich Lasse. Der Questore trat vorsichtig näher, schüttelte Lasse die Hand und ließ sie schnellstmöglich wieder fallen. »Willkommen! Herzlich willkommen in unserem Team!« Erst jetzt schien er zu merken, dass der tedesco keine Ahnung hatte, mit wem er es zu tun hatte. »Ich bin Questore Zingara! Wann immer Sie ein Problem haben, kommen Sie einfach zu mir … Ich habe stets ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter …« Vermutlich hatte er den Rest seiner einstudierten Begrüßungsrede in der Aufregung vergessen, denn schon im nächsten Augenblick verflüchtigte sich jegliches Lächeln aus seinem Gesicht, und er wandte sich nervös an Luca. »Was ist das mit dem Mord an diesem Pater? Sie müssen das aufklären, so rasch es geht! Und vergessen Sie nicht den Tatortbericht; ich will ihn schnellstens auf meinem Schreibtisch.« Zingara drehte sich zurück zu Lasse, musterte ihn verwirrt, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Mit der Verstärkung aus dem tüchtigen Germania wird die Lösung des Falls ein Leichtes sein, nehme ich an.« Hilflos nickend verschwand er aus dem Zimmer, und sie konnten hören, wie er im Vorzimmer die Sekretärin fragte, für wann er am Abend zum Treffen seines Malzirkels verabredet sei.
Wie um nach dem nicht unbedingt geglückten Morgen ihren guten Willen zu beweisen, forderten Luca und Massimo den Neuen auf, sie zum Mittagessen in ihre Lieblingstrattoria zu begleiten. Zwar blieb auch in der kleinen Gaststube in der Via Alberoni die Atmosphäre noch angespannt, doch die Frage, welche Art Wohnung der tedesco suchte – eine mit Balkon oder Dachterrasse, das war für Lasse erste und wichtigste Bedingung – erwies sich als geeignetes, weil unverfängliches Gesprächsthema für den Einstieg. Und Massimo erinnerte sich dabei, dass seine Schwester von jemandem erzählt hatte, der ein Appartement vermieten wolle. Er versprach, nach dem Essen bei Luisa anzurufen. Anschließend kehrten die Gedanken aller zu dem Mordfall zurück.
»Wieso«, fragte Lasse, »sind überhaupt Sie für den Mord zuständig? Ich dachte, in Italien arbeitet die Polizei nur in den Städten, und mit allem, was auf dem Land passiert, dürfen sich die Carabinieri rumschlagen?«
»Ganz so einfach ist die Zuständigkeitsregelung nicht. Allerdings, der Grund, auf dem die Kapelle steht, gehört sowieso noch zu Ravenna«, erklärte Massimo.
»Na, dann«, Lasse nahm seine Rucola-Pasta in Angriff, »können wir bloß hoffen, dass der kleine Mönch etwas Klarheit ins Geschehen bringt.«
»Saverio wird vermutlich nicht allein kommen«, sagte Luca.
»Ist das ein Problem?«
Der Commissario schwieg eine Weile. Dann fragte er: »Was wissen Sie über die Benediktiner?«
»Nicht allzu viel. In meinem Führer stand was über die Geschichte des Klosters, aber ich muss gestehen, ich hab den Artikel bloß kurz überflogen. Das Einzige, was hängen geblieben ist«, Lasse dachte nach, »ist, dass die Ordensbrüder nach den Regeln leben, die dem heiligen Benedikt von Nursia im Mittelalter eingefallen sind – nein, sogar noch vor dem Mittelalter. Vor ewig langer Zeit halt.«
»Was Sie vielleicht auch wissen sollten«, sagte Luca, während er eine Muschel aus seinem Meeresfrüchtesalat pickte, »ist, dass ein Benediktinerkloster normalerweise autark sein soll. Das heißt, jedes Kloster wirtschaftet für sich, unabhängig von anderen Häusern des selben Ordens. Und die höchste Instanz ist der jeweilige Abt. Jeder Klostervorstand legt quasi für seinen Konvent die internen Regeln selbst fest. Natürlich immer im Hinblick auf die Vorgaben Benedikts.«
Lasse runzelte die Stirn. »Sie meinen, der Abt ist so was wie der Kapitän auf einem Schiff? Eine Art Mini-Gott in einem Mini-Universum?«
Luca nickte. »Wenn ein Kloster einem gutmütigen Abt untersteht, haben die Mönche ein wesentlich angenehmeres Leben, als wenn der Abt ein sehr strenger Mensch ist.«
»Und in welche Kategorie gehört unser Klostervorstand?«
»Streng hoch drei«, sagte Massimo düster. »Und genau deswegen wird er Saverio nicht erlauben, allein anzutreten.«
»Damit der Junge keine Kloster-Interna ausplaudert?«
Die beiden Italiener nickten. »Das Kloster ist eine Welt für sich. Eine Welt, in der die für uns normalen Spielregeln außer Kraft gesetzt sind«, erläuterte Luca. Er erzählte, dass es vor ein paar Jahren einen Einbruch im Kloster gegeben hatte, und dass der Abt schon damals alles andere als glücklich über die Hilfe der Polizei gewesen war.
»Und dieser Prior? War der auf seiner Linie? Was ist überhaupt ein Prior?«
»Der zweite Mann nach dem Abt. Um in Ihrem Bild zu bleiben, der erste Offizier an Bord. Und ja, der Prior wurde vom Abt in sein Amt eingesetzt. Also ist anzunehmen, dass er ein Mann nach dessen Geschmack war.«
»Na, prost Mahlzeit.« Und Lasse spendierte Espresso für alle.
Die Steinplatten der Gräber glänzten in der Mittagssonne. Diesmal, am Tag, trug die Gestalt keine Kapuzenjacke und hatte nur eine einzelne, blutrote Rose dabei. Geduldig wartete sie, bis die alte Frau, die das benachbarte Grab betreute, zu Ende gebetet und sich entfernt hatte, dann zog sie ein Tuch aus der Tasche und entfernte den Staub, der von dem auf der gegenüberliegenden Kanalseite liegenden Industriegebiet herübergeweht worden war, von der Abdeckplatte des Grabs, ehe sie die Blume sanft darauf legte.
»Es ist alles gut gegangen«, sagte sie leise, wobei es ihr kaum gelang, den Triumph in ihrer Stimme zu unterdrücken, den Stolz auf eine perfekte Leistung. »Der Anfang ist gemacht!« Plötzlich jedoch verhärtete sich ihre Miene; die Gestalt blickte über das Grab hinweg. »Sie werden alle sterben!«, versprach sie, und der Hass verzerrte ihre Stimme, dass sie metallen klang. »Alle! Ich werde alle töten! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue!«
Nach dem Essen schleppte Lasse ein paar Pappschachteln ins Büro hinauf und räumte seinen Schreibtisch ein. Als er gerade fertig war, meldete die Sekretärin, ein aknegeplagtes, junges Mädchen mit Namen Bianca Novelli, zwei Männer an: Den jungen Saverio und einen kleinen, älteren Mönch, dessen gelbliches Gesicht wie eine verkniffene Versteinerung wirkte.
»Hallo, Saverio.« Luca lächelte dem Jungen zu, während er dem alten Mann nur ein kurzes Nicken gönnte. »Come stai? Geht's besser?«
Unsicher blickte der Junge zu seinem Begleiter, dann nickte er vorsichtig.
»Kaffee?«
Die Mönche lehnten ab. Massimo erhob sich, um ihnen Stühle anzubieten. Luca runzelte die Stirn. »Sie kenne ich nicht«, sagte er mit seiner üblichen ruhigen Stimme zu dem älteren Mann.
Der verneigte sich leicht. »Pater Martino.« Er warf einen Blick zu Lasse, und Luca erklärte knapp, dass Signor Wolafka ihn als sein Assistent bei den Ermittlungen unterstütze.
Saverio sah elend aus; tiefe bläuliche Schatten lagen unter seinen dunklen Augen, sein Gesicht wirkte gealtert.
»Ich – wollte mich noch einmal bedanken, Commissario. Dafür, dass Sie mich … heimgefahren haben.« Der junge Benediktiner sah kurz zu Pater Martino, dann auf seine Hände, die sich um die Tischkante krampften.
»Schon gut. Schildere uns einfach, was geschehen ist, Saverio! Erzähl alles, woran du dich erinnerst, egal, ob es dir unwichtig erscheint oder nicht.«
Wieder ein Blick zu dem Pater. Dann senkte der Junge, den Lasse auf etwa fünfundzwanzig schätzte, den Kopf. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, murmelte er. »Wir sind zu der Kapelle gefahren. Um frische Blumen hinzubringen. Als wir anhielten, erwischte uns dieser Schauer. Prior Paolo meinte, der würde nur kurz dauern, wir sollten im Auto warten. Und bald darauf, als es tatsächlich zu regnen aufhörte, stiegen wir aus und – und dann fiel der Schuss!«
»Ein einzelner Schuss zuerst?«
Neuerliches Schielen zu Martino. Der Junge barg das Gesicht in den Händen und begann zu weinen.
»Und anschließend?«, drängte Luca sanft. Saverio schüttelte den Kopf. »Es ist alles – so schrecklich!«, brachte er mühsam heraus.
»Wir wissen, dass weitere Schüsse gefallen sein müssen.«
»Ich war – völlig fertig. Ich weiß nichts … In meinem Kopf geht alles durcheinander.«
»Worüber habt ihr denn im Wagen geredet, Prior Paolo und Sie?«, mischte sich Lasse vorsichtig ein.
»Wir sind Benediktiner«, sagte Martino, bevor der Junge antworten konnte. »Unsere Regeln verbieten unnützes Geschwätz.«
»Danach hat Signor Wolafka nicht gefragt«, kam der Commissario Lasse zu Hilfe. »Er wollte wissen, was in diesem konkreten Fall gesprochen wurde.«
»Ich erinnere mich nicht … Ich glaube, Prior Paolo sagte etwas über das Wetter, die globale Klimaänderung. Die Anmaßung des Menschen, der aus Profitgier die Erde zerstört …« Jetzt sah der Junge auf, Verzweiflung in seinem runden Gesicht. »Ich … hätte besser zuhören sollen.«
»Das hätte dir in der Tat gut angestanden!«, rügte Martino augenblicklich. »Du musst endlich lernen, deine Gedanken auf den Herrn und den Konvent zu konzentrieren, statt auf die Welt vor den Toren!«
»Aber ich habe gar nicht …!« Auf den eisigen Blick Martinos hin schien der Junge zusammenzuschrumpfen. »Scusa … Es tut mir leid, Pater, ich wollte nicht widersprechen. Wirklich nicht.«
Der Commissario hatte die kleine Szene schweigend beobachtet. Jetzt wandte er sich an den älteren Mönch. »Ich muss Sie bitten, eine Weile draußen Platz zu nehmen. Ich möchte mit dem jungen Mann allein sprechen.«
Nun zeigte sich, dass das Gesicht des Paters doch keine Versteinerung war; die Brauen des Mönchs zogen sich zusammen, dass sie fast ein V bildeten. »Weshalb?«, grollte Martino. »Bruder Saverio hat keine Geheimnisse vor mir. Er kann ebenso gut in meinem Beisein reden.«
Der Junge sagte nichts, fuhr sich mit dem Ärmel seines Habits über die Augen. Auch Lasse schwieg angesichts der Blicke, mit denen der Prior und der Commissario einander maßen. Irgendetwas ging zwischen den beiden vor, etwas, was er nicht verstand. Und er zwang sich, keine Fragen zu stellen, um nicht in der ungünstigsten Minute wieder in ein Fettnäpfchen zu steigen, das er nicht als solches erkannte.
Nach einer schier unendlich langen Zeit gegenseitigen Anschweigens und damaszenerscharfer Dolchblicke stand Martino auf und wurde von Massimo hinausbegleitet.
»Also noch mal«, sagte Luca, als habe es keine Unterbrechung gegeben. »Du musst diese anderen Schüsse gehört haben, Saverio! Und der Schütze muss seine Deckung verlassen haben, um sie abzufeuern.«
Der Junge schniefte. »Ich bin schlecht«, flüsterte er. »Schlecht und … schwach. Ich … muss Buße tun, bis ans Ende meiner Tage!«
»Die Schüsse, Saverio!«
Endlich sah der Junge Luca an; Qual verzerrte sein noch kindliches Gesicht. »Ich bin weggelaufen, Commissario! Als – als Pater Paolo zu Boden fiel, da hatte ich solche Angst … Ich bin gerannt, hinein in die Wiesen. Ich habe ihn im Stich gelassen, ich habe ihn einfach im Stich gelassen, ich bin so schlecht!«
»Du bist nicht schlecht, Saverio. Was du getan hast, war nur menschlich und absolut verständlich. Außerdem kann ich dich beruhigen: Prior Paolo war bereits nach dem ersten Schuss sofort tot. Erzähl weiter!«
»Ich bin gestürzt, in die Binsen am Bachrand und dann kam – diese Salve. Ich habe mich flach auf den Boden gepresst, ich dachte, jetzt schießen sie gleich auf mich …«
»Sie? Waren es mehrere?«, hakte Luca ein.
Erschrocken blickte der Junge auf. »Non lo so. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gesicht ins Gras gedrückt. Es war nass vom Regen. Und roch … faulig. Wie die Sünde … Der Höllenpfuhl.«
»Weiter«, forderte Luca ihn auf. »Erzähl mir alles, Saverio. Hier brauchst du dich für nichts zu schämen. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst!«
»Als sie aufhörten zu schießen, bin ich liegen geblieben. Ich habe mich gefragt, ob ich wirklich noch lebe. Irgendwo in der Ferne ist ein Auto weggefahren, mit aufheulendem Motor. Aber ich … Ich bin nicht aufgestanden. Weil ich gefürchtet habe, sobald ich mich bewege, schießen sie mich tot! Ich habe nur an mich gedacht, an mein armseliges Leben … Und währenddessen ist Pater Paolo …« Er schluchzte erneut.
Lasse füllte bei der Kaffeemaschine einen Espresso ab, stellte ihn vor dem Jungen auf den Tisch. Saverio leckte sich über trockene Lippen, starrte auf das Tässchen, streckte zögernd die Hand danach aus.
»Die Kapelle dort draußen. Schmückt ihr sie regelmäßig?« Nachdenklich sah Luca den Benediktiner an.
Saverio bejahte. Er schien jetzt etwas ruhiger, erzählte, dass die Pflege der Kapelle zu den Routineaufgaben des Konvents gehörte. »Jeden Dienstag bringen wir frische Blumen hin. Die Kapelle wurde im achtzehnten Jahrhundert von einem Bauern errichtet, dessen Sohn dort vom Wagen stürzte und sich schwer verletzte. Die Mutter des Jungen ging täglich zur Unfallstelle, um zur Madonna zu beten, und als der junge Mann nach seiner Kopfverletzung völlig genas, errichteten die Angehörigen die Kapelle. Mittlerweile lebt von dieser Familie niemand mehr, und so übernahmen die Benediktiner die Pflege der Gedenkstätte.«
Jeden Dienstag, dachte Lasse. Hatte der Mörder diese Gewohnheit der Mönche gekannt?
»Als Sie das Kloster verlassen haben, heute Morgen, ist Ihnen da irgendetwas Besonderes aufgefallen? Zum Beispiel ein anderes Auto, das in der Nähe der Abtei wartete? Oder ein Mann, der sich in der Nähe herumtrieb, vielleicht mit einem Handy telefonierte?«, fragte der Deutsche.
Der Mönch runzelte die Stirn, verneinte. Es sei ein ganz normaler Morgen gewesen. »Zuerst sind wir zur Klostergärtnerei gegangen, um den frischen Strauß abzuholen, und dann zur Kapelle gefahren. Sonst war nichts.«
»Und unterwegs«, nahm Luca den Faden auf, als seien er und Lasse ein seit Jahren eingespieltes Team. »Hast du da etwas bemerkt? Andere Fahrzeuge? Jemanden, der aussah, als ob er vielleicht – Vögel beobachten wollte? Oder einen Wanderer, einen Touristen?«
»Die Gegend ist so einsam …« Der Junge biss sich auf die Lippen. »Bruder Ignazio sagt, das sei erst der Anfang gewesen!«, brach es plötzlich aus ihm heraus. »Der … Anfang vom Ende! Er sagt, dass sich die Macht des Bösen verstärkt und dass … viele sterben werden … Viele.« Tränen perlten von Saverios Wimpern, als der Junge den Commissario ansah. »Bruder Martino meint, Ignazio sei … nicht mehr klaren Geistes. Aber was … wenn es wirkliche Gesichte sind? Wenn Ignazio recht haben sollte, und die Macht des Bösen …?«
Luca stand auf und öffnete das Fenster weit. Doch die Sonne, auf deren Licht er gehofft hatte, verbarg sich erneut hinter grauen Wolken. Ich muss den Tag durchstehen! Ich muss den verdammten Tag durchstehen! Und das Letzte, was ich brauche, sind Geschichten von irgendwelchen Irren, die noch mehr Unheil prophezeien! Gewaltsam zwang sich Luca, die Kälte, die sich von nirgendwoher kommend in seinem Inneren auszubreiten begann, zu ignorieren.
»Das Böse lauert überall«, murmelte Saverio, nun mehr zu sich selbst. Es schien, als falle dem Jungen erst jetzt die Tasse in seiner Hand auf, die er geistesabwesend geleert hatte. Erschrocken starrte er auf den Kaffeesatz, als läse er darin eine grauenhafte Zukunft für sich. »Ich – darf ich jetzt gehen?«
Luca nickte ihm zu, und Saverio schoss von seinem Sitz hoch. Doch plötzlich, kurz vor der Tür, blieb er stehen, zögerte. »Aspetti, Commisssario. Doch, Augenblick, da war etwas …«
Unbewusst tat Luca, der zum Fenster getreten war, einen Schritt auf ihn zu. »Ja?«
»Ein Landstreicher! Als wir zur Kapelle gefahren sind, haben wir einen Landstreicher gesehen! Nicht auf dem Weg, den wir fuhren, sondern auf einem Trampelpfad parallel zur Straße, auf der anderen Seite des Bachs. Es sah aus, als wäre er gerade unterwegs Richtung Kloster. Ich habe gefragt, ob ich anhalten soll, aber Prior Paolo meinte, das bräuchte ich nicht, der Mann würde im Kloster bestimmt besser bedient als von uns, die wir ja nur Blumen dabei hatten.«
»Beschreib den Mann!«, verlangte Luca. »Stell dir vor, du sitzt wieder im Auto, und er geht diesen Weg entlang. Was genau siehst du?« Er warf einen auffordernden Blick zu Lasse, und der Deutsche schnappte sich Block und Stift.
»Er war mittelgroß.« Der Junge überlegte. »Und trug eine blaue Jacke.« Er zögerte. »Leider war er nicht so nah, dass ich sein Gesicht hätte sehen können …«
»Hatte er etwas dabei?«, half der Commissario. »Einen Schlafsack, vielleicht, oder …?« Er ließ die unvollendete Frage in der Luft hängen. Begierig griff Saverio die Anregung auf:
»Ja, er hatte einen Rucksack. Einen großen, grauen Rucksack. Und außen dran hing ein – ein Musikinstrument. Irgendwas mit Metall. Es hat in der Sonne geblitzt. Eine Klarinette, glaube ich.«
»Woher weißt du, dass es ein Landstreicher war, und kein Wanderer?«
»Das sah man … Zu unserem Kloster kommen viele Leute. Die einen, um Fotos vom Campanile zu machen, die anderen um zu betteln.« Zum ersten Mal stahl sich etwas wie ein schüchternes Lächeln auf das Gesicht des Jungen. »Wir brauchen sie nur aus der Entfernung zu sehen, und schon wissen wir, zu welcher Sorte unsere Gäste gehören.«
Als Saverio fort war, kam Massimo wieder herein, über das ganze Gesicht strahlend. »Die Wohnung, Signor Wolafka! Meine Schwester sagt, Sie können die Wohnung heute Abend ansehen! Und wenn sie Ihnen gefällt, gleich dort bleiben! Sie liegt mitten in der Altstadt, mit einer kleinen Dachterrasse!«
»Haben Sie eine Adresse?«
Massimo erbot sich, den Kollegen persönlich hinzubringen, und Lasse akzeptierte dankend.
»Der Landstreicher.« Luca interessierte sich nicht mehr für Lasses Wohnprobleme. »Wir müssen den Landstreicher finden. Sofern es wirklich einer war …«
»Sie meinen, es könnte sich um den Mörder handeln?«, fragte Lasse.
»Es erscheint mir unwahrscheinlich, aber wir müssen für alles offen bleiben. – Ich persönlich halte ihn nicht für den Mörder, denn der war vermutlich mit einem Wagen unterwegs. Saverio hat ein Auto starten gehört, nach der Tat. Weshalb sollte der Mörder also einen riesigen Rucksack mit sich tragen? Und eine Klarinette! Aber der Vagabund ist ein wichtiger Zeuge. Er könnte etwas beobachtet haben. Vielleicht sogar den Täter. Wir müssen ihn suchen!«
»Das übernehme ich«, sagte Lasse schnell. Die beiden anderen starrten ihn an.
»Sie kennen sich in der Obdachlosenszene hier gar nicht aus«, meinte Luca langsam.
»Diese Szene finde ich überall.«
Der Commissario zog die Brauen hoch. »Hier ist nicht Ihr Germania, Wolafka. Unsere Vagabunden sind der Polizei nicht unbedingt wohlgesonnen. Um die Wahrheit zu sagen, etliche haben sogar einen ziemlichen Hass auf unsere Leute. Außerdem gibt es immer wieder blutige Revierkämpfe zwischen verschiedenen Bettlergruppen.«
»Ich werde kaum so bescheuert sein rumzuposaunen, dass ich zu den piedipiatti, den Bullen, gehöre …«
»Ihr italienischer Wortschatz ist wirklich bemerkenswert«, sagte Luca trocken.
Kapitel 3
Die Wohnung war ein Traum, für einen Mann wie ihn zumindest, wie Lasse sogleich erkannte. Kurz vor der Fußgängerzone, in der historischen Altstadt also. Direkt unter dem Dach, ein winziges Schlafzimmer, doch mit ausreichend Platz für ein Doppelbett, eine voll eingerichtete Mini-Küche, ein überraschend geräumiges Bad, die weißen Fliesen mit maritimem Dekor in Blau und Gold, ein großes, helles Wohnzimmer. Und die versprochene Dachterrasse. Circa acht Quadratmeter, über der Ecke Via Angelo Mariani / Via di Roma, zur Hälfte mit einer scheußlichen Konstruktion aus Metallstreben und Plexiglas überdacht und zum Ausgleich mit einem duftenden Zitronenbusch, den der Vorgänger dagelassen hatte, und an dem bereits tischtennisballgroße, dunkelgrüne Früchte wuchsen.
»Warum ist der vorige Mieter ausgezogen?«, fragte Lasse.
Die etwa sechzigjährige Signora, die ihnen aufgesperrt hatte, hob die Arme und rief eine Beschwörung in den Himmel. »Der arme, unglückliche Signor Pedrelli! Seine Frau hatte ein Verhältnis, da hat er sich erschossen!«
»Hier in der Wohnung?« Lasse war nicht abergläubisch; dennoch wäre ihm der Gedanke, ständig über das eingetrocknete Blut eines Selbstmörders zu laufen, unangenehm. Auch Massimo blickte beunruhigt; schließlich war es seine Schwester, die die Wohnung vermittelte und bestimmt ein schönes Geschenk einstecken würde, sollte der deutsche Polizist mieten.
»Nein, nicht hier. Auf der Jagd, bei Comacchio. Er hat sich auch nicht richtig erschossen, nur ein bisschen. Wahrscheinlich, weil er das Gewehr falsch gehalten hatte, und als er aus dem Krankenhaus kam, hat ihn seine Tochter mitgenommen. Sie wohnt in Torre Annunziata, bei Napoli, und wenn er noch mal sterben will, ist vielleicht der Vesuv gnädig genug, ihn zu verschütten. Die Möbel hat sie mitgenommen, die Tochter, aber den Zitronenbusch wollte sie nicht. Ihr Garten dort unten ist voll mit solchem Zeug, Orangen, Zitronen und Feigen, das hat sie gesagt …«
Lasse unterzeichnete den Vertrag und wusste, dass er diese Nacht nicht am Strand, sondern unter seinen Zitronen schlafen würde. Doch zuvor wollte er sich ein wenig in seinem neuen Job engagieren.
»Gott helfe Ihnen, diese entsetzliche Sache aufzuklären!« Nervös drückte der alte Giorgio, der die Klosterpforte betreute, auf einen Knopf seiner Sprechanlage, flüsterte hastig und drängend in einen Telefonhörer, bekreuzigte sich und sperrte das Tor auf. »Sie wissen ja, wo das Besucherzimmer ist, Signor Commissario.«
Er wusste es nur zu gut, schritt den sparsam beleuchteten, kahlen Gang entlang, wandte sich nach rechts. Das Zimmer, das er betrat, war einfach, jedoch einigermaßen wohnlich eingerichtet, mit einer dunklen Sofagarnitur, einem schweren Holztisch, Heiligenbildern an den Wänden – Apollinaris und Vitalis, natürlich – sowie einer meterhohen geschnitzten Madonna in einem Eck. Die Fenster gingen auf den Innenhof hinaus, den der blasse Mond in gespenstisch weißes Licht tauchte. »Commissario.« Der Abt sprach keine der üblichen Begrüßungsfloskeln, aber das störte Luca nicht, im Gegenteil. So empfand auch er nicht die Notwendigkeit, sich mit Höflichkeiten aufzuhalten.
»Prior Paolo. Sie können sich sicher denken, dass ich seinetwegen hier bin. Ich hätte Sie bereits früher kontaktiert, aber Ihre Brüder teilten mir heute Morgen mit, Sie seien in Rom.«
»Ich war auf einem Konzil, ja. Doch als ich von dem bedauerlichen Todesfall hörte, bin ich so rasch wie möglich zurückgekehrt. – Ich nehme an, Sie wollen mir Ihr Beileid aussprechen?«
Der sarkastische Unterton belastete Luca keineswegs. »Wenn Sie darauf bestehen … Der Tod eines Menschen erfüllt mich immer mit Trauer.« Er hielt einen kurzen Moment inne, ehe er fortfuhr: »Hatte irgendjemand einen Grund, Ihren Mitbruder zu hassen? Hatte der Prior Feinde?«
Die strenge Miene des hageren alten Mannes, der genauso aussah, wie Luca sich biblische Propheten vorstellte, verfinsterte sich noch mehr, falls dies überhaupt möglich war. »Prior Paolo war ein Mann Gottes. Und tat Gottes Werk. Wie sollte er Feinde haben?«
»Nun, jemand hat ihn immerhin so wenig leiden können, dass er ihn tötete.«
»Vermutlich ein Raubüberfall. Unser bedauernswerter Bruder war zur falschen Zeit am falschen Ort. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, denn mehr weiß ich nicht.«
Luca war klar, dass der Alte vor allem nicht mehr sagen wollte. Er ging nicht darauf ein, dass überhaupt kein Raub stattgefunden hatte, wechselte das Thema. »Heute Morgen kam ein Landstreicher zu Ihrem Kloster. Ein Mann mit blauer Jacke und grauem Rucksack.«
Für Bettler sei die Pforte zuständig, sagte Pio. »Und, wenn es erforderlich ist, unsere jüngeren Brüder. Außer natürlich, der Betreffende will seine Seele erleichtern.«
»Wollte der Mann das?«
»Da müssen Sie Bruder Giorgio fragen.«
Luca stand auf. »Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.« Er bemühte sich, es wie eine Beleidigung klingen zu lassen, was jedoch nicht gelang. »Und jetzt möchte ich Sie bitten, mir Sandro zu schicken.«
»Sandro?! Weshalb?« Auch der Abt erhob sich; seine fast schwarzen Augen musterten den Besucher feindselig.
»Ich bin Ihnen keine Rechenschaft über meine Arbeit schuldig, Signor abate. Mein Wunsch, Sandro zu sehen, ist rein dienstlicher Natur!«
Er musste fast eine halbe Stunde warten, bis der junge Mönch mit gesenktem Kopf hereintrat, zu Lucas Erleichterung allein. Der Benediktiner blieb bei der Tür stehen, ohne sie zu schließen.
»Sandro!« Luca wollte auf ihn zugehen, doch der Junge wich zurück, und der Commissario setzte sich. »Haben sie dich instruiert, was du sagen darfst und was nicht, oder warum hat es so lange gedauert?« Er wusste sofort, dass er das nicht hätte aussprechen dürfen, verfluchte sich dafür, dass er seine Gefühle die Oberhand über den Verstand hatte gewinnen lassen. »Mi dispiace. Es war dumm, so zu reden. Es ist nur – ich mache mir Sorgen um dich!«
Jetzt endlich blickte der Junge auf. Er wirkte müde, hatte die gleichen Ringe unter den Augen wie Saverio. »Ich weiß, Luca. Es ist unnötig.« Er sprach monoton, wie eine Maschine, ein Tonband. Unpersönlich wie die Durchsagen am Bahnhof.
»Bist du glücklich?«
Wieder senkte der Junge den Kopf. »Der Weg ist steinig, aber das Ziel überstrahlt ihn.«
Luca musste an sich halten, nicht aufzuspringen, diese schmalen Schultern zu packen und zu schütteln, dies stumpfe Gesicht anzuschreien. Aber er wusste, dass er es nicht durfte. Und, dass es sinnlos wäre.
»Sandro, weißt du etwas von dem Landstreicher, den Saverio und Prior Paolo heute Morgen gesehen hatten? War er beim Kloster?«
Der Junge schien zu überlegen. »Sì«, sagte er endlich leise. »Er war hier. Ich habe ihm ein paar Schuhe aus der Sammlung herausgesucht, weil seine so kaputt waren.«
Luca fuhr hoch wie elektrisiert. »Die alten Schuhe, hast du sie noch?«
»Sie wurden mit dem Abfall verbrannt. Heute Nachmittag.«
Luca seufzte. »Hat der Mann dir seinen Namen gesagt? Beschreib ihn mir, so genau du kannst!«
»Seinen Namen wollte er nicht nennen. Das wollen sie oft nicht.« Sandro dachte nach. »Vielleicht aus Angst vor der Polizei … Aber es war kein Mann, Luca.«
»Er hat tatsächlich eine Klarinette, Wolafka. Allerdings, wir suchen nicht nach einem Mann, sondern einem Jungen. Einem Burschen zwischen vierzehn und achtzehn, bartlos. Keine besonderen Kennzeichen, kein Name.« Der Commissario rief Lasse auf dem Handy an, und der Deutsche notierte die Infos so gewissenhaft, wie er es sich für seinen neuen Job vorgenommen hatte.
Fünf Minuten später war Lasse unterwegs auf den Straßen der ihm unbekannten Stadt. Die Kostümierung hatte ihm keine Probleme bereitet. Wann immer er irgendwo im Freien nächtigte, tat er das in einer uralten, abgewetzten Jeans und einer verschlissenen Cordjacke, die er normal zum Autoreparieren trug. Das Schwierigste war gewesen abzuwarten, bis seine neue Vermieterin in der Küche werkte und ihn nicht bemerken würde.
Lasse fühlte sich immer wohl in dieser Kluft, als würde ihm mit der Kleidung eines Obdachlosen eine grenzenlose Freiheit geschenkt. Natürlich wusste er, dass er diese Freiheit nur deshalb so uneingeschränkt genießen konnte, weil er in Wirklichkeit ein einigermaßen gesundes Bankkonto, einen Wagen und jetzt sogar wieder eine Wohnung besaß, ganz im Gegensatz zu den echten Landstreichern. Trotzdem genoss er die Maskerade jedes Mal aufs Neue. Ohne Eile streunte er durch die abendliche Stadt, deren Zentrum sich so ganz anders präsentierte als Antons München: Schmale Sträßchen, die Häuser höchstens zwei- oder dreigeschossig, vorwiegend in warmen Ocker-, Rot- und Brauntönen, fast alle mit hölzernen Fensterläden. Beim Tabacchaio in der Via di Roma erstand Lasse zwei Schachteln Zigaretten, amüsierte sich bald darauf über den pikierten Blick eines Kiosk-Betreibers, der ihm eine Flasche billigsten Grappas verkaufte und ebenso über die Touristenpärchen, die den vermeintlichen Stadtstreicher misstrauisch beäugten und ihre teuren Digitalkameras fester fassten, wenn er zu dicht an ihnen vorbeischlenderte.
Selbstverständlich hatte er keine Ahnung, wo sich die Obdachlosenszene genau dieser Stadt traf, doch er hatte sein untrügliches Gespür dafür, wo er suchen musste, nie verloren. In öffentlichen Parks erkannte man es an Papierkörben, an dem Müll im Gebüsch, ob sie gern zur Übernachtung genommen oder aber an den Abenden zu stark frequentiert oder zu genau überwacht wurden.
Lasse schlenderte durch den Parco della Pace, wie jemand, der zu viel Zeit und zu wenige Ziele hat, suchte sich die abgelegenste, dunkelste Ecke, tat, als sähe er nichts als den gekiesten Weg und beobachtete doch aus den Augenwinkeln scharf jede Bewegung, jeden Schatten, der sich nicht so still hielt, wie es einem Baum oder Strauch zukam. Er genoss die milde Wärme der Luft, erinnerte sich an die Nächte in Deutschland, an die verzweifelten Versuche, über Abluftschächten wenigstens ein bisschen Wärme zu finden, nicht zu erfrieren im täglichen Kampf um das Überleben … In manchen Punkten bot das Leben im Süden Vorteile.
Der Parco war sauber, zu sauber; möglicherweise der Touristen wegen, deren Augen nicht auf Hinweise des täglichen Elends stoßen sollten, oder aufgrund seiner Nachbarschaft zur Santa-Maria-Kirche. Oder vielleicht hatte die Polizia erst kürzlich eine Razzia vorgenommen und auf diese Weise verhindert, dass sich die Szene hier traf? Lasse störte es nicht, dass er nicht sofort Erfolg hatte.
Langsam wanderte er weiter durch die nächtliche Stadt, die Glockenlieder der zahlreichen Kirchen im Ohr, überquerte ein paar Straßen, entdeckte erneut einen Park, den der umfriedeten, mittelalterlichen Festung Rocca Brancaleone, und trat durch das steinerne Tor. Sofort spürte er, dass die Atmosphäre stimmte. Nicht zu viele Lampen, nicht zu helle Wege, nicht zu viele Leute. Instinktiv wusste er, dass er den richtigen Platz gefunden hatte. Jetzt hieß es, vorsichtig zu sein, sich völlig in seine Rolle zu versenken und keine Fehler zu machen.
Er suchte sich eine Bank möglichst weitab von den Kinderspielgeräten, lümmelte sich darauf, einen Arm um die Lehne und die Füße auf einem schief hängenden Abfallkorb. Eine lange Weile blieb er ruhig sitzen, die Augen halb geschlossen, den Grappa neben sich.
Es war sein Instinkt, der ihm die Anwesenheit anderer Menschen verriet, noch bevor er das Rascheln im Gebüsch, die bemüht leisen Schritte bewusst registrierte. Angst verspürte er keine, höchstens eine leichte Erregung. Schließlich war das einmal seine eigene Welt gewesen, und er tauchte mental so mühelos darin ab, als habe er sie nie verlassen.