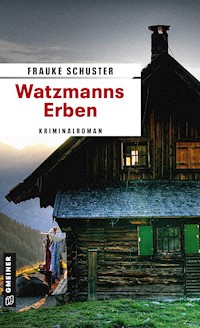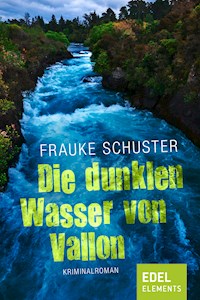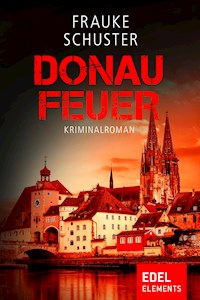Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalist Paul Leonberger
- Sprache: Deutsch
In einer abgebrannten Scheune macht die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Handelt es sich um eine aus den Fugen geratene Zündelei oder steckt mehr dahinter? Der Journalist Paul Leonberger beginnt zu ermitteln und hat bald das unheimliche Gefühl, dass jeder seiner Schritte beobachtet wird. Als er in den Bergen nur knapp einem Anschlag auf sein Leben entgeht, begreift er, dass jemand dem Täter Informationen liefern muss. Unerwartete Unterstützung findet Paul bei der wortkargen Rangerin Tessa, die auf einer abgelegenen Alm lebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauke Schuster
Der Watzmann und der Tod
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Finsteres Begehren In einer abgebrannten Scheune macht die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Handelt es sich um eine aus den Fugen geratene Zündelei oder steckt mehr dahinter? Der Journalist Paul Leonberger vermutet Letzteres und beginnt zu ermitteln. Könnte der ruppige Künstler Barth etwas damit zu tun haben? Oder der aggressive Jungbauer Rainer? Und was hat es mit dem Rumänen auf sich, der sich in einem Zelt am Waldrand vor den Menschen verbirgt? Bald beschleicht Paul das unheimliche Gefühl, dass jeder seiner Schritte beobachtet wird, und schließlich entgeht er nur knapp einem Anschlag auf sein Leben. Unerwartete Unterstützung findet Paul allerdings bei der wortkargen Rangerin Tessa, die mit einem halbzahmen Adler auf einer abgelegenen Alm lebt.
Frauke Schuster, Jahrgang 1958, verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Ägypten, wo sie eine deutsch-arabische Begegnungsschule besuchte. Zurück in Deutschland studierte sie Chemie an der Universität Regensburg und arbeitete anschließend mehrere Jahre für eine Chemie-Fachzeitschrift. Neben der Liebe zum Orient und den Naturwissenschaften spielt die Schriftstellerei eine Hauptrolle in ihrem Leben. Frauke Schuster schreibt Kriminalromane sowie Kurzgeschichten auf Deutsch und Englisch. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und einer Unzahl Bücherregale in einem kleinen Ort in Südbayern. In ihrer Freizeit liebt sie es zu reisen und wandert u.a. gern im Berchtesgadener Land.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Watzmanns Erben (2017)
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Kanusommer/Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5768-5
Widmung
Für meine Familie, insbesondere für meinen Mann, der bei Recherchetouren selbst die verborgensten Pfade für mich aufspürt.
Prolog
Er kauerte hinter den Büschen und ließ das Haus nicht aus den Augen. Heute war er ein Detektiv. Oder doch vielleicht ein Spion? Als ein Mann mit einem Abfallkübel aus dem Haus trat und zum Komposthaufen ging, wagte sich der Junge nicht zu rühren. Sollte der Mann ihn entdecken, wäre das Spiel ruiniert. So aber konnte er sich ausmalen, der andere sei ein Verbrecher, den er stellen wollte.
Doch nachdem der Mann wieder im Haus verschwunden war, wurde dem Jungen in seinem Versteck ein bisschen langweilig. Ob der Mann allein wohnte? Oder gab es Kinder, mit denen man spielen könnte? Neugierig spähte der Junge zu den Fenstern hinüber. Ein anderer Junge, etwa in seinem Alter, wäre ihm am liebsten. Aber vielleicht hatte der Mann nur Töchter? Solche, die ihre Puppen in rosa Glitzerkleider stopften? Oder dauernd über Ponys und Pferde reden wollten? Allerdings hatte er auch schon Mädchen getroffen, die begeistert auf Bäume kletterten oder Fußball spielten.
Als sich weiterhin nichts rührte und er keine Kinder hören konnte, stand der Junge auf. Wenn der Mann allein lebte, lag hier bestimmt nirgendwo Spielzeug herum, mit dem man sich beschäftigen könnte. Oder das sich einstecken ließ. Als der Junge fast schon am Gehen war, fiel ihm auf, dass das Garagentor einen Spalt breit offen stand. Vorsichtig drückte er es weiter auf, und es knarrte kaum.
Besaß der Hausbesitzer ein Motorrad, auf das man sich mal setzen könnte? Der Junge schob sich in den halbdunklen Raum. Kein Motorrad, kein schnittiger Porsche oder so. Wie langweilig. Doch als er auf dem Fensterbrett ein Smartphone sah, das der Eigentümer wohl dort vergessen hatte, leuchteten seine Augen auf.
»Was machst denn da, Saufratz?«
Man durfte ihm nichts tun, wusste der Junge. Weil er zu klein war. Kinder durfte man nicht einsperren. Nicht mal die Polizei durfte das. Wenn er überhaupt jemals bei seinen Diebereien erwischt wurde, war der Junge höchstens angeschrien und weggejagt worden. Ab und an drohte mal jemand mit dem Jugendamt, aber mehr geschah selten.
»Stehlen hast wollen, stimmt’s?«
Der Junge zuckte die Schultern.
»Und deine Eltern? Wo sind die?« Der Mann trat einen Schritt näher. »Wo wohnst du?«
Das Kind schwieg. Stumm starrten sie einander an. Wahrscheinlich überlegt er, ob er die Polizei rufen soll, dachte der Junge. Er beschloss, zerknirscht zu tun, und senkte den Blick.
»Dass Stehlen unrecht ist, weißt schon?«, fragte der Mann nach einer Weile streng. In gespielter Reue nickte der Junge. Er merkte, dass der Mann sich noch nicht entscheiden konnte, wie er weiter reagieren sollte.
Doch plötzlich veränderte sich etwas im Gesicht des Mannes; er lächelte beinahe. Dann packte er den Jungen am Handgelenk, zog ihn zum Garagentor. Dort sah er sich nach allen Seiten um, obwohl sich niemand draußen befand.
»Jetzt kommst erst mal mit ins Haus. Und kein Theater, verstanden?«
Verblüfft zögerte der Junge. Er hatte mit Wut gerechnet, schlimmstenfalls mit einer Ohrfeige, aber nicht damit. Es wäre ihm lieber, der Mann würde ihn loslassen. Aber der behielt sein Handgelenk in festem Griff, während er den Jungen zur Haustür zerrte und sie mit der freien Hand öffnete.
»Und jetzt«, sagte der Mann, als sie im Flur standen, »zeig ich dir den Musikraum.« Sein Atem ging schwer, fast keuchend.
»Musikraum?«, fragte der Junge verwirrt. Das veränderte Wesen des Mannes beunruhigte ihn.
»Früher hat hier mal jemand Schlagzeug gespielt«, erklärte der Mann.
Befand sich das Instrument noch im Haus? Wollte der Mann es ihn ausprobieren lassen? Der Junge schwankte zwischen Hoffnung und Furcht.
»Weißt du, was das bedeutet, dass hier mal jemand ein Schlagzeug besessen hat?« Der Griff des Mannes wurde fester, sodass der Arm des Jungen schmerzte. Stumm schüttelte das Kind den Kopf.
»Es bedeutet«, sagte der Mann, »dass der Musikraum schallisoliert ist.« Er sah auf den kleinen Jungen hinab, und seine Augen glänzten, als habe ihm jemand mitten im Frühjahr ein Weihnachtsgeschenk gemacht. »Und das heißt im Klartext, dass dich dort niemand hört, wennst schreist.«
Kapitel 1
Als sich sein Handy meldete, stand Paul Leonberger auf dem riesigen Parkplatz beim Königssee und hatte gerade die hintere Tür seines Wagens geöffnet, um nach dem dort liegenden Rucksack zu greifen. Er zog das Telefon heraus, starrte auf das Display, den angezeigten Namen. Die Gewohnheit des Journalisten, einen Anruf stets anzunehmen, und sein Wunsch nach einem Tag ohne Komplikationen stritten für den Bruchteil einer Sekunde miteinander. Dann schob er das Handy in die Tasche zurück.
Ohne es komplett auszuschalten. Wer allein in die Berge ging, sollte sein Handy anlassen. Um in einem Notfall mittels des Signals geortet werden zu können. Was die Bergwacht bei ihrem gut gemeinten Ratschlag nicht erwähnte, war, dass man so auch für andere erreichbar blieb. Leider.
Ein Touristenpaar, das sich zwei Meter weiter ebenfalls für eine Wandertour rüstete, blickte zu ihm herüber. Paul zuckte die Achseln. Der Mann, der seine Bergstiefel schnürte, grinste. »Not important?«
»Don’t know«, sagte Paul. Die Frau starrte ihn an, und er vermutete, dass sie ihn zurechtweisen wollte. Rasch drehte er ihr den Rücken zu, lud sich den Rucksack auf und schloss den Wagen ab, um loszumarschieren.
Der zweite Anruf, drei Minuten später, kam von seinem Vater. Wieder weigerte sich Paul ihn anzunehmen. Er schaltete das Handy auf stumm und erwog, es nun doch ganz auszumachen. Die Tour über die Archenkanzel nach St. Bartholomä war im ersten Teil, bis zum hoch über dem See gelegenen Aussichtspunkt, nicht schwierig. Und somit die Gefahr, dass die Bergwacht nach ihm suchen müsste, gering. Doch die Routine des Journalisten blieb, wie meist, Sieger über die Emotionen. Und das Handy auf Vibrationsalarm.
Kurz darauf, als Paul umkehrte, weil er seinen geliebten Fotoapparat im Wagen vergessen hatte, lief eine Textnachricht ein. Von Kira, natürlich. ›Es geht um Jannis. Melde dich, du Arsch!!!‹ In Pauls Magen breitete sich ein unangenehmes Kribbeln aus. Er konnte den Namen ›Jannis‹ nicht mehr hören. Wollte ihn nicht auf dem Display sehen. Am liebsten hätte er einen Schluck aus der Miniweinflasche genommen, die normalerweise nicht zu seiner Standardausrüstung gehörte. Die er an diesem Tag jedoch eingepackt hatte, um sich zu belohnen, sobald er St. Bartholomä erreichte. Dort, bei der berühmten Kirche, würde er auf das Boot warten müssen, das ihn zur Anlegestelle Königssee und damit in die Nähe des Parkplatzes zurückbringen sollte.
Als er den Evoque aufschloss, dachte er an den Streit vom Vorabend. Seit drei Monaten lebten Kira und er eine lose und dennoch intensive Beziehung. Zu der auch die eine oder andere Auseinandersetzung gehörte. Wenngleich die vom Vortag schon unüblich heftig gewesen war. Paul biss sich auf die Lippen. Nachtragend zu sein galt nicht als positiver Charakterzug. War es Zeit, das Kriegsbeil zu begraben? Er dachte an einen wunderbaren Versöhnungsabend, mit Wein und Candle-Light-Dinner. Und heißem Sex zum Dessert. Falls … ja, falls Kiras Mutter noch einmal den Jungen nehmen konnte.
Aber zuerst wollte er sich einen entspannten Tag in seinen geliebten Bergen gönnen. Mit einem gemütlichen Zwischenstopp auf der Kührointalm, wo er sich für den späteren Steilabstieg zum See über den Rinnkendl-Steig wappnen konnte. Paul war schon lange nicht mehr zur Archenkanzel aufgestiegen und freute sich auf die herrliche Aussicht über den fjordartigen Königssee mit seinem je nach Lichteinfall tiefblauen und smaragdgrünen Wasser.
Paul kannte, von gutem Sex abgesehen, keine bessere Möglichkeit zum Stressabbau als eine lange Wanderung oder Radtour. Und abgesehen davon, dass er hoffte, die Reste seines Ärgers durch einen flotten Aufstieg zu besiegen, würde es Kira nicht schaden, ein bisschen schmoren zu müssen. Schließlich hatte sie den Streit angefangen, nicht er. Glaubte er zumindest.
Falls er erwartet hatte, Kira durch sein Schweigen eine Lektion in Geduld zu erteilen, verfehlte sie ihre Wirkung.
›Melde dich jetzt oder nie wieder!‹, lief als nächste Nachricht ein. Paul hasste es, wenn Leute alltägliche Dinge dramatisierten. Allmählich fragte er sich, ob er nicht ohne feste Beziehung besser dran wäre. Er war immer ein Einzelgänger gewesen, jemand, der viel Wert auf seine Freiheit legte.
Dennoch. Das Bauchgefühl des erfahrenen Journalisten erkannte die Verzweiflung hinter dem kurzen Text. Vielleicht steckte mehr dahinter als ein Machtkampf?
Eine Krähe flog hinter Paul auf und erschreckte ihn mit ihrem misstönenden Krächzen. Paul atmete tief durch und drückte Kiras Nummer.
Mailbox. Warum das so plötzlich? Hatte sie Paul bereits abgeschrieben? Oder behinderten die Berge den Handyempfang? Aber Paul hatte gerade erst die Königsseer Ache überquert, befand sich auf einem ruhigen Wiesenweg mit Blick zum Grünstein. Er sandte eine Nachricht: ›Hab versucht, dich anzurufen. Bis bald.‹
Was nun? Sollte er die Tour durchziehen, auf die Gefahr hin, gleich wieder umkehren zu müssen?
»Ich hasse Beziehungskisten«, sagte Paul laut. Und marschierte schneller als vorhin weiter bergauf. Was immer Kiras Problem sein mochte, es ließ sich vermutlich telefonisch erledigen. Oder die Lösung per Handy zumindest einleiten oder aufschieben.
Er konnte höchstens eine Viertelstunde lang gegangen sein, als sein Handy vibrierte. Paul fühlte sich mittlerweile entspannter und nahm den Anruf an, ohne auf den angezeigten Namen zu sehen.
»Solltest du als Schreiberling nicht ständig erreichbar sein? Ich hab mindestens dreimal angerufen!«, schimpfte die Stimme seines Vaters.
»Hast du nicht«, korrigierte Paul.
»Egal.« Der Vater war geschickt darin, sich aus seinen Lügennetzen herauszuwinden. Schnelle Richtungswechsel, wenn er bei einem Thema ins Schlittern kam, waren seine Spezialität. »Dein Mädel versucht seit Stunden, dich zu erreichen.«
»Du hast mit Kira gesprochen?« Pauls Magen krampfte sich zusammen. Seit Jahrzehnten achtete er sorgfältig darauf, sein Privatleben vor dem Vater abzuschotten. Kira wusste das. Wenn sie trotzdem mit Pauls Vater Kontakt aufgenommen hatte, musste tatsächlich etwas Außergewöhnliches passiert sein. Hatte Jannis einen Unfall gehabt? In Sekundenschnelle schossen Szenarien durch Pauls Kopf: Ein Auto hatte das Rad des Jungen gerammt, Jannis lag mit Schädelbruch im Krankenhaus, und zwischen den piepsenden Geräten der Intensivstation versuchte Kira ihren in den Bergen herumstreunenden Freund zu erreichen … Oder: Jannis hatte sich ein Brot abschneiden wollen, sich dabei das Messer versehentlich in den Bauch gerammt, und zwischen den piepsenden Geräten …
»Was treibst denn, dass d’ nicht ans Telefon gehen kannst?« Kilian Leonbergers Neugier brachte das Kopfkino seines Sohnes zum Stoppen.
»Ich bin auf einer Wanderung. In den Bergen gibt’s nicht überall Handyempfang.« Paul hatte wenig Skrupel, dem Vater gegenüber die Wahrheit kreativ zu verschleiern. Zwar stimmte es, dass in den Bergen Funklöcher existierten, aber immerhin hatte er vorhin Kiras Nachrichten bekommen.
»Immer die Berge. Immer abhauen. Warum kannst net mal deinen alten Vater besuchen anstatt durch langweilige Wälder zu latschen? Bei meinen Herzproblemen. Wer weiß, wie langst noch einen Vater hast?«
»Du wirst hundert«, sagte Paul ohne Mitgefühl. »Schon, um mir kontinuierlich auf den Nerven herumzutrampeln, wirst du mindestens hundert.« Er atmete tief durch. »Hat Kira erwähnt, worum’s geht?« Er ärgerte sich nun, ihren Anruf ignoriert zu haben. Dann wäre sein Vater jetzt nicht in der Position mehr zu wissen als Paul.
»Nix hat’s gesagt. Alle sind s’ gleich, die Weiber. Dauernd reden, aber nichts sagen.«
»Irgendetwas muss sie gesagt haben«, beharrte Paul.
»Geheult hat sie«, antwortete der Vater.
Dass er zu schnell dran war, merkte Paul erst, als ihn am Ortsausgang von Bischofswiesen ein Lichtblitz traf. »Scheiße, verdammte Scheiße!«, schrie er gegen Milows ›Against the Tide‹ im Radio an, während er automatisch abbremste. Und kurz darauf auf einen Parkplatz gewunken wurde.
»Ihre Papiere?« Der junge Polizist verhielt sich professionell höflich, was Paul erst recht aufbrachte. Statt seinen Ausweis zu zeigen, griff er zum Handy und probierte Kiras Nummer. Mailbox.
»Wen rufen S’ denn an? Ihren Anwalt?«, fragte der zweite Polizist, ein älterer Mann mit rundem, gutmütig wirkenden Gesicht. »So weit ist’s noch net. Außer Sie haben Drogen im Wagen? Oder Waffen?«
Paul gab keine Antwort, streckte stattdessen endlich Ausweis und Führerschein durchs Fenster.
»Würden S’ bitte aussteigen?«
»Ich hab’s eilig«, knurrte Paul. »Meiner Freundin … geht’s nicht gut.«
»Kriegt s’ ein Kind?«, fragte der ältere Polizist.
Paul schüttelte den Kopf, und der jüngere Mann sagte streng: »Dann werden Sie sich Zeit für uns nehmen müssen. Sind Sie mit einem Alkotest einverstanden?«
»Ich fühl mich wie im falschen Film. Um die Uhrzeit hab ich doch nichts getrunken. Wissen Sie, wie spät es ist? Beziehungsweise wie früh?«
»Ja oder nein?« Die Stimme des Beamten klang gelangweilt, und Paul pustete widerwillig in den kleinen Apparat. Jetzt war er froh, die Weinflasche im Rucksack nicht angebrochen zu haben.
»Sagen Sie mir, was ich zahlen muss, und lassen Sie mich weiterfahren!«
»Zeigen S’ uns bittschön Warndreieck und Verbandskasten!«, mischte sich nun der ältere Mann wieder ein. Paul war mit drei langen Schritten beim Kofferraum, riss ihn auf und holte die verlangten Gegenstände heraus. ›Falls Sie auch meine Socken sehen wollen, sagen Sie’s gleich! Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren‹, wäre ihm beinahe herausgerutscht, doch er hielt die Worte in letzter Sekunde zurück. Die beiden Beamten konnten nichts dafür, dass er Stress mit Kira hatte.
Er kam mit ein paar Euro, ohne Punkte, davon. Und musste sich zusammennehmen, um nicht mit aufheulendem Motor zu starten und sofort die nächste Strafe zu kassieren.
In Anbetracht des eben Erlebten achtete Paul darauf, den Wagen nicht im Halteverbot abzustellen, und stürmte wenig später die Treppe zu Kiras Wohnung hinauf. Die Tür war angelehnt; er stieß sie weit auf und prallte fast gegen Kiras Mutter Helga. Paul machte sich nicht die Mühe zu grüßen.
»Kira?«, schrie er in die Wohnung hinein. »Kira, was ist los? Warum hast du meinen Vater angerufen?«
Nun tauchte Kira hinter ihrer Mutter auf. Eine verheulte Kira mit verquollenem Gesicht und einem zu großen Sweatshirt in Nebelgrau, dessen überlange Ärmel ihre Hände verdeckten. Pauls Sweatshirt, das er mal bei ihr vergessen hatte. Doch sie fiel Paul nicht in den Arm, wie sie es noch vor zwei Tagen getan hätte.
»Jannis.« Ihrer Stimme war anzuhören, wie viel sie geweint hatte. »Jannis ist …« Und Tränen strömten über ihre Wangen, ehe sie den Satz vollenden konnte.
»Warum hast du dein Handy ausgeschaltet?« Eigentlich hatte Paul etwas anderes sagen wollen, doch die Frage hatte sich selbstständig gemacht. In Kiras Augen trat neues Entsetzen.
»Das Handy? Mein Gott!« Sie rannte ins Wohnzimmer, gefolgt von Paul, wo sie hektisch zu suchen begann, ehe sie das Telefon auf einem Regalbrett fand.
»Ich … Der Akku ist leer, und ich hab’s nicht gemerkt!« Ohne von Paul Notiz zu nehmen, steckte sie das Handy am Ladegerät an und checkte ihre Nachrichten. Um das Telefon schließlich enttäuscht wegzulegen.
»Kira, bitte! Sag endlich, was geschehen ist!« Paul konnte hören, wie Helga in der Küche einen Kaffee bereitete; das laute Mahlwerk des Automaten zerschnitt die zwischen Kira und ihm eingetretene Stille.
»Er ist … weg.« Kira sank auf das Sofa und schlug die Hände vors Gesicht. Ihre Mutter trug ein Haferl Kaffee herein, drückte es Paul in die Hand. Er dankte mit einem Nicken und setzte sich neben Kira.
»Weg? Was meinst du damit?« Paul nahm Kiras Hand in seine. Was eine neue Tränenflut auslöste. Doch nun lehnte sich Kira an ihn.
»Weggelaufen«, sagte sie mit dieser zerbrechlichen Stimme, die so gar nicht zu ihr passen wollte.
Eine Viertelstunde und viele Tränen später hatte Paul ein klareres Bild von den Ereignissen. Kira zeigte ihm den Zettel, den Jannis mit einem Magnetsaurier an den Kühlschrank gepinnt hatte. Dahin, wo der Junge und seine Mutter immer dringende Nachrichten füreinander hängten. ›Du wilst mich nicht mer, du hast disen Mann lieber als mich.‹ Der Satz musste Kira ins Herz getroffen haben. Und Paul überkam ein Anflug von schlechtem Gewissen, weil mit dem ›Mann‹er gemeint war.
»Wo hat er den Quatsch her? So was fällt einem Kind nicht von alleine ein«, sagte er barsch, um seine Emotionen zu überspielen. Kira wischte sich mit einem Papiertaschentuch über die Augen. Ihr Blick wanderte wie von ungefähr zur Küche, und Paul verstand. Offenbar war Kiras Mutter, die er bisher nur selten getroffen hatte, ähnlich intrigant wie sein eigener Vater. Und fand nichts dabei, einen Sechsjährigen gegen den Freund seiner Mutter, wenn nicht sogar gegen die Mutter selbst, aufzuhetzen. Doch es brachte nichts, jetzt darüber nachzugrübeln, wie sich dies abstellen ließe. Im Moment galt es, sich auf Dringenderes zu konzentrieren.
Paul holte tief Luft. »Okay. Und du hast diesen Zettel wann entdeckt?«
»Als ich aufgestanden bin, so gegen acht.« Kira hatte sich einen Kaffee bereiten wollen, die Nachricht gesehen und war sofort in Jannis’ Zimmer gelaufen. Wo sie nur das ungemachte Bett ihres Sohnes vorfand.
»Und was habt ihr bisher versucht?«
»Die nähere Umgebung abgesucht … Seine Freunde angerufen, beziehungsweise deren Eltern.«
»Niemand hat ihn gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Mit Erleichterung stellte Paul fest, dass sie zu weinen aufhörte. »Niemand. Aber seit Kurzem ist er dicke mit einem Karel. Und von dem hab ich keine Kontaktdaten.«
»Ruf Jannis’ Lehrerin an. Die kann dir zumindest den Nachnamen sagen. Auch wenn sie die Telefonnummer vielleicht nicht rausrücken wird.« Aber entweder die oder die Adresse des Jungen würde sich dann über das Internet finden lassen, hoffte Paul. Doch Kira sah ihn entsetzt an.
»Das kann ich nicht.«
»Dann sag mir, wie die Lehrerin heißt, und ich mache den Anruf.«
»Nein!« Kira schrie es fast, und Paul starrte sie an.
»Was hast du? Warum nicht?«
»Die hetzt mir das Jugendamt auf den Hals.« Kira sah auf das zerknüllte Tuch in ihrer Hand. »Jannis ist schon mal weggelaufen. Vor einem Jahr. Damals hab ich sofort die Polizei verständigt und …«
»Und die haben das Jugendamt eingeschaltet?« Kiras Schweigen war Antwort genug.
»Dann googeln wir eben den Jungen«, sagte Paul. »Oder vielleicht wüsste einer von Jannis’ anderen Kumpeln, wie Karel vollständig heißt?« Er merkte an Kiras Reaktion, dass sie wenig Lust hatte, einen neuen Rundruf zu starten, und setzte sich an ihr Notebook.
»Wie willst du im Netz einen Sechsjährigen finden?«, fragte Kira. »Für Facebook, Instagram und Co. ist der zu jung.«
Doch Paul entdeckte den Jungen tatsächlich: Karel hatte bei einer Kindergartenaufführung von ›Hänsel und Gretel‹ eine der Hauptrollen gespielt, und unter dem Bühnenfoto stand sein voller Name. Im Telefonbuch gab es zu seinem Nachnamen zwar eine Rufnummer, aber dort meldete sich niemand.
»Hier stehen auch Straße und Hausnummer. Fahr einfach hin«, schlug Paul vor. Bei dem sonnigen Wetter hockte Karels Familie vielleicht im Garten und hörte das Telefon nicht.
»Und du?«, fragte Kira. »Was tust du?«
»Gibt’s noch eine andere Möglichkeit, die du bisher nicht abgecheckt hast?«
»Barth«, sagte Kiras Mutter von der Tür her.
»Der Holzbildhauer?« Paul kannte den Namen von den Ausstellungen des Mannes, über die die Zeitung ab und an berichtete. »Was hat Jannis mit dem zu schaffen?«
»Der Mann flämmt die fertigen Figuren mit einer Lötlampe«, erklärte Kiras Mutter. »Jannis findet das faszinierend. Manchmal radelt er zu dem Anwesen, auf dem Barth hauptsächlich arbeitet, und schaut ihm heimlich zu. Zum Künstlerhof ist’s von meiner Wohnung aus nicht weit. Wir haben versucht, dort anzurufen, aber niemanden erreicht.«
»Wieso sieht Jannis dem Mann nur heimlich zu?«
»Dieser Barth ist ein Eigenbrötler. Sobald er Jannis bemerkt, jagt er ihn weg.«
Was die Wahrscheinlichkeit, den Jungen dort zu finden, nicht erhöhte. Doch Paul sprach es nicht aus, sondern fasste stattdessen die Aufgaben für alle zusammen. Kira würde zu Karels Eltern radeln; mit dem Auto wollte Paul sie nicht fahren lassen, und außerdem konnte ihr die frische Luft nur guttun. Ihre Mutter Helga würde in der Wohnung bleiben, falls Jannis zurückkommen sollte. Paul selbst wollte den Holzbildhauer aufsuchen.
»Die meisten kleinen Ausreißer kehren von allein zurück. Oder werden binnen zwei Tagen aufgegriffen«, beruhigte Paul die anderen, ehe sie sich trennten. Dass er schon über Fälle hatte berichten müssen, die wesentlich schlechter ausgegangen waren, behielt er lieber für sich.
Der Künstler, der sich selbst Barth nannte, arbeitete auf einem aufgelassenen Bauernhof in Richtung Weißbach. Schon im Vorgarten begrüßten riesige Holzskulpturen die Besucher. Paul erinnerte sich gelesen zu haben, dass es sich hauptsächlich um Neuinterpretationen mythologischer Figuren handelte. Die unteren Teile, manchmal aber auch Köpfe und Arme, waren von Flammen dunkel gefärbt, was die Skulpturen archaisch wirken ließ.
Paul blieb zunächst im Auto sitzen und sah sich um. Der Feldweg, den Jannis von Helgas Wohnung im Ortsteil Froschham entlangradeln musste, um hierher zu gelangen, schlängelte sich zwischen dem kleinen Anwesen und einem größeren Bauernhof hindurch. Paul hatte sich bei seinen Zeitungskollegen per Anruf darüber informiert, dass der Künstlerhof seit dem Tod des früheren Besitzers der Stadt gehörte, die in den Nebengebäuden Dinge lagerte, für die der Bauhof woanders keinen Platz fand. Barth durfte einen Teil des Anwesens für eine geringe Miete mitbenützen. Für die Stadt bot dies den Vorteil, dass der alte Hof einen bewohnten Eindruck erweckte, wodurch sich die Gefahr für Vandalismus verringerte. Paul fragte sich, welche der Scheunen oder Schuppen hinter dem heruntergekommenen Wohnhaus, das kaum mehr als vier Zimmer beherbergen konnte, das Atelier des Künstlers darstellen mochte.
Als Paul ausstieg, erklangen von irgendwoher Hammerschläge. Der Bildhauer arbeitete also. War er allein? Langsam ging Paul um das Haus herum. Auf dem großen Platz zwischen den diversen Nebengebäuden war der Künstler dabei, mit Hammer und Meißel einen mindestens zwei Meter hohen, aufrecht stehenden Holzquader zu bearbeiten. Der mit Splittern und Spänen übersäte Boden verriet, dass der Mann an diesem Projekt nicht erst seit Kurzem zugange war. Barth war groß, breiter als Paul und trug sein grau werdendes Haar in einem Pferdeschwanz. Ein aus einem roten Tuch improvisiertes Stirnband verhinderte, dass ihm der Schweiß in die Augen rann. Paul schätzte den Künstler auf um die 50.
»Hallo«, sagte Paul, als der Mann ihm nur einen kurzen Blick gönnte und gleich weiterarbeitete. »Mein Name ist Paul Leonberger. Ich suche einen kleinen Jungen. Er ist von zu Hause ausgerissen, und seine Großmutter sagt, er komme manchmal hierher. Er ist blond, sechs Jahre, klein für sein Alter, aber stämmig.«
Ohne seine Arbeitsgeräte fortzulegen, sah Barth zu Paul hinüber.
»Tut mir leid, Sie zu stören.« Paul hätte den Künstler gern gepackt, um eine Reaktion aus ihm herauszuschütteln. »Der vermisste Junge heißt Jannis und ist der Sohn meiner Freundin.« Er hoffte, damit seine Berechtigung für die Frage zu legitimieren.
»War heut net da. Zum Glück«, brummte Barth.
»Wieso ›zum Glück‹?«
Der Künstler wandte sich wieder seinem Holz zu, bearbeitete es mit einem scharfen Eisen und einem schweren Hammer. Im oberen Teil ließen sich bereits die Konturen eines Männerkopfes erahnen.
»Weil ich keine Schraazn hier rumlungern haben mag«, knurrte er. »Net mit all den Werkzeugen.«
Paul seufzte. Wenn er daran dachte, wie sehr ihm Kiras Sohn manchmal auf die Nerven ging, konnte er den Mann verstehen.
»Falls Jannis sich zeigen sollte: Hier meine Karte.« Er hielt sie Barth hin, der keine Anstalten machte, sie zu nehmen. Paul legte die Visitenkarte auf eine verwitterte Bank vor der großen Scheune. »Wir machen uns riesige Sorgen. Bitte geben Sie uns Bescheid, falls der Junge bei Ihnen auftaucht.«
Wieder im Auto rief er Kira an, doch auch sie hatte keinen Erfolg zu vermelden. Jannis’ Freund Karel hatte keine Ahnung, wo sein Kumpel stecken könnte. Und sie weinte wieder.
Kapitel 2
Der Mann hatte Mühe, seinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Er hatte das nicht gewollt. Seine Gefühle fuhren Achterbahn, während er den Körper in der Ecke betrachtete. Die blauen Flecken und die rötlichen Male am Hals.
»Du Depp!«, flüsterte der Mann und war nicht sicher, wen er meinte. Vielleicht sich selbst? »Du verdammter, hirnloser Depp!« Tränen traten in seine Augen, und er konnte den Anblick des reglosen Körpers nicht länger ertragen, flüchtete aus dem Raum, aus dem Gebäude, setzte sich draußen ins Gras und stützte den Kopf in die Hände.
»Was hab ich getan? Herr im Himmel, was hab ich getan?«, stöhnte der Mann. Wie hatte er derart ausrasten können? So viele Jahre lang hatte er geglaubt, seinen Jähzorn hinter sich gelassen zu haben. Hatte sich sicher gefühlt in dem Bewusstsein, seinem Geist zu Reife und Ausgeglichenheit verholfen zu haben. Und nun das.
Seine Hände zitterten, und seine Beine fühlten sich an wie Pudding. Mal schoss es ihm heiß in den Kopf, dann überrannen ihn eisige Schauer. Wie sollte, wie konnte es weitergehen?
Er brauchte sein Handy; jetzt gab es nur einen einzigen Menschen, der helfen konnte. Aber das Telefon lag im Haus, und der Mann fühlte Zweifel, ob ihn seine Beine bis dorthin tragen würden.
Später wusste er nicht mehr, wie lange er so gesessen war, unfähig, seine kräftigen Hände anzusehen. Es mochten 15 Minuten gewesen sein, oder drei volle Stunden, ehe der Schock ein wenig abklang. Mühsam schleppte sich der Mann in die Küche, wo er sich in den Mülleimer erbrach. Danach zwang er seine bebenden Hände, den Wasserkocher zu füllen und einen Kamillenteebeutel in das nächstbeste Haferl zu hängen. Während der Tee zog, stapfte der Mann schwerfällig die Treppe hoch, um sein Handy zu holen.
Zurück in der Küche trank er einen ersten Schluck Tee, um den ekligen Geschmack im Mund loszuwerden. Dann wählte er die Nummer desjenigen, der ihm hoffentlich, hoffentlich aus seinem Schlamassel helfen würde.
Der Angerufene meldete sich erst nach dem siebten Klingeln.
»Hallo?« Die Stimme klang ruhig wie immer.
»Ich habe … Also, ich meine … es ist ein verdammtes Unglück passiert«, flüsterte der Mann.
Für einen Moment herrschte Schweigen. Dann: »Und wieso?«
»Er hat net hören wollen. Ich wollt ihm bloß ein bisserl Angst einjagen.« Der Mann merkte, wie zittrig seine Stimme klang, und wünschte mehr denn je, er wäre stets so beherrscht wie sein Gesprächspartner. Er zwang sich, an sein Vorbild zu denken – der Italiener war nach menschlichen Maßstäben auch kein Heiliger gewesen –, doch nicht mal das half, und er sprudelte die Geschichte heraus, wirr durcheinander.
»Du musst ihn loswerden. So, dass niemand rausfinden kann, was geschehen ist«, sagte Kyrill nach einer Pause. Der Mann wusste, dass Kyrill nicht der echte Name des anderen war. Sie alle verwendeten Decknamen; er selbst nannte sich Oskar.
»Und … wie?«
Doch Kyrill schien ihn nicht zu hören. »Vorher solltest du das Ganze zeichnen. Oder fotografieren, falls deine Hand nicht ruhig genug ist.« Seine Stimme wurde weicher, fast verträumt. »Du kannst … Posen arrangieren. Sogar die Vergänglichkeit birgt Schönheit.«
Oskar starrte auf den Boden. Sein Herz schlug so schnell, als wolle es ihn umbringen. »Aber … ich weiß nicht … ja, vielleicht. Und hinterher?«
Der andere zögerte. »Was nicht mehr benötigt wird, sollte man dem Feuer übergeben«, sagte er nach einer Weile.
»Feuer?« Oskar schluckte, sein Mund wurde trocken.
»Es ist unverdächtig«, erklärte Kyrill. »Such dir einen geeigneten Ort, wo du alles in Ruhe herrichten kannst.«
Als der andere das Gespräch beendete, fühlte sich Oskar besser. Kyrill hatte ihm einen Weg aufgezeigt, um das Problem zu lösen. Aber natürlich erwartete er im Gegenzug, dass Oskar die Anregung bezüglich der Bilder aufgriff. Schönheit in der Vergänglichkeit. Wie ließ sich das Thema umsetzen? Mit einer welkenden Lilie als Accessoire? Einem toten Schmetterling, dessen Farben bunt schillerten? In einem Spinnennetz? Oskar holte seinen Skizzenblock und einen Stift an den Küchentisch. Mechanisch trank er den seinen Magen beruhigenden Tee, während er mit der freien Rechten erste, kühne Striche auf das Papier warf.
Eine Stunde später erklärte Paul, dass sie den Gang zur Polizei nicht länger aufschieben durften. Jannis war zu jung, zu verletzlich. Zwar war das Frühjahr warm, der Junge würde selbst nachts nicht erfrieren, aber weder Kira noch Paul hätten gewusst, wo sie weiter suchen könnten.
In einem Akt der Verzweiflung rief Paul auf dem Künstlerhof an, doch niemand nahm ab. Immerhin klickte sich ein Anrufbeantworter ein, der allerdings keine Ansage von sich gab, sondern nur den Piepston. »Wenn ich schon mit einer Maschine reden muss, sollte sie wenigstens ›Hallo‹ sagen«, fauchte Paul das unschuldige Aufnahmegerät an. »Wenn Sie oder wer immer das abhört, den kleinen Jannis Freesen gesehen haben, melden Sie sich bei der Polizei oder der folgenden Nummer …«
»Melden Sie sich bitte bei Punkt, Punkt, Punkt«, unterbrach ihn Kira, die neben ihm wartete, schniefend. »Paul, wenn du die Leute anblaffst, ruft garantiert niemand zurück.«
»Tausend Dank für den freundlichen Ratschlag.« Doch dann nahm Paul seine Freundin tröstend in den Arm. Er fühlte sich schuldig, weil sie mit ihrem tränenverschmierten Gesicht und ihrer Anlehnungsbedürftigkeit in ihm den Wunsch weckte, sie ins Schlafzimmer zu tragen. Und zugleich wusste er, dass sie ihm das Gesicht zerkratzen würde, sollte er dergleichen vorschlagen. Im Moment war sie ausschließlich auf Jannis fixiert, und der Vorwurf des Jungen, sie habe Paul lieber als ihr eigenes Kind, saß wie ein giftiger Stachel in ihrem Herzen.
»Kommst du mit aufs Präsidium?«, fragte sie.
Intuitiv zögerte Paul. Vor vielen Jahren, in seiner Jugend, hatte man ihn fälschlicherweise beschuldigt, seine Schwester ermordet zu haben. Das Trauma saß tief, sodass er aus Reichenhall geflüchtet und erst als selbstbewusster Erwachsener zurückgekehrt war. Noch immer hegte er Misstrauen gegenüber jeglicher Polizei. Doch er durfte Kira nicht im Stich lassen.
Xaver Porant saß mit einem halbvollen Pilsglas im Präsidium und zeigte zwei Kollegen Fotos von einem Wochenende am Staffelsee.
»Seit wann darf man hier trinken?«, fragte Paul. Ihn und den dicken Kommissar verband eine tiefe gegenseitige Abneigung, obwohl oder gerade weil sie von Berufs wegen immer wieder miteinander zu tun bekamen.
»Der Leonberger mit dem großen Maul.« Porants Blick wanderte von dem Polizisten zu Kira. »Wen bringen S’ uns denn da Hübsches?«
»Vielleicht sollten Sie vorsichtig sein. Eh in der Zeitung steht, dass in Ihrem Präsidium sexistische Äußerungen gemacht werden?«
Porant verdrehte die Augen. »Was haben S’ denn gegessen, dass S’ gar so garstig drauf sind?«
»Paul …« Kira war nahe daran, wieder in Tränen auszubrechen, und der Journalist begriff, dass er sich zusammenreißen musste.
Ohne eine Aufforderung abzuwarten, zog er Kira einen Stuhl heran und drückte sie darauf. »Es geht um eine vermisste Person«, sagte er dabei.
Die beiden uniformierten Polizisten und der Kommissar sahen gleichermaßen zu Kira.
»Wer geht euch denn ab?«, fragte Porant, nun in viel freundlicherem Ton.
»Ein Kind.« Paul legte das mitgebrachte Foto auf den Tisch. »Dieser Junge.«
Porant schob sein Bier beiseite. Paul sah an der daneben stehenden Flasche, dass es sich um die alkoholfreie Version handelte. Der ältere Polizist drehte sich zu seinem Computer, um eine Datei zu öffnen. Paul legte Kira die Hand auf die Schulter. Und, den Blick auf ihre im Schoß verschränkten Hände gerichtet, begann Kira zu erzählen.
»Er ist also seit dem frühen Morgen abgängig«, fasste Porant zusammen, als Kira geendet hatte. »Und hat sich bei keinem Freund oder Verwandten gemeldet.«
Kira schaffte es nicht einmal mehr zu nicken.
»Was für eine Art Bub ist er?«, fragte Porant, und Paul musste widerwillig anerkennen, dass es eine gute Frage war.
»Wie meinen Sie das?« Kira sah auf.
»Ist er gern allein, zum Beispiel? Oder eher anhänglich? Hat er einen speziellen Platz, an dem er sich mit Freunden trifft?«
»Allein? Nun ja … Als Einzelkind ist er gewöhnt, sich selbst zu beschäftigen. Und vor allem im Sommer ist er oft draußen, radelt viel herum.« Kira zögerte. »Außerdem versteckt er sich gern. Vor allem, wenn ich mal wütend auf ihn bin.«
»Hatten Sie am Vortag Streit mit ihm?«, hakte Porant sofort ein.
»Meine Mutter hat vor zwei Tagen sein Smartphone konfisziert. Jannis hatte bei ihr zu Mittag gegessen und sollte hinterher das Geschirr in die Küche tragen«, erzählte Kira mit gesenktem Blick. Aber Jannis hatte die Oma ignoriert und mit dem Handy gespielt, bis Helga es ihm wegnahm. Als Jannis nach Hause kam, hatte er sich bei seiner Mutter beschwert, doch Kira meinte, er müsse sich bei der Oma entschuldigen, wenn er das Handy zurückbekommen wolle.
»Einen speziellen Lieblingsplatz außerhalb des Hauses hat er unseres Wissens nicht«, fügte Paul hinzu. Dann erzählte er noch von dem Künstler, den Jannis gelegentlich beobachtete. Er hoffte, den Kommissar damit von einer anderen Frage abzuhalten, der, vor der Kira graute.
Doch er hatte Pech, denn der jüngere der beiden Polizisten war mehr auf Zack, als Paul seiner zurückhaltenden Art anfangs zugetraut hatte. »Ist Ihr Bub schon öfter fortgelaufen?«, wollte er wissen.
Paul merkte, wie sich Kiras Schultern verspannten. Sie sagte nichts.
»Ja, einmal«, sagte Paul. »Und vermutlich hat er sich daran erinnert, dass das damals ein wirksames Mittel war, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.«
»Hör auf!« Kira schrie es fast. »Du tust, als würde er das … zum Spaß machen.«
»Nicht zum Spaß«, begütigte der ältere Polizist. »Aber, der Botschaft auf seinem Zettel nach zu schließen, vielleicht mit dem Hintergedanken einer kleinen Erpressung?« Kira begann zu weinen.
»Wo ist er denn das letzte Mal hingelaufen?«, erkundigte sich Porant.
»Ich weiß es nicht«, sagte Kira. »Er war damals erst fünf. Unser Nachbar hat ihn schließlich auf einem Spielplatz gefunden. Aber wir wohnten zu der Zeit noch nicht in Reichenhall.«
»Sie sagten vorhin, Sie seien alleinerziehend. Könnte er auf die Idee gekommen sein, zu seinem Vater zu fahren?«, fragte der junge Polizist.
Leise erklärte Kira, dass Jannis seinen Vater nicht kannte. Und nie nach ihm fragte.
Porant sah zu Paul; vermutlich fürchtete er sich vor weiteren Tränen. »Wenn ein Kind verschwindet, kann man ein Verbrechen nie ausschließen«, sagte er. »Aber hier scheint’s sich eher um einen Lausbuben zu handeln, der sich aus Trotz ein bisserl versteckt. Was in Anbetracht seines Alters allerdings nicht ungefährlich ist. Vor allem, wenn man an die Saalach denkt und an die Bundesstraßen. Bei einer so jungen vermissten Person gehen wir jedenfalls immer von einer bestehenden Gefahr für den Betroffenen aus. Wir werden also sofort eine Suche einleiten.«
»Vielen Dank«, murmelte Kira. In der nächsten halben Stunde wurde ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Natürlich hatte sie ein Foto ihres Sohnes mitgebracht, aber Porant verlangte jede Menge zusätzlicher Details: Die Namen und Anschriften von Jannis’ Freunden sowie von Kiras und Helgas Nachbarn. Eine Liste der Spielplätze, Eisdielen, Radwege etc., die Mutter und Sohn bevorzugt aufsuchten. Ebenso eine Auflistung der Dinge, die Jannis bei sich trug.
»Das Rad. Seinen grün-blauen Rucksack. Und das Geld aus seinem Sparschwein, etwa 30 Euro. Vielleicht zwei oder drei seiner Comics.«
»Ich kann zusätzlich sein Bild auf der Zeitungsseite online stellen«, schlug Paul vor, als Kira nichts weiter einfiel.
»Tun S’ das ruhig.« Porant blickte kurz zu Kira. »Meinem Gefühl nach taucht der Bub jedoch bald wieder auf.« Und Kira zuliebe hoffte Paul ausnahmsweise, dass der Kommissar recht behalten würde.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, setzte Paul Kira in der Salzburger Straße ab und versicherte ihr, dass er selbst, unabhängig von Porants Aktivitäten, mindestens bis zum Einbruch der Nacht weitersuchen werde. Sie und ihre Mutter hingegen sollten für den Fall, dass Jannis zurückkam oder bei seiner Oma Zuflucht suchte, gemäß den Anweisungen der Polizei in ihren jeweiligen Wohnungen bleiben.
Er überlegte, wo er selbst als Sechsjähriger an Jannis’ statt hingelaufen wäre, und die Antwort war eindeutig: zur Saalach. Die meisten Kinder wurden von Wasser magisch angezogen; Paul hatte keine Ausnahme gebildet.
Konnte Jannis schwimmen? Paul hatte Kira nie danach gefragt; sie waren meist ohne den Jungen unterwegs gewesen. Vermutlich, weil Kira aus Erfahrung wusste, dass viele Männer durch ein eifersüchtiges, nervtötendes Kind abgeschreckt wurden. Und Jannis war nervig. Ließ die Erwachsenen nicht ausreden, musste alles anfassen, egal, wie schmutzig seine Finger waren, und inszenierte Wutanfälle, wann immer er nicht seinen Willen bekam. Paul hätte Kira schon vor Wochen gern geraten, strengere Saiten aufzuziehen, denn wie wollte sie Jannis’ Pubertät überleben, wenn sie keine Grenzen setzte? Aber er durfte sich nicht in ihre Erziehung einmischen, und zudem verstand er irgendwo im Hinterkopf, dass der Junge die einzig konstante männliche Präsenz in ihrem Leben darstellte. Eine Rolle, die das Kind überforderte.
Paul ließ seinen Wagen beim Wehr stehen und suchte die Stadtseite der Saalach ab. Er wanderte über den groben Kies, zunächst flussabwärts, und war sich bewusst, was für eine Mammutaufgabe er sich vorgenommen hatte. Auf beiden Seiten des Flusses gab es immer wieder Baum- und buschbestandene Flächen, in denen sich ein kleiner Junge leicht vor der Welt verborgen halten konnte.
Dennoch gab er erst bei Sonnenuntergang frustriert auf. Mittlerweile hatte er nicht nur die Saalachufer, sondern auch den Kurpark und andere Orte, die ihm als Versteck geeignet schienen, abgesucht. Da er per Handy mit Kira Kontakt hielt, wusste er, dass der großanlegte Polizeieinsatz, dessen Hubschrauber des Öfteren über ihn hinweg geflogen war, bisher ebenfalls keinen Erfolg gezeigt hatte.
»Ich fahr nach Hause, um den Hund zu versorgen, dann komm ich zu dir. Du solltest diese Nacht nicht allein bleiben«, sagte Paul ins Telefon.
Zu seiner Überraschung zögerte Kira. »Nimm’s nicht persönlich, aber … Ich denke, ich will lieber allein sein.«
Frauen. Wer sollte sich da auskennen? Paul fühlte sich gekränkt, sein Angebot ausgeschlagen zu hören. Nach dem nervenaufreibenden Tag war ihm absolut nicht danach, die halbe Nacht eine weinende Frau zu trösten, aber er hätte es getan. Weil er verstand, wie wichtig Jannis für sie war. »Wie du willst.«
»Ich fühle mich ihm näher, wenn ich allein bin.« Kiras Stimme klang so traurig, dass sich Pauls Ärger in Mitleid verwandelte. »So wie damals, als er noch ein Baby war.« Sie schluchzte auf.
»Alles wird gut, Kira. Du kennst seine Launen. Und es ist nicht kalt, eine Nacht im Freien bringt ihn nicht um.«
»Er wird solche Angst haben, wenn’s finster ist.«
»Sieh’s positiv. Je mehr er sich fürchtet, umso weniger Lust wird er morgen verspüren, eine weitere Nacht fern von daheim zu verbringen.« Als Kira heulend auflegte, wurde Paul klar, dass er mal wieder das Falsche gesagt hatte.
Als Paul anschließend zu dem Haus am Ortsrand fuhr, in dem er seit seiner Rückkehr nach Reichenhall lebte und das früher seinen Eltern gehört hatte, hoffte er dennoch in unchristlicher Weise, dass Jannis sich wirklich halb zu Tode fürchten möge. Um sein Zuhause danach besser schätzen zu wissen. Im nächsten Moment sagte er sich, dass nur ein abgrundtief schlechter Mensch sich so etwas wünschen würde. War er also schlecht? Möglicherweise. Seit dem Tod seiner Schwester Sonja hatte Paul selten jemanden so nah an sich herangelassen wie Kira. Weil er den Menschen misstraute. Seiner Erfahrung nach waren allzu viele ausgesprochene Egozentriker. Und erzogen ihre Kinder in die gleiche Richtung.
»Monsieur?« Als er die Zauntür öffnete, rief Paul nach dem alten Kampfhund, den er vor einiger Zeit mehr durch Zufall denn aus freiem Willen bei sich aufgenommen hatte. Wenn Paul unterwegs war, ließ er den Hund meist im Garten; so brauchte er sich keine Sorgen um proppenvolle Hundeblasen zu machen, falls es bei ihm später werden sollte.
Doch der Hund kam nicht. »Bist du nicht hungrig, Monsieur?« Paul ging ins Haus und entriegelte die hintere Küchentür, die direkt in den Garten führte. Der zusehends verwilderte, da Paul selten Gelegenheit fand, sich um ihn zu kümmern.
»Hey, Monsieur, wo steckst du?« Vielleicht, dachte Paul, war das Tier draußen tot umgefallen. Da Paul nie einen Kampfhund oder überhaupt einen Hund gewollt hatte, erschreckte ihn die Vorstellung nicht allzu sehr. Eine junge Frau, die eine Zeit lang bei ihm gewohnt hatte, hatte ihm das Tier bei ihrem Auszug quasi zwangsvererbt. Ärgern würde Paul sich deshalb eher darüber, ein Grab schaufeln zu müssen. Oder käme es teuer, einen toten Hund einäschern zu lassen?
Er ließ sich einen Kaffee ab, richtete sich eine Leberkäsesemmel. Vielleicht geruhte das Vieh zu kommen, wenn es die Wurst roch; trotz seines Alters war Monsieur unendlich verfressen. Aber kein Hund ließ sich blicken.
Die Semmel schmeckte nicht. Paul wanderte zur Tür, blickte in den finsteren Garten.
»Monsieur?« Er horchte in die Dunkelheit. Raschelte dort nicht etwas, hinten bei dem schiefen Schuppen, den Paul längst hatte erneuern wollen? Hatte der Hund einen Schlaganfall und schaffte die paar Meter nicht ohne Hilfe?
Paul holte eine Taschenlampe, trat in den Garten hinaus. Und sagte sich zum hundertsten Mal, dass das Gelände einen besseren Eindruck machen würde, wenn er gelegentlich jäten und mähen würde. Aber dazu war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Methodisch ließ Paul den Lichtkegel über den Garten wandern, von rechts nach links. Und dann sah er ihn: Der Hund lag vor dem Schuppen, den Kopf auf den Pfoten.
»Was zum Teufel treibst du da?« Monsieur knurrte. Und Paul begriff, dass er etwas vor sich liegen hatte: eine tote Forelle.
»Wo hast du das her?« Sofort war Paul misstrauisch. Dachte an Stories von Rasierklingen in Wurst, Gift in Semmeln. Versuchte irgendein Hundehasser Monsieur etwas anzutun?
»Ab ins Haus, los!« Natürlich würde das Tier seine Beute nicht freiwillig abgeben, und Paul verspürte keine Lust, mit einem Kampfhund um einen angebissenen Fisch zu raufen. Langsam ging er um Monsieur herum, der ihn anknurrte, sich aber dann wieder seiner Beute zuwandte.
Schließlich gelang es Paul, das Tier mithilfe eines Hundeleckerlis dazu zu bewegen, die Forelle aufzugeben und in die Küche zu trotten. Schnell schloss Paul die Tür von außen, kehrte in den Garten zurück und entsorgte den halb vergammelten Fisch in der Mülltonne. Selbst wenn das Ding, aus der Nähe betrachtet, unverdächtig aussah: Wo hatte es der Hund gefunden? Er konnte nicht aus dem Garten heraus. Also musste es ihm jemand zugeworfen haben. Aber wer und warum? Selbst Fischer gingen nicht üblicherweise mit toten Forellen in der Jackentasche spazieren.
Leicht beunruhigt, weil er die Frage nicht lösen konnte, kehrte Paul ins Haus zurück und checkte sein Handy: keine Nachricht von Kira.
»He, du! Was machst denn da?« Der Mann mit dem Fahrrad stoppte und sah zu dem Kind, das vor der hölzernen Scheunenwand saß. In dem vom Fluss aufsteigenden Nebel war der Junge kaum zu erkennen; lediglich sein Schniefen hatte ihn verraten.
Der Mann blickte sich um. Weit und breit niemand zu sehen. Sein Herz jagte. Er wollte das nicht. Oder doch?
»Wo gehörst denn hin, Bub?« Er legte das Rad ins Gras.
»Geht dich nichts an!« Dem Jungen rannen Tränen über das Gesicht.
»Ist kalt hier draußen. Und feucht. Wirst dir den Tod holen, wennst net heimgehst.« Versuchsweise trat der Mann näher. Das Kind blieb sitzen, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht.
»Hast dich verlaufen? Oder Krach mit den Eltern? Hier kannst net bleiben, hörst du?«
Es ist nicht meine Entscheidung, sagte eine Stimme im Kopf des Mannes. Höhere Mächte haben ihn mir gesandt. Er bemühte sich darum, weich und einschmeichelnd zu reden. »Du musst müd sein, und hungrig. Wennst willst, kannst erst mal mit zu mir kommen. Ich mach dir ’ne heiße Schokolade. Und du darfst ein bisserl am Sofa schlafen. Oder Fernsehen schauen. Hinterher überlegen wir, wie’s weitergeht.«
Die Augen des Jungen verengten sich. Der Mann wusste, dass das Kind überlegte, was das größere Übel wäre: In dem feuchten Gras oder der stockfinsteren Scheune zu übernachten oder mit einem Fremden mitzugehen. Wovor es bestimmt gewarnt worden war.
Doch der Mann begriff schnell, wie er zu reagieren hatte. Er tat, als grüble er nach. »Sag mal, kenn ich dich nicht? Bist net mit unserm Bertl in der Klasse?«
»Ich kenn keinen Bertl.« Aber die Erwähnung der Schule, eines eigenen Kindes verfehlte nicht ihre Wirkung. Der Junge stand auf, und der Mann holte sein Rad näher heran.
»Komm, sitz hinter mir auf. Wie heißt denn überhaupt?«
»Sag ich nicht.«
»Später vielleicht.« Der Mann gab sich verständnisvoll. Denn natürlich ahnte er, wen er vor sich hatte. Schließlich hatte er im Radio die Lokalnachrichten gehört. Sein Mund wurde trocken, als der Kleine tatsächlich auf den Gepäckträger kletterte. Nun galt es, ihn ungesehen nach Hause zu bringen.
Der Junge schien vollkommen erledigt und hielt sich wie verlangt am Gürtel des Mannes fest. Er machte den Eindruck, als könne er jeden Moment einschlafen. Umso besser. So würde er keine Schwierigkeiten bereiten.
Froh über den dichter werdenden Nebel zwang sich Oskar, langsam zu radeln. Nicht auffallen. Um keinen Preis auffallen. Zum Glück kannte er jeden Schleichweg in der Umgebung. Er hoffte, dass das Kind nicht wieder zu weinen beginnen würde. Doch offenbar war es selbst dafür zu müde, und sie erreichten das Haus ohne Zwischenfälle. Hier fühlte Oskar sich sicherer. Er hob den Jungen vom Gepäckträger und behielt die kleine Hand in seiner. Schließlich wollte er kein Risiko eingehen, das Kind nicht im letzten Moment verlieren. Er führte den Kleinen ins Haus und sperrte hinter sich ab.
»Jetzt die heiße Schokolade, okay? Damit du nicht weiter frierst?«
Der Junge blinzelte, konnte die Augen kaum offenhalten. Es brauchte keinen Kunstgriff, ihm das Schlafmittel in das Getränk zu rühren. Oskar hatte den Sirup zu Hause, weil ihn phasenweise Selbstzweifel quälten, die ihn schwer zur Ruhe kommen ließen.
»Wie heißt du?«, fragte das Kind nach dem ersten Schluck.
»Sag ich dir erst, wennst mir auch deinen Namen verrätst.« Der Mann zwinkerte dem Kind zu, als sei das Ganze ein lustiges Spiel.
Der Junge schlürfte laut. Am liebsten hätte Oskar ihm eine gescheuert, doch er agierte lieber vorsichtig.
»Setz dich auf die Bank, eh du mir vor Müdigkeit umkippst.« Es dauerte nicht lange, und der Kleine lehnte den Kopf an und schloss die Augen. Der Mann nahm ihm den Becher mit dem Getränk aus der Hand, und das Kind merkte es nicht einmal. Zufrieden wartete Oskar eine Viertelstunde, um ganz sicherzugehen, ehe er den Jungen aufhob und in den Keller hinabtrug.
Es hätte nicht besser laufen können, sagte sich Oskar zufrieden. Wieder einmal dachte er an sein bewundertes Vorbild. Der Italiener hatte sich Inspiration in den Gassen seines Heimatlandes geholt und sich nicht gescheut, gelegentlich Gesetze zu missachten. Oskar war stolz darauf, in seine Fußstapfen zu treten. Und zudem hatte er an diesem Abend endlich den perfekten Platz gefunden, an dem er Kyrills Rat würde umsetzen können.
Der Morgen vertrieb den Nebel. Paul hatte lange nicht einschlafen können und wachte dennoch vor dem Wecker auf. Sein erster Blick galt dem Handy neben seinem Bett: Keine neuen Nachrichten, keine missed calls. Er wagte nicht Kira anzurufen; sie hatte bestimmt eine schlechtere Nacht als er selbst gehabt. Falls sie erst vor Kurzem eingenickt sein mochte, wäre es grausam, sie zu wecken. So wählte er stattdessen Porants Nummer.
»Der Leonberger weiß also auch nix«, sagte der Kommissar so gemütlich, dass Paul ihn am liebsten gewürgt hätte. »Dabei sind S’ sonst immer so siebengescheit, Herr Journalist.«
»Vielleicht will ich einfach mal Ihnen eine Chance geben, Ihre Fähigkeiten zu zeigen. Sofern Sie welche haben.« Obwohl er sich um Kiras Sohn sorgte, konnte Paul es nicht lassen, den Polizisten zu reizen. Dann jedoch seufzte er. »Verdammt, das Kind kann nicht spurlos verschwinden. Jemand muss den Kleinen rumstreunen gesehen haben.«
»Wir setzen unsere Suche fort. Die Feuerwehr und meine Leut, plus eine Hundertschaft von der Bereitschaftspolizei, sind seit einer Stunde wieder draußen«, sagte Porant. »Und der Heli startet auch gleich. Außerdem ist heut der Himmelfahrtstag, da sind so viele Ausflügler unterwegs, dass der Bub vielleicht eher jemandem auffällt als gestern.«
»Sie wissen so gut wie ich, dass nach den ersten 24 Stunden die Chancen, ihn unversehrt zu finden, rapide sinken.«
»Machen S’ net auf dramatisch, Leonberger. Der Bub ist fortgelaufen, nicht gekidnappt worden. Wahrscheinlich hat er sich verirrt. In dem Alter sind s’ schon hübsch abenteuerlustig, und mit dem Radl kommt er recht weit herum.«
Paul legte auf und schickte eine Nachricht an Kira. ›Bist du wach?‹
Keine Minute später meldete sich sein Telefon, und sie verabredeten sich bei ihr.