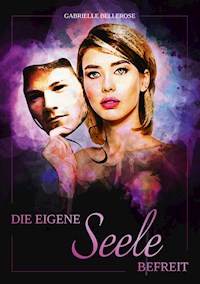
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die kleine Gabrielle wächst in einem Provinzstädtchen im schweizerischen Aargau auf. Alle nennen sie Jochen und behandeln sie auch wie einen Jungen, genauso wie es bei ihrer Geburt bestimmt wurde. Doch die Seele des Mädchens leidet. Sie versucht sich anzupassen. Sie will dazugehören und dem typischen Bild eines Jungen entsprechen. Später, als Erwachsene, ist sie beruflich erfolgreich, glücklich verheiratet mit Kindern - und ein maskuliner Teddybär. Das scheinbar perfekte Bilderbuchleben. Aber ihre Seele schreit. Ihre Emotionen stehen Kopf. Die innere Zerrissenheit wird unerträglich. Von der tiefen Sehnsucht getrieben, das Maskenspiel endlich zu beenden, beginnt sie schließlich den langen, steinigen Weg zu ihrem Wahren Ich. Mit diesem Buch möchte die Autorin einerseits Mut machen aber auch Informationen vermitteln, wie vermeintlich ausweglose Situationen gemeistert werden können. Es soll zum Thema informieren und aufzeigen, was tief im Inneren betroffener Personen vorgeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die eigene Seele befreit
Gabrielle Bellerose
© 2021 Gabrielle Bellerose.
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-95778-229-8
Auflage 1
Druckabwicklung & Druckvorbereitung:
One World Distribution, Remscheid
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Prolog
Kindheit & Jugendzeit
Schulzeit
Erster Schultag
Pubertät
Tod der geliebten Mutter
Genf
Rowdy und Macho Zeit
Silvia
Beginn des seriösen Lebens
Schwangerschaft und Hochzeit
Geburt und Rückkehr in die Deutschschweiz
Deutschschweizer Alltag
Doppelleben
Die ersten Veränderungen
Outing gegenüber Silvia
Verarbeitung von Silvia
Suizidgedanken
Die Lösung als Projekt
Auslegeordnung und Planung
Es geht los – Umsetzung
Epilog
Danksagungen
Prolog
Der Zug hielt in Lausanne an, es war ein sonniger, freundlicher Januartag nach der Jahrtausendwende. Ich schleppte meine zwei Koffer mit meinen Habseligkeiten ächzend aus dem Zug. Klar, der eine Koffer enthielt natürlich noch einiges Zusätzliches, was ich vermutlich unter normalen Umständen nie brauchen würde. Den Sitzring hatte ich von einer Kollegin erhalten, die Watte und die entsprechend bequem großen Slips besorgte ich mir einige Tage vorher in einem Kaufhaus. Ich war ja gespannt, ob ich die Sachen alle wirklich brauchen würde.
Dann ging ich, wie immer, den Weg des geringsten Widerstands suchend, schnurstracks in Richtung Taxistand. An diesem Tag war wenig Betrieb und sogleich kam auch schon ein sportlich erscheinender junger Mann auf mich zu und fragte:
»Kann ich Ihnen helfen, Madame?«
»Madame« hatte er mich genannt. Mein Herz hüpfte vor Freude. Hocherfreut antwortete ich ihm in rassenreinem Französisch, das ich natürlich noch von meiner Genfer Zeit her perfekt beherrschte: »Ja, vielen Dank, das ist sehr nett! Ich muss zur Klinik. Sind Sie gerade frei?« Er bejahte dies zwar, meinte aber, die Klinik sei ja nicht so weit, ob ich denn wirklich ein Taxi nehmen wolle. Das war ich gar nicht gewohnt von den Taxifahrern, dass sie freiwillig auf eine Fahrt würden verzichten wollen. Aber es amüsierte mich.
Ich wusste natürlich nur allzu genau, warum ich dorthin gefahren werden wollte und ich hatte ausgerechnet an diesem für mich so wichtigen Tag wirklich so etwas von überhaupt keine Lust, mich die fünfhundert Meter mit meinen Koffern in diesem hügeligen Lausanne auf dem Weg in die Klinik abzumühen. So packte er also meine Koffer in sein Auto und wir begaben uns zu besagtem Ziel.
Die Fahrt dauerte gerade Mal vier Minuten bis zur Clinique Beaulieu. Dort angekommen, wusste ich zuerst nicht so recht, ob ich wirklich an der richtigen Adresse war. Der Name dieses Hauses schien durchaus richtig ausgewählt – Beaulieu – Schöner Ort. Treffender konnte man ein Gebäude nicht bezeichnen – nomen est omen. Etwas schüchtern und gleichzeitig respektvoll bewegte ich mich in Richtung Eingang. Das wuchtige, kunstvoll geschwungene Eisentor ging wie von Geisterhand auf und ich betrat andächtig die heiligen Gewölbe des Ortes, der mein Leben so nachhaltig verändern sollte.
Knapp fünfzehn Meter lang und sicher drei Meter breit war der dicke rote Teppich, auf dem sich meine Füße wie in Trance Richtung Empfang bewegten. Das Ganze kam mir wie in einer Hotellobby vor. Die Gemälde an den Wänden, die leicht barock angehauchte Baukunst des Gebäudes und die mindestens acht Meter hohe Eingangshalle erinnerten mich an Fünf-Sterne- Hotels meiner besten Erfahrungen.
Selbstverständlich wurde ich erst einmal auch nicht als Patientin, sondern als Kundin behandelt. Höflich wurde ich gebeten, mich doch noch quelques minutes zu gedulden, bis ich abgeholt und in mein Zimmer gebracht würde. Es vergingen dann aber doch fast zehn Minuten, die ich dort unten staunend dem Treiben dieser Eingangshalle zuschaute, bis mich die Empfangsdame an der Rezeption an eine weitere Frau verwies, die allerdings unverkennbar als Krankenschwester auftrat.
»Je suis Denise«, hatte sich die rund fünfundvierzigjährige und attraktive Frau vorgestellt. Ihre Krankenschwesterhaube ein bisschen keck über das leicht lockige mittellange Haar gezogen, meinte sie dann noch: »Enchantée de vous connaître, Madame.«
Ich merkte, wie ich leicht errötete und entgegnete fast ein bisschen stotternd: »Pareillement, Denise.«
Der Bann war gebrochen. Auf dem Weg in mein Zimmer erklärte sie mir vorab die wichtigsten Dinge, die mir das Leben hier noch ein bisschen angenehmer gestalten sollten. Dann, nach einem kleinen Zwischenhalt im zweiten Stock, betrat ich mein Hotelzimmer.
Denise meinte nur noch, sie wolle mich in aller Ruhe auspacken lassen und käme dann in einer halben Stunde nochmals. Auspacken? Nichts da. Zuallererst die Koffer aufs Bett werfen und dann Fenster auf und bei strahlend blauem Himmel die freie Sicht auf den Genfer See genießen. Das war das, was ich jetzt zuerst brauchte. Mein Genfersee! So lange habe ich dich nicht gesehen. Ein Heimatgefühl beschlich mich kurz. Ich träumte.
Brrrrrrrrrrrrrr! Das Vibrieren meines Mobiltelefons riss mich aus meiner Ruhe heraus. Silvia wollte sich erkundigen, ob ich gut angekommen sei. Ich meinte nur:
»Ja, es ist unglaublich, aber wahr. Ich bin hier.«
An dem Ort, an dem ich am nächsten Tag endlich die lang ersehnte Operation haben durfte.
Danach, wie es sich schließlich für eine Frau gehört – immer diese Klischees schmunzelte ich zu mir – räumte ich alles schön säuberlich in die Schränke, welche dafür zur Verfügung standen. Die Schränke ließen das Gefühl des vermeintlichen Hotelzimmers eindeutig verblassen und das Bett, das darin stand, auch noch dazu. Trotzdem! Es war wunderbar und doch war mir gleichzeitig etwas mulmig zumute. Fast schon ein bisschen Angst stellte sich vor der fünfstündigen Operation ein. ›Komm schon‹, sagte ich zu mir selbst, um mir Mut zu machen. ›Du hast es so lange gewollt. Jetzt ist es endlich soweit. Du bist jetzt hier und es darf kein Zurück mehr geben‹, trichterte ich mir immer wieder ein.
Kaum eingerichtet, kam auch schon die erste von vielen Krankenschwestern herein. Ich erwartete eigentlich Denise, sollte aber dann schnell merken, dass da eine ganze Schar von Krankenschwestern sein musste. Sie stellte sich mit Olga vor und fragte mich, welches Menü ich denn zum Abendessen möge. Ich war platt. Ich beschäftigte mich die ganze Zeit damit, warum ich eigentlich hier war und diese Frau fragte mich, was ich zu Abend essen möchte. Leicht verwirrt, musste ich sie einige Minuten vertrösten, bis ich mich wieder fassen konnte. Dann aber, ja dann war ich bereit. Bereit für alles – auch für das Abendessen. Ich rief nach ihr und bestellte. Olga sprach nur sehr gebrochen Französisch. Sie war aus der Ukraine. Aber sie strahlte eine Herzlichkeit aus, die ihre Französischkenntnisse zweitrangig werden ließen. Hoffentlich hat sie alles gut verstanden, dachte ich noch.
Kurze Zeit später genoss ich dann das, für meine Verhältnisse doch sehr leichte, Abendessen. Aber ich wusste ja, dass das vor einer Operation immer so ist.
Um punkt neunzehn Uhr, ich war gerade dabei in einer Zeitschrift zu schmökern, kam Marie-Thérèse herein. Marie-Thérèse war, zusammen mit Denise, eine der wenigen westschweizerischen Krankenschwestern in dieser Klinik. Mit einer zwar sehr angenehmen, aber doch fordernden Stimme, machte sie mir klar, dass sie mir jetzt einige Medikamente zur sofortigen Einnahme geben müsse und einige weitere für die Nacht bereitstellen wolle. Natürlich hatte sie schon bemerkt, dass ich mich ein wenig sträubte, schon um neunzehn Uhr Medikamente einzunehmen. Schließlich verstand ich ja nicht, weshalb ich das tun sollte, da ja die Operation erst am anderen Tag sei. Sie erklärte aber, diesmal in einem viel weicheren Ton, dass die Operation schon um sieben Uhr morgens beginnen würde und es deshalb nötig wäre, schon etwas am Vorabend zu sich zu nehmen.
Kaum war Marie-Thérèse wieder draußen, kam auch schon der Narkosearzt. Ich dachte noch: ›Ein Verkehr ist das hier...‹ Aber der Narkosearzt. Mann, war dieser Mann schön. Braunhäutig, eine makellose Gesichtskontur und einen Körper hatte diese Schönheit. Kein See auf dieser Welt hat diese hellblaue Farbe mit dem wachen Glitzern und kein Filmstar diese Ausstrahlung. ›Was macht so ein Mensch als Narkosearzt‹, fragte ich mich. Selbst Adonis wäre neidisch geworden ob dieser Tadellosigkeit von Mannsbild.
»Je suis Dr. Samulahawi, votre anésthésiste«, stellte er sich mir mit leicht verschmitztem Lächeln vor.
Klar! Der hatte natürlich voll bemerkt, wie ich wahrscheinlich mit leicht hängendem Kiefer diese Schönheit bestaunte.
Als ich mich wieder einigermaßen fassen konnte – die paar Sekunden kamen mir wie eine Ewigkeit vor – erklärte mir Dr. Samulahawi, wie am nächsten Morgen, sechs Uhr dreißig alles vonstattengehen sollte. Ich konnte nur halbherzig zuhören, so sehr war ich von diesem Mann fasziniert. Aber irgendwie gelang es mir dann doch, noch zwei unbedeutende Fragen zu stellen, bevor er sich dann wieder von mir verabschiedete, nicht ohne mich vorher noch zu beruhigen:
»Il ne faut pas vous inquiéter – tout se passera bien.«
Ich solle mir keine Sorgen machen, es werde schon alles gut gehen, versuchte er mich zu beruhigen. Den Worten dieses Mannes MUSS man einfach glauben.
Fünf Uhr: Die Krankenschwester weckte mich sanft und sagte, ich solle jetzt das Schlafmittel einnehmen, das mich schon ein wenig beruhigen sollte. Von beruhigen spricht diese Frau. Dabei bin ich erstaunlicherweise die Ruhe selbst – noch. Doch das sollte sich kurze Zeit später akut und ziemlich dramatisch ändern.
Um sechs Uhr fünfzehn kamen mich eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger in meinem Zimmer abholen. ›Aha, es gibt also auch männliche Krankenschwestern hier‹, dachte ich grinsend. Die beiden schoben mich sehr behutsam mitsamt meinem Bett in den Vorraum des Operationssaals. Ihre Namen hatte ich nie zu Ohren bekommen. Wahrscheinlich wirkte das Dormikum schon ein bisschen. Dort wechselte ich noch selbst auf den OP-Schragen, wie in der Schweiz diese Liege genannt wird. Mit meinem Gewicht war es besser, dieses noch selber zu tun, denn die Helferinnen und Helfer wären sicher ziemlich gefordert, höchstwahrscheinlich aber überfordert gewesen.
Nun lag ich also auf dieser Operationsliege. Festgeschnallt. Leicht benommen. Aber jetzt klopfte mein Herz wie wild, legte immer wieder einen Hüpfer hin. Ich war aufgeregt, vorfreudig und jetzt auch so richtig ängstlich. Aber trotzdem konnte ich es kaum erwarten. Auf diesen Moment hatte ich jahrelang gewartet, insgeheim vielleicht ein Leben lang.
Neben mir ging eine OP-Schwester, sie war weiß gekleidet und trug einen Mundschutz um den Hals.
»Sie müssen keine Angst haben«, sagte sie in einem Deutsch mit charmantem Akzent, lächelte und legte eine Hand auf meine Schulter.
Ich versuchte, mich aufzurichten um ihr zu erklären, dass ich keine Angst habe, dass ich mich vielmehr freue. Ich schaffte aber nur noch ein schwaches Zucken mit meinem Arm und aus meinem Mund kam ein unverständlich lallendes Gebrabbel. Die Betäubungsmittel mussten schon angeschlagen haben. Aber meine Gedanken waren noch einigermaßen klar. Die Schwester lächelte verständnisvoll und meinte beruhigend:
»Sie werden bald immer ruhiger werden und dann einschlafen. Wenn Sie wieder aufwachen, sind Sie ein neuer Mensch. Dann haben Sie es geschafft.«
Ein neuer Mensch. Das hallte in mir wider, während man mich durch die Schiebetür in den Operationssaal schob.
Mein Körper war ebenfalls in einen weißen Kittel gehüllt. Ein neuer Mensch. Stimmte das wirklich? Ich merkte, wie mir ein wenig schummrig wurde und Bilder vor mir auftauchten.
Dann ein abrupter Unterbruch, den ich allerdings, wenn auch schon leicht benommen, wahrnahm. Der Arzt, der mich operieren sollte! Freundlich fragte er mich, wie es mir gehe. Ich lallte beim Versuch scherzhaft zu antworten:
»Ich hoffe, Sie sind fit so früh am Morgen, ich erwarte ein gutes Resultat.«
Ich wusste nicht mehr, was er geantwortet hatte – weg war ich.
Rund sieben Stunden später:
Ich befand mich im Aufwachraum. Völlig benommen schaute ich meinem Körper entlang nach unten und sah eine zentimeterdicke Schicht von Verbänden in der Mitte meines Körpers.
»Bonjour Madame«, hörte ich die warme Stimme des Professors, der mich operiert hatte.
»Tout s’est bien passé.«
›Tout s’est bien passé‹, hat er gesagt. Alles ist gut gegangen! Ich war nur noch glücklich. Nach einem langen Leidensweg, der mich ein Leben lang verfolgt hatte, hatte ich endlich den großen Meilenstein erreicht, den ich mir so sehr wünschte.
Mein ganzes Leben lief wie in einem Film vor mir ab. Alle diese Erlebnisse und Stationen, die ich durchlaufen musste, um diesen Meilenstein zu erreichen. Aber dann wurde mir bewusst, dass es trotzdem nur ein Meilenstein war – das wahre Leben als Frau begann erst jetzt. Die Höhen und Tiefen, die gesellschaftlichen Probleme, das Gefühls- und Sexleben als Frau. Ich war sehr gespannt darauf, wie sich mein weiteres Leben als Frau entwickeln würde.
Kindheit & Jugendzeit
Schulzeit
Ein kleines Provinzstädtchen im schweizerischen Aargau in einem kleinen Außenquartier. Keine reichen Leute wohnten hier. Alte, teilweise schon renovationsbedürftige Wohnblöcke, wenngleich auch mit viel Grün, da sehr nahe des Waldrandes, prägten – zusammen mit dem damals einzigen städtischen Altersheim – diese recht ärmliche Gegend.
Ich, dazumal noch als Jochen lebend, war für meine erst elf Jahre schon recht groß gewachsen und kräftig. Nicht selten hielten mich die Erwachsenen bereits für dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Diese Größe kam mir aber gerade recht, wenn mich die anderen Kinder hänselten, nicht nur weil ich als Deutscher mehr als einmal von den anderen Knirpsen als Hitlerjunge bezeichnet wurde, obwohl ich doch in der Schweiz geboren und aufgewachsen bin und mit Hitler überhaupt nichts am Hut hatte. Aber der Krieg schien ganz offensichtlich noch nicht lange genug vorbei zu sein, so dass die Eltern der Kinder diese natürlich vor allem und allen warnten, was nur irgendwie deutsch aussah oder so tönte. Ich konnte die Abneigung, die diesen jungen Kindern von ihren Eltern eingeprägt wurde, gut spüren und ihr leider nicht entkommen. Klar und deutlich wurde mir zu verstehen gegeben, dass ich gefälligst nur geduldet sei und mich so schweizerisch wie nur möglich zu verhalten habe. Das traf mich, denn ich verstand nicht, was ich denn diesen anderen Kindern angetan hatte. Mehr als einmal rannte ich, als die Schule aus war, direkt nach Hause und ließ mich von meiner Mutter trösten.
Aber es gab noch einen anderen Grund, weshalb die kleinen Bengel, denn es waren vor allem Knaben, mich so dermaßen aufzogen. Sie beobachteten mich, wie ich immer wieder versuchte, mit den Nachbarsmädchen anzubändeln, um mit diesen zu spielen. Nun, ich fand daran überhaupt nichts Schlimmes. Was konnte ich denn dafür, wenn mir die Räuber und Polizeispiele der Jungen nichts sagten. Nein, da war mir bei den kleinen kichernden und geheimnisvoll tuschelnden Mädchen schon viel wohler. Allerdings war es auch recht schwierig, mit diesen jungen Fräuleins regelmäßig in Kontakt zu kommen. Denn diese fragten sich natürlich zu Recht:
»Das ist doch ein Junge, was will der denn mit uns?«
Außer mit Marianne. Mit ihr schien es doch ein wenig anders zu sein. Marianne war klein, zierlich und hatte wunderschönes, langes, glänzendes, braunes Haar mit zwei Zöpfen. So bieder sie auf den ersten Blick schien, so faustdick hatte sie es wohl auch hinter den Ohren. Ihr entging natürlich nicht, dass ich lieber mit den Mädchen spielte als mit den Jungs. Und dann eines Tages, ich kam gerade schlendernd vom Pausenhof und wollte mich schon auf den Heimweg machen, zischelte es hinter einer Hausecke: »Jochen, hey Jochen!«
Ich konnte die Stimme nicht gleich erkennen und schon gar nicht, woher sie kam. Aber dann sprang auf einmal mit einem riesigen Hüpfer Marianne hervor, stellte sich keck vor mich hin und fragte mich scheinheilig, aber doch leicht neckisch und mit spitzbübisch blinzelnden Augen:
»Willst du schon nach Hause gehen?«
Ich stand da, leicht verdattert ob dieser Situation, spürte wie mir das Blut ins Gesicht schoss und stotterte nur:
»n...ein, ne...in. Nicht ... wirklich sofort.«
»Also komm mit«, forderte sie mich auf und nahm mich bei meiner Hand.
Gott, was hatte dieses Mädchen vor? Ich musste zugeben, dass die Situation mich einerseits zwar sehr freute, andererseits mir aber doch ziemlich mulmig dabei war. Marianne zog mich mit entschlossenen Schritten in ein Nachbargebäude, das gerade vollständig renoviert wurde und deshalb eine einzige große Baustelle war. Freilich war es verboten, die Baustelle zu betreten. Aber das kümmerte Marianne nicht im Geringsten. Mit Todesverachtung schob sie die Absperrung beiseite und gebot mir, ihr zu folgen. Erst zögernd, dann ein bisschen mutiger, leistete ich ihr folge. Geheimnisvoll führte sie mich die Treppe hinab in ein Kellergeschoss, in dem es allerdings ziemlich dunkel war. Dann sah ich sie nicht mehr. Plötzlich hielten mir von hinten zwei kleine Hände meine Augen zu, drehten meinen Kopf und ich spürte wie sich ein zarter Mund auf meinen eigenen presste. Und wieder spürte ich wie mir warm, nein heiß im Kopf wurde. Die Temperatur in meinem Kopf war gefühlte fünfzig Grad. Ich konnte nichts sagen! Mein erster Kuss! Ich genoß den Moment. Aber gleichzeitig war da noch etwas anderes. Ich wusste nicht, was es war. Es war etwas in mir, das ich nicht zuordnen konnte. Eine Gefühlskombination von schön und doch irgendwie seltsam.
»Was ist?«, fragte mich Marianne, als ich so sprachlos vor ihr stand.
»Hat es dir nicht gefallen?«
»Doch, doch«, korrigierte ich schnell.
»Gut, dann ist das jetzt unser gemeinsames Geheimnis und Versteck, wenn wir uns treffen wollen«, bestimmte sie.
Die Monate verstrichen und wir wurden uns sehr vertraut. Bis dann die Primarschule zu Ende war. Gleichzeitig zog Marianne fort in einen anderen Kanton. Jetzt hieß es Abschied nehmen. Traurig hockten wir beide in unserem Verlies, küssten uns so innig, wie man das mit elfeinhalb Jahren machte, und lagen uns weinend in den Armen.
So sehr der Abschied von Marianne schmerzte, waren wenigstens die Primarschule mit ihren strengen Lehrern, den fast schon altertümlich anmutenden Hausregeln des Schulareals und die ständigen Hänseleien endlich überstanden. Alle Zeichen schienen auf Neubeginn zu stehen. Das Gymnasium lag auf einer Anhöhe nahe am Stadtzentrum. Jetzt lockte die Kleinstadt und ein erster Hauch von Freiheit flatterte um meine Nase. Weite und Erleichterung. Ich freute mich darauf, der Enge des ärmlichen Viertels täglich ein Weilchen mehr zu entkommen. Zwar wohnte ich noch dort, aber jetzt wenigstens durfte ich in die Stadt zur Schule fahren.
Erster Schultag
Eine Schar von Schülern strömte auf das große Eingangsportal zu, ich mittendrin, immer noch größer als die meisten anderen. Ich war jetzt offenbar Teil des Ganzen – nicht mehr der deutsche Außenseiter, der mit Mädchen spielen wollte. Ich gehörte dazu. Ein berauschendes Gefühl!
Mein Magen fing an zu knurren. Ich hatte vor Aufregung zum Frühstück keinen Bissen heruntergebracht. Mit etwas trockenem Mund eilte ich mit großen Schritten dem Schulhaus entgegen. Plötzlich wurde ich unsanft aus meinen Gedanken gerissen. Ein Rucksack hatte die Unverschämtheit, mich anzurempeln.
»Tschuldigung«, murmelte die Trägerin dieses Ungetüms mit weiß Gott was für Sachen drin. Ein mittelgroßes Mädchen mit braunen Zöpfen, blickte kurz auf. Ich erschrak! War sie es oder war sie es nicht? Doch, sie musste es sein. Ich blickte sie einige Sekunden an, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Nein, es war doch nicht mein erstes Schulschätzchen Marianne, die ich ja schon monatelang nicht mehr gesehen hatte. Diese hier kannte ich also nicht. Sie musste sich denken:
»Was für ein Lulatsch!« Naja, ein bisschen lulatschig muss ich schon dreingeschaut haben.
Zugegebenermaßen verwirrt ging ich weiter, den anderen hinterher, die steinernen Stufen hinauf und hinein in die kühle Halle. Hier roch es fast ein bisschen modernd. Der Baustil und die Art, wie die Eingangshalle ausgestattet war, ließen keine Zweifel offen: Dieses Schulhaus hatte bestimmt schon unsere Lehrer und deren Väter und Mütter als Schüler gesehen.
»Wo ist denn dieses Klassenzimmer?«, fragte ich mich, suchend die Stockwerke rauf und runter irrend.
Es stimmte schon: Ich hatte noch nie einen guten Orientierungssinn. Sonst wäre ich nicht mindestens zweimal schon daran vorbeigelaufen.
›Ahh, da ist es ja‹, dachte ich erleichtert, als ich den Raum endlich entdeckte.
Das Erste, was mir auffiel, war, dass das Klassenzimmer frisch grün gestrichen war. Der Raum füllte sich schnell mit unbekannten Gesichtern. Einige kleine Grüppchen hatten sich schon, eifrig schwatzend, gebildet. Kannten die sich vielleicht schon von vorher? Einige sicher. Andere hatten sich eben gerade kennen gelernt. Zwischen all diesen, meinen offenbar künftigen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, entdeckte ich auch die Mausaugen und die braunen Zöpfe, die zur eiligen Remplerin gehörten.
»Das ist also auch meine Klassenkameradin!«, sagte ich zu mir.
Auch sie schien mich wieder erkannt zu haben. Zuerst sah sie mich nur kurz an, musterte mich aber danach fast schon aufdringlich. Ich spürte, wie mir wieder die Röte ins Gesicht schoss. Das passierte mir immer, wenn ich spürte, dass mich jemand musterte. War etwas anders an mir? Ich verstand es nicht. Endlich! Mit einem neckischen Kopfdreher, der ihre Zöpfe schwungvoll um ihr Gesicht wedeln ließ, wandte sich ihr Blick von mir ab.
Die Tische waren in Paaren zu zweien hintereinander angelegt und ich steuerte wie von einem Magneten angezogen den Platz vor einem alten Schrank an. Im Augenwinkel immer diese grässliche grüne Wand. Ein kleiner, eher schmächtig wirkender Junge steuerte ebenfalls den Tisch vor dem Schrank an, stutzte aber, als er diesen bereits durch mich besetzt sah. Er blickte sich Hilfe suchend um. Aber ich hatte keine Lust, den Zwerg neben mir zu haben und deutete ihm deshalb auch mit keinerlei Geste an, sich zu setzen. Nein, vielmehr verschränkte ich die Arme vor der Brust und sah ihn bewegungslos aber mit giftig blitzenden Augen an. Verängstigt und verwirrt zottelte er wieder davon und suchte sich anderweitig eine Sitzgelegenheit.
Unwillkürlich hob ich mein Kinn, beteiligte mich jedoch nicht am Stimmengewirr, sondern beobachtete sehr genau, wie sich nahezu von selbst überall heftig gestikulierende Grüppchen bildeten. Klar! Viele der Schüler kannten sich schon von der Primarschule. Witze wurden ausgetauscht, die kommende Fußballsaison diskutiert. Die Mädchen saßen mehrheitlich an ihren Plätzen, beobachteten mit hochgezogenen Brauen das Geschehen. Scheinbar beste Freundinnen tuschelten und kicherten. Wortfetzen und Seitenblicke trafen mich. Die Remplerin schien gerade ihr Erlebnis mit mir ihrer Nachbarin zu berichten – auffallendes Gekicher von dieser. Ich spürte wieder die Röte, die in mein Gesicht strömte und wandte deshalb den Kopf der Wand zu. Nur wenige Sekunden später traf mich etwas an der Schulter und ich vernahm ein Kichern. Langsam drehte ich mich wieder zum Raum, blickte allerdings – wie könnte es anders sein – nur in unschuldige Mienen. Klar, dass das niemand gewesen war. Ich verzog meinen Mund zu einem schiefen Grinsen, so als ob mich das Ganze überhaupt gar nichts anginge und gab scheinheilig vor, etwas in meinem Schulsack zu suchen. Und während ich so eifrig suchte, standen die Buben bereits beieinander, verglichen ihre Schulsäcke, Pausenbrote und vieles andere mehr untereinander. Es war Sommer und alle trugen kurze Hosen. Die teilweise verschrammten Knie zeigten schon deutlich, wer eher der kämpferischen Sorte zuzuordnen war und wer eben weniger. So richtige Buben halt. Aus einigen Hosentaschen zwinkerten verstohlen Zigarettenschachteln hinaus. Ein beschämendes Gefühl beschlich mich. Ich sollte mich wohl besser auch zu den anderen Jungs gesellen aber etwas Unsichtbares zog mich immer wieder zu den Mädchen hin. Warum war das so? Warum sagte es mir nichts, mich unter die Gruppe der Buben zu mischen? Da war es wieder, dieses undefinierbare Gefühl von Anderssein.
Der Klassenlehrer wurde abrupt mitten im Satz unterbrochen. Rrrrrring – die Pausenglocke. Grinsende Kinder erhoben sich und drängten dem Ausgang zu. Buben und Mädchen für sich und auch ich für mich. Pause!
Der Pausenhof füllte sich rasch. Ein paar Jungs verzogen sich hinter einer Weide. Fetzen von bitterem und aromatischem Tabakduft drangen einem hin und wieder in die Nase. Ein lautes Stimmengewirr – viele Grüppchen. Ich stand gelangweilt allein in einer Ecke und beobachtete das Pausentreiben.
Das war sie jetzt also – die große weite Welt? Und ich fragte mich, warum war ich schon wieder allein?
Zögernd machte ich ein paar Schritte auf die Weide zu, hinter der sich die Raucher versammelt hatten. Das war ja irgendwie noch cool, so hinter dem Baum, nur halb versteckt. Doch da sahen mich die Rauchenden herannahen, ich war ja auch kaum zu übersehen.
»Was willst denn du?«, fragte einer der Knirpse provozierend und mit herausforderndem Blick, die Hand lässig in der Hosentasche.
»Ich...«, begann ich leise stotternd. Und da merkte ich, dass ich ja gar nicht wusste, was ich überhaupt wollte.
»Gar nichts«, murmelte ich schnell und drehte wieder ab, jetzt mit hochrotem Kopf.
Betont lässig begab ich mich in eine andere Ecke des Pausenhofes. In meinem Kopf jedoch ratterten die Gedanken. Schon wieder abgewimmelt. Bin ich wirklich so unerträglich? Was ist an mir so anders, dass ich mich bei den Jungs nicht integrieren kann?
›Klar, solche Freunde brauchte ich nicht. Mit den Mädchen wäre mir das gewiss nicht passiert‹, dachte ich so bei mir. Ich versuchte, mir einzureden, dass ja alles gar nicht so schlimm war. Aber es war schlimm! Und es störte mich, dass ich mich nicht integrieren konnte und es störte mich, dass sich die anderen über mich lustig machten und es störte mich, dass ich anders war.
Nein, es war mir nicht egal! Es schmerzte tief in mir drin. Wütend trat ich mit dem Fuß auf den geteerten Platz. Immer wieder die Frage: Warum nur muss ich so sein wie ich bin?
Währenddessen hockten die Mädchen in kleinen Gruppen beieinander, tauschten in leisen Stimmen kleine und große Geheimnisse aus und begannen so, erste Freundschaften zu gründen. Eine etwas Dickliche hockte sich einsam dazu und blickte mit ihrer hohen Stirn schicksalsergeben auf das Treiben, das ohne sie stattfand. Auch sie gehörte nicht dazu. Aber das war mir egal. Zu sehr war ich mit mir selbst beschäftigt.
Ich drehte eine Runde, Hände in den Taschen, die Schultern leicht nach vorne gebeugt, nachdenklich. Ich fühlte mich von den Mädchen angezogen – immer wieder. Unmerklich näherte ich mich der Gruppe, um dann auch gleich wieder verstohlen mich abzuwenden. Ich wurde noch wütender auf mich.
Das Bild meines Vaters erschien jetzt vor meinem inneren Auge, der am Wochenende vor Schulbeginn wieder einmal eines seiner Männergespräche hatte führen wollen.
»Nun wirst du langsam erwachsen Jochen. Männer müssen in dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen lernen. Dazu braucht es Disziplin, Ehrgeiz und einen festen Willen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Männer sind hart und geradlinig... und nun schau dich an...«
Nie werde ich seinen abschätzigen Blick vergessen. Geradlinig, genau, echte Kerle. Das bin ich dann ja wohl nicht. Immer wieder kam das Thema, wie ein Mann zu sein hatte, zur Sprache. Wofür sollte das gut sein? Wollte er mich zum Rauchen, Brüllen, Springen, laut und hart sein erziehen? Wenn ich doch nur den Mut gehabt hätte, ihm ins Gesicht zu schreien, dass ich nicht so bin, wie er mich haben wollte. Dass ich mich am liebsten mitten unter die tuschelnden Mädchen gesetzt und mit ihnen gelacht und geschwatzt hätte. Aber irgendwie durfte es nicht sein. Ich hätte heulen können.
Schon schauten sie auf, denn ich hatte mich ihnen unbewusst immer mehr genähert, mit einem betont schlurfenden Gang. Die Remplerin stieß ihre Freundin an, ihre Namen hatte ich mir noch nicht alle merken können. Diese schaute auf und grinste, die Mädchen ringsum begannen zu kichern. Nur die Dickliche mit dem fettigen Haar versuchte, freundlich zu lächeln. Erschrocken drehte ich ab. Ich zog mich in mich zurück, dorthin wo auch die Gedanken leiser wurden und nur noch Traurigkeit zurückblieb. Dann fasste ich einen Entschluss.
Die Geschichtslehrerin hatte rot gefärbte Haare, die in Büscheln von ihrem Kopf abstanden. Über den, von Tag zu Tag wechselnden Tönen geschminkten Lippen, umrandete eine kantige Brille ihre Habichtnase und sie trug sehr gerne farbige Kleider.
Kein Wunder zog sie den Spott der Buben in der Klasse auf sich. Sobald sie sich zur Tafel wandte, um eines ihrer beständigen Diagramme zu zeichnen, traf sie eine kleine Papierkugel am Rücken. Nicht immer merkte sie das, aber wenn ja, drehte sie mit einem erschreckten Huch das entrüstete Gesicht der Klasse zu, um dort allerdings in unschuldig konzentrierte Mienen zu blicken. Wandte sie sich dann erneut ihrer Zeichnung zu, ertönte nicht selten ein Huch aus den Reihen hinter ihr.
Frau Huch, wie sie aufgrund ihrer Eigenart inzwischen von uns genannt wurde, hatte es gewiss nicht leicht. Die Buben nahmen sie kaum ernst, freundlich und ein wenig naiv, wie sie war, und die Mädchen, schon beginnend damenhafte Manieren zu erproben, mokierten sich über ihre Kleidungsgewohnheiten und ihre Frisur. Mir hatte es besonders ihre Brille angetan. Allerdings konnte ich mir nicht erklären, warum das so war – brauchte ich selbst doch gar keine Brille. Aber irgendwie zog mich das an.
Die ganze Klasse war überrascht. Für gewöhnlich war ich ziemlich still und brütete oft ein wenig vor mich hin. Ich verhielt mich auch nicht auffällig und beteiligte mich je nach Fach eher wenig am Unterricht. Aber dann erschien ich eines Tages mit einer klobigen Brille auf der Nase zum Geschichtsunterricht. Es war klar, dass ich damit Frau Huch nachäffte. Verwunderte Blicke der Klasse begegneten mir. Als Frau Huch den Raum betrat, und ihr Blick auf mich fiel, fragte sie mit besorgt empor gezogenen Augenbrauen, ob ich beim Augenarzt gewesen sei. Meine Antwort allein in einem überraschten Huch bestehend, hatte durchschlagenden Erfolg.
Die Buben schüttelten sich vor Lachen, die Mädchen lachten ebenfalls laut, während Frau Huch mit säuerlicher Miene und hektischem Schnaufen hinter dem Pult ein paar Dinge aus ihrer Tasche hervorzukramen begann. Ich sonnte mich in der unerwarteten Aufmerksamkeit, die mir nun von den Klassenkameraden zuteil wurde. Das ließ ich mir freilich nicht anmerken, sondern legte mein gewohnt ironisches Lächeln auf und ließ die Brille schnell verschwinden. Mein fast etwas demonstrativ schüchternes Schweigen verdeckte sehr gut meinen inneren Stolz. Es fühlte sich warm und gut an, gesehen und wahrgenommen zu werden. Allerdings sollte dies der Beginn einer Karriere der ganz neuen Art sein.
Ich sah Bilder. Bilder eines Waldes mit einem Teppich aus weichem Moos, Efeu an manchem Stamm. Tannen erhoben sich aus dem Unterholz und hektisches Rascheln unterstrich den bitteren Erdgeruch. Vereinzelte Sonnenstrahlen bahnten sich einen Weg durch das Dach aus Laub und Nadelzweigen. Und da konnte ich es fühlen. Ich war nicht allein. Neben mir atmete jemand. Zwar konnte ich das Gesicht nicht erkennen, es blieb immer im Schatten. Aber der Griff einer zarten, weiblichen Hand, mit dem sie den Arm um meine Hüfte geschlungen hatte, war fest und sicher. Es war fast so, als würde sie mich tragen. Ich konnte ihren Atem spüren. Langsam – ein und aus. Meine Hand lag auf ihrer Schulter. Ich stützte mich auf sie, nur ein wenig. So ließen wir uns in den Frühling tragen. Warm und konturlos fühlte ich mich. Als ich versuchte, den Mund zum Sprechen zu öffnen, versagte mir die Stimme. Ich wollte doch ihren Namen erfragen. Doch beruhigend drückte sie ihre Hand in meine Seite, still ging ihr Atem weiter – ein und aus. Wir gingen nicht auf dem Weg – es gab auch keinen in diesem Wald. Wir brauchten auch keinen. Ich versuchte immer wieder sie anzusehen, aber ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Es war wie ein Schatten und dies machte mir Angst. Sie roch nach frisch feuchtem Moos. Nein, ich wusste ihren Namen nicht – vermutlich hatte sie keinen. Langsam verblasste ihr Geruch, entschwand mir ihr Griff und ich war wieder allein. »Jochen!« Ich schrak auf. Lächelte verlegen, öffnete ganz die Augen.
»Wie war die Frage?«
»Das war keine Frage.«
»Ach so...« Verwirrt blickte ich um mich, die Gesichter der Kameradinnen mir zugewandt.
Neben meinem Pult standen ein Junge und Herr Rubikon, unser Lehrer für Französisch.
»Das ist Paul.«
Schüchtern blickte der mich an. Ein schmales Gesicht, stille braune Augen. Ich grinste. Paul grinste auch, testend. Zwinkern. Das war gut. Rubikon blickte mich streng an.
»Paul wird ab jetzt neben dir sitzen.«
Der Platz neben mir war frei geblieben, anfangs, weil niemand neben dem Eigenbrötler sitzen wollte, später, weil niemand mehr durfte – man fürchtete den schlechten Einfluss des neuerdings so beliebten wie aufsässigen Jochen. Ich blickte forschend in Rubikons Gesicht. Was wollte der genau? Mich bestrafen? Wegen der nassen Kreide letzter Woche?
»Hast du gehört?«
»Das ist Paul. Paul wird ab jetzt neben mir sitzen«, äffte ich ihn nach, grinste und blickte aus dem Augenwinkel in die Runde. Die Mädchen kicherten.
»Lass den Quatsch!«
Rubikon war nervös, vielleicht fragte er sich, ob das gut gehen würde, den offenbar schüchternen und stillen Paul neben mich, dem zwar ebenfalls stillen, aber bisweilen arroganten Jochen zu setzen. Schließlich war ich nie ganz zu kontrollieren und seit meinem Erfolg mit Frau Huch, fiel mir auch immer etwas ein, an dem sich alle belustigen konnten.
Überrascht zog ich die Augenbrauen hoch.
»Ach, ist das gar nicht Paul? Dann muss ich das geträumt haben, verzeihen Sie, Herr Rubikon.«
Ich zwinkerte Paul nochmals zu und der verzog seine schmalen Lippen zu einem leichten Grinsen. Von der anderen Seite des Raums fing ich Ursels Blick ein.





























