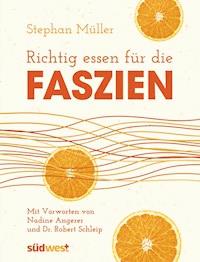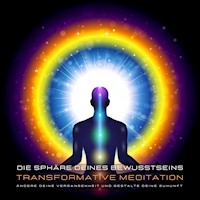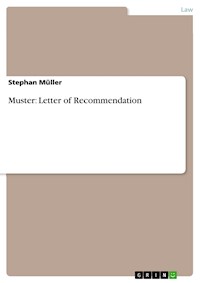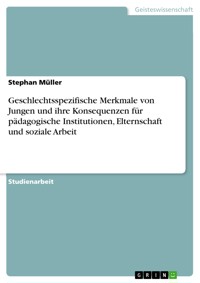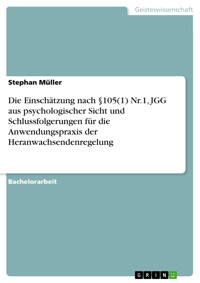
Die Einschätzung nach §105(1) Nr.1, JGG aus psychologischer Sicht und Schlussfolgerungen für die Anwendungspraxis der Heranwachsendenregelung E-Book
Stephan Müller
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,5, Hochschule Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Anwendung des Jugendstrafrechts (und damit die Anwendung des § 105, Jugendgerichtsgesetz (JGG)) auf Heranwachsende gerät immer wieder in den Fokus der politischen und öffentlichen Diskussion. Dabei votiert eine Mehrheit für die Abschaffung dieses Paragraphen, allerdings aus höchst unterschiedlichen Gründen. Während der überwiegende Teil der Fachliteratur für die generelle Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende und damit eine Abschaffung des § 105 JGG plädiert (vgl. Eisenberg 2012, S. 997; DVJJ 2002), wird die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende in der öffentlichen und politischen Diskussion oftmals äußerst kritisch betrachtet. Es sind daher auch immer wieder Bestrebungen zu erkennen, die generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende durchzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist der „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz“ (Bundesrat 2003), der durch das Land Baden-Württemberg in den Bundesrat eingebracht wurde. Zeichen dieser Bestrebungen ist auch die Regelung in Baden-Württemberg zu verstehen gewesen, dass Heranwachsende zwischenzeitlich keine der Regelungen für junge Untersuchungsgefangene in Anspruch nehmen konnten (vgl. Jung-Pätzold et al. 2010, S. 303). Ziel der damaligen Landesregierung war es augenscheinlich, [...] der regelhaften Einbeziehung Heranwachsender in das allgemeine Strafrecht ‚durch die Hintertür’ näherkommen “ (Jung-Pätzold et al. 2010, S. 306). Je nach Rechtskreis, nach dem der Heranwachsende verurteilt wird, hat dies eklatante Folgen für die betroffene Person (vgl. Allgeier 2010). Die Diskussion der Fragestellung, inwieweit Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist, wird durch eine (bislang) sehr polemische Debatte und Darstellung in der Öffentlichkeit weiter befeuert, zum Beispiel durch Publikationen wie „Das Ende der Geduld“ (Heisig 2010), oder „Schluss mit der Sozialromantik! Ein Jugendrichter zieht Bilanz“ (Müller 2013), die beide ein eindrückliches Bild von der mentalen Belastung der Jugendrichter zeichnen. Dabei werden alle gewünschten Klischees bedient: Der Rückgang der Jugendkriminalität, weil eine neue Generation von Jugendrichtern „hart durchgreift“ (Müller 2013, S. 409), die „in Kuschelpädagogik hervorragend ausgebildeten Sozialarbeiter“ (Müller 2013, S. 44), die daher als Kooperationspartner ungeeignet sind, und als „Sozialromantiker“ der „ungeliebten Person des Richters“ „persönlich die Robe ausziehen wollen“ (Müller 2013, S. 47).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Stand der Forschung
3 Der § 105 (1) JGG
3.1 Inhalt
3.2 Historische Entwicklung
3.3 Die Anwendungspraxis des § 105 (1) Nr. 1 JGG
4. Die Beurteilungskriterien des § 105 (1) JGG
4.1 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“
4.1.1 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“ aus Perspektive der Entwicklungspsychologie
4.1.2 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“ aus Perspektive der Entwicklungspsychopathologie
4.1.3 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“ aus Perspektive der Kriminologie
4.1.4 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“ aus Perspektive der Entwicklungskriminologie
4.1.5 Das Beurteilungskriterium „Gesamtwürdigung der Persönlichkeit“ aus Perspektive der Soziologie
4.2 Das Beurteilungskriterium „Umweltbedingungen“
4.2.1 Das Beurteilungskriterium „Umweltbedingungen“ aus Perspektive der Entwicklungspsychopathologie
4.2.2 Das Beurteilungskriterium „Umweltbedingungen“ aus Perspektive der Bindungstheorie
4.2.3 Das Beurteilungskriterium „Umweltbedingungen“ aus Perspektive der Resilienzforschung
4.2.4 Das Beurteilungskriterium „Umweltbedingungen“ aus Perspektive der Kontrolltheorie
4.3 Das Kriterium „geistige Entwicklung“
4.3.1 Das Kriterium „geistige Entwicklung“ aus Perspektive der Entwicklungspsychologie
4.3.2 Das Kriterium „geistige Entwicklung“ aus Perspektive der Neurowissenschaften
4.4 Das Kriterium „sittliche Entwicklung“
4.4.1 Das Kriterium „sittliche Entwicklung“ aus Perspektive der Moralpsychologie
4.4.2 Das Kriterium „sittliche Entwicklung“ aus Perspektive der Neurowissenschaften
5 Operationalisierung der Beurteilungskriterien des § 105 JGG
5.1 Psychosoziale Diagnostik und soziale Arbeit
5.2 Die Marburger Richtlinien
5.3 Das Modell nach Esser et al.
5.4 Die Bonner Delphi Studie
6 Die alternative Möglichkeit der Beurteilung auf Basis der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
6.1 Die Entwicklung höchstrichterlicher Rechtsprechung in Bezug auf § 105 (1) Nr. 1 JGG
6.2. Die Entwicklung der Rechtsprechung aus entwicklungspsychologischer Perspektive
7 Fazit
7.1 Erkenntnisse
7.2 Diskussion und offene Forschungsfragen
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit.
Abbildung 2: Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz nach Havighurst (vgl. Oerter und Dreher 2008, S. 281).
Abbildung 3: Bedeutsamkeitseinschätzungen der Entwicklungsaufgaben von männlichen und weiblichen Jugendlichen im Vergleich 1985 und 1997 (Oerter und Dreher 2008, S. 282).
Abbildung 4: Dissoziale Persönlichkeitsstörung und kriminalrelevante Risikofaktoren (Santos-Stubbe 2007, S. 74).
Abbildung 5: Wegen Verbrechen und Vergehen Verurteilte nach Altersgruppen (Heinz 2012, S. 22).
Abbildung 6: Biosoziales Modell der Gewalt (vgl. Petermann 2005, S. 92).
Abbildung 7: Ökosystem nach Bronfenbrenner (Quelle: de.wikipedia.org).
Abbildung 8: Wesentliche Risikofaktoren aggressiv-dissozialen Verhaltens (vgl. Petermann 2005, S. 98).
Abbildung 9: Wesentliche Schutzfaktoren aggressiv-dissozialen Verhaltens (vgl. Petermann 2005, S. 101).
Abbildung 10: Flussdiagramm der Theorie des Gruppendenkens (vgl. Fischer und Wiswede 2009, S. 685).
Abbildung 11: Das rationalistische Modell moralischen Urteilens (Heidbrink 2008, S. 152).
Abbildung 12: Das sozial-intuitive Modell moralischen Urteilens (Heidbrink 2008, S. 153).
1 Einleitung
Die Anwendung des Jugendstrafrechts (und damit die Anwendung des § 105, Jugendgerichtsgesetz (JGG)) auf Heranwachsende gerät immer wieder in den Fokus der politischen und öffentlichen Diskussion. Dabei votiert eine Mehrheit für die Abschaffung dieses Paragraphen, allerdings aus höchst unterschiedlichen Gründen. Während der überwiegende Teil der Fachliteratur für die generelle Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende und damit eine Abschaffung des § 105 JGG plädiert (vgl. Eisenberg 2012, S. 997; DVJJ 2002), wird die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende in der öffentlichen und politischen Diskussion oftmals äußerst kritisch betrachtet. Es sind daher auch immer wieder Bestrebungen zu erkennen, die generelle Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende durchzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist der „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz“ (Bundesrat 2003), der durch das Land Baden-Württemberg in den Bundesrat eingebracht wurde. Zeichen dieser Bestrebungen ist auch die Regelung in Baden-Württemberg zu verstehen gewesen, dass Heranwachsende zwischenzeitlich keine der Regelungen für junge Untersuchungsgefangene in Anspruch nehmen konnten (vgl. Jung-Pätzold et al. 2010, S. 303). Ziel der damaligen Landesregierung war es augenscheinlich, [...] der regelhaften Einbeziehung Heranwachsender in das allgemeine Strafrecht ‚durch die Hintertür’ näherkommen “ (Jung-Pätzold et al. 2010, S. 306). Je nach Rechtskreis, nach dem der Heranwachsende verurteilt wird, hat dies eklatante Folgen für die betroffene Person (vgl. Allgeier 2010).
Die Diskussion der Fragestellung, inwieweit Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist, wird durch eine (bislang) sehr polemische Debatte und Darstellung in der Öffentlichkeit weiter befeuert, zum Beispiel durch Publikationen wie „Das Ende der Geduld“ (Heisig 2010), oder „Schluss mit der Sozialromantik! Ein Jugendrichter zieht Bilanz“ (Müller 2013), die beide ein eindrückliches Bild von der mentalen Belastung der Jugendrichter zeichnen.
Dabei werden alle gewünschten Klischees bedient: Der Rückgang der Jugendkriminalität, weil eine neue Generation von Jugendrichtern „hart durchgreift“ (Müller 2013, S. 409), die „in Kuschelpädagogik hervorragend ausgebildeten Sozialarbeiter“ (Müller 2013, S. 44), die daher als Kooperationspartner ungeeignet sind, und als „Sozialromantiker“ der „ungeliebten Person des Richters“ „persönlich die Robe ausziehen wollen“ (Müller 2013, S. 47).
Es kann festgestellt werden, dass eine Frage, die für manchen Heranwachsenden entscheidend sein mag – nach welchem Rechtskreis sein Verhalten strafrechtlich bewertet wird – mit einem hohen Maß an Polemik auch von Entscheidungsträgern in Politik und Justiz diskutiert wird. Als Ziel dieser Arbeit ergibt sich daher, zur Versachlichung der Diskussion einer aktuellen Fragestellung des Jugendstrafrechts beizutragen, indem anwendungsrelevante Erkenntnisse aus den Bezugswissenschaften – insbesondere der Psychologie, aber auch der Soziologie und Kriminologie – gesammelt und dargestellt werden und so „in aufgeladener Atmosphäre eine fachlich korrekte Anwendung des §105 JGG“ (Karle 2003, S. 299) angestrebt wird. Da die Persönlichkeit des Heranwachsenden im Mittelpunkt der Arbeit steht, nicht das Kriterium der jugendtypischen Tatmerkmale, konzentriert sich die Analyse auf § 105 (1) Nr. 1 JGG. Auch wird geprüft, inwieweit taugliche Modelle vorliegen, um die Anwendung der Beurteilungskriterien des § 105 (1) Nr.1 1 in geeigneter Weise zu operationalisieren.
Es ergeben sich daraus folgende Fragestellungen für die Arbeit:
Welche psychologischen Erkenntnisse bzw. Erkenntnisse der Bezugswissenschaften sind bei der Anwendung der Bewertungskriterien des § 105 (1) Nr. 1 JGG im Wesentlichen zu berücksichtigen?
Inwieweit dienen Modelle wie die Marburger Richtlinien der Operationalisierung der Bewertungskriterien des § 105 (1) Nr. 1 JGG aus psychologischer Sicht?
Inwieweit berücksichtigt die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zur Anwendung des § 105 (1) Nr. 1 JGG die Erkenntnisse der Psychologie?
Ausgehend von diesen Fragen wird abschließend ein Ausblick auf weitere relevante Forschungsfragen bzw. relevant erscheinende Diskussionsthemen gegeben.
Daraus resultiert folgender Aufbau der Arbeit:
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit.
Nach der Einleitung folgt ein Überblick über den Stand der Forschung zur Einstufung Heranwachsender gemäß § 105 (1) Nr. 1 JGG. Darauf folgt ein Abschnitt, der den § 105 (1) Nr. 1 JGG unter drei Gesichtspunkten darstellt:
Inhalt,
Historie,
gegenwärtige Anwendungspraxis.
Im nächsten Abschnitt werden die Bewertungskriterien des § 105 (1) Nr. 1 JGG dargestellt, gleichzeitig werden auch die relevanten Erkenntnisse der Bezugswissenschaften mit dem jeweiligen Kriterium in Bezug gesetzt. So erklärt sich auch das Titelbild dieser Arbeit: Aus Perspektive aller relevant erscheinenden Theorien wird die Heranwachsendenregelung in Augenschein genommen. Nach diesem Abschnitt ist die Grundlage geschaffen, um die in der Fachliteratur üblicherweise diskutierten Modelle der Operationalisierung der Bewertungskriterien dahingehend zu bewerten, inwieweit sie dem Stand der Psychologie bzw. der anderen Bezugswissenschaften entsprechen und damit einer fachlich fundierten Entscheidungsfindung dienlich sind. Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 06.11.86, das ebenfalls häufig als Entscheidungsgrundlage herangezogen wird, wird im Rahmen einer Darstellung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ebenso dahingehend bewertet, inwieweit es psychologischen Erkenntnissen entspricht. Das Fazit teilt sich zum einen in eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit, zum anderen in eine Diskussion bzw. Darstellung offener Forschungsfragen.
2 Stand der Forschung
„Angesichts der Komplexität des Themas erstaunt dessen geringe Beachtung in der forensischen Forschung bzw. Literatur. Die Thematik wird vorrangig von Juristen bzw. Ärzten, namentlich Kinder- und Jugendpsychiatern oder Psychiatern behandelt“ (Karle 2003, S. 274).
Das Erstaunen – negativ formuliert: Unverständnis –, das Karle äußert, lässt sich noch um zwei weitere Aspekte erweitern:
Gemäß § 38 (2) JGG haben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die für die Jugendgerichtshilfe tätig sind „[...] zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten“ zu unterstützen. Somit sollte man davon ausgehen können, dass zur Unterstützung der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe Fachliteratur zur Verfügung steht. Bislang gibt es keine Publikationen aus dem Bereich der sozialen Arbeit zu diesem Thema. Eine mögliche Erklärung ist die kritische Haltung vieler Vertreter der sozialen Arbeit in Bezug auf alles, was im weitesten Sinn als Diagnostik verstanden werden kann. Hierzu kann auch die Beurteilung nach § 105 (1) Nr. 1 JGG gezählt werden. Die Problematik psychosozialer Diagnostik wird im Rahmen dieser Arbeit an späterer Stelle diskutiert werden.
Ebenfalls erstaunlich ist der Umstand, dass die öffentliche Diskussion zum Thema Jugendkriminalität unter Ausschluss der Fachwelt stattzufinden scheint: Publikationen wie die von Heisig (2010) und Müller (2013) erzeugen lediglich Reaktionen in Fachpublikationen (vgl. Heinz 2013; Höynck 2013), eine Versachlichung der Diskussion durch das Bekanntmachen grundlegender Erkenntnisse, d. h. durch die Beteiligung ausgewiesener Experten an der öffentlichen Diskussion in den Massenmedien, blieb bisher aus.
So resümiert Karle, dass Publikationen zur strafrechtlichen Begutachtung Heranwachsender ein Schattendasein führen (vgl. Karle 2003, S. 276). Lediglich in der Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe (ZJJ) ist eine nennenswerte Zahl von Publikationen zu diesem Thema erschienen (vgl. Karle 2003, S. 276), ebenso als grundlegend zu betrachten ist die Dissertation von Pruin (Pruin 2006).
Der vergleichsweise dürftige Stand der Forschung und der geringe Beitrag der Wissenschaft zur Lösung der Anwendungsproblematik des § 105 (1) Nr. 1 werden bei der Betrachtung der Bewertungsmodelle weiter deutlich werden.
3 Der § 105 (1) JGG
3.1 Inhalt
Der § 105 JGG ist als die zentrale Vorschrift der deutschen Heranwachsendenregelung zu sehen (vgl. Pruin 2007 S. 12).
Wenn ein Heranwachsender eine Verfehlung begangen hat, die einen Straftatbestand des StGB erfüllt, muss die Entscheidung nach § 105 JGG durch den Richter getroffen werden (vgl. Pruin 2006, S. 12).
Eine Anwendung des Jugendstrafrechts ist sowohl aus täter- als auch aus tatbezogenen Gründen möglich, beide Tatbestände sind unabhängig zu prüfen (vgl. Pruin 2006, S. 13). Die Voraussetzungen werden in § 105 (1) JGG dargelegt:
1. „Die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder
2. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt.“
Nr. 2 stellt dabei die tatbezogenen Gründe für die Anwendung des Jugendstrafrechts dar, Nr. 1 die täterbezogenen Gründe, das Thema dieser Arbeit.