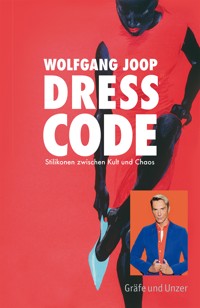9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufgewachsen auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Bornstedt bei Potsdam, verbringt Wolfgang Joop die ersten acht Lebensjahre dort. Der große Garten und der nur wenige Schritte entfernte Park Sanssoucis waren in der Vorstellung des Kindes sein Reich. Er erzählt von Familienfesten, die aus dem Ruder laufen, von seiner lebenshungrigen Mutter, seiner ersten Liebe - die Potsdamer Pfarrerstochter -, der bleiernen Zeit nach dem Umzug nach Braunschweig, die einer Vertreibung aus dem Paradies gleichkam. Wir erfahren von seiner Einsamkeit, davon, wie er im Internat mit selbstgezeichneten Pin-up-Girls erstes Geld verdiente, von seiner Zeit an der Kunsthochschule Braunschweig und den ersten Erfolgen als Designer - zu einer Zeit, als das Wort "Modedesign" noch gar nicht zum deutschen Wortschatz zählte. Dieses persönliche, fast intime Buch gibt Auskunft: Was hat Wolfgang Joop geprägt? Warum ist Heimat so wichtig für ihn? Wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? Zugleich ist es eine faszinierende deutsch-deutsche Geschichte und ein eindrückliches Porträt der 50er und 60er Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wolfgang Joop
Die einzig mögliche Zeit
Über dieses Buch
Aufgewachsen auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Bornstedt bei Potsdam, verbringt Wolfgang Joop die ersten acht Lebensjahre dort. Der große Garten und der nur wenige Schritte entfernte Park Sanssouci waren in der Vorstellung des Kindes sein Reich. Er erzählt von Familienfesten, die aus dem Ruder laufen, von seiner lebenshungrigen Mutter, seiner ersten Liebe – der Potsdamer Pfarrerstochter –, der bleiernen Zeit nach dem Umzug nach Braunschweig, die einer Vertreibung aus dem Paradies gleichkam. Wir erfahren von seiner Einsamkeit, davon, wie er im Internat mit selbstgezeichneten Pin-up-Girls erstes Geld verdiente, von seiner Zeit an der Kunsthochschule Braunschweig und den ersten Erfolgen als Designer – zu einer Zeit, als das Wort «Modedesign» noch gar nicht zum deutschen Wortschatz zählte.
Dieses persönliche, fast intime Buch gibt Auskunft: Was hat Wolfgang Joop geprägt? Warum ist Heimat so wichtig für ihn? Wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? Zugleich ist es eine faszinierende deutsch-deutsche Geschichte und ein eindrückliches Porträt der 50er und 60er Jahre.
Vita
Wolfgang Joop wurde am 18. November 1944 in Potsdam geboren. Zunächst arbeitete er als Modezeichner, Autor und freier Designer, bis er im Jahr 1978 mit einer Pelzkollektion den internationalen Durchbruch erreichte. Im Jahr 1981 gründete er sein eigenes Label JOOP! und zeigte im Folgejahr seine erste Prêt-à-porter Damenkollektion. Wolfgang Joop machte seinen Namen zum Markenzeichen: Fortan waren unter dem Label JOOP! weltweit Damen- und Herrenkollektionen, Accessoires und Parfüm erhältlich. 1985 wurde Wolfgang Joop Honorarprofessor für Modedesign an der Universität der Künste in Berlin. Im Jahr 2001 verließ er das Label JOOP! und gründete 2003 WUNDERKIND. Sein internationales Debüt hatte das Label im September 2004 auf der New Yorker Fashion Week und präsentiert seine Kollektionen seit dem Jahr 2006 in Paris und Mailand. Mit WUNDERKIND hat Wolfgang Joop bis zum Verkauf im Jahr 2017 das einzige deutsche Modehaus seiner Art geschaffen. Neben seiner Tätigkeit als Modedesigner hat Wolfgang Joop auch internationale Anerkennung als Künstler erlangt. Seine Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen wurden in zeitgenössischen musealen Einzel- und Gruppenausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Jahr 2011 wurde seine Ausstellung «Eternal Love» auf der Biennale di Venezia gezeigt. Wolfgang Joops private, unverwechselbare Kunstsammlung beinhaltet Werke verschiedenster Epochen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Familienfoto Copyright © privat
Wolfgang Joops Zeichnung der Mutter Copyright © privat
Gedicht «Ausweg» auf Seite 117 von Christa Reinig, 1960
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Edwin Lemberg
ISBN 978-3-644-00346-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Karin und Edwin, die mich zu dem werden ließen, der ich bin!
Lasse ich Erinnerungen zu, kommen die Geister von allein – ungerufen. Ich werde dann für eine Zeitlang wieder der, der ich gewesen bin. Manchmal erschrecke ich darüber, dass Sehnsüchte und Ängste nicht vergangen sind. Nur verborgen unter dem Erlebten. Aber in meinem Blick zurück muss ein Staunen zu spüren sein. Darüber, dass diese letzte Zeit meine beste ist.
Wolfgang Joop
15.05.2019, Paris,
im Anthropozän
Meine Eltern Gerhard und Charlotte Joop, ich und Tante Ulla Ebert auf der Veranda in Bornstedt
Prolog
Es ist einer dieser Nachmittage Mitte Juni, die früh beginnen und bis in die Nacht andauern. Es hat wieder nicht geregnet – wie schon seit Wochen nicht. Der Mai war wie ein großzügiges Abschiedsgeschenk der Himmelsgötter, die zeigen wollten, dass solch ein blankgeputzter, goldener Monat in meinem Leben nicht mehr vorkommen wird.
Auf dem Hof hinter dem grünen Tor hatte ich eine Galerie aus Oleandertöpfen aufstellen lassen. Linkerseits acht, rechterseits sieben. Im Treibhaus hatten sie überwintert und lange, dünne Äste gegen die Glasdecke gestreckt, als wollten sie im Potsdamer Winter durch die Fenster ins Freie fliehen. Jetzt eskortieren sie jeden, der über den gepflasterten Hof will, und berühren ihn mit ihren giftigen Blüten und den ebenso giftigen, schmalen Blättern, die wie Sardellen geformt sind.
Ich komme vom Garten, der sich weitflächig wie ein konzeptlos angelegtes Paradies erstreckt. Die Pflanzenrabatten, Wiesen, Bäume und Büsche im wenige Schritte entfernten Park Sanssouci standen in der Hitze der letzten Wochen vor Wassermangel ganz still. Unser Garten hingegen, den wir abwechselnd gießen und sprengen – den Teich auffüllen, während die Frösche von den Seerosenblättern ins olivgrüne Wasser hopsen –, erscheint mir im abnehmenden Licht dieses Tages so schweigsam, aber auch verwöhnt und satt, verglichen mit der notleidenden Natur rundherum.
Die Frau, die ich von weitem durch das Tor treten sehe, ist meine Tochter Jette. An ihrem zögernden Schritt habe ich sie eher erkannt als an ihrem Gesicht. Irgendeine Absicht für ihren Besuch kann ich spüren. Hinter ihr, in Kornblumenblau, ihr wortkarger Schatten Sasha. Er sagt gern «okay», wenn er etwas zu familiären oder geschäftlichen Konversationen beitragen will. Er ist hochgewachsen, und sein blondes Haar und der kurze Vollbart sind nicht so deutsch, wie man denken könnte.
«Weißt du, Jette, was ich auf Business of Fashion gelesen habe? Dass die Welt sich rasant ändert, nur die Mode nicht. Was man eigentlich von ihr erwarten müsste», begrüße ich meine Tochter.
«Wie soll sich etwas ändern, was sich längst selbst gekillt hat», antwortet Jette.
Und ich sage nichts mehr. Denn schnell und schlau hat meine Tochter mir gezeigt, dass sie entweder «prepared» oder «bored» ist. So war sie immer: konzentriert und abwesend zugleich, wie früher im Mathematikunterricht.
Wir gehen gemeinsam zum Wohnhaus.
«Sasha, sag es ruhig laut», erklärt Jette plötzlich, als wir in der Eingangshalle stehen.
Ich habe nichts gehört.
«Sasha, du kannst Papa die Wahrheit sagen!»
«Was denn?», frage ich.
«Dass du den gelben Engel mit dem schwarzen Totenkopf zur Hochzeit haben willst!»
Sasha erwidert nichts.
«Wie wär’s mit einer Wunschliste …?», schlage ich vor.
«Oh ja – Porzellan, wir brauchen alles», erklärt Jette. Meint aber: Sieh mal, ich werde gewollt und geheiratet und falle euch nicht mehr zur Last.
Daraufhin frage ich: «Bist du hier, um die Maklerin zu treffen?»
«Ja, sie sagt, die Preise steigen. Und ich habe auch das Penthouse mal schätzen lassen.»
Ich weiß es schon lange, dass Jette Stück für Stück von unserem Besitz verkaufen will. Nicht nur weil sie kann, sondern auch weil sie sich von uns und unserer Vergangenheit freikaufen will. In den Rabatten finde ich Disteln, die ich mit Gummihandschuhen aus den Beeten reiße. Die Tätigkeit entbindet mich langer Abschiedsworte. Jette und Sasha müssen ohnehin los.
Von links durch hohen Rittersporn und Rosenbüsche schlendert Karin auf mich zu. Ihr fast weißes Haar fliegt um ihren Kopf wie der Schatten einer Taube und flattert beim Gehen auf und ab. Die Leinen ihrer Hunde hält sie gebündelt in der Hand. Die rote Umhängetasche sitzt schräg über dem blauen Jeanskleid. Karin und ich schauen uns an. Wir tauschen aus, was uns schon längst bewusst ist, und wundern uns dennoch, wie wenig wir uns in dem, was unsere Töchter treiben, spiegeln können. Das, was die Töchter treiben … ja, da staunen die beiden alt gewordenen Kinder. Wir, die wir niemals erwachsen sein wollten, werden vom Alter nun zurechtgewiesen.
Ich betrachte Karin und mache mir klar, dass ich ähnliche Spuren im Gesicht trage, denn ich erkenne in ihrem Blick, was ich mit eigenen Augen sehe: Der Geist, der in gemeinsam vergangenen Jahren wohnt, der die Tage zu Jahren werden lässt und alles weiß, was wir nicht wissen wollen, streckt seinen Finger nach uns aus und verwischt endgültig die Linien der Jugend.
Unendlich lange gehen wir schon durch diesen Garten, der, benannt nach meiner Tante, «Ullas Garten» heißt. Wie oft hatte ich sie von «meinem Garten» sprechen hören. Die Schwestern Charlotte, Ehefrau im Westen, und Elisabeth, hier im Osten, hatten ja einen Mann, um den sie sich kümmern mussten, damit waren sie für Ulla vom Anspruch auf und Verpflichtung für ihren Garten entbunden. Ulla war «verheiratet» gewesen mit Herrn Kühn, dem Gärtner, und mit ihrem Garten. Wenn Tante Ulla «mein Garten» sagte, lag die Betonung auf «mein», und die ließ keinen Widerspruch zu. Es ist ihr Garten geblieben. In all den Jahren ließ er sich von niemandem wirklich verändern. Auch zu mir spricht dieser Flecken Erde nicht, er hat sich mir nicht erschlossen. Daran merke ich, dass ein Ort treu sein kann. Auch unsere andere Tochter Florentine betritt den Garten kaum, obwohl sie doch jetzt hier lebt. Als Jette hier wohnte, verlandete der Seerosenteich, das Unkraut übernahm die Herrschaft, und die Rosen blühten, ohne bewundert zu werden.
Ich kann die Verantwortung für diesen Garten nicht tragen. Das weiß ich. Dabei hat dieser Garten mich aufgenommen, wie ich es mir gewünscht hatte; nein – wie ich es mir nicht anders hatte vorstellen können.
Schließe ich die Augen, kommen die Bilder der Erinnerung unaufgefordert. Der alte Kuhstall mit dem schweren hölzernen Schiebetor war durch einen Gang zweigeteilt. Die Decke, ebenfalls aus Holz, hatte in der Mitte ein rundes Loch. Auf dem Dachboden lagerten Stroh und Heu. Mit einer großen Mistgabel wurde mal Heu, mal Stroh hinuntergeworfen, für die Schweine links und die Kühe rechts vom Gang.
Mit Angela oder Hilde, der Tochter der Melkerin Frau Kussin, spielte ich Verstecken. Manchmal spielten wir auch ein anderes Spiel, das wir «Verlobung» nannten. Wir hatten die Magd und den Kutscher heimlich beim Liebesspiel auf dem Strohboden beobachtet. Ab und an retteten wir ein Schwalbenküken, das aus einem der vielen Nester, die an den Wänden unter dem Dach klebten, gefallen war. Wir nahmen eine Pinzette aus Ullas Waschbeutel und fütterten das magere Baby mit Fliegen. Sie waren leicht zu fangen bei den Kühen und Schweinen. Das Vogelbaby öffnete seinen Schnabel jedes Mal so weit, dass wir tief in das Hälschen schauen konnten. Nicht eines der geretteten Küken überlebte.
Trat man aus dem düsteren Stall ins Freie, erstreckte sich vor einem der zwei Morgen große Garten. Zur Linken verlief eine lehmgelbe Backsteinmauer mit einem kleinen Tor, das auf den Bornstedter Friedhof hinausführte. Hatte man ihn durchquert, stand man plötzlich im weitläufigen Park von Schloss Sanssouci.
Unser Garten endete am Hohenzollerngraben. Er war ungefähr zweihundert Meter lang. Warum sich die Hohenzollern keinen längeren Graben leisten konnten, hatte ich Opa Paul oft gefragt, aber keine Antwort bekommen. Hinter dem Graben befand sich eine Senke, die sich nach ein paar Regengüssen in einen kleinen Naturteich verwandelte. Große Weidenbäume bildeten vereinzelte, urwaldartige Inseln, und dort, wo das Schilf stand, führte eine Straße zum Nachbardorf Bornim. Die Senke gehörte der Bornstedter Kirche, aber wir schnitten das Schilfgras, um daraus wärmende Schilfmatten flechten zu lassen. Die verhüllten dann in den Frühbeetkästen die keimende Saat und die ersten jungen Pflanzen – und brachten sie beschützt durch den Winter.
Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Boden wärmten, wurden die Matten eingerollt. Dann glitzerten die Fensterscheiben wie das Eis, das noch die Pfützen und den kleinen Teich zwischen den Weiden bedeckte.
In regelmäßigen Abständen standen die Frühbeetkästen und beanspruchten die ganze linke Seite des Gartens. Auf schmalen Wegen gelangte man zu ihnen, und zu zweit – einer oben, der andere unten – wurden die Fenster an einem Griff angehoben und vorsichtig auf die Nachbarfenster gelegt.
Die Frauen, die auf dem Hof arbeiteten, trugen dicke Turnhosen unter den Röcken, zogen zwei Jacken übereinander und knieten sich vor die Kästen auf den kalten Boden, um die zu dicht keimenden Pflanzen zu «pikieren». Das heißt, die Pflanzen, die zu dicht standen, herauszuziehen und in weiteren Abständen erneut einzupflanzen. Komischerweise sagt man «Ich bin pikiert», wenn man sich beleidigt fühlt.
Erst langsam mit den Jahren und neuen Notwendigkeiten veränderte sich der Garten zu Ullas Garten.
Meine Tante Ulla hatte sich schon früh von ihrem Vater, Opa Paul, ein kleines Stück eigenen Garten erbettelt. Erbettelt deshalb, weil Opa Paul vom Blumenanbau nichts hielt.
Ein alter Fliederbusch wurde zum Mittelpunkt von Ullas Gärtchen. Er breitete sich im Laufe der Zeit aus wie eine bunte Insel im Meer der grünen Nutzpflanzen. Bis auf ein Erdbeerbeet und zwei Reihen Tomatenpflanzen unterwarf Ulla den alten Nutzgarten ihrem Schönheitssinn und ihrer für diese Gegend typischen Liebe zu natürlich angelegten Gärten.
Neben Rosenbüschen und Rhododendren wuchsen Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Die gab es in heimischer Ausführung oder in rein dekorativer Version. Die heimischen Sorten trugen Früchte, die anderen blühten so üppig in Pink-Rosé, dass man hätte denken können, man stünde in der Kulisse von «Land des Lächelns».
In jedem Mai, den ich hier in Bornstedt verbringen darf, stimmt mich die Vergänglichkeit dieser Schönheit traurig. Ich kann nicht glauben, dass die Natur zuverlässiger ist, als der Mensch es verdient.
Aber auch eine andere Schönheit erinnere ich. Die der frühen Monate des Jahres, wenn der Garten von all den Leuten, die hier gemeinsam Seite an Seite arbeiteten, zum Leben erweckt wurde. Die Erinnerung an diesen Anblick ist unvergesslich. Das Nützliche ist nicht nur praktisch, sondern ergibt einen schönen Sinn.
Am 31. Januar 2002 starb Tante Ulla nach langer Krankheit. Kurz zuvor, ich war in Monte Carlo, telefonierten wir, und sie sagte: «Ich will nur noch einmal meinen Garten sehen.»
Ich versprach: «Du wirst nicht sterben, bevor es Frühling wird.»
Als ich zu ihr nach Potsdam reiste, ging es ihr schon sehr schlecht. Sie lag auf dem Empire-Bett aus Mahagoniholz. «Es stammt aus dem Schloss Monbijou, hat Frau Justi mir gesagt», betonte Ulla oft. Neben ihrer Gartenkunst war meine Tante vor allem stolz auf ihre Einrichtung, die aus dem Nachlass von Frau Justi stammte, die in einer verfallenen Wohnung in der Orangerie Wilhelms IV. gewohnt hatte.
Ulla deutete mir an, sie wolle nun ins Krankenhaus. Als ich sie am nächsten Tag dort besuchte, erkannte ich sie nicht mehr. Fiebrig, das Gesicht aufgedunsen, röchelte sie aus offenem Mund, dem die Ärzte die Zahnprothese entnommen hatten. Ich spürte, dass sie nicht so gesehen werden wollte, und verließ das Zimmer. Draußen fragte ich die Ärzte, ob sie sicher seien, dass Ulla keine Schmerzen habe.
Sie zuckten die Schultern. «Wir können auf Ihre Verantwortung die Morphiumdosis leicht erhöhen …»
«Ich bitte darum!», sagte ich.
Ulla starb. Und als ich am nächsten Morgen erwachte, strahlte ein Frühlingshimmel über unserer Stadt und unserem Garten. Er blieb eine Woche, und es kam mir vor, als ob der Himmel nicht wollte, dass ich mein Versprechen breche. Aber mit Tante Ulla starb ein Stück Heimat in mir – etwas, das so hieß, weil meine Tante erwartet hatte, dass ich heimkommen und den Garten beschützen würde.
ISchmalzpapier
Ote sagte immer: «Das machen nur die Leute ohne Bildung!»
Und dann tat meine Großmutter genau das, was man angeblich nicht machen durfte: Sie legte ein Kissen auf das Fensterbrett. Das Fenster vom Wohnzimmer hatte sie zuvor geöffnet. Zur Ribbeckstraße hin.
Es war die Zeit des Feierabends, kurz vor der Dämmerung. Ote wartete darauf, dass jemand den Fußweg entlangkommen würde, am Vorgarten vorbei. Um diese Uhrzeit waren es stets dieselben Leute. Und Ote fragte sie das, was sie meistens fragte, und die älteren Leute, die kurz stehen blieben, antworteten dann meist dasselbe, was sie am Abend zuvor schon geantwortet hatten.
Wir wohnten in der Ribbeckstraße 39. Benannt nach dem Herrn – wie oft hatte meine Großmutter mir das erzählt? – «von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand …».
Auf unserem Hof stand ein großer Walnussbaum. Fielen im Herbst die Nüsse herunter, steckten sie meist noch in einer dicken grünen Schale, die man entfernen musste. Die braune Nussschale fühlte sich ganz feucht an. Knackte man sie, war der Nusskern noch von einer zarten Haut umhüllt. Die musste man abziehen, weil sie ganz bitter schmeckte.
Gegenüber dem Walnussbaum ragte ein schräges Holzdach über den Hof. Kam man mit dem Pferdewagen an, musste man erst vom Kutschbock absteigen, um das große Hoftor zu öffnen. Dann wurde der Pferdewagen, wenn er entladen worden war, unter dem Holzdach abgestellt.
Im Stall links nebem dem Holzdach arbeitete Frau Kussin. Sie war Melkerin. Sommers wie winters lief sie mit nackten Füßen in Holzpantinen hin und her und stellte ihren Holzschemel mal links, mal rechts zwischen die Kühe.
Manchmal sagte sie zu mir: «Komm mal her und mach deinen Mund weit auf.»
Dann nahm sie eine Zitze und spritzte mir die warme Kuhmilch direkt in den Mund. Ich war nicht der Einzige, der in den Genuss der frischen Milch kam. Schon frühmorgens und dann den ganzen Tag über erschienen Leute mit Henkelkannen in der Hand, um sich davon etwas zu holen.
Meine Großmutter stellte in der Küche auch Butter her. In einer Blechzentrifuge wurde die Sahne von der Milch getrennt und dann in ein Fass gegossen. Mit beiden Händen auf und ab bearbeitete Ote mit einem Stuker – einer Art dickem Besenstiel mit einer zum Fass passenden gelöcherten Scheibe am Ende – die Sahne. Bevor sie zu gelber Butter wurde, war sie cremig-weiß. Meine Großmutter hörte dann kurz auf zu stuken, nahm eine Portion von der dicken Sahne heraus und strich sie auf eine Stulle. Darüber streute sie Zucker. Das war die köstlichste aller Speisen, die sie mir zu bieten hatte.
Das Haus, in dem wir damals alle wohnten, war ungefähr hundertfünfzig Jahre alt. Ein paar überdachte Stufen führten in den Flur, von dem Küche und Keller abgingen. Der Flur verlief früher vom Hof am Wohnzimmer vorbei bis hin zur Ribbeckstraße. Durch eine Doppeltür mit Glasscheiben gelangte man über ein paar Stufen in den Vorgarten. Blieb man auf der oberen Stufe stehen, konnte man die Ribbeckstraße überblicken. Man konnte auch die Passanten grüßen oder ihnen zuwinken. Diese Art Plätze an den Vorderseiten der Häuser nannte man «Neugierde». Man hatte wie im Theater einen Platz direkt an der Bühne. Von der «Neugierde» aus beobachtete man die Stücke, die das Leben schrieb, aus nächster Nähe. Vielleicht ist das unanständig, dachte ich, als Ote mir das erklärte. Wer Niveau hat, lernt erst mal zu ignorieren.
Manchmal, sehr selten, wurde ein Schwein geschlachtet. Das schreckliche Quieken, wenn das Schwein den Bolzenschlag vor die Stirn erhielt, ging mir unter die Haut. Tot lag es dann auf einer Holzbank in dem Durchgang vom Kuhstall, der den Hof mit dem Garten verband. Das Schwein wurde mit heißem Wasser übergossen, und der Metzger, der geholt worden war, zückte eine Art Metallglocke, die einen messerscharfen Rand hatte. In ausholenden Bewegungen rasierte er damit die blonden Borsten vom rosa Schweineleib. Danach wurde das tote Tier mit den Hinterfüßen auf eine Leiter gebunden. Durch einen langen Schnitt öffnete der Metzger den Bauch, und ein Gemenge an Gedärm und Organen quoll heraus.
Ich stand daneben, von dem Akt des Tötens gleichzeitig fasziniert und angeekelt.
Erst in der Waschküche, die sich unten in dem weitläufigen Kellergewölbe befand, wurden das Fleisch, das Fett, die Organe und vor allem die Därme zerteilt, gewaschen, sortiert oder als Wurstmasse mit Rosmarin, Majoran und Thymian zubereitet. Dort wurde das Schlachten zu einem Festtag: In die leeren Därme wurde die Wurstmasse gepresst, bis sie sich prall füllten. Die Enden der glitschigen blassen Würste wurden mit Holzstäben und einem Stück Schnur verschlossen. Schließlich wurden die Leber- und Blutwürste in einen großen Waschkessel geschüttet, in dem schon gewürzte Brühe kochte. Unter dem Waschkessel brannten Holzscheite und Steinkohle, und Ote oder eine Helferin rührten mit einem hölzernen, rechteckig abgeknickten Stock, «Flegel» genannt, die Brühe, stundenlang.
Wann immer wir schlachteten, fanden sich auf dem Hof Nachbarn ein und standen Schlange vor dem Kellereingang. Sie baten um Wurstbrühe. Ote aber wickelte schnell und heimlich eine frische Leber- oder Blutwurst in Zeitungspapier und drückte das Paket in die Tasche des Bittstellers.
Meine Großmutter war großzügig und ertrug es nicht, wenn jemand hungerte.
Otes Hände waren stets in einer Greifhaltung gekrümmt, auch wenn sie sie neben den Teller legte, bevor wir aßen. Besonders der rechte kleine Finger konnte sich nicht strecken. Er war einmal gebrochen, sagte Ote. Und war nicht gerade zusammengewachsen.
Wie alle älteren arbeitenden Frauen hielt sie die Unterarme mit den Ellenbogen leicht abgewinkelt vom Körper. Wohl eine Haltung, die bleibt, wenn Hände und Arme ein Leben lang zum Greifen, Umfassen und Tragen benutzt worden waren.
Wenn ich durch ihre Küche kam, griff Ote oft nach mir. Sie hatte es anscheinend auf mein in ihren Augen zu glattes, dichtes Haar abgesehen, das sonst keiner in der Familie Ebert hatte. Sie nahm mich dann mit einem Arm in den Schwitzkasten und drückte meinen Rücken an ihre Schürze. Ich war zwar erst fünf Jahre alt, hatte aber eine genaue Vorstellung davon, wie meine Frisur oder meine Kleidung auszusehen hatten. Ote allerdings auch. Den Kamm in der rechten Hand, tauchte sie ihn in eine Tasse mit Zuckerwasser und kämmte mir einen Seitenscheitel. Akkurat und stramm. Damit mir die Haare nicht wieder in die Stirn fielen, holte sie eine lange Haarklemme aus ihrer Schürzentasche und schob sie mir in das klebrige Haar.
Ich schrie «Aua!», weil ich das Kratzen auf meiner Kopfhaut spürte.
Dann nahm sie ein Schmalzpapier und wischte damit über meine Frisur. Das hätte ihre Mutter einst auch so gemacht, wenn dem Mädchen Lina Käthe die langen dunklen Zöpfe frisch geflochten waren, erklärte sie mir. Durch das Fett am Schmalzpapier fingen die Zöpfe an zu glänzen wie das Fell bei einem frisch gestriegelten Pferd.
Nach dieser Behandlung traute ich mich kaum nach draußen und schon gar nicht unter die Nachbarskinder, die mit mir in die Bornstedter Schule gehen sollten. Denn es könnte geschehen, dass mir ein Blatt oder ein Fussel auf den Kopf fallen würde und auf meinem Haar festklebte. Dennoch blieb mir diese Frisur auch am Tag meiner Einschulung nicht erspart. Ein kleines Foto von einem trotzigen Jungen mit abstehenden Ohren und glänzend gescheiteltem Haar neben einer fast gleich großen Schultüte ist der Beweis.
Ote erzählte oft von früher vor dem Krieg, zum Beispiel, dass des Öfteren junge Männer in schicker Offiziersuniform vorstellig wurden, um Liesel abzuholen – auch wenn Opa Paul mit dem Führer nix im Sinn hatte. Er war «kaisertreu», sagte er immer. Liesel oder besser Elisabeth war die älteste und hübscheste der drei Töchter von Ote und Opa Paul. Die nächste war Charlotte, die mit ihren dunklen Locken Ote ähnelte, aber «wahllos» war, wenn es um die Männer ging, wie Tante Ulla fand, die jüngste der drei Schwestern.
Wenn im Sommer die jungen Offiziere auf den Hof kamen, gab es oft Erdbeeren mit Schlagsahne. Ote erinnerte sich, dass Liesel mit jeder neuen Bekanntschaft schnell fertig war. Aber Charlotte war bereit zu übernehmen; ebenfalls nicht für lange.
Mittlerweile hatten sich die jungen Offiziere jedoch so an Erdbeeren mit Schlagsahne gewöhnt, dass sie wiederkehren wollten. Also machten sie dann Ulla den Hof. Ulla kam mehr nach den Eberts, nach Opa Paul. Die hohe Stirn, der klare türkisblaue Blick, die preußisch lange Nase und der Unterbiss. Aber alle Mankos kompensierte Ulla mit Körperhaltung und gutem Geschmack.
Nach den Nazis erschienen die Russen auf dem Hof, und danach «kam der Mob von unten nach oben», wie Ote immer sagte.
Am Ende des Kriegs hatte sich meine Großmutter mit Tantchen Golling von gegenüber im Treibhaus versteckt.
Liesel, die schließlich doch noch einen der jungen Offiziere zum Ehemann genommen und ihn im Krieg verloren hatte, blieb im Haus. Sie war die einzige Frau im Dorf, die während der letzten Kriegstage fetter geworden war, erzählte sie selbst.
«Ich habe mir jeden Mittag einen Pudding gekocht und dabei die Bombenflieger über mir gehört. Ich rührte und dachte: Was soll mir denn noch passieren? Ich habe das Wichtigste in meinem Leben verloren.»
Später wurde sie von den Russen und deren deutschen Helfern abgeholt. Man hatte sie auf dem Zwischenboden über der Toilette gefunden, geschlagen und verhört. Liesel gab zu, Obergauführerin der nationalsozialistischen Mädchenorganisation «BDM» gewesen zu sein. Nachdem sie mehrmals abgeholt und verprügelt worden war, hatte sie nichts mehr zu gestehen und schaffte die Flucht nach Hamburg. Zur Mutter ihres gefallenen Mannes.
Dort oder noch in Bornstedt traf sie irgendwann einen Jugendfreund wieder, den sie auf dem gefrorenen Bornstedter See beim Schlittschuhwalzer kennengelernt hatte. Er hatte sie sofort geliebt; sie lernte das später.
Tante Ulla und ihre Schwester Charlotte, meine Mutter, waren getrennt voneinander ebenfalls nach Hamburg geflohen. Ulla war mit Elli und mir als kleinem Baby unterwegs. Mit ihnen war noch ein Mann, der ihnen beistand, wenn die Soldaten den Weg blockierten. Elli musste für mich Mohrrüben klauen, und wenn die Tiefflieger kamen, flüchtete sie mit mir in den Straßengraben. Der Gemüsewagen, in dem sie hier in Bornstedt losgefahren waren, ist ihnen abgenommen worden … Wie hatten sie es bloß geschafft, mit mir heil nach Hamburg zu kommen?
«Ach», hatte Elli später lachend erzählt, «als wir dann am Falkensteiner Ufer an der Elbe im strahlenden Sonnenschein endlich ankamen, war alle Mühe vergessen, und Ulla und ich zogen die Bikinis an, die ich aus zwei alten Hakenkreuzflaggen mit der Hand genäht hatte.»
Auf meine Frage, wo Elli die Mohrrüben unterwegs für mich gekocht habe – wo meine Mutter gewesen war, als wir ankamen, bekam ich nie eine genaue Antwort.
Nur dass der Begleiter Hans Krämer hieß und ein «Abenteurer mit extrem schmalen Hüften» gewesen war – zu der Zeit –, erzählte Ulla ziemlich oft in schwärmerischem Ton.
IILotte Pietsch und Linas Eifersucht
Die Elsässer Weinstuben hatten nichts mit dem Elsass zu tun. Sie lagen an der Ecke unserer Ribbeckstraße – leicht abgerundet gebaut. Wein gab es auch nur selten, meist nur dann, wenn sich jemand eine Mahlzeit vorbestellt und Wein mitgebracht hatte. Opas Stammtisch stand auf Dielen direkt vor einer hohen Schrankwand mit Biergläsern auf den Regalen, deren Rückseite verspiegelt war.
Es war Samstag, fünf Uhr nachmittags, und Ote, meine Großmutter, sagte: «Wölfchen, lass uns mal um die Ecke gehen – mal sehen, was dein Opa macht.»
«Was soll er denn machen?», fragte ich. «Er ist doch jeden Samstag bei Pietsch.»
Pietsch hieß der Wirt, dem die Stuben gehörten. Wir liefen das Stück Ribbeckstraße hinunter. Mit mir an der Hand bog Ote kurz vor der Gaststätte in einen Hinterhof ein, wo es ein Fenster mit rot geklinkertem Sims gab.
«Komm, kletter hoch und erzähl mir genau, was du siehst!»
Ich zog mich am Sims hoch und schaute in den Schankraum, in dem Opa Paul mit zwei ungefähr gleichaltrigen Männern an dem großen runden Stammtisch saß. Malermeister der eine, Steinmetz der andere. Die beiden kannte ich. Alle drei Männer waren deutlich zu erkennen in dem warmen Licht, das die Kneipe nur gnädig erhellte.
«Was macht dein Opa gerade – erzähl doch.»
«Opa sitzt da, und eine Frau mit weißer Schürze und einem Buckel am Rücken stellt gerade ein großes Glas Bier an Opas Schulter vorbei auf den Tisch.»
«Lotte Pietsch, das Biest! Hab ich’s mir doch gedacht! Wegen der rennt er jeden Samstag hierhin. Ich sag dir eines, Wölfchen: Die wartet nur auf meinen Tod, dass ich abkomme!»
Plötzlich schrie Ote auf und hielt sich die linke Brust. Sie trug an diesem Tag ein schwarzes Kleid mit kleinem weißem Blumenmuster. Ihr Gesicht war rot angelaufen, und sie atmete so laut und schwer, dass ich Angst bekam.
«… Und dann will sie die Wirtschaft übernehmen und Paule heiraten!»
Ich glaubte Ote das aber nicht. Schon deshalb nicht, weil ich das mit ihr schon am letzten und am vorletzten Samstag erlebt hatte. Aber ich liebte Ote sehr. Sie hatte schönes graues Haar, das sie mit zwei Kämmen einschlug. Außerdem hatte sie die gleichen hohen Wangenknochen wie meine Mutter. Aber braune Augen, nicht grüne.
Ote erzählte mir oft Geschichten von ihrer Heimat Bergholz und von ihrer Katze, die ihr Mäuse brachte. Auch dass sie in den Jahren mitten im ersten Krieg, als ihre drei Töchter geboren wurden, so viel Geld hatte, dass sie mit ihren Helfern beim Geldzählen eingeschlafen war.
«Der ganze Esstisch war voller Scheine. Aber wert waren die nichts, denn man kriegte nischt dafür. Ein Brot – eine Million!»
Ote war immer da für mich. Auch wenn ich was ausgefressen hatte. Dann rannte ich zu ihr und stellte mich vor ihren Bauch, den Rücken fest an sie gepresst. Mit den Händen griff ich nach hinten und hielt mich an ihrem Rock fest. Dann verteidigte sie mich – auch wenn ich gar nicht im Recht war.
IIIGroßmutter und Wolf
Wir, das hieß immer: Angela, Klaus und ich. Mehr Freunde hatte ich nicht. In dem großen Haus neben unserem Hof gab es viele Kinder. Aber die waren ziemlich schmutzig und heruntergekommen. Sie sprachen auch irgendwie anders.
Einmal saßen wir am Ufer des Bornstedter Sees. Wir wollten Blutegel fischen. Das war nicht besonders schwer; sie hingen an Zweigen, die im flachen Wasser lagen. Wir zogen vorsichtig die Zweige aus dem Wasser und schüttelten die Blutegel in ein Marmeladeglas mit Schraubdeckel.
Wir hatten vor, die Blutegel zur Apotheke zu bringen. Da konnte man die Tiere waschen lassen. Ich hatte gesehen, wie unser Hausarzt Blutegel mit einem Wasserglas an Otes Beine ansetzte und wartete, bis sich die Tiere in die Krampfader oder die Thrombose gesaugt hatten. Erst wenn sie kein weiteres Blut mehr saugen konnten, fielen sie voll und dick von Otes Beinen. Ote sagte, das würde nicht weh tun – die Thrombosen schmerzten mehr.
Manchmal lag Ote im Bett, weil sie offene Beine hatte – so sagte sie. Die Stellen waren dann mit feuchten Lappen bedeckt; ihr ganzes Zimmer war erfüllt vom Geruch der Arzneien, mit denen die Lappen getränkt waren.
Meine Großmutter war öfter krank. Aber sie fand im Bett keine Ruhe. Auf dem Nachttisch neben ihr stand eine Glocke. Eine nackte Männerfigur aus Eisen, die eine Weltkugel stemmte. Auf der Kugel war ein Knopf. Wenn man ihn drehte, klingelte es schrill durchs ganze Haus. Wenn dann nicht sofort jemand bei ihr war, rief sie: «Ja, ja, ich weiß – ich soll hier verrecken. Es geht ja auch ohne mich.»
Ich kam dann mit einem Körbchen in der Hand zur Tür herein; darin lagen entweder ein paar Kirschen oder ein Stück Kuchen.
«Großmutter, sag, bist du die Ote oder der Wolf?»
«Ach, lass doch den Quatsch, Wölfi!»
«Na gut, dann bin ich der Wolf und fresse dich.»
Ote hatte hohen Blutdruck und dadurch ein wackeliges Temperament. Vor allem konnte sie alte Weiber nicht leiden. Von der Veranda aus schaute sie über den Hof.
«Da wackelt schon wieder so ’n altes Weib», sagte sie dann oft.
Einmal kam eine alte Frau ganz in Schwarz mit einem fast bodenlangen Rock auf sie zu. An einem Haken an ihrem Krückstock hing ein Beutel. Sie wollte wohl Kartoffeln in Ullas Gemüsekammer kaufen. Plötzlich schrie die alte Frau. Biene, die Mischlingsdackelhündin, hatte der Frau ins Bein gebissen. Biene hatte langes Fell, für einen Dackel zu hohe Beine und helle bernsteinfarbene Augen. Sie war nur bissig, wenn sie in Otes Nähe war.
Ote versuchte, mildtätig zu sein, und ließ jemanden die Frau auf die Veranda geleiten. Nun legte sie einen Lappen in eine Schüssel mit Wasser und dann auf die blutige Wunde am Bein der alten Frau.
Ote hielt den Lappen mit beiden Händen, beugte sich vornüber und musste sich prustend in den Korbsessel zurückfallen lassen, in dem sie gesessen hatte. Denn sie bekam einen Lachanfall. Gegen ihren Willen, gegen ihre Absicht – aber peinlich war es ihr schon. Sie konnte aber nicht anders. Es lag an ihrem Blut – dieser Druck. Verstehen konnte ich das alles nicht – aber: Wer mag schon alte Weiber? Ote war zwar nicht mehr jung, doch sie verstand sich mit mir am besten. Das lag daran, dass wir beide noch Kinder waren.
Ote ist nicht meine einzige Großmutter. Die andere heißt Joop – wie ich. Das hatte mich immer gewundert, denn alle hier im Haus hießen Ebert mit Nachnamen. Nur meine Mutter hieß noch so wie ich – aber das vergaß ich hin und wieder, weil alle entweder Lotti riefen oder Charlotte, wenn es ernst wurde.
Meine andere Großmutter hieß Oma, das ist der größte Unterschied zu Ote. Omas haben andere auch, eine Ote habe nur ich.
«Ach, da kommt die alte Joop!», sagte Ote. Wie sie das sagte, klang es irgendwie abfällig. Und auch ungerecht, denn Ote war genauso alt wie Oma. Meine Oma hieß Margarete Joop. Sie hatte ein blasses, trauriges Gesicht. Wenn sie uns, die Eberts, besuchte, sprach sie nicht viel. Ich denke, sie wusste, dass sich niemand besonders freute, sie zu sehen.
Das muss ein schreckliches Gefühl sein, überlegte ich oft, wenn man selber spürt, dass keine Freude von einem ausgeht, weil man so viel Kummer in sich trägt.
Oma Joop sprach langsam und meistens irgendwie mahnend oder besorgt, beispielsweise wenn sie sich erkundigte, ob ich auch meine Schularbeiten gemacht hatte. Ich fand, die Frage verschlimmerte Omas Situation nur umso mehr, und dachte nicht daran zu antworten.
«Ich hätte so gern jelernt», sagte Oma oft zu mir. Und das R sprach sie so seltsam breit gequetscht aus. Sie kam aus Mentschikal. Das war nicht mehr in Deutschland und lag weit weg an einem Ort, wo die Ostsee endete oder begann. Sie war mit ihrem Mann Ludwig Joop von dort in den Nachbarort Bornim gezogen, weil das Ehepaar lieber deutsch bleiben und nicht polnisch werden wollte.
In Mentschikal wurde auch mein Vater geboren, erzählte meine Mutter mir und erklärte, weshalb Oma Joop immer traurig war. Sie hatte vier Kinder gehabt. Davon lebte nur noch mein Vater. Den hatte ich aber noch gar nicht kennengelernt, und weder meine Mutter noch Oma wussten, ob er noch lebte. Angeblich war er irgendwo in Gefangenschaft.
Von Omas anderen drei Kindern war der kleine Junge an einem Wespenstich in seine Zunge gestorben, er war auf den Knien seiner Mutter erstickt. Ein Mädchen wurde, noch klein, von der Diphtherie dahingerafft. Manchmal sprach man auch von Ilse, der zweiten Tochter. Immer mit so einem geheimnisvollen Klang in der Stimme.
«Eine Tochter tut so was nicht», sagte Ote, «wenn sie ihre Mutter liebt.»
Dass Ilse sich früh das Leben genommen hatte, war nur eine von vielen schaurigen Geschichten, die man sich abends am runden Esstisch erzählte. Jedes Mal klang etwas Verbotenes in den verworrenen Geschichten über Ilse mit, als würde damit ein Tabu gebrochen.
Mal hörte ich, dass sie sich in einem Zug nach Hamburg aufgehängt haben sollte – was ich nicht glaubte. Denn ich wusste, wie voll die Züge waren, die im Bahnhof ankamen oder abfuhren. Leute saßen auf ihren Koffern in den Gängen. Dann wieder wurde geraunt, dass Ilse sich in einem Hotel in Hamburg das Leben genommen hätte. Dort sollte sie mit meiner Mutter gewesen sein.
Meine Mutter erzählte nie davon. Von ihr erfuhr ich nur, dass Ilse sehr klug und intelligent gewesen war und in Ostpreußen ein Gut geleitet hatte. Mit dem Gutsbesitzer hatte sie dann eine Affäre, obwohl der Mann verheiratet gewesen war. Von ihm hatte sie eine Tochter, verlor das Kind aber auf ihrer Flucht in den Westen. War Ilse deshalb so untröstlich und lebensmüde gewesen?
Die Geschichten flossen an meinen Ohren vorbei, ohne in mein Herz zu dringen. Noch hatte ich selbst keinen großen Schmerz oder Verlust erlitten.
«Man tut seiner Mutter das nicht an», wiederholte Ote. «Kein Wunder, dass Margarete schwermütig wurde. Sie wollte sich dann wohl auch umbringen. Aber das gelang ihr nicht, und sie kam in die Klapsmühle nach Plötzensee. Da haben sie sie nackt in eine Gummizelle gesperrt. Sogar das Nachthemd nahm man ihr weg. Sie hat nackt auf dem Boden gesessen, weil sie versucht hatte, sich mit dem Nachthemd zu erwürgen.»
Ich überlegte, wie das wohl gehen sollte. Drehte man sich eine Wurst, die man sich um den Hals legte, und machte dann vorne einen dicken Knoten? Oder musste man das Hemd in Streifen reißen und als Seil ans Fensterkreuz knoten? Das hatte ich schon mal gehört. Aber hatte Oma Joop ein Fenster in ihrer Zelle gehabt?
Eines Tages fuhr ich mit dem Rad nach Bornim zu Oma Joop. Sie wohnte in der Amtsstraße in einem Haus für vier Familien. Es wirkte wuchtig, mit rauem grauem Putz und dicken weißen Fensterrahmen.
Ich ging die Treppe hoch, und dabei fiel mir auf, dass ich hier noch nie eine Familie hatte herauskommen sehen. An Omas Tür stand auf einem Schild «Manthey».
Ich klingelte, und Oma Joop öffnete. Ihr blasses Gesicht war um die hellblauen Augen herum irgendwie gepolstert, und die ovalen Wangen wirkten zu schwer, um zu lachen. Sie wollte mich aber liebevoll umarmen. Im Gegensatz zu unserem Haus in Bornstedt merkte man sofort, dass die Einsamkeit in ihrer Wohnung Dauergast war. Wie ein Schatten, der unter der Zimmerdecke lauerte.
Ich interessierte mich für ein großes blaues Seidentuch, das wie eine Tischdecke mit weißem Stoff gedoppelt war. Auf beiden Seiten waren mit goldenen Fäden große Flaggen in bunten Farben gestickt. Umrandet war die Decke mit Kordeln in Rot-Weiß, die an den Ecken in langen Quasten endeten. Das Tuch durfte ich vom runden Tisch wegnehmen und mir über die Schultern werfen wie ein Kaiser aus China. Oma Joop gab mir einen bemalten Fächer aus einem Vitrinenschrank. Und drückte mir ein Album in die Hand, dessen schwere rot gelackte Holzdeckel mit Einlegearbeiten aus Perlmutt und Elfenbein verziert waren. Sie zeigten Chrysanthemen und Schmetterlinge.
Die Seiten des Albums waren aus Pappe, und in der Mitte waren alte Fotos von chinesischen Paaren eingelassen, entweder nur Frauen oder Mann und Frau. In alter Tracht standen sie stocksteif da und schauten den Betrachter direkt an. So mischte sich ein exotisches Glimmen, ein Hauch aus einer unbekannten Welt in die stille Traurigkeit der Wohnung.
«Alles Souvenirs aus dem Boxer-Aufstand in China», erklärte Oma Joop. «Da war dein Opa Ludwig Joop.»
«Der alte Ludwig Joop», sagte Ote, als ich ihr von dem Besuch in Bornim erzählte, «der alte Ludwig Joop, der sah aus wie ein Franzose. Mit seinen dunklen Haaren und den schönen blauen Augen. Interessant, muss man sagen. Und als ich dich das erste Mal in den Armen hielt, da sagten alle: Guckt mal, wie der Ludwig Joop!»
Ludwig Joop hatte eine Schwester, Ida. Sie wohnte genau gegenüber von Oma Joop. Die Ida – natürlich sagte ich auch Tante Ida zu ihr – sah seltsam aus. Wie eine alte Indianerin trug sie ihre dunklen Haare, durch die viele silberne Strähnen liefen, am Hinterkopf zu einem langen Zopf geflochten. Auf der Oberlippe lag ein ganz feiner Schnurrbart.
«‹Damenbart› nennt man ihn, wenn ihn Frauen tragen», sagte Ote.
Viel sprach Ida nicht, wenn man sie in ihrem Haus besuchte, das einen Turm mit kupfergrünem Zinndach hatte. Ähnlich einer Dorfkirche mit Zwiebelturm. Das Haus konnte sie sich leisten, seitdem sie aus Amerika zurückgekommen war. Mit ihrem Mann war sie vor langen Jahren dorthin ausgewandert. Der Mann war dort drüben angeblich reich geworden, weil er irgendetwas mit Eisenbahnen zu tun gehabt hatte.
Tante Ida saß meistens in ihrem aus rötlichem Holz gedrechselten Schaukelstuhl, in dem eine Art Teppichläufer lag. Sie sprach auch Englisch, aber wie gesagt, sie sprach nicht viel. Stattdessen rauchte sie eine Art Pfeife und lächelte unter ihrem Schnurrbart, wenn ich sie fragte, ob ich den Schaukelstuhl haben könnte, wenn sie mal tot wäre.
Einmal stand sie plötzlich auf, zog aus einer Schublade riesige Dollarnoten und drückte sie mir in die Hand. Ich zeigte sie Ote. Die sagte: «Tut mir leid für dich, mein Kleiner, dafür kannst du dir nix kaufen.»
IVSchau nicht hin
Mama saß mit mir im Zug. Sie trug einen flachen Hut mit runder Krempe und ein Kostüm. Mir hatte sie die kurze Lederhose angezogen, die mit den Hirschhornknöpfen und den Hosenträgern. An dem einen Träger kaute ich herum. Mama hatte mir wieder diese langen braunen Strümpfe anziehen wollen, die man unter der Hose an einem Leibchen festknöpfen musste, aber ich hatte mich geweigert. Also trug ich nur Söckchen in meinen Schnürstiefeln aus glattem Leder.
Ich war jetzt fünf Jahre alt, und Mama sagte, dass es so nicht weitergehen konnte. Den ganzen Winter über hatte ich mit Bronchitis im Bett gelegen. Deshalb fuhren wir jetzt in die Berge zur Erholung. Die Berge nannte man Erzgebirge. Mama erklärte, dass man dort Eisen aus der Erde holte. Erz hieß auch Eisen. Und Eisenerz klang wie Eis am Herz. An der Haltestelle Oberbärenburg stiegen wir aus.
«Weißt du, Wölfchen, du wirst da eine Weile in einem Erholungsheim sein, damit deine Lunge kräftiger wird.»
Das Erholungsheim war ein großes Gebäude mit vielen kleinen Fenstern und einem Dach, das weit über die Hauswände reichte. Eine nette große Frau empfing uns. Fragte mich direkt nach meinem Namen. Und um mir ins Gesicht zu schauen, setzte sie sich auf einen Stuhl.
«Du bist hier der Kleinste. Also werde ich auf dich besonders achtgeben!»
«Ich muss leider wieder los, es geht nur ein Zug! Sei brav, ich hole dich bald wieder ab.» Mama gab mir einen Kuss und ging. Ich wollte hinterherlaufen, aber die Heimleiterin hielt mich fest.
«Mama hat nicht gesagt …», schluchzte ich. «Ich, wir wollen doch zusammen …»
«Nein, deine Mutter kann nicht bleiben, sie hat zu Hause viel zu tun. Ich passe jetzt auf dich auf. Die anderen Kinder im Heim haben ihre Eltern auch nicht hier. Viele haben gar keine Eltern mehr. Und du hast doch eine Mutter, die auf dich wartet.»
Das alles wollte ich nicht hören, ich wusste, dass ich in eine Falle gelockt worden war. Noch nie war ich alleine gewesen. Irgendwo unter fremden Leuten. Ich glaubte auch nicht, dass Mama etwas Wichtiges zu tun hatte. So wichtig war nie etwas gewesen. Mir rollten die Tränen über die Wangen. Ich weinte jetzt laut. Die große Frau nahm mich fest in ihre Arme. Ich schrie, so laut ich konnte. Sie sagte immerzu etwas, das ich überhörte. Denn was sollte ich antworten – ich wollte nicht alleine bleiben! Ich schrie und heulte gleichzeitig, bis mir die große Frau die Hand auf den Mund legte und flüsterte:
«Das kannst du nicht machen, Wölfchen. Alle Kinder hier sind traurig. Manche haben gar kein Zuhause mehr. Wissen nicht, wo ihre Geschwister sind. Ich hab dir gesagt …»
«Ist schon gut», antwortete ich plötzlich. Mir war klar, dass man mich eingefangen hatte wie einen entlaufenen Hund. «Ich will die Kinder nicht traurig machen. Ich muss nur noch einmal schreien, dann mache ich das nie wieder.»
Die Heimleiterin ließ mich los. Ich stellte mich fest mit den Füßen auf den Boden. Aus meiner schwachen Lunge holte ich einen Schrei heraus, über den ich mich selber wunderte. Wo er wohl vorher gesteckt haben mochte? Dann nahm die Heimleiterin mich und den kleinen Koffer bei der Hand und zeigte mir den Schlafsaal und mein Bett.
Kurz darauf gab es Abendbrot. An langen Holztischen saßen sich Jungs gegenüber. Sie sahen sehr unterschiedlich aus. Manche waren schon viel älter als ich und auch viel größer. Von Tellern, die in der Mitte des Tisches standen, konnte man sich entweder eine Schmalzstulle oder eine Scheibe Brot mit Harzer Käse nehmen. Der Harzer Käse war in der Mitte noch ganz weiß und krümelig und schmeckte bitter. Ich griff nach einer Schmalzstulle, und der große Junge mir gegenüber mit den abstehenden Ohren sagte: «Das ist meine. Wie kommst du dazu, die anzufassen?»
Ich antwortete nicht. Auch nicht als ein anderer mit rotem Gesicht meinte: «Du hast mir die Zunge rausgestreckt! Du kriegst gleich eine Ohrfeige!»
Ich schüttelte den Kopf. Denn an meinen Vorsatz, nichts zu sagen, würde ich mich halten. Die ganze Zeit, die ich hier sein musste. Nach dem Abendbrot brachte man mich in einen Waschsaal. Kupferfarbene kleine Badewannen standen nebeneinander in dem großen Raum. Aber nicht genug für alle Jungs. Deshalb wurden wir aufgeteilt. Unsere Kleidung mussten wir in schmalen Fächern im Vorraum ablegen. Nun waren wir alle nackt. Ich mochte nicht betrachtet werden und schaute mich auch nicht um. Dann mussten wir zu zweit in die Wannen. Das Wasser war lauwarm, und der Junge, der mit mir die Wanne teilte, war ungefähr so groß wie ich. Plötzlich erstarrte ich vor Schreck. Mit dem Fuß hatte er mein Geschlecht berührt. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Die Atemgeräusche der anderen Kinder hielten mich wach. Manche atmeten laut und stöhnten beinahe, bei anderen pfiffen die Bronchien, so wie ich es von meinen eigenen kannte. Die Geräusche versetzten mich in Angst, und mir war fast, als müsste ich ersticken.
Zum Frühstück saßen wir wieder an den langen Tischen, und ein Heimleiter schritt dazwischen auf und ab. Man durfte sich anstellen mit einem Suppenteller in der Hand. Es gab einen dicken Klacks Haferbrei. Mit Zucker bestreut und Magermilch begossen. Das schmeckte gut, aber ich musste beim Essen aufpassen, denn viele kleingeschnittene Strohhalme steckten in dem Brei. Ich stellte mich aber gleich wieder an. Für eine zweite Portion.
Das machte ich jetzt, egal, was auf dem Speiseplan stand, jeden Tag. Einmal allerdings übertrieb ich es. Es gab in Milch gekochte Nudeln mit Rhabarberkompott. Das war bisher mein Lieblingsessen gewesen. Ich schaffte sechs Teller. Ich weiß nicht genau, warum, aber kurz darauf hörte ich auf zu atmen. Vielleicht hatte der übervolle Magen die Lunge zusammengedrückt. Ich rührte mich jedenfalls nicht mehr, und mein Gesicht musste eine seltsame Farbe angenommen haben, denn plötzlich riss mich der Heimleiter vom Stuhl hoch und trug mich in den Schlafsaal, wo er mich ausgestreckt hinlegte und mit beiden Händen auf meiner Brust rumdrückte.
Irgendwie fühlte sich das ganze Theater an wie ein Triumph, und ich hatte wieder einmal etwas gelernt: Wer nichts zu bieten hat, wer der Kleinste ist, kann seine Schwäche in Stärke umwandeln, indem er das, was für andere natürlich ist, künstlerisch verändert.
Da ich schwieg, wurde ich dauernd angesprochen. Der enorme Appetit auf Speisen, die die anderen Kinder nur mit Widerwillen zu sich nahmen, machte Eindruck. Vor allem, weil mein kleiner Körper gar nicht so viel verdauen konnte. Ich blieb schweigsam, während ich immer dicker wurde. Die Wanderungen durch die Salinen änderten nichts daran. In diesen unterirdischen Höhlen tropfte Salzwasser durch Reisigzweige, mit denen die Höhlen der Stollen ausgekleidet waren. Wir sollten laut singen, damit die Salzluft in unsere schwachen Lungen dringen konnte. Auch Wanderungen durch die Natur sollten uns kräftigen.
Eines Tages nahm mich die Heimleiterin an die Hand, und zusammen führten wir die Wandergruppe an. Sie bestand aus jeweils zwei nebeneinandergehenden Jungen. Wir waren wieder einmal auf dem Weg, an dessen Ende eine Burgruine lag. Es gab viele davon im Erzgebirge. Die Heimleiterin erzählte uns, laut, damit es auch die Letzten in der Gruppe hören konnten, was im Mittelalter geschehen war, als diese Ruine noch keine Ruine war, sondern eine Burg, die gerade gebaut wurde:
«Ja, Kinder, um böse Geister oder Feinde abzuwehren – oder um den Gott, den sie fürchteten, milde zu stimmen –, wurde das hübscheste Kind des Dorfes ausgesucht und als Opfer mit eingemauert. Alle aus dem Dorf kamen zusammen, um dabei zu sein, wenn das Kind geopfert wurde. Hier in dieser Burg war es ein kleines Mädchen. Vor ein paar hundert Jahren – also, es ist schon länger her – stand es da hinter der Grundmauer der Burg. Der Maurer legte eine Reihe Steine aufeinander, und das Mädchen rief seine Mutter: ‹Mutter, siehst-du-mich-ich-sehe-dich!› Der Maurer legte die nächste Reihe Steine, und das Mädchen rief erneut nach seiner Mama. Die nächste Reihe Steine folgte und dann wieder eine. Jetzt sahen die Dorfbewohner nur noch ihr Gesicht. Die Mutter weinte, aber getan werden musste, was das Dorf beschlossen hatte!»
Die Heimleiterin erzählte die Geschichte in einem klaren Ton, keiner unterbrach sie. Sie schritt auf und ab, während sie sprach. Ich stand ganz vorn, als sie sagte:
«So, und nun rief das Mädchen: ‹Mama, ich kann dich noch gerade sehen, gleich nicht mehr!› Da legte der Maurer wieder eine Reihe Steine auf die Mauer, und das Mädchen war nur noch leise zu hören, als es rief: ‹Jetzt seh ich dich nimmermehr!›»
Die Geschichte war zu Ende, und wir kehrten um. Auch meine Zeit im Heim war um. Vier oder fünf Wochen waren vergangen. Als sie mir meine Reisesachen wieder anzogen, passte mir nichts mehr. Ich war unheimlich dick geworden. Die Klappe der Lederhose mit den Hosenträgern konnte nicht mehr an den beiden Hirschhornknöpfen befestigt werden. Die innere Lasche, mit der die Hose zusammengehalten wurde, schnürte die Heimleiterin notdürftig mit einer Paketschnur zusammen, die Klappe darüber hing allerdings herunter.
Die Heimleiterin setzte mich in den Zug. Sie konnte mich natürlich nicht begleiten.
«Stell dich ans Fenster und schau auf die Gleise. Irgendwann wirst du plötzlich das Schild Potsdam sehen, dann winkst du aus dem Fenster, damit deine Mutti dich sieht. Sie wartet auf dem Bahnsteig auf dich.»
Zum Abschied wurden uns allen die Haare geschnitten. Mir stand die neue Frisur mit den hoch geschnittenen Seiten gar nicht. Meine Ohren waren viel zu groß und meine Backen zu dick. Ich heulte, als ich in den Spiegel schaute.
Der Zug lief ein. Während der Fahrt blieb ich im Gang stehen, weil die Landschaft so schön an den Fensterscheiben vorbeiflog. Ich streckte auch gern den Kopf aus dem Fenster, es machte Spaß, wenn man fühlen konnte, wie der Gegenwind einem das Fleisch vom Gesicht zog.
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, sah ich von weitem meine Mutter. Sie trug eine Art Jagdkostüm mit Eichenblättern am Kragen, auf denen ein Hirschhornknopf wie ein Käfer saß. Dazu einen Hut mit kleiner Feder hinter dem Hutband. Ich winkte. Sie bemerkte mich nicht. Immer, wenn ich dachte, ich sei nah genug, um Kontakt zu ihr zu bekommen, drehte sie sich um – und lief in die andere Richtung. Ich stieg aus dem Zug und blieb vorsichtshalber stehen. Mama kam in meine Richtung zurück. Sie wirkte nervös. Ihr Kopf schwenkte von rechts nach links, von links nach rechts. Ich beobachtete sie. Sie steuerte jetzt auf mich zu, schaute mir kurz ins Gesicht und ging weiter.
«Mama», rief ich schließlich. Sie kehrte um, und ihre Gesichtszüge entspannten sich.
«Mein Gott, Wölfchen, ich habe dich nicht erkannt! Wie siehst du denn aus? Sind deine Beinchen so dick geworden, dass du jetzt keine Schnürsenkel für deine Stiefelchen hast? Und die Hose, die nicht zugeht?»
«Ich habe aus Traurigkeit gegessen, Mama!»
Sie hockte sich hin.
«Weißt du, ich bin ja noch lange in deiner Nähe geblieben. Ich hatte mich verborgen – ich wollte wissen, wie du dich alleine machst. Aber du solltest mich nicht finden, damit du dich an den Abschied gewöhnen konntest.»
Ich glaubte ihr nicht, dass sie sich in Oberbärenburg versteckt gehalten hatte. Sie war immer in Eile und hatte etwas anderes vor, als sie vorgab. Das wusste ich schon. Ote sagte oft einen Spruch zu mir: «Wenn ein Kind die Hand gegen seine Mutter erhebt, wächst dem Kind die Hand aus dem Grab. Dann muss die Mutter mit einem frisch geschnittenen Stock auf den Friedhof gehen und so lange auf dies Händchen schlagen, bis es sich ins Grab zurückzieht!»
Ich musste an das Mädchen in der Burgmauer denken und auch daran, dass Kinder vor dem Erwachsenwerden sterben, obwohl sie doch noch nicht so viel falsch gemacht haben können wie die Erwachsenen.
VLieber Gott, mach mich fromm
An meinen Vater dachte ich in diesen ersten Lebensjahren nicht oft, denn ich kannte ihn nicht. Meine Mutter hatte mir ein Bild von ihm gezeigt. Ein kleines schwarzweißes Foto mit einem blonden Mann im Profil. Der Kragen einer Uniform war zu sehen. Es fühlte sich schön an, irgendwo einen Vater zu wissen, der nur darauf wartete, gut zu mir sein zu können. Jeden Abend musste ich im Bett die Hände falten und beten: «Lieber Gott, mach mich fromm und lass Vater wiederkomm’!»
Das plapperte ich gleichzeitig mit Charlotte. Ich hatte das geübt und bekam einen Kuss dafür.
Aber viel hatte man mir von ihm nicht erzählt. Opa Paul, das hatte ich längst gemerkt, beurteilte Männer nur nach ihrer Einsatzfähigkeit im Krieg oder in der Landwirtschaft.
Und Charlotte? Vermisste sie meinen Vater Gerhard wirklich? Oder konnte sie sich nach sieben Jahren Abwesenheit nicht mehr so richtig an ihn erinnern?
«Ach, der Joop …», sagte Opa öfter beiläufig, «der kleene Schreiberling. So eener ist doch im wahren Leben zu nix zu jebrauchen. Wer immer nur einen Stift hält, kann nicht feste zupacken.»
Ich fand schon, dass Charlotte darauf hätte antworten sollen. Aber vielleicht tat sie es ja, eben nur nicht vor großem Publikum. Sie kicherte auch immer nur verlegen, wenn plötzlich der «olle Major Buchholz» zu Besuch in die Küche kam. Provozierend und mit lauter, blecherner Stimme fragte er: «Na, Lottchen, haste Post bekommen, oder haste ihn schon abjeschrieben?»
Charlotte wandte dann verärgert ihr Gesicht ab, blieb aber stumm.
Der olle Buchholz war hochgewachsen. Vielleicht wirkte sein kahler Kopf so weit oben deshalb so klein – im Verhältnis zum Rest des Körpers. Sein Gesicht war voller Schmisse, also Narben, die die Degen seiner Gegner beim Fechten in der Burschenschaft geschlagen hatte. Eine davon lief direkt senkrecht über die Stirn und teilte Augenbraue und den oberen Teil der geröteten Wange. Es folgte eine kurze Unterbrechung, dann war die Oberlippe getroffen. Beim Sprechen verzog sich die Vernarbung und legte einen Goldzahn frei. Darüber zuckte ein schmales Oberlippenbärtchen.
Major Buchholz war ein Kriegskamerad von Opa Paul gewesen und hatte mit hellblauen Augen den herrischen Blick des letzten deutschen Kaisers geübt, an dessen Wiederkehr er angeblich glaubte.
Er trug eine grüne Jagdjacke, dazu immer ebenfalls grüne Reithosen, deren Waden mit passenden Bandagen gewickelt waren.
Opa Paul schaute zu ihm auf, so als wäre der olle Buchholz sein Held gewesen, als man noch Helden brauchte. Dabei war der Ton des Majors frech und anmaßend. Ote machte sich sofort von dannen, wenn er unangemeldet durch ihre Küche schritt und im Wohnzimmer schon vormittags verlangte, mit Opa Paul einen Cognac zu trinken.
«Lottchen», rief der Major meine Mutter, «Lottchen, hast verjessen, was du mir jesagt hast, als ich dich fragte: Warum haste denn nun doch den kleenen Joop jeheiratet? – Da haste jeantwortet: Ach, lieber ein Spatz in der Hand als ein Bussard auf’m Dach!»
Charlotte lächelte genervt und doch charmiert, als der olle Buchholz hinzufügte: «Mit dem Bussard haste wohl mich jemeint. Ich wär dir vom Dach ins Bettchen jeflogen – hättest mal dein Fenster uffjelassen.»
Was die Erwachsenen im Gespräch vor Kindern fallenlassen, zeigt, wie sehr sie Kinderohren unterschätzen. Kinder machen sich einen eigenen Reim aus den Wortgebilden der Erwachsenen. An den Bildern, die ich durch Erzähltes oder Erlauschtes in meinem Herzen trug, konnte sich mittlerweile nicht mehr viel ändern. Wie oft hatte ich zum Beispiel gehört, dass mein Vater sieben Jahre auf Charlottes Jawort gewartet hatte. Obwohl sie ihm in der Wartezeit mehrmals zu verstehen gegeben hatte, dass seine Vorstellung von Zukunft so gar nichts zu tun hätte mit ihrer.
Während dieser sieben Jahre hatte Charlotte in Bredstedt in Schleswig-Holstein an einer Art Schulung für Töchter aus dem «Reichsnährstand» teilgenommen. Töchter und Söhne aus dem «Reichsnährstand» waren Bauerntöchter und -söhne gewesen. Lotti gefiel es dort. Und die Kursleiterin besuchte Charlotte auch noch sehr viel später nach dem Krieg. In der Sprache der Landwirtschaft würde man die Frau «Typ schwere Kaltblüterin» nennen. Sie hatte durchaus Ähnlichkeit mit einem Ackergaul.
In Bredstedt saßen die deutschen Mädels an Webstühlen, sangen, turnten und lernten, «groß zu planen und zu denken». Meine Mutter erzählte mir oft, dass sie in dieser Zeit ein Bild von sich entworfen hatte, das ihr sehr zusagte: hoch zu Ross über die Felder reitend, vom Rücken des Pferdes aus Landarbeitern Befehle zurufend – und abends dann am Kaminfeuer sitzend; in der einen Hand einen Cognacschwenker haltend, mit der anderen den Jagdhund kraulend.
Mit dem Bild, das sie für sich in dieser Zeit entworfen hatte, war die Geduld inklusiv gewesen, lange auf den passenden Mann zu warten. Diese Zeit war wohl zu schön, um sich zu schnell zu binden. Charlotte hatte in ihr ein wenig von ihrer Sensibilität für Mengen- und Größenverhältnisse eingebüßt – das gab sie später, viel später, noch zu, wenn sie, lange nach unserer Ausreise aus der DDR, in Braunschweig für uns drei Personen vier Rotkohlköpfe kaufte und kochte oder mit einem Armvoll grüner Petersilie nach Hause kam, um dort festzustellen, dass sie für das Gericht nur einen Stiel Petersilie brauchte.
Diese oft zitierten sieben Wartejahre, die Charlotte meinem Vater Gerhard angetan hatte, waren noch nicht vorüber, da rächte sich Gerhard, indem er seiner Auserwählten einen Streich spielte. Er kannte sie immerhin gut genug, um zu wissen, dass der böse Scherz klappen würde:
Zur Abschlussfeier ihres Hauswirtschaftskurses, der Ausbildung zu einer Frau, die mindestens einen Großgrundbesitzer im Osten des Reiches heiraten würde, war Lotti die Aufgabe zugefallen, eine Rede zu halten. Sie konnte nicht nein sagen, obwohl sie wusste, dass ihr fürs Redenhalten die Konzentration fehlte. Sie bat Gerhard, ihr eine Rede zu schreiben, die sie ablesen wollte.
Gerhard war ihr zu Hilfe geeilt – was Charlotte nicht weiter erstaunte. Er nahm sich einen oder zwei Tage frei von der Redaktion in Posen, um Lotti die Rede zu schreiben. Die trat in selbstgewebter bunter Wollweste mit weißer Kurzarmbluse vor das Rednerpult. Von der Tribüne herunter grüßte sie die Eltern und Geschwister, die gekommen waren. Dann breitete Lotti den Zettel aus und las:
«Mädchen vom Reichsnährstand! Uns verbindet gar ein festes Band. Aber hier lernten wir auch, uns zu entfalten und für den Führer unsere Furche zu halten!»
Der Text ging noch weiter, aber Charlotte wurde von schallendem Gelächter unterbrochen. Gerhard hatte gewusst, dass sie die Rede zuvor nicht sorgfältig lesen würde. Sie machte eben immer alles aus der Lamäng!
Eines Abends sagte Charlotte plötzlich: «Gleich ist er da!» Sie wirkte genauso überrascht wie ich. Auch seltsam gehetzt, fand ich, als sie mir die Haare bürstete, Hemd und Pullover überzog und mir befahl, schnell noch ein kleines Bild zu malen. Das tat ich auch, dann sollte ich mich auf einen Stuhl setzen, mit Blick zur Tür.
Als sie sich endlich öffnete, erschrak ich.
Ein kahlgeschorener Mann mit blassen, eingefallenen Wangen starrte mich an. Die Augen dunkel – nicht dunkelblau, nur dunkel und glühend wie ein Hungernder. Es war der Blick eines Fremden, der einen großen Schritt auf mich zu machte und plötzlich innehielt. Die Zeichnung, die ich ihm mit ausgestreckten Armen reichte, beachtete er nicht. Er sagte nur den einen Satz zu mir: «Gibst du gern ab?»
Ich weiß nicht, ob ich antwortete. Die Frage indes verstand ich sofort: Teilst du deine Mutter mit mir?
Ich bin auf dem Stuhl sitzen geblieben. Genau unter der Deckenlampe. Mein Vater und meine Mutter verschwanden nebenan und schlossen die Tür. In dem anderen Zimmer befand sich das große Sofa, auf dem Charlotte schlief. Der Mann war wohl nicht zum Schlafen nach Hause gekommen, denn ich hörte laute Schreie und verzweifeltes Schluchzen.
Am nächsten Morgen lief ich gleich nach dem Aufwachen in den Garten hinaus und kletterte auf einen der drei Weidenbäume. Sie standen am Ende des Gartens, dort, wo er tief und sumpfig wurde. Das tat ich oft; der Stamm war schräg gewachsen und das Raufklettern leicht. In einer Astgabelung war mein Platz. Von dort hatte ich einen guten Überblick. Der große Stall, in dem rechts acht Kühe und links sechs Schweine wohnten, aber auch Ullas Gemüsekammer untergebracht war, versperrte den Blick zum Wohnhaus.
Jetzt sah ich meinen Vater vor dem Stall am Eingang des Gartens stehen. Er suchte nach mir, fand mich aber nicht.
Er rief meinen Namen. Einmal laut, dann noch mal lauter. Dann kamen drohende Worte hinzu. Ich regte mich nicht. Auf einmal warnte mich etwas in seiner Stimme, und mir wurde klar, dass ich irgendwann doch von der Weide runtermusste. Ich lief ihm langsam entgegen. Die Frühbeete mit den Glasfenstern lagen noch zwischen uns. Mein Vater schritt mir entgegen und griff nach meinem Handgelenk. Mit schnellen Schritten zog er mich auf das Wohnhaus zu.
In dem Zimmer, in dem ich mit Charlotte wohnte, stand an der Wand ein Klavier. Zu dem Klavier gehörte ein mit rotem Samt bezogener Klavierhocker. Über den musste ich mich beugen. Mein Vater hatte sich eine Gardinenstange zurechtgelegt – mit der prügelte er auf mich ein. Hart und lange. Ich erinnere die Worte nicht, die er dabei von sich gab – nur dass er plötzlich aufhörte zu schlagen, weil die Gardinenstange zerbrach.
Dann standen wir beide uns gegenüber, und er fragte: «Soll ich wieder gehen?»
«Ja», sagte ich.
Hatte er diese einzig mögliche Antwort nicht erwartet? Mein Vater fiel auf die Knie, schlug die Hände vors Gesicht, und ich musste ertragen, ihn schluchzen zu sehen.