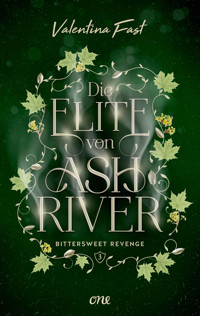
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elite von Ashriver
- Sprache: Deutsch
Der krönende Abschluss der Dark-Academia-Reihe. Ein echter Pageturner!
Leah schwört Rache. Nach dem Tod ihrer Mutter ranken sich böse Gerüchte um sie, denen sie endlich ein Ende setzen will. Doch nicht nur das: Jemand in Ashriver hat es auf sie abgesehen und hängt ihr ein Verbrechen an, dass sie nicht begangen hat. Mithilfe ihrer Fähigkeiten als Leserin schleust sie sich in die Elite der Akademie ein, um den Schuldigen zu überführen. Dabei kommt sie dem Womanizer und Elementar Vincent gefährlich nahe. Nichts hätte Leah auf die Anziehung vorbereiten können, die zwischen den beiden entflammt. Je stärker ihre Gefühle für ihn werden, desto tiefer landet sie in dem Geflecht aus Intrigen und Geheimnissen, dass die Elite umgibt. Wird sie ihren Racheplan durchziehen?
Hidden Identity & He falls first: Eine Romantasy von Erfolgsautorin Valentina Fast, die süchtig macht
Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Über das Buch
Trigger
Prolog
1. Kapitel
Leah
2. Kapitel
Leah
3. Kapitel
Leah
4. Kapitel
Leah
5. Kapitel
Leah
6. Kapitel
Leah
7. Kapitel
Vincent
8. Kapitel
Leah
9. Kapitel
Vincent
10. Kapitel
Leah
11. Kapitel
Vincent
12. Kapitel
Leah
13. Kapitel
Vincent
14.Kapitel
Leah
15. Kapitel
Vincent
16. Kapitel
Leah
17. Kapitel
Vincent
18. Kapitel
Leah
19. Kapitel
Vincent
20. Kapitel
Leah
21. Kapitel
Vincent
22. Kapitel
Leah
23. Kapitel
Vincent
24. Kapitel
Leah
25. Kapitel
Leah
26. Kapitel
Vincent
27. Kapitel
Leah
28. Kapitel
Vincent
29. Kapitel
Leah
30. Kapitel
Vincent
31. Kapitel
Leah
32. Kapitel
Vincent
33. Kapitel
Leah
34. Kapitel
Ezra
35. Kapitel
Asher
36. Kapitel
Riley
37. Kapitel
Jade
38. Kapitel
Vincent
39. Kapitel
Leah
40. Kapitel
Vincent
41. Kapitel
Leah
42. Kapitel
Vincent
43. Kapitel
Leah
44. Kapitel
Vincent
45. Kapitel
Leah
46. Kapitel
Vincent
47. Kapitel
Ezra
48. Kapitel
Jade
49. Kapitel
Asher
50. Kapitel
Leah
51. Kapitel
Vincent
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin:
Über Valentina Fast
Impressum
Inhaltsinformation
Über das Buch
Der krönende Abschluss der Dark-Academia-Reihe. Ein echter Pageturner!
Leah schwört Rache. Nach dem Tod ihrer Mutter ranken sich böse Gerüchte um sie, denen sie endlich ein Ende setzen will. Doch nicht nur das: Jemand in Ashriver hat es auf sie abgesehen und hängt ihr ein Verbrechen an, dass sie nicht begangen hat. Mithilfe ihrer Fähigkeiten als Leserin schleust sie sich in die Elite der Akademie ein, um den Schuldigen zu überführen. Dabei kommt sie dem Womanizer und Elementar Vincent gefährlich nahe. Nichts hätte Leah auf die Anziehung vorbereiten können, die zwischen den beiden entflammt. Je stärker ihre Gefühle für ihn werden, desto tiefer landet sie in dem Geflecht aus Intrigen und Geheimnissen, dass die Elite umgibt. Wird sie ihren Racheplan durchziehen?
Hidden Identity & He falls first: Eine Romantasy von Erfolgsautorin Valentina Fast, die süchtig macht – Erstauflage exklusiv mit Farbschnitt & Charakterkarte (nur solange der Vorrat reicht)
Liebe Lesenden,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr genauere Angaben am Ende des Buchs.
ACHTUNG: Sie enthalten Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmöglicheLeseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Prolog
Schweiß steht auf Louise Gerards Stirn, während sie mit einem frustrierten Seufzen den Drucker anstarrt, der auch nach dem vierten Versuch nur die Hälfte ihres Dokuments ausspuckt. Genervt schiebt sie den unbrauchbaren Papierstapel in den Aktenvernichter zu ihren Füßen und eilt durch den Flur zurück in ihr Büro am Ende des Gangs. Das Licht über ihr flackert. Es riecht nach verbranntem Toast, den jemand in der Büroküche zurückgelassen hat, wie sie naserümpfend feststellt, während sie einen Blick auf das Thermometer wirft. Es sind noch immer dreißig Grad, obwohl es bereits nach sieben Uhr ist. Am liebsten würde sie das Fenster aufreißen, doch dann würde sie nur mehr von der schwülen Luft reinlassen, die seit einigen Tagen über Phoenix hängt. Und laut Meteorologen ist vorerst keine Besserung in Sicht.
Louise schnappt sich ihren selbstgebastelten Fächer, um sich Luft zuzufächeln, während sie die Druckeinstellungen des Dokuments überprüft. Als sie den Fehler findet, stößt sie den Vorgang erneut an und eilt zum Drucker im Flur, der ein leises Piepen von sich gibt.
Mit dem Fächer in der einen und der Unterschriftenmappe in der anderen Hand läuft sie an den mittlerweile leeren Büros vorbei. Sie ist die Letzte, weil ihr neuer Chef vor dem Wochenende einige Korrekturen von ihr gefordert hat.
Sobald das erledigt ist, kann sie endlich nach Hause fahren. Ihr Mann Alexander wartet dort bereits auf sie, in einer Wohnung, in der das zentrale Klimasystem nicht ausgefallen ist. Er hat bereits einen frischen Thunfischsalat und einen eiskalten Mocktail vorbereitet.
Der ursprüngliche Plan war, heute Überstunden abzubauen. Doch stattdessen muss sie nun für ihren Chef einen ganzen Stapel Gesetzestexte anpassen.
Louise beißt sich auf die Unterlippe, sieht zu, wie ein Blatt nach dem anderen ausgespuckt wird, und das ungute Gefühl kommt zurück. All diese Verträge greifen grundlegend in die Struktur ihres Hauses ein. Sobald die nötigen Unterschriften gesetzt sind, wird es möglich sein, alle bisher geltenden Regeln zu umgehen.
Doch das ist unvorstellbar.
Lächerlich, es überhaupt erst zu probieren.
Die Berater werden die Dokumente in der Luft zerreißen.
Alexander hat Recht. Sie sollte kündigen. Mit dem bald einsetzenden Mutterschutz und der darauffolgenden Elternzeit würde sie wenigstens für eine Weile hier rauskommen. Dann kann sie sich überlegen, was sie als Nächstes tun soll. Allein der Gedanke daran reicht, um ihre Laune zu heben. Sie summt leise vor sich hin, tackert fein säuberlich die Gesetzestexte und schiebt sie dann in sechsfacher Ausführung in die Mappe. Ihr Sommerkleid schwingt um ihre Knie, als sie kurz darauf in den Flur zum Büro ihres Chefs läuft. Anthrazitfarbener Teppichboden dämpft ihre Schritte. Von den dunklen Holzwänden starren Dutzende unterschiedliche Porträts auf sie nieder. Schweiß rinnt Louises Nacken hinunter, und die Luft fühlt sich in diesem Teil des Gebäudes stickiger an.
Sie läuft an leeren Schreibtischen vorbei, an denen schon lange niemand mehr sitzt. Seit dem Wechsel in der Chefetage, ist die eh schon angespannte Stimmung noch zusätzlich angeheizt. Dass dieses Haus langsam zerfällt, ist jedem bewusst, und es war nur eine Frage der Zeit, bis sich etwas ändern würde.
Doch die neue Führungsebene verschlimmert alles nur. Täglich gibt es Neuigkeiten über weitere Kündigungen. Langjährige Mitarbeiter werden ausgetauscht und durch unerfahrenere ersetzt. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, und Fehler werden nicht geduldet.
Als Louise das Büro ihres Chefs erreicht, ist es leer. Oh nein. Sie ist zu spät.
Sofort schießt Gänsehaut über ihren verschwitzten Körper, und sie rennt beinahe zum Besprechungsraum. Erst vorhin hat sie dort für einen Termin eingedeckt.
Hoffentlich ist die Tür noch offen. Sie biegt um die Ecke, und ihre Hoffnung zerschlägt sich. Von Weitem kann sie durch die Glastür die Männer und Frauen sehen, die in den dunklen Konferenzstühlen Platz genommen haben.
Plötzlich spürt sie ihren Puls überdeutlich, und ihre Hände zittern, als sie vorsichtig an die Tür klopft, bevor sie mit gesenktem Kopf eintritt. Auf der glatten Oberfläche der Unterschriftenmappe zeichnen sich Feuchtigkeitsflecken ab, die sie möglichst unauffällig an ihrem Kleid abwischt, während sie durch den Raum eilt.
Am Kopf des langen Tisches sitzt ihr Chef und mustert sie kühl. Louise kann nichts dagegen machen, dass ihre Kraft sich leise in ihr meldet. Grün-wiegende Halme tanzen in ihrem Sichtfeld, unsichtbar für die übrigen Anwesenden, und offenbaren ihre Auren. Die Aura ihres Chefs ist seltsam düster, klebrig, ungreifbar, als stimme etwas mit ihm nicht.
Neben ihm steht diese Person, die in letzter Zeit ständig bei ihnen ein und aus geht. Allein bei ihrem Anblick überkommt Louise immer ein seltsames Gefühl, das sie nicht abschütteln kann, egal, wie sehr sie es versucht. Denn diese Person besitzt keine Aura. Oder sie ist so stark, dass sie sie verhüllt. Etwas, das niemals jemand tut, der nur Gutes im Sinn hat.
»Die Gesetzestexte«, murmelt Louise und legt die Mappe vor ihrem Chef auf den Tisch.
»Danke. Und nun gehen Sie.«
Louise nickt und verlässt mit schnellen Schritten den Raum. In ihrer Brust flattert es weiter, selbst als sie in ihrem Büro ihre Sachen zusammenräumt und den Computer herunterfährt. Sie konzentriert sich auf ihren Feierabend, ihren wartenden Mann, den Mocktail und das leichte Strampeln unter ihrem Herzen. Dennoch breitet sich Eiseskälte in ihr aus und wird schlagartig zu einem Blizzard, als sie am Drucker vorbeikommt und zwei darin verbliebene Zettel entdeckt. »Oh nein«, stößt sie aus, nimmt sie an sich und kann nichts gegen das Grauen tun, das sie beim Durchlesen überkommt. »Nein, nein, nein, nein, nein!«
Louise zögert nicht. Sie legt sich entschuldigende Worte zurecht und ist so abgelenkt, dass sie erst kurz vor der Glastür aufschaut – und erstarrt. Der Raum ist voller roter Funken, wie der Staub eines implodierten Sternes. Sie schwirren umher und sammeln sich direkt über den Köpfen der Besucher. Sirenenmagie. Das Wort pulsiert warnend durch Louises Gedanken, und sie zuckt zurück, will wegrennen, doch da wird die Tür vor ihr aufgerissen. Die fremde Person taucht vor ihr auf, die Lippen zu einem Lächeln verzogen, das einem die Eingeweide verknotet. »Danke, die fehlten uns noch.« Mit spitzen Fingern werden Louise die Ausdrucke abgenommen. Ihre eigene Magie regt sich fauchend, auch wenn sie als Seherin absolut nichts ausrichten kann. Mit einem Mal ist da nur noch düsteres Anthrazit, fast schwarz. Eine Farbe, die jegliche Alarmglocken in ihr schrillen lässt. Anthrazit, wie abgrundtiefe Bösartigkeit, durchzogen mit hellen roten Schlieren, die davon singen, wie sehr sie für ihre Taten brennt.
Ihr Blick zuckt zu Louises Bauch. Seufzen, Zögern, Genervtsein. »Vergiss was du gesehen hast. Geh in Richtung Süden, bau dir dort ein neues Leben auf, lass alles und jeden zurück, und komm nie wieder.«
Louise kann nichts gegen die Macht tun, die ihre Gedanken verpestet und ihren Willen an sich reißt. Sie will schreien, will wüten und toben. Stattdessen nickt sie, dreht sich um und geht los. Richtung Süden, während ihr Handy klingelt, nach ihr schreit. Doch sie kann nicht drangehen, weil ihr neues Leben auf sie wartet. Ohne Alexander. Ohne ihre Mutter. Ohne ihren Vater. Ohne ihre Schwestern. Ohne ihre Katzen.
Tränen laufen über ihre Wangen, während sie läuft, und läuft, und läuft.
1. Kapitel
Leah
Vierzehn Monate zuvor
Beklemmung breitet sich in mir aus, wird zu einem Grummeln in meinem Bauch, einem Kratzen in meiner Kehle, einem Stechen in meiner Brust. Fünfzig Dollar. Das ist nicht viel. Für die meisten auf der Akademie ist es nichts. Für uns ist es das Budget für den Wocheneinkauf.
Wir haben gerade erst die letzte Arztrechnung bezahlt. Das hier ist eine Katastrophe. Wie kann es sein, dass wir so viel Geld für Trikots ausgeben sollen? Das ist Wahnsinn. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mich dem Tennisteam anzuschließen. Ich hätte auch niemals zugesagt, bei der Sommerolympiade mitzumachen. Und jetzt ist es zu spät, denn meine Trainerin rechnet fest mit mir. Ich kann nicht einmal so tun, als wäre ich krank, weil die Olympiade erst in ein paar Wochen startet, direkt nach den Prüfungen und unmittelbar vor den Ferien.
Okay, keine Panik. Das wird schon gehen. Möglicherweise ist es in Ordnung, wenn ich einen Teil meiner Trinkgelder dafür nehme und wir diese Woche wieder nur von den Erzeugnissen aus unserem Garten leben. Mein Blick zuckt über den alten Küchentisch hinweg zur Vorratskammer. Obwohl die helle Tür geschlossen ist, weiß ich genau, wie es um die Vorräte steht. Es wird reichen, auch wenn ich gehofft habe, meine Mutter zur Feier ihres Geburtstages ausführen zu können. Mir entfährt ein leises Fluchen. Dann klingelt es, und ich laufe durch den schmalen, von Farbspritzern bedeckten Flur unserer Zweizimmerwohnung zur Tür, die sich direkt auf der Grenze zwischen dem Viertel der Elementare und der Gestaltwandler befindet. Ein Deckenventilator sorgt dafür, dass die stehende Luft hier im Dachgeschoss zirkuliert, doch es hilft nur wenig gegen die ungewöhnlich drückende Maihitze. Überall stehen Pflanzen herum, und Gemälde hängen an den Wänden. Meine Mutter lebt für die Kunst, und ihr Traum ist es, irgendwann eine Galerie zu eröffnen. Und diesen Traum werde ich ihr ermöglichen. Sobald ich einen richtigen Job habe, Geld verdiene und sie nicht mehr so viele Schichten wie möglich übernehmen muss, um unsere Kosten zu decken.
Als ich öffne, steht mein Onkel vor der Tür, in Jeans und Shirt, was bedeutet, dass er außer Dienst ist. »Onkel Diego, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist mitten in diesen Fall verwickelt.« Ich trete zurück, damit er reinkommen kann.
»Hey, Leah. Haben wir heute Morgen gelöst. Bin gerade mit dem Papierkram fertig geworden.« Er grinst breit, doch das kann nicht von seinem Bartschatten und den müden Augen ablenken. »Lucia würde mir den Kopf abreißen, wenn ich auch nur daran denke, ihren Geburtstag zu verpassen.« Sein Blick fliegt durch den Flur, wo Dutzende bunte Papierblumen von der Decke hängen, die wir schon seit Jahren für unsere Geburtstage nutzen. »Bist du schon fertig mit der Deko, oder brauchst du noch Hilfe?«
»Fertig. Aber Danke.« Ich schließe die Tür und deute in Richtung Küche. »Willst du was trinken? Mom braucht sicher noch zehn bis fünfzehn Minuten.«
»Das wäre fantastisch.« Onkel Diego geht voraus, und als er sich setzt, erspäht er die Rechnung für mein Trikot. »Fünfzig Dollar für Sportbekleidung?«
»Verrückt, oder?« Ich gieße ihm etwas von der selbstgemachten Limonade in ein Glas und stocke, als ich mich umdrehe und sehe, wie er die Rechnung abfotografiert. »Was machst du da?«
»Moment«, murmelt er und tippt auf seinem Handy herum, bevor er den Zettel zu mir schiebt. »Ist erledigt.«
Das Glas rutscht mir beinahe aus der Hand, und ich stelle es unsanfter ab, als beabsichtigt, weshalb ein kleiner Schwall Limonade über den Rand und auf meine Finger läuft. »Das solltest du nicht tun.«
»Ich will es aber.« Er hebt herausfordernd eine Augenbraue, doch dann bildet sich ein Grübchen auf seiner Wange, und ein Lächeln stiehlt sich auf sein Gesicht. »Sei nicht zu stolz, und bedanke dich einfach.«
Meine Nasenflügel blähen sich, als ich tief einatme und ihn vorwurfsvoll ansehe. Seine Hilfe hat uns schon so oft davor bewahrt, auf der Straße zu landen. Doch was, wenn sich das irgendwann ändert? Mom und ich hassen es, von anderen Leuten abhängig zu sein. Dennoch kann ich nichts gegen die Erleichterung tun, die sich schlagartig in mir ausbreitet. »Danke.«
»Und sobald wir den Kuchen gegessen haben, gehen wir aus. Ich habe uns einen Tisch reserviert.« Er runzelt die Stirn und schaut sich in unserer hellen, kleinen Küche um. »Es gibt doch Kuchen, oder?«
»Bei der Hitze?«
Obwohl er versucht, seine Enttäuschung zu verbergen, sinken seine Mundwinkel hinab.
Ich halte es nur wenige Sekunden aus, bevor ich lache. »Der ist natürlich im Kühlschrank.«
Onkel Diego lacht und deutet mit dem Zeigefinger auf mich. »Da hättest du mich fast drangekriegt.«
»Ein Geburtstag ohne Kuchen ist wie ein ...«
»Zuhause ohne Schlafplatz«, beendet er mit mir die Phrase, die meine Großmutter ständig genutzt hat, bis sie vor sieben Jahren an Brustkrebs starb. Einen Moment lang schweigen wir, erinnern uns an die resolute Frau, die dauernd in der Küche sang und Mom und mich aufnahm, als wir kurz davor waren, alles zu verlieren. Sie ließ uns bei sich einziehen, hierher in diese kleine Wohnung. Jetzt hat Mom ihr altes Zimmer, und manchmal, wenn sie schläft, höre ich sie leise nach ihr seufzen. Mama.
Das Geräusch von einem Schlüssel im Schloss lässt mich aufblicken, und während meine Mutter noch die Tür öffnet, treten wir in den Flur, um gleichzeitig »Happy Birthday!« zu rufen.
Mom lacht und lässt sich von mir umarmen, wobei sich der Rest ihres gelockerten Zopfes verabschiedet und ihre dunklen, lockigen Haare über ihre Schulter fallen. »Danke, mein Liebling.«
Danach ist mein Onkel dran. Im Gegensatz zu mir, kann man ihnen die Verwandtschaft ansehen. Ich hingegen bin das Abbild meines abwesenden Vaters.
»Los, mach dich frisch«, drängelt Onkel Diego und nimmt ihr die Handtasche ab.
Mom lächelt, obwohl dunkle Augenringe ihren Teint fahl wirken lassen und die Falten zwischen ihren Brauen jeden Tag ein wenig tiefer zu sein scheinen. In letzter Zeit hat sie viele Extraschichten übernommen. Doch das wird sich hoffentlich bald ändern. Denn sobald ich mit dem Studium fertig bin, werde ich mir einen gut bezahlten Job suchen, mit dem es mir möglich ist, uns beide zu versorgen. Wir werden Urlaub machen, werden jeden Abend essen gehen und nie wieder Angst haben müssen, dass das Geld nicht bis zum Ende des Monats reicht. Doch das dauert noch zwei ganze Jahre, in denen ich auf der Akademie mein Bestes geben werde, um meinem Stipendium gerecht zu werden.
Zehn Minuten später singen wir in der Küche lauthals Happy Birthday, bevor meine Mutter die achtundfünfzig Kerzen auspustet, die Diego und ich in aller Schnelle darauf verteilt haben. Es ist eine alberne Tradition, aber ich liebe sie. Während mein Onkel sich zum Rauchen entschuldigt, schaue ich meiner Mutter dabei zu, wie sie die letzten Reste der Müdigkeit überschminkt.
Mit einem schelmischen Lächeln betrachtet sie mich durch den Spiegel hindurch, bevor sie sich Eyeliner aufträgt.
»Erzähl schon.« Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, weil ich diesen Gesichtsausdruck kenne, den sie immer aufsetzt, wenn während ihrer Schicht irgendetwas vorgefallen ist. Dieses Schmunzeln, ganz unscheinbar, das jedoch ihre Augen funkeln lässt. »Was ist passiert?«
Sie beißt sich auf die volle Unterlippe, und ich weiß, dass sie nicht tratschen will, es aber unbedingt rauslassen muss. Dann gibt sie sich einen Ruck. »Es war wirklich eine verrückte Nacht. Mr Vanadis hatte zwei seiner speziellen Freundinnen da«, beginnt sie, und wir wissen beide, was es eigentlich bedeutet. »Mrs Vanadis tauchte unvermittelt früher auf und hatte ebenfalls einen speziellen Freund dabei. Es war ein Desaster, weil kurz darauf nämlich auch noch alle vier Kinder kamen, da ihre Großmutter den Kurzurlaub mit ihnen aufgrund von Herzproblemen absagen musste.«
Schockiert schlage ich mir die Hand vor den Mund. »Und was ist dann passiert?«
»Es war wie in einer dieser alten Komödien. Die speziellen Freunde sind von Raum zu Raum geschlichen, haben versucht sich vor den anderen Familienmitgliedern zu verstecken und hinauszugelangen. Zwei von ihnen konnte ich ungesehen hinausschleusen, doch eine der jungen Frauen ist unglücklicherweise dem jungen Erben in die Arme gelaufen.«
Sofort habe ich Vincent Vanadis’ Gesicht vor Augen, einen meiner Kommilitonen, dem die ganze Welt zu Füßen liegt.
Schuldgefühle breiten sich in mir aus, weil ich weiß, dass das perfekte Gebilde seiner Familie nichts als Schein ist. Ich weiß es, aber er tut es nicht.
»Und?«, hake ich nach, unsicher, ob ich überhaupt mehr hören will.
Mom verzieht den Mund. »Mr Vanadis hat sie für meine Tochter ausgegeben.«
Ich reiße die Augen auf. »Wie kam er denn auf diese Idee?«
Mom schnaubt. »Sie war wirklich sehr jung, wenn auch ein wenig älter als du, und sie trug eines von diesen leichten Dienstmädchenkostümen.«
Mein Mund klappt auf, doch ich bringe keinen Ton raus. Schnell versuche ich, das Bild zu verdrängen, das sich vor meinem inneren Auge bildet. Keiner von meinen Kommilitonen weiß, dass meine Mutter für das Haus der Elementare arbeitet, also wird mich auch keiner mit dieser Geschichte in Verbindung bringen. Dennoch gefällt mir der Gedanke nicht, was das für ein Licht auf meine Mutter wirft. »Hat er es geglaubt?«
»Es wirkte so. Er hat nur knapp genickt und sie dann kaum weiter beachtet.«
Das passt zu dem Bild, das ich von Vincent habe. Er behandelt die Angestellten wie Luft, genauso wie die Leute an der Akademie, die nicht zu seinem direkten Umkreis gehören. Obwohl wir diverse Kurse miteinander hatten und sogar dieselbe Highschool besucht haben, würde ich darauf wetten, dass er keine Ahnung hat, wie ich heiße. Nicht, dass das ein großer Verlust für mich ist, weil wir zwei völlig unterschiedliche Leben führen und ich ehrlich gesagt auch nicht möchte, dass alle an der Akademie von dem Job meiner Mutter erfahren. Reiche Snobs können richtige Miststücke sein.
»Sie tun mir so leid. Es ist wirklich eine Schande, dass ihre Eltern weiterhin an ihrer Ehe festhalten, obwohl sie so offensichtlich den Respekt voreinander verloren haben.« Sofort umspielt ein schuldbewusster Zug ihren Mund, wie immer, wenn sie an meinen Vater denkt, den sie nach einer Affäre verließ.
»Ich bin dankbar, dass es bei uns keine Spielchen gibt. So weiß jeder von uns, woran er ist«, versichere ich ihr und meine es ernst. Die Vorstellung, so leben zu müssen, in diesem Gebilde aus Lügen und falschem Glanz, wäre der Horror. Da kratze ich lieber jeden Monat am Existenzminimum.
»Oh mein Schatz, du warst schon immer so viel besser als ich.« Sanft streicht sie mir über die Haare. »Ich liebe dich so sehr.«
»Ich liebe dich auch. Und jetzt lass uns was Essen gehen, und danach gibt es den allerbesten Cocktail, den du jemals getrunken hast. Und morgen kannst du dann hoffentlich sogar mal ausschlafen.« Normalerweise trinken wir keinen Alkohol, nur an unseren Geburtstagen, an denen wir uns gegenseitig ausgefallene Getränke mixen. Und in zwei Jahren, wenn ich den Abschluss und einen Job habe, werde ich uns einen Tisch im Las Palmas buchen, einer Strandbar am Ashriver mit Tanz und Musik, der meine Mutter beim Vorbeifahren immer sehnsüchtige Blicke zuwirft. Sie liebt es zu tanzen, doch wenn sie ausnahmsweise mal frei hat, holt sie den Schlaf nach, hilft mir im Haushalt oder versucht zu malen.
Mom hat dieses Lächeln im Gesicht, das einen zu jedem Unfug überreden könnte. »Und dann reden wir über Jungs.«
»Es gibt keine Jungs in meinem Leben.«
»Niemanden?« Sie zieht die Mundwinkel hoch, bevor ihre Augenbrauen hüpfen. »Ein Mädchen?«
Ich lache und öffne demonstrativ die Tür. »Lass uns gehen.«
»Du weißt, ich unterstütze dich bei allem.«
»Nett gemeint, aber unnötig. Keine Dates für mich, bis ich meinen Abschluss habe.« Nicht, dass ich derzeit in irgendeiner Weise an irgendwem Interesse hätte.
Mom schnalzt mit der Zunge. »Nur weil deine Mutter jung schwanger wurde, heißt es nicht, dass du wie eine Nonne leben musst.«
Mir entfährt ein lautes Lachen, als ich im selben Moment meinen Onkel entdecke, der jedes Wort gehört hat und die Augenbrauen finster zusammenzieht. »Hat Leah etwa einen Freund?«
»Nein, das ist ja das Problem. Sie ist jung und wunderschön, sie sollte Spaß haben.«
Onkel Diego sieht mich an. »Lass dir keine Flausen in den Kopf setzen von derjenigen, die praktisch ein Teenager war, als sie ihre bezaubernde Nichte gebar.«
»Danke für euer Interesse an meinem Leben, aber ich für meinen Teil möchte nun etwas essen.«
Auf dem Weg zum Restaurant diskutieren sie weiter und kommen zu dem Schluss, dass Diego meine potentiellen Dates nicht in der Datenbank der Sonderkommission überprüfen darf.
Und ich? Ich lächle, weil die Sonne scheint, die Blumen blühen und der Geburtstag meiner Mutter doch nicht wegen unserer finanziellen Lage ins Wasser fallen muss.
2. Kapitel
Leah
Zwölf Monate zuvor
»Deine Rückhand ist heute mörderisch!«, ruft mir Daniel entgegen, während er auf der anderen Seite des Netzes hin und her springt und seinen Schläger dabei herumwedelt, als wolle er einen Paarungstanz aufführen. »Aber dieses Jahr werde ich dich schlagen!«
Die Julisonne brennt heiß auf uns herunter, und auf den Bühnen sitzen Dutzende Studierende aus der Northland Academy, die ihm lauthals zujubeln.
Auch mein Name wird von den Anwesenden der Ashriver Academy gerufen, doch sie kommen kaum gegen die Fangesänge an, die meinem Mitstreiter entgegengegrölt werden. Nur leider wird ihm das nichts nützen.
»Sorry, verlieren ist keine Option für mich.« Ich lächle, bevor ich den kleinen gelben Ball in die Luft werfe und mit voller Kraft meinen Schläger dagegen donnere.
Ein Pfeifen ertönt, und das Spiel endet mit sechs zu drei und sechs zu vier.
Mein dunkelroter Rock weht mir um die Beine, und mein dazu passendes Oberteil mit dem goldenen Wappen unserer Akademie klebt mir am Oberkörper fest. Ich löse es leicht und lasse warme Luft darunter strömen, während ich zum Netz gehe, um Daniel die Hand zu geben. »Ein tolles Spiel.«
»Nächstes Jahr werde ich dich schlagen«, verspricht er und grinst dabei breit.
Ich erwidere das Lächeln so sehr, dass meine Mundwinkel wehtun. »Dabei ist es doch eine nette Tradition, dich während der Sommerolympiade im Endkampf zu schlagen.«
Er lacht und klopft mir auf die Schulter. »Wehe, du versetzt mich nachher schon wieder. Stoß mit mir bei der Afterparty an.«
»Mal sehen.«
Er deutet mit seinem Schläger auf mich, und in seinen Augen blitzt es. Verdammt, er ist süß. »Ich halte nach dir Ausschau.«
Meine Wangen sind vor Anstrengung und Hitze ganz rot, doch ich wette, nun glühen sie regelrecht.
Daniel lässt mir keine Zeit zum Antworten, sondern zwinkert mir ein letztes Mal zu, bevor er in Richtung seines Trainers läuft. Ich zwinge mich, ihm nicht hinterherzusehen, und tue dasselbe.
Ich schlage mit meiner Trainerin Miss Fevre ein, ehe sie mir eine Wasserflasche reicht, wobei ihr hochgebundener blonder Zopf hin und her wippt. »Das war fantastisch! Ich wusste, dass du es schaffst.«
»Danke.« Ich trinke die Flasche halb leer und wische mir dann über den Mund, ringe gierig nach Luft. »Es war echt ein gutes Spiel.«
»Gut? Du solltest wirklich überlegen, ob du mit deinem Talent nicht unter die Profis gehen willst.«
»Mal sehen«, antworte ich, obwohl mir insgeheim klar ist, dass dies niemals passieren wird. Tennis ist ein Hobby, das ich beherrsche. Es ist nichts, was ich Vollzeit machen möchte.
Die Tribünen leeren sich langsam, und aus den Lautsprechern wird der Kurzstreckenwettkampf der Läufer angekündigt. Ich verabschiede mich schnell von Miss Fevre und eile zwischen den Sportanlagen hindurch zum Sportplatz der Leichtathleten.
Dort stelle ich mich mitten unter die Zuschauer und schaue gebannt zu, wie mein Cousin Matteo sich vorne bei den Läufern aufstellt. In einer Reihe mit Ezra Clarkson und Vincent Vanadis, den Starläufern unserer Akademie.
Ich verziehe den Mund und sehe die Anspannung in Matteos Gesicht, weil er genau dieses Szenario befürchtet hat. Die anderen drei Felder gehören Läufern von der Northland Academy.
Der ganze Platz wimmelt nur so von rot-goldenen und blau-silbernen Trikots und Uniformen. Alle Studierende der beiden Akademien konnten sich das Jahr über in ihren Disziplinen beweisen, und die besten von uns treten heute bei den Wettkämpfen an, die jeden Sommer stattfinden.
Ich streiche mir nervös über das Trikot, das Onkel Diego bezahlt hat, voller Dankbarkeit, weil ich ohne ihn eventuell nicht hätte teilnehmen können.
Der Startschuss fällt, und die Läufer sprinten los. Matteos Braids, die er zu einem Zopf hochgebunden hat, wehen im Wind, während er alles gibt.
Doch es ist am Ende Ezra Clarkson, Erbe des Flüstererhauses, der als Erster durchs Ziel läuft. Den zweiten Platz ergattert Vincent Vanadis, Erbe der Elementare, und Matteo schafft es nur ganz knapp hinter den Dritten.
Er lacht nach dem Rennen, schlägt mit den anderen Läufern ab, doch ich sehe ihm die Enttäuschung an, als er vom Platz geht.
Sofort geselle ich mich zu ihm. »Du warst gut.«
Seine Nase kräuselt sich, als er leise schnaubt. »Wieso konnte sich nicht einer von ihnen vorher das Bein brechen?«
»Matteo!«
Er lacht. »Okay, Magen-Darm hätte gereicht.«
»Nächstes Jahr«, verspreche ich ihm.
Er lacht leise. »Wie lief es bei dir? Sorry, ich konnte nur einen Teil deines Spiels sehen, aber du warst richtig gut.«
Ich zucke mit den Schultern. »Hab gewonnen.«
Matteo stößt einen Jubelschrei aus und hält mir seine Hand zum Abklatschen hin. »Fantastisch! Ich wusste, dass du es schaffst.«
»Danke.« Wir klatschen ein und folgen dem Strom der Zuschauenden in Richtung des Hallenbads, wo gleich der Wettkampf der Schwimmer stattfinden wird.
»Hast du dir schon überlegt, ob du zur Party kommst?«
Daniels Einladung kommt mir wieder in den Sinn. Obwohl ich zuvor ganz sicher Nein gesagt hätte, zögere ich. Immerhin sind wir sowieso bis morgen früh hier. Und ich teile mir das Zimmer mit einer Fußballerin, die vorhin wenig begeistert über meine Anwesenheit war. Nicht, dass sie gemein gewesen ist, aber es war offensichtlich, dass sie lieber mit jemand anderem ein Zimmer geteilt hätte.
Matteo stößt mich mit dem Ellenbogen an. »Komm schon, das wird lustig.«
»Okay, ich kann es mir ja mal ansehen.« Besser, als den ganzen Abend von meiner Mitbewohnerin ignoriert zu werden.
Matteo streckt eine Faust in den Himmel und vollführt einen kleinen, total albernen Freudentanz, während wir über die schmale Tribüne gehen und uns einen Platz in der Menge suchen.
Es ist so voll, dass wir immer weiter nach vorne geschoben werden, bis wir in der dritten Reihe landen, knapp hinter den wartenden Schwimmern, die ihre Wettkämpfe noch vor sich haben.
Die Schwimmhalle der Northland Academy ist dreimal so groß wie unsere und mit eindrucksvollen Sprungtürmen ausgestattet.
Die Luft vibriert vor vorfreudiger Anspannung, es ist schwülwarm und unfassbar laut, doch ich sauge jede Sekunde dieser Atmosphäre in mir auf. Normalerweise hasse ich Lärm und kann kaum dröhnende Musik ertragen, aber während Wettkämpfen sieht es anders aus. Hier bin ich Teil eines Ganzen, gehe in der Menge von roten und blauen Trikots unter und bin nicht nur das stille Mädchen, das beobachtend in der Ecke sitzt. Hier bin ich Mitglied der Tennismannschaft der Ashriver Academy.
Ich bin so erfüllt von Endorphinen, dass ich Ezra und Vincent erst bemerke, als sie direkt vor uns stehen und mir die Sicht auf das Becken versperren. Matteo versteift sich neben mir, als den beiden von rechts und links gratulierend auf die Schulter geklopft wird.
»Nächstes Jahr bist du dran«, raune ich ihm aufmunternd zu.
Matteo nickt dankbar, aber ich kann ihm ansehen, dass meine Worte nur minimal helfen. Ich kann ihn verstehen.
»Da ist Asher.« Vincent deutet auf den Startpunkt für die Schwimmer, an dem sich unter anderem Asher Hastings aufgestellt hat. Er ist Erbe des Hauses der Magier und Teil ihres exklusiven Freundeskreises, den alle nur ehrfürchtig die Elite nennen. Es ist erstaunlich, wie die Leute zu ihnen aufsehen und alles dafür tun, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Selbst jetzt sind unzählige Blicke auf Asher, Ezra und Vincent gerichtet, was sich schlagartig ändert, als das Startsignal ertönt. Mit einem Mal schauen alle gebannt zu, wie die Wettkämpfer gleichzeitig losspringen und durch das Wasser pflügen. Die Anfeuerungsrufe sind unfassbar laut, dennoch kann ich nichts dagegen tun, dass Ezras Stimme unter alldem Geschrei in den Vordergrund rückt. »Es war echt eine von euren Angestellten? Ausgerechnet an dem Wochenende, wo das Haus brechend voll mit Besuchern war?«
»Ja, es ist eine Schande.« Vincent schnaubt angewidert. »Offenbar war sie schon eine Ewigkeit für unser Haus angestellt.«
Ich sollte nicht lauschen, aber ich kann einfach nicht anders, als mich leicht vorzubeugen und genauer hinzuhören. Wurden sie bestohlen? Meine Mutter kennt die Person sicher. Vielleicht kenne ich sie ja auch von ihren Erzählungen?
»Habt ihr sie denn der Sonderkommission gemeldet?«
»Nein. Meine Eltern haben sie nur entlassen und aus dem Haus verbannt. Sie war wohl viele Jahre bei ihnen tätig. Das Zeug wurde in ihrer Handtasche gefunden.«
»Zum Glück. Tante Ursula hat den ganzen Sonntag getobt. Ich bin froh, dass Onkel Charles sie davon abhalten konnte, selbst die Polizei zu rufen.« Ezra schaut sich um, bemerkt mich aber nicht. »Ich bin echt froh, dass ihr die Sachen noch gefunden habt. Auch wenn es natürlich eine Schande ist, dass es jemand ist, dem ihr vertraut habt.«
»Eigentlich hätten sie es ahnen können.«
»Wieso?«
»Weil sie erst kürzlich meinem Vater dabei geholfen hat, seine Affäre zu verstecken und sogar eine davon als ihre Tochter ausgegeben hat.« Vincents Stimme trieft vor Ekel.
Mir wird eiskalt. Nein. Das kann nicht sein. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Mom kann nicht gemeint sein.
Trotzdem bewegen sich meine Beine wie von selbst.
Ich murmle Matteo eine Entschuldigung zu, bevor ich mich durch die Menge kämpfe und in Richtung der Umkleide renne, in der sich meine Sachen befinden. Nachdem ich mein Handy gefunden habe, wähle ich Moms Nummer und tigere nervös durch die nach Schweiß und Deo riechende Umkleide. Es dauert ewig, bis abgenommen wird. »Leah? Alles in Ordnung bei dir? Hast du nicht gerade deinen Wettkampf?«
Meine Mutter klingt völlig normal und stellt die Fragen so selbstverständlich, dass ich vor Erleichterung aufatme. »Ja, alles gut, ich wollte dir nur sagen, dass ich gewonnen habe.«
Mom freut sich am anderen Ende der Leitung, so laut, dass ich das Handy vom Ohr weghalten muss. »Ich wusste es!«
Ihr hörbarer Stolz lässt mich lächeln, und meine ganze Anspannung ist wie weggeblasen. »Danke, Mom.«
»Wann kommt ihr morgen zur Akademie zurück?«
»Direkt nach dem Frühstück. Wollt ihr immer noch zum Mittagessen kommen? Dann kann ich dir schreiben, sobald wir da sind.«
»Natürlich! Ich wollte schon immer das ominöse Blaue Haus sehen, das sich meine wunderbare Tochter als Angestellte sichern konnte.« Mom übertreibt total, aber ich liebe es insgeheim, wenn sie so ist.
»Super, ich freue mich schon.«
Wir legen auf, und ich merke jetzt erst, wie heftig mir das Herz in der Brust schlägt. Was auch immer an dem letzten Wochenende im Haus der Elementare vorgefallen ist, meine Mutter hat damit nichts zu tun. Sonst hätte sie niemals so entspannt geklungen.
***
Als ich am nächsten Tag zurück an die Akademie komme, bin ich völlig erschöpft. Matteo und ich haben die halbe Nacht gefeiert, und obwohl ich mich ziemlich zurückgehalten habe, steckt mir die Müdigkeit in den Knochen.
An der Bahnstation entdecke ich meine Mutter unter einigen anderen wartenden Eltern. Rohe, ungefilterte Freude bereitet sich in mir aus, bis zu dem Moment, als ich hinter mir Vincents Stimme höre. »Ist doch nicht zu fassen. Was macht diese Diebin hier?«
Verwirrt wende ich den Kopf zu ihm herum und dann wieder nach draußen. Meine Mom folgt meinem Blick, und ihre Augen weiten sich eine Millisekunde lang. Sie deutet auf ihr Handy und läuft zu Onkel Diego. Ein weiterer Blick, dann verlassen sie die Station, ohne zurückzusehen.
Noch bevor sich die Türen des Zuges öffnen, sind sie verschwunden.
Mir ist schlecht. Das kann nicht wahr sein. Ich steige aus und verabschiede mich von Matteo, der nichts von alldem mitbekommen hat, bevor ich mich durch die Masse hinausschlängele und meine Mutter anrufe.
Sie geht sofort dran, schweigt aber.
»Mom?« Ein zittriges Wort, das mir nur schwer über die Lippen kommt.
»Ich war es nicht«, sagt sie leise, und ihre Stimme bricht.
Entsetzt schlage ich mir die Hand vor den Mund, unfähig, etwas zu erwidern.
»Ich finde schon was Neues«, beteuert Mom mit ihrer unerschütterlichen Zuversicht, doch ich höre das Zittern in jedem ihrer Worte, höre den Schmerz, höre die Scham.
Denn egal wie hart ihr Job war, es hat meine Mutter mit Stolz erfüllt, für ihr Haus zu arbeiten. Anders als ich, die eine Leserin bin, ist sie eine Elementarin.
»Ich bin keine Diebin«, flüstert meine Mutter, und dann legt sie auf, lässt mich zurück mit dem Gefühl, als wäre dies nur der Anfang einer Katastrophe.
3. Kapitel
Leah
Sechs Monate zuvor
»Mom, bist du da?« Ich werfe den Schlüssel in die Schale auf der Kommode und ziehe den Mantel aus. Schnee klebt an meinen Schuhsohlen und bleibt auf der Fußmatte hängen, als ich sie ausziehe. Vorsichtig schiebe ich sie zur Seite, trete dann aber doch in das kalte Nass und verziehe den Mund, als meine Socke durchweicht. »Ich habe Essen mitgebracht.« Reste, weil ich eine Bestellung zu spät ausgeliefert habe und der Kunde die Annahme verweigerte. Glücklicherweise war nicht ich, sondern die Küche Schuld. »Muss es nur noch warm machen.« Man sollte meinen, dass ich gebratene Nudeln nicht mehr sehen könne, weil ich sie jedes Wochenende ausliefere, aber ich liebe sie genauso wie vorher.
»Mom?« Suchend laufe ich durch die Wohnung, kann sie jedoch nirgends finden. Seltsam. Normalerweise ist sie immer vor mir zuhause. Ihr Mantel hing doch an der Garderobe, oder?
Ich bin kurz davor noch einmal nachzusehen, als leise Stimmen zu mir dringen.
Die Tüte mit dem Essen stelle ich auf den Küchentisch, bevor ich in Moms Zimmer nachsehe. Ihr unordentliches Bett ist das Erste, was mir ins Auge springt. Das Display ihres Tablets leuchtet, ein Artikel über die Familie Vanadis offen.
Augenblicklich schnürt sich meine Kehle zu. Es ist ein halbes Jahr her, seit Mom gekündigt wurde, aber es vergeht kein Wochenende, an dem ich sie nicht dabei erwische, wie sie sich Artikel über die Vanadis’ durchliest. Ich wünschte, sie würde aufhören, sich so zu quälen und es einfach hinter sich lassen.
Wenn sie nicht hier ist, dann kann sie eigentlich nur auf der kleinen Dachterrasse sein. Draußen ist es frostig, und dicke Flocken bedecken jeden Zentimeter von Phoenix. Was macht Mom bei diesem Wetter nur draußen?
Die Terrassentür ist angelehnt und lässt eisig kalte Luft in die Wohnung, während im Kamin das Feuer unermüdlich dagegen anheizt. Ich strecke die Hand aus, doch als ich die Stimme meiner Mutter höre, halte ich inne. »Es ist überall.« Sie wirkt gebrochen, und schließlich beginnt sie zu schluchzen.
Meine Kehle schnürt sich zu, und wie auf Autopilot ziehe ich die Tür auf.
Mom steht dort, gemeinsam mit Onkel Diego.
Sie sehen mich an, und ich weiß sofort, dass es schrecklich sein muss.
Schrecklicher als die Kündigung.
Schrecklicher als die Dämonen, die Moms Geist seitdem rastlos und getrieben zurückgelassen haben.
Schrecklicher als ihr nächster Job, in dem Mom belästigt wurde und nach ihrer Anzeige keine Stelle mehr als Dienstmädchen fand.
»Mom?« Ein Wort, gebrochen und kratzig, doch ich bringe es irgendwie raus.
Meine Mutter weint. So richtig. Ich habe ihr leises Schluchzen in so vielen Nächten gehört, doch nie gesehen. Stets hat sie mich aufmunternd angelächelt. Bis heute. Bis jetzt. Sie kommt auf mich zu und umarmt mich, hält mich fest, so fest, als würde sie mich nie wieder loslassen wollen. »Oh, Liebling.«
Onkel Diego sieht mich an, und auch in seinen Augen schimmert es verdächtig.
Mom schluchzt und spuckt die Worte aus, die keinen Sinn ergeben wollen, mich nur durch den Dunst aus Schock und Starre erreichen. »Krebs.« »Metastasen.« »Unheilbar.«
»Was?«
»Morgen beginnt die Therapie.« Mom schnieft und lässt mich los, sieht mich an, versucht zu lächeln, aber es misslingt ihr. »Mach dir keine Sorgen.«
»Aber Mom ...« Mehr bringe ich nicht heraus, während mir das Herz bis in die Kehle pocht.
Sie wischt sich mit beiden Händen über ihr tränennasses Gesicht. »Lass uns reingehen. Es ist eiskalt hier draußen.«
»Ich komme gleich nach«, meint Onkel Diego. Vermutlich will er noch eine rauchen und uns Zeit lassen, doch als ich mich zu ihm umdrehe, zittern seine Hände so sehr, dass er das Feuerzeug kaum bedienen kann.
Ich versuche zu verstehen, was los ist, doch Moms Worte ergeben noch immer keinen Sinn. Das kann nicht sein. Nicht Mom. Nicht wir. Andere. Aber nicht wir.
Sie hat meine Hand genommen und zieht mich in die Wohnung. »Du hast Essen mitgebracht? Fantastisch.«
»Mom ...«
Sie lässt meine Hand nicht los, während sie mich in die Küche führt und umständlich beginnt, das Essen mit einer Hand aus der Tüte zu schälen. »Wusstest du eigentlich, dass ich gebratene Nudeln liebe?«
»Mom ...«
»Es wird alles gut.« Sie sieht mich nicht an.
»Mom, wie schlimm ist es?«
Sie erstarrt, und ihre großen Augen finden meine. Für einen kurzen Moment sehe ich etwas über ihr Gesicht flackern, doch dann lächelt sie mich beschwichtigend an. »Liebling.«
Doch ich habe sie gesehen. Diese alles verzehrende Angst, die mir den Atem raubt und mich nach Luft schnappen lässt. »O mein Gott.« Tränen schießen mir in die Augen, und ich kann mich nicht länger zurückhalten. Ich weine, weine, weine, während Mom mich in den Arm nimmt und fest an sich drückt.
Ihre Finger fahren über mein Haar, und sie murmelt beruhigende Worte, von denen ich kein einziges verstehe.
4. Kapitel
Leah
Fünf Monate zuvor
»Wieso tust du dir das an?« Ich nehme meiner Mutter das Tablet aus der Hand, auf dem wieder ein Artikel über die Familie Vanadis offen ist.
»Ich interessiere mich einfach für unsere Oberhäupter«, erwidert sie gespielt lässig und hebt ihre Arme, um ihre Locken zu einem Zopf zu binden. Mein Blick fällt auf ihre Schlüsselbeine, die immer mehr hervorstehen. Sie hat abgenommen. Schon vorher, doch erst jetzt ist es offensichtlich. Die ganze Zeit hat ihr Körper gekämpft. Aber niemand von uns hat es gesehen. Ich schiebe den Gedanken von mir, weil mir davon schlecht wird.
»Mom, du kannst die Vergangenheit nicht ändern«, flüstere ich und setze mich neben sie auf das Sofa.
Sie nickt, doch ihre Finger umklammern fest die Decke, die ich über ihre Beine gelegt habe. »Sie halten mich für eine Diebin. Dabei habe ich alles für das Haus getan. Wieso wollten sie mir nicht zuhören? Irgendjemand muss mir die Schuld zugeschoben haben. Oder Mrs Clarkson hat den Schmuck verlegt und wollte es nicht zugeben.« Groll schwingt in ihrer Stimme mit, und ich hasse die Bitterkeit, die sich daruntermischt. »Vielleicht hat sie ja das Schmuckstück ihrer Affäre geschenkt, für die sie Charles Clarkson angeblich verlassen hat.«
»Aber wir wissen, dass du es nicht warst«, flüstere ich und will mich nicht dazu hinreißen lassen, so negativ zu empfinden. Ich habe sowieso keine Möglichkeit, etwas an der Situation zu ändern. Wir werden niemals erfahren, was wirklich passiert ist. Das Wichtigste ist, dass meine Mutter wieder gesund wird. Egal wie minimal die Chancen stehen. Es gibt immer noch Wunder.
»Ich weiß«, flüstert Mom, aber mir ist klar, dass ihr das nicht ausreicht. Sie will, dass Mr und Mrs Vanadis ebenfalls die Wahrheit erfahren. Aber wie sollen wir ihre Unschuld beweisen? »Ich denke immer wieder darüber nach, und es ist, als wäre da ein Detail, das ich übersehe, etwas, das mir einfach nicht einfallen will.«
Ich greife ihre Hand und löse sie sanft von der Decke. »Was hältst du von einem kleinen Spaziergang auf die Terrasse? Es hat wieder geschneit, und in der Abenddämmerung glitzert alles ganz bezaubernd.«
Ihre Mundwinkel heben sich, aber das Lächeln erreicht ihre Augen nicht. Wie so oft in letzter Zeit. »Danke, Schatz, aber ich bin zu müde. Morgen gern.«
Das hat sie gestern schon gesagt. Und den Tag davor.
Ich wünschte, Onkel Diego wäre hier. Er würde das Ganze ein wenig erträglicher machen. Aber er arbeitet unermüdlich, um die Arztrechnungen zu bezahlen, die ich alleine nicht mehr stemmen kann. Denn offenbar gibt niemand einer todkranken Frau einen Kredit.
Um nicht wieder loszuweinen, schalte ich den Fernseher an und kuschle mich an meine Mom, inhaliere ihre Wärme, die so kurz vor Weihnachten der einzige Trost ist.
Sie wird es schaffen. Sie muss.
5. Kapitel
Leah
Vier Monate zuvor
»Ihr geht es deutlich besser, nicht?« Mein hoffnungsvoller Ton ist an die Pflegerin des Hospizes und Onkel Diego gerichtet. Wir stehen in der Tür ihres kleinen Zimmers und schauen dabei zu, wie sie das erste Mal seit Tagen selbstständig einen Löffel zum Mund führt. Ihre Hand zittert, und es geht einiges daneben, aber das ist unwichtig. Vor ihr sitzt eine zweite Pflegerin und liest ihr einen neuen Artikel über die Familie Vanadis vor, und so sehr ich es auch hasse, dass sie sich damit quält, könnte mir gerade nichts egaler sein.
Mom ist erst seit einigen Tagen hier. Ihr Zustand wurde zusehends kritischer, und ich konnte mir keine weiteren Fehlzeiten an der Akademie erlauben. Doch sie jetzt so zu sehen, weckt einen Hoffnungsschimmer in mir, den ich unter all den Tränen und der Angst längst verloren geglaubt habe.
»Vielen Patienten geht es zum Ende hin noch einmal besser.« Die Worte der Pflegerin sind wie ein Messer, das mir in den Bauch gerammt wird.
Ich erstarre, selbst mein Herzschlag setzt einen Moment lang aus. »Was?«
Onkel Diego nimmt meine Hand und schweigt, als wäre ihm das bereits klar gewesen.
Ich starre meine Mutter an, die so wunderschön ist, so stark, so mutig. Ich starre sie an und will weinen, aber da sind keine Tränen mehr. Da ist nichts mehr. Nur alles betäubende Leere.
Als Mom ihre Mahlzeit beendet hat, lächelt sie mich aufmunternd an und klopft neben sich. »Wie geht es dir, mein Liebling?«
Sie stirbt und fragt mich, wie es mir geht? Ein Laut entkommt mir und poltert heraus. Ein Lachen, rau und abgehackt. Ich lache, so laut, dass eine Pflegerin neugierig den Kopf durch die Tür steckt, und selbst die Mundwinkel meines Onkels zucken. Und Mom lacht ebenfalls. Wir lachen, lachen und lachen, bis ich plötzlich wieder weinen muss. Weil es so verdammt unfair ist.
»Mein Liebling.« Mom klopft neben sich, und ich lege mich zu ihr in das Bett, direkt in ihre Arme, wie damals, als ich ein Kind war und keine Zweifel daran hatte, dass sie für immer bei mir bleiben würde. »Meine wundervolle Leah. Kannst du mir etwas versprechen?«
»Wieso klingt das so nach Abschied?« Ich will mir die Ohren zuhalten, aber kneife stattdessen die Lider zusammen, weil meine Augen schon wieder brennen.
»Ist es nicht. Es ist ein ›Auf Wiedersehen‹. Ich glaube daran, dass wir alle uns auf der anderen Seite wiederbegegnen werden. Das weißt du doch, oder?«
»Ich weiß.« Aber ich will sie hier haben. Auf dieser Seite. Bei mir. Während ich eine Familie gründe. Während ich alt werde. Sie soll hier sein und nicht dort.
»Gut. Vergiss das niemals.« Ihre Finger streichen sanft über meinen Rücken. Wie früher, als ich ein Kind war, und ich inhaliere dieses Gefühl von Liebe, auch wenn darunter jetzt so viel Schmerz liegt. »Aber ich bitte dich auch darum, weiterzumachen. Bleib so wundervoll, mutig und zuversichtlich. Bleib diese wunderbare Person, bei der ich das Glück habe, sie meine Tochter nennen zu dürfen.«
»Oh, Mom«, stoße ich aus, und meine Finger krallen sich in ihr Bettlaken, während ich versuche, nicht schon wieder zu weinen.
»Ich liebe dich, mehr als alles andere. Vergiss das niemals.«
»Ich liebe dich auch«.« Meine Stimme bricht.
Mom hustet, ein rasselndes Geräusch entkommt ihrer Kehle. Ihre Hand auf meinem Rücken wird ganz schlaff.
Panik durchflutet mich, und ich richte mich ruckartig auf. Ihre Augen sind geschlossen, sie lächelt, und ihre Brust hebt und senkt sich quälend langsam.
Aber sie lebt.
Onkel Diego tritt hinter mich, legt seine Hand auf meine Schulter und drückt sie leicht. »Willst du etwas essen?«
Ich schüttle den Kopf, weil ich nicht weiß, wie ich jemals wieder etwas essen soll.
»Geht ruhig«, flüstert meine Mutter. »Vielleicht kann eine der Pflegerinnen-«
»Keine Artikel mehr«, sage ich leise. »Hör auf, dich zu quälen.«
»Ich hoffe nur immer, dass ich endlich darauf komme. Auf dieses eine Detail«, murmelt sie, und wieder atmet sie rasselnd ein, wobei sie einen Hustenanfall bekommt.
»Mom?« Ich richte mich auf. »Onkel Diego, kannst du jemanden holen?«
»Sicher.« Mit schnellen Schritten durchquert er den Raum, und ich höre, wie er etwas ruft, doch meine ganze Aufmerksamkeit ist auf Mom gerichtet.
Ihre Augen weiten sich ganz plötzlich, und ihr Blick richtet sich an die Decke. »Ich weiß es wieder.« Ein weiteres Husten erschüttert sie.
Ihre Hand findet meine und umfasst sie, während ihre Augen sich flatternd schließen. »Leah. Du musst ...« Sie verstummt, und kurz darauf erschlafft ihr Körper. Ihre Finger lösen sich aus meinen.
Panik schießt durch mich hindurch. »Was muss ich? Mom? Mom!«
Doch meine Mutter antwortet nicht mehr.
Ich schreie. Onkel Diego ist wieder da und drückt mich fest an sich, während ich meine Mom anstarre, die völlig regungslos in diesem Bett liegt, das nicht ihr eigenes ist. In diesem Gebäude, das nicht ihr Zuhause ist. An diesem Ort, von dem ich insgeheim hoffte, sie könne ihn wieder verlassen.
»Schhhh«, beruhigt mich Onkel Diego durch seine von Tränen erstickte Stimme, doch in diesem Moment tritt alles um mich herum in den Hintergrund. Ich sehe nur noch meine wunderschöne Mom, die mich nie wieder anlächeln wird, die mich nie wieder umarmen wird, die niemals die Chance hatte, ihre letzten Worte auszusprechen. Weil sie tot ist.
Und ich hasse die Familie Vanadis dafür, dass sich sogar die letzten Minuten ihres Lebens um sie drehten, nachdem sie schon die letzten Monate eingenommen haben.
Ich hasse jeden Einzelnen von ihnen.
6. Kapitel
Leah
Drei Monate zuvor
Ich funktioniere. Lerne, arbeite, tue so, als wäre ich innerlich nicht zerbrochen. Neben den Dozierenden ist mein Cousin Matteo der Einzige, der weiß, dass ich nun offiziell bei meinem Onkel lebe und Moms Grab wöchentlich mit frischen Wildblumen versorge.
»Bist du sicher, dass du auf eine Strandparty willst?« Matteo zieht zweifelnd seine Augenbrauen zusammen und deutet auf mein Outfit. »Sieht eher nach Bankräuberin aus.«
Ich belächle seine Worte, mit denen er meine schwarze Jeans und den schwarzen Hoodie kommentiert. »Irgendwann werde ich darüber lachen.«
»Und dann trägst du den Rest des Tages pink«, beendet er meinen Satz.
Ich nicke, weil ich weiß, wie unrealistisch das ist. Lachen fühlt sich weit weg an, und es ist fürchterlich, weil meine Mutter so gerne mit mir gelacht hat.
Wir machen uns auf den Weg zum Strandabschnitt, der sich direkt hinter dem Blauen Haus am Ashriver befindet. Der Frühling war heute gut zu uns, dennoch ist die Luft noch frisch, als wir uns unter die Leute mischen. Mehrere Lagerfeuer verteilen sich über den Strandabschnitt und erhellen ihn, überall sitzen Studierende mit Bierflaschen in der Hand, die lachen und sich unterhalten. Die Stimmung ist ausgelassen, doch ich fühle nichts, nur diese Leere, die alles in mir betäubt.
»Der Plan ist folgender.« Matteo dreht sich mit ernstem Gesichtsausdruck zu mir um. »Ich weiß, dass es eine große Sache ist, dass du überhaupt mitgekommen bist, und ich kann mir vorstellen, dass es dir irgendwann zu viel wird. Deshalb kannst du einfach neben mir stehen, nicken und so tun, als würdest du zuhören. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann zupf an meinem Ärmel, und wir hauen sofort wieder ab.«
Vor Rührung bekomme ich einen Kloß im Hals und kann nur schwach nicken. Matteo lächelt schief und wuschelt mir einmal durchs Haar. »Aber erstmal besorgen wir uns etwas zu Trinken.«
Den Rest des Abends verbringen wir mal hier und mal dort, weil Matteo einfach jeden kennt. Niemand stört sich an dem Schatten, der an seinen Fersen heftet und bis auf ein gelegentliches Nicken kaum etwas zustande bringt. Ich lasse meinen Blick durch die Menge schweifen und entdecke schließlich Jade. Sie sitzt mit ihrem Freund Asher an einem Lagerfeuer. Obwohl sie von allen umschwirrt werden wie Motten das Licht, wagt es dennoch keiner, sie zu stören.
Jade ist nett und hat schon ein paar Mal versucht, sich mit mir zu treffen. Das Problem war nur immer, dass ich nie Zeit hatte. Weil ich ständig arbeiten musste. Wenn ich nicht im Blauen Haus gekellnert habe, gab ich Nachhilfeunterricht, und an den Wochenenden war ich meist mit dem Ausliefern von Essen beschäftigt.
Doch das ist inzwischen Vergangenheit.
Ich wohne jetzt bei meinem Onkel, der sich weigert, Geld von mir anzunehmen, weshalb ich mehr aus Gewohnheit, als aus Notwendigkeit kellnere.
Jade scheint meinen Blick zu bemerken, denn sie hebt den Kopf, entdeckt mich und lädt mich mit einem Winken zu sich und Asher ein. Sie lächelt, so freundlich wie immer, und ich gebe mir einen Ruck. »Bin gleich wieder da.«
Matteo schaut mich fragend an, und ich deute auf Jade, woraufhin sich sein Mundwinkel hebt. »Bis gleich, und treib es nicht zu wild.«
Ich verdrehe die Augen. »Ja, ja.«
Beim Lagerfeuer angekommen, nickt Asher mir zu, während Jade mich anstrahlt. »Hi, wie schön dich zu sehen.«
»Ich wurde überredet.« Äußerlich sind die beiden das komplette Gegenteil. Er mit seinen blonden Haaren und der von der Sonne gebräunten Haut und daneben Jade, blass und mit dunkelbraunem Haar. Als wäre sie Schneewittchen und er ihr Prinz.
Schnell sehe ich wieder weg, bevor sie denken, dass ich starre. »Dafür, dass die Party so spontan ist, sind echt viele Leute hier, oder?«
Asher prustet los, während Jade leise stöhnt und das Gesicht in beiden Händen vergräbt. »Dafür bekomme ich sicher eine Verwarnung, wenn ich nicht sogar suspendiert werde.«
»Wieso?«
Asher lacht leise weiter und streicht sanft über ihre Hand. »Jade wollte ein kleines Treffen am Lagerfeuer hier unten veranstalten. Das hat sich herumgesprochen, und hier sind wir.«
Mir entfährt ein »Oh«, weil ihre Reaktion jetzt sehr viel mehr Sinn ergibt. Sie erwähnte mal, dass sie versucht, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, nachdem die Sonderkommission sie vor einigen Monaten vor den Augen der gesamten Akademie festnahm. Niemand weiß warum, und irgendwann kam das Gerücht auf, es wäre eine Verwechslung gewesen. Doch als ich Onkel Diego darauf ansprach, knirschte er nur mit den Zähnen und sagte, er dürfe nicht darüber sprechen.
Es muss also etwas sein, das mithilfe von viel Geld und Einfluss vertuscht worden ist. Seit diesem Moment sehe ich sie so richtig als Teil der Elite.
Keine Ahnung, warum ich hier überhaupt sitze. Vielleicht, weil sie so unfassbar nett ist und mich immer anlächelt. »Also ich wusste nicht, dass du die Party ursprünglich geplant hast. Und solange keiner Mist baut, wird sicher auch niemand danach fragen.«
Da ist es wieder. Ihr Lächeln, das mir das Gefühl gibt, sie würde mich gerne um sich haben. »Ich hoffe es.«
Im nächsten Moment taucht ein großer schwarzer Hund neben mir auf, und ich erstarre vor Schreck, als seine Schnauze gegen meinen Oberschenkel drückt.
»Coco!«, ruft Marina und kommt grinsend zu uns gelaufen, bevor sie ihren Hund am Halsband schnappt. »Du sollst doch nicht einfach weglaufen.«
Ich will sie fragen, warum sie ihn unangeleint lässt, hier zwischen all den Betrunkenen. Aber ich verkneife es mir. Marina nimmt mich sowieso kaum wahr, sondern wendet sich an die anderen beiden. »Ich habe Ezra nirgends gesehen. Ihr?«
Jade runzelt die Stirn. »Nicht mehr, seit er und Riley sich was zu Trinken holen wollten.«
Asher schaut auf seine Armbanduhr. »Das ist doch sicher schon eine Stunde her. Hast du denn Riley irgendwo gesehen?«
Marina schüttelt den Kopf und schnauft. »Meint ihr, die sind zusammen abgehauen?«
»Eher hat Riley ihn von der Klippe gestoßen und versucht nun, ein glaubwürdiges Alibi aufzutreiben«, scherzt Asher, was ihm einen bösen Blick von Jade einbringt. Sofort hebt er beide Hände. »Was denn? Die zwei sind wie Katz und Maus.«
»Wir sollten sie suchen. Nicht, dass Riley über den Durst getrunken hat. Ihr kennt sie ja. Party, Party, Party.« Die letzten drei Worte klingen fast wie eine Melodie aus Marinas Mund.
»Na gut, lasst uns nach den beiden schauen.« Asher steht auf und klopft sich den Sand von der Hose.
Jade schaut zögernd zu mir, doch ich erhebe mich ebenfalls. »Ich wollte eh langsam zurück ins Wohnheim. Soll ich in ihrem Zimmer nachsehen? Vielleicht schläft sie schon.«
»Das wäre wirklich fantastisch«, stößt Jade aus und gibt mir ihre Handynummer, die ich einspeichere, bevor sie mich ein letztes Mal anstrahlt. »Lass uns unbedingt mal einen Kaffee trinken gehen.«
»Klar«, sage ich, unsicher, ob ich bereit für ein Treffen bin und schiebe das Telefon in meine Hosentasche. Sie würde nicht verstehen, warum ich manchmal mitten im Satz verstumme, wenn mich eine Erinnerung übermannt. Oder warum ich nicht mehr lache. Ich bin definitiv noch nicht bereit, die Worte auszusprechen.
Sie nur zu denken, weckt alle Fluchtinstinkte. Meine Magie zuckt, weil ich so aufgewühlt bin, und ich balle meine Hände zu Fäusten. Doch niemandem fällt die weiße Aura auf, die mir wie heraufsteigender Dunst über den Handrücken wabert.
Die anderen machen sich auf den Weg, und ich will es ihnen nachtun, als ich etwas Glitzerndes im Sand entdecke.
Ein Medaillon. Es ist klein und golden und erinnert mich an das meiner Mutter. In ihrem ist ein Bild von mir, nun begraben unter einer meterdicken Schicht Erde.
Meine Finger kribbeln, und meine Augen brennen verdächtig. Und doch kann ich nicht anders, als nach dem Gegenstand zu greifen. Eine kurze Berührung, und meine Kräfte übernehmen, weil mit einem Mal alles zu viel ist.
Bilder flackern vor meinen Augen. Erinnerungen, die an dem Medaillon hängen.
Beine. Finger, die nach ihr greifen.
Ein schlanker Hals und eine dünne Kette.
Gesichter. Vincent. Ezra. Asher. Jade. Riley. Marina. Und noch einige andere. Fremde. Eine Hand mit einem Ring daran. Moment.
Das ist der Ring meiner Mutter.
Mir wird eiskalt und flammendheiß zugleich. Meine plötzliche Panik reißt mich aus den Erinnerungen. Ich habe eindeutig Moms Hand gesehen. Diese feine Narbe auf dem Knöchel ihres Zeigefingers und der darunter liegende Goldring mit dem dunkelroten Rubin, den sie von meiner Großmutter erbte, würde ich überall erkennen.
Es ist derselbe Ring, den ich gerade am Finger trage. Ich versuche tief durchzuatmen und mein rasendes Herz zu beruhigen. Mir ist so schwindelig, dass ich zurück auf den Baumstamm plumpse.
Ich umfasse das Medaillon fester und starre in die Flammen, während mir drei Sachen bewusst werden.
Erstens: Das hier ist der Schmuck, den meine Mutter angeblich gestohlen hat.
Zweitens: Jemand von der Elite muss dafür verantwortlich sein.
Drittens: Ich muss dringend herausfinden, wer es war.
7. Kapitel
Vincent
Gegenwart
Irgendwer in diesem Lyrikkurs schreibt verdammt gute Gedichte. Ich lehne mich auf dem Platz zurück und höre zu, wie einer meiner Kommilitonen eines der Gedichte von unserer letzten Hausaufgabe vorliest. Wir alle mussten sie in Boxen werfen, damit niemand weiß, von wem sie kommen, da das Thema unsere dunkelste Stunde lautet.
»Flüstern in der Nacht,
schleichende Gedanken quäl‘n,
Herz schlägt voll Zweifel.«
Der ganze Kurs schweigt, und die Stille wird nur von dem Zusammenfalten des Blattes durchbrochen.
Unser Lyrikdozent Mr Fothergill, der am Pult gelehnt steht, nickt ernst und bedächtig. »Ein schöner Haiku. Nennen Sie mir doch den Aufbau dieser Gedichtform.«
Verstohlen starre ich auf meine Notizen und finde glücklicherweise die Antwort in den Mitschriften.
Was auch immer Direktorin Winters dazu bewegt hat, mich ausgerechnet in diesen Kurs zu stecken, sie war definitiv auf dem falschen Dampfer.
Lyrik ist wohl so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich unter Spaß verstehe. Und die Gedichtanalyse wird mich noch meinen perfekten Notendurchschnitt kosten.
Ich habe absolut keinen Plan, was ich hier tue. Aber ich erkenne, wenn sich etwas gut anhört und wann eine Frage leicht genug ist, damit ich mich mit einer Antwort nicht vollends blamiere. Also hebe ich die Hand, weil die mündliche Note das Einzige ist, was meinen Schnitt noch retten kann.
Mr Fothergill sieht mich, nimmt aber jemand anderes dran. Umso besser.
»Ein Haiku besteht aus drei Sätzen, mit fünf Silben in der ersten Zeile, sieben in der zweiten und fünf in der letzten. Es stammt aus Japan und ist eine Form der Kurzdichtung«, rattert einer meiner Kommilitonen herunter, was unseren Dozenten dazu veranlasst, ein wenig weiter auszuholen.
Ich unterdrücke das Gähnen, das in mir hinaufschleicht, ersticke es mit einem Schlucken und wünschte wirklich, ich wäre die letzten Nächte früher ins Bett gegangen.
Mein Blick fliegt über die Köpfe meiner Kommilitonen hinweg nach draußen zu den grünblühenden Baumwipfeln, die im Sommer die Aussicht auf den blauen Himmel versperren. Sobald dieser Kurs endet, werde ich mir meine Badesachen schnappen und zum Strand gehen, bevor er wieder völlig überfüllt ist. Wäre doch gelacht, wenn ich mir nicht den besten Platz sichern könnte. Oder ich schreibe eine kurze Nachricht in meine Gruppenchats und bitte einen von meinen Freunden, die sicher auch dort abhängen wollen.
Unauffällig ziehe ich das Handy aus meiner Hosentasche und tippe eine Nachricht.
»Mr Vanadis, möchten Sie nicht etwas zum Unterricht beitragen?«
Ich blicke auf und schiebe das Telefon zurück in die Hose. »Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich darf nicht mit meinem Handy spielen, das weiß ich genau.«
Der ganze Kurs bricht in Gelächter aus, und selbst Mr Fothergill kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Gut, dass Ihnen das bewusst ist. Was halten Sie davon, uns den nächsten Beitrag vorzulesen?«
»Sehr gerne.« Lässig stehe ich auf und laufe nach vorne zu dem Karton, indem wir anonym unsere Hausaufgaben hineingeworfen haben. »Hoffentlich ist es nicht mein eigener«, murmle ich leise, doch die erste Reihe hört es und kichert. Ich grinse und greife nach einem der Zettel, ziehe ihn heraus und entfalte ihn.
»In stillen Nächten, wo der Schatten siegt,
Verblasst das Licht, das einst so hell gebrannt.
Ein Echo hallt, das Herz dem Schmerz erliegt,
Die Erinnerung verrinnt, die Seele stumm verbrannt.
Die Wut, sie tobt, wie ein Sturm aus Tränen,
Ein Feuer, das die Kälte hart bekriegt.
Die Fragen schreien »Warum musstet ihr sie mir nehmen?«
Die Schuldigen schweigen, bis die Vergeltung siegt.«
Einen Moment lang starre ich die Worte an, die jemand fein säuberlich mit einem Kugelschreiber auf ein weißes Blatt geschrieben hat. Die Buchstaben stehen in perfekter Reihe, mit groß geschwungenen Unterlängen.
»Ein schönes Gedicht, was meinen Sie? Worum geht es darin?«
»Es ist traurig«, antworte ich, ohne dass er mich drannimmt, und sehe auf. »Und so wütend.«
»Richtig. Trauer und Wut mischen sich darin. Und wer auch immer das geschrieben hat, hat gute Arbeit geleistet.« In Mr Fothergills Ton schwingt noch etwas anderes mit, doch er hält sich zurück, so wie er es zu Beginn unseres Kurses versprochen hat. Niemand wird aufgrund dessen, was er abgibt, bewertet. Es geht darum, dass wir die Arbeiten beurteilen, nicht die Person, die es geschrieben hat.





























