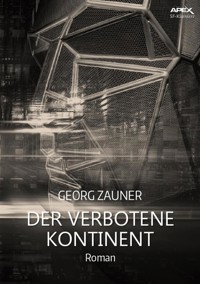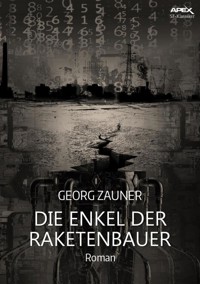
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Zeitalter der Verschwendung ist vorüber.
Die Bewohner Europas im 3. Jahrtausend, die Enkel der stolzen Raketenbauer des ausgehenden 2. Jahrtausends, leben von den kärglichen Resten, die ihnen das Industriezeitalter und seine furchtbaren Auseinandersetzungen um die letzten Rohstoffe übrig gelassen haben.
Dies ist eine Sammlung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die in Bajuvien etwa zwischen 2750 und 2800 entstanden.
Es sind vor allem Tagebucheintragungen des Mönchsbruders Friedel im Kloster MUNIC, das inmitten eines riesigen Trümmerfeldes an dem Flusse Isar liegt.
Eisenfrevler und andere gottlose Schatzgräber plündern zum Ärger der geistlichen Herren im Untergrund, während Abgesandte der offiziellen Commissionen an der Seite von Mönchen in die verfallenen Stollen der ehemaligen U- und S-Bahn-Schächte vorstoßen, um wertvolle Metalle zu bergen, wobei sie oft seltsame, unheimliche und zuweilen schreckliche Dinge zutage fördern, Relikte einer Vergangenheit, die längst unverständlich geworden und zur Sage geronnen ist...
Der dystopische Roman Die Enkel der Raketenbauer des Schriftstellers, Drehbuchautors und Filmregisseurs Georg Zauner (* 17. April 1920; † 04. Oktober 1997) gilt bis heute als einer der besten deutschen Science-Fiction-Romane und wurde im Jahr 1981 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.
Der Roman erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX SCIENCE-FICTION-KLASSIKER.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
GEORG ZAUNER
Die Enkel der Raketenbauer
Die Bajuvischen Dokumente
Berichte und Briefe aus dem 3. Jahrtausend (n. Chr.)
Roman
Apex Science-Fiction-Klassiker, Band 60
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE ENKEL DER RAKETENBAUER
1. Statt eines Vorwortes
2. Berichte und Dokumente aus dem 3. Jahrtausend (2750 - 2800 n.Chr.)
Das Buch
Das Zeitalter der Verschwendung ist vorüber.
Die Bewohner Europas im 3. Jahrtausend, die Enkel der stolzen Raketenbauer des ausgehenden 2. Jahrtausends, leben von den kärglichen Resten, die ihnen das Industriezeitalter und seine furchtbaren Auseinandersetzungen um die letzten Rohstoffe übrig gelassen haben.
Dies ist eine Sammlung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die in Bajuvien etwa zwischen 2750 und 2800 entstanden.
Es sind vor allem Tagebucheintragungen des Mönchsbruders Friedel im Kloster MUNIC, das inmitten eines riesigen Trümmerfeldes an dem Flusse Isar liegt.
Eisenfrevler und andere gottlose Schatzgräber plündern zum Ärger der geistlichen Herren im Untergrund, während Abgesandte der offiziellen Commissionen an der Seite von Mönchen in die verfallenen Stollen der ehemaligen U- und S-Bahn-Schächte vorstoßen, um wertvolle Metalle zu bergen, wobei sie oft seltsame, unheimliche und zuweilen schreckliche Dinge zutage fördern, Relikte einer Vergangenheit, die längst unverständlich geworden und zur Sage geronnen ist...
Der dystopische Roman Die Enkel der Raketenbauer des Schriftstellers, Drehbuchautors und Filmregisseurs Georg Zauner (* 17. April 1920; † 04. Oktober 1997)gilt bis heute als einer der besten deutschen Science-Fiction-Romane und wurde im Jahr 1981 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.
Der Romanerscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX SCIENCE-FICTION-KLASSIKER.
DIE ENKEL DER RAKETENBAUER
1. Statt eines Vorwortes
Sehr geehrte Damen und Herren des Verlages!
Bei der Lektüre Ihrer Berichte und Dokumente aus dem dritten Jahrtausend kann ich mich des Verdachtes nicht erwehren, dass Sie einigen gefälschten Papieren aufgesessen sind. Sie selbst wissen ja wohl, dass gerade die Urkunden aus dem Zeitabschnitt von 2600 bis 2800 n. Chr. mit großer Vorsicht zu genießen sind. Leider bleiben Sie dem Leser die Auskunft schuldig, wo diese Papiere aufgefunden und bisher aufbewahrt wurden. So möchte ich persönlich vermuten, dass die Figur des Priester-Bruders Friedel, der Ihr Haupt-Quellenlieferant ist, Ihrer immerhin beachtenswerten Fantasie entsprungen ist, wobei Sie wahrscheinlich darauf spekulieren, dass man Geschehnisse und deren Überlieferung umso eher glaubt, wenn sie bereits 400 oder 500 Jahre zurückliegen!
Am 10. 11. 3276
Mit vorzüglicher Hochachtung
R. F. Kl.
Sehr geehrter Herr R. F. Kl.,
Ihren Verdacht, mit ungeprüften oder gar selbsterfundenen Dokumenten vor die Öffentlichkeit zu treten, müssen wir entschieden und nicht ohne Empörung zurückweisen. Gerade die tagebuchähnlichen Aufzeichnungen des Priesterbruders Friedel von Munic, die ja gewissermaßen das inhaltliche Rückgrat der Sammlung bilden, sind absolut authentisch. Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen mit, dass sie lange Zeit unbeachtet in den Archiven des »Zentralen Institutes für terrestrische Evolution« lagen, und zwar deshalb, weil die Übersetzung der alten »mitteleuropäischen« Sprachen sehr schwierig und zeitraubend ist. Inzwischen liegen sie sogar im Urtext gedruckt vor, und zwar in der Reihe »Beiträge zur Geschichte des späten Europa«. Wir hoffen also, mit dieser Klarstellung den von Ihnen ausgesprochenen Verdacht entkräftet zu haben.
Am 14. 11. 3276
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Verlag
Sehr geehrte Damen und Herren des Verlages!
Nach der Lektüre Ihrer Dokumentensammlung aus dem 28. Jahrhundert möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen:
a) wo liegt das Land Bajuvien beziehungsweise: wo hat es gelegen?
b) kann man die beschriebenen Stätten, vor allem die alte Stadt Munic noch besichtigen?
Für die Beantwortung dieser mich sehr interessierenden Fragen wäre ich Ihnen außerordentlich verbunden.
Am 12. ix. 3276
Mit vorzüglicher Hochachtung
Gr. Gr. Do.
Sehr geehrter Herr Gr. Gr. Do.,
in Beantwortung Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen gern mit, dass Bajuvien etwa in der Mitte Europas lag, und zwar unmittelbar nördlich des Alpengebirges. Das Land reichte im Norden noch etwas über den Fluss Danub hinaus, der früher auch Donau genannt wurde.
Was die alte Stadt Munic (Munich) betrifft, so sind an dieser Stätte unseres Wissens noch einige Kirchen-Ruinen vorzufinden. Da aber der gesamte Platz, wie überhaupt der größte Teil Europas - wie Sie wissen -, zur ökologischen Regenerationszone erklärt wurde, dürfte der Zugang sehr erschwert und daher nur mit expeditionsmäßiger Ausrüstung erreichbar sein. Wobei im Übrigen sehr zweifelhaft ist, ob eine Genehmigung in diesem Falle erteilt würde.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Mitteilung gedient zu haben.
Am 17. xi. 3276
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Verlag
Sehr geehrte Damen und Herren des Verlages!
Erlauben Sie mir, dass ich neben meinen besonderen Komplimenten ein paar kritische Äußerungen zu Ihrer Veröffentlichung mache, ohne deren grundsätzlichen Wert dabei in Frage zu stellen: Ich, frage mich nämlich, ob der heutige Leser des 33. Jahrhunderts, soweit er nicht historisch gebildet ist, durch diese Blätter überhaupt ein Gesamtbild jener Epoche erhält, die ja mehr als 400 Jahre zurückliegt!
Müsste man nicht ein paar erläuternde Worte darüber verlieren, dass die sogenannte post-zivilisatorische Epoche, die man heute zwischen 2100 und etwa 3000 ansetzt und aus der Ihre Dokumente stammen, eine Zeit des Niederganges war, als Folge gewaltiger Umwälzungen am Ende des sogenannten Industrie-Zeitalters?
Klugerweise haben Sie sich geografisch beschränkt und nur die bajuvische Kultur als Teil dieser globalen Übergangszeit näher beschrieben! - Dann aber wäre es vielleicht wichtig anzumerken, dass diese bajuvische Epoche ihre besondere Überlebensstruktur in der Bildung klösterlicher »Kommunen« fand, die als Herrschafts- und Wirtschaftszentren gedacht werden müssen. Anderswo fand man bekanntlich andere politische Formen, um mit den reduzierten Ressourcen eine einigermaßen funktionierende menschliche Gesellschaft am Leben zu erhalten.
Vielleicht sollte man dem (verwirrten) Leser auch noch mitteilen, dass das sogenannte Industrie-Zeitalter wahrscheinlich gar nicht durch die Anwendung von Superwaffen beendet wurde, sondern einem rapiden Auflösungsprozess auf Grund des zunehmenden Mangels anheimfiel. Die starre, auf Primär-Verbrauch hin orientierte Gesellschaft war unfähig, sich dem Versiegen der natürlichen Ressourcen rechtzeitig anzupassen, und zerbrach in bürgerkriegsähnlichen Raubzügen. Die Erinnerung an diese untergegangene, in der Geschichte des Planeten einmalige Epoche von rund 300 bis 400 Jahren lastete auf den nachfolgenden überlebenden Gesellschaften wie ein böser Alptraum.
In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Hinweisen nicht lästig gefallen zu sein, verbleibe ich
mit besonderer Hochachtung
Am 18. 11. 3276
Frau G. H. Ol.
Sehr geehrte Frau G. H. Ol.!
Ihre Anregungen haben wir dankend entgegengenommen. Wenn wir das historische Umfeld unserer Dokumente nicht näher erläutert haben, so deshalb, weil sich unsere Veröffentlichung an einen Kreis wendet, der die Voraussetzungen für das Verständnis mitbringen dürfte, vor allem auch deswegen, weil in den letzten Jahren eine vielfältige historische Literatur auf den Markt kam. Nicht zuletzt denken wir dabei auch an Ihr bekanntes Werk: »Von London bis Leningrad. Vergangene Stätten des alten Europa«.
Auch glauben wir, dass gerade durch eine geschickt getroffene Auswahl von Dokumenten sich wie von selbst das Bild dieser Epoche mosaikartig zusammensetzt, angefangen von der Priester-Herrschaftskaste über die Religion mit ihrer Anlehnung an christliche Überlieferungen, die agrarisch-handwerkliche Wirtschaftsstruktur bis hin zur Wiederverwendung sekundärer Rohstoffe.
Ihre These von der Selbstzerstörung des sogenannten Industrie-Zeitalters, die wir im Übrigen teilen, wird - so meinen wir - in einigen der Schriften deutlich genug zum Ausdruck gebracht. Die ganze Dokumentation ist ja vor allem deshalb ausgewählt worden, weil die Schriften, die mehr oder weniger aus dem Zeitraum von 2750 bis 2800 stammen, die Erinnerung an die vorausgegangene Epoche - nämlich das oben erwähnte Industrie-Zeitalter - konserviert haben! Was also damals noch gewusst oder gesehen wurde, ist in den Aufzeichnungen enthalten, die somit zwei Fragen beantworten: Wie und warum endete das Industrie-Zeitalter und - was kam danach?
Nochmal für Ihre Anregungen dankend verbleiben wir
mit besonderer Hochachtung Am 24. 11. 3276
Der Verlag
2. Berichte und Dokumente aus dem 3. Jahrtausend
(2750 - 2800 n.Chr.)
Aufgezeichnet von den Vätern, Priestern, Brüdern, Vorreitern, Fürbittern, Aufsehern, Verwaltern und sonstigen Bewohnern des Landes Bajuvien, insbesondere aber von dem Priester-Bruder Friedel von Munic.
Aufgefunden bei verschiedenen Ausgrabungen im Zuge der Landeskulturellen Bereinigung.
Zum besseren Verständnis des Lesers sind bei der Wiedergabe der Schriften folgende Veränderungen vorgenommen worden:
1. Ausdrücke, die wahrscheinlich aus dem sogenannten Industrie-Zeitalter stammen, sind in Großbuchstaben ausgedruckt. Zum Beispiel: AUTOBAHN, KÖNIG, ZENTER usw.
2. Ausdrücke aus der Zeit der bajuvischen Epoche, die inzwischen nicht mehr gebräuchlich oder verständlich sind, wurden kursiv gedruckt. Zum Beispiel: Weichglas, Heilige Garden, Fürbitter, Eisenfrevler usw...
Außerdem wurden die einzelnen Dokumente mit hinweisenden Überschriften versehen. Gelegentliche Anmerkungen sollen zusätzlich das Verständnis nach dem heutigen Wissensstand (3276) fördern.
Aus den Aufzeichnungen des Priester-Bruders Friedel, Vorsteher der Bruderschaft im Heiligen Bezirk von Munic
In Gottes Namen, nun bin ich auf dem Felde MUNIC angekommen, um dort an den Heiligen Stätten zu dienen.
Zusammen mit einer kleinen Schar von Brüdern gilt unser Dienst vor allem aber auch den zahlreichen Pilgerzügen, die hierher kommen.
In früheren Zeiten gab es hier die STADT MUNIC, aber es ist für uns Heutige unvorstellbar - wiewohl nur wenig von all dem erhalten ist und das meiste sich in Schutt und Trümmer verwandelte -, dass die Damaligen solch ungeheure Anstrengungen und vielfältige Künste bewerkstelligt haben. Woher nahmen sie die Kraft, woher die Steine, das Holz, das Eisen und all die Sachen, die man dazu braucht? Vor allem aber: woher die Nahrung, denn das Land ist dasselbe wie früher, aber es ernährt außer denen, die das Feld bestellen, nur die Väter und Brüder in den KOMMUNEN und die Heiligen Garden. Die anderen aber, die Werker und Fuhrleute, arbeiten für die Bauern und bekommen von diesen Nahrung im Tausch für ihre Dienste. Woher konnten sie die Nahrung nehmen für eine so riesenhafte STADT, in der vielleicht so viele Menschen lebten wie heutigentags in ganz Bajuvien?
Die Brüder begrüßten mich freundlich bei meiner Ankunft, und nachdem sie mir das Salz gereicht hatten, sagte ich ihnen, dass ich schon früher einmal an dieser Stätte gewesen, vor etlichen zehn Jahren, und mir daher alles auf das vortrefflichste bekannt sei. Da waren sie sehr froh, weil die Bedrückung von ihnen genommen war, die immer dann eintritt, wenn ein Oberer hinzukommt, der von dem Ort und seinen Umständen nichts weiß. Also fragte ich sie nach den Heiligen Stätten und den Wegen, die über das Feld MUNIC führen, und sie gaben mir fröhliche Auskunft. Es sind ihrer sechs Brüder, und ihre Namen sind Friedemann, Toto, Gernhelf, Alto, Reinhold und Victor. Die enge Klause war noch dieselbe, mit den Schlafzellen, dem Ess- und Betraum und der Küche. Die Zelle, in der ich wohnen sollte, war von den Brüdern mit einem weißen Fliederstrauß geschmückt worden, den sie von einem der zahlreichen Büsche gebrochen hatten, die vielerorts auf dem Felde MUNIC wachsen und blühen.
Meine Reise von der KOMMUNE Gottesreich-I bis hierher währte insgesamt drei Tage. Wohl hatten mir die Väter geraten, mit dem Fuhrwerk zu fahren, welches in jeder zweiten Woche Nahrung zu den Brüdern bringt, aber meine Ungeduld erlaubte mir nicht, noch zehn Tage auf diesen Wagen zu warten, zumal ich gern durch das heitere Frühlingsland wandere. So schritt ich also nach Süden und Westen aus und musste an diesem ersten Tage das große Sumpfland durchqueren. Nur wenige Dörfer trifft man dort, aber es gibt einige feste Wege - wohl noch von früher her -, auf denen man fast trockenen Fußes hindurchgelangt. Mitten in den Sümpfen, umgeben von Schilf und Ried, erblickte ich eine verfallene Kirche, welche Zeugnis davon ablegte, dass früher einmal, vor vielen hundert Jahren, hier auf trockenem Boden Dörfer und Äcker bestanden haben.
Ich erblickte auch die Stelle, wo auf Geheiß der Väter damit begonnen worden ist, einen tiefen Graben auszuheben, damit das Moor trocken würde. Auf solche Weise soll neues Ackerland an dieser Stelle entstehen. Das Werk aber scheint mir so gewaltig, dass die wenigen Gefangenen, die unter der Aufsicht der Heiligen Garden die Arbeit verrichten, wohl noch viele Jahre daran zu tun haben, wenn sie nicht zuvor an Entkräftung sterben werden.
Am Abend dieses Tages gelangte ich bis zu dem Dorfe Tiefenweiher, wo ich bei dem Fürbitter in dessen Gastgemach nächtigte. Während der Fürbitter selbst ein mürrischer und wortkarger Mann war, der dem Gaste, zu dessen Beherbergung ihn das Gesetz verpflichtet, eher scheel entgegensah, war die Frau von mitteilsamerer Art. Sie war von kleiner, stämmiger Statur, mit großen Brüsten, schwarzen Augen und ebensolchem Haar. Ihre Vorfahren mochten vielleicht einmal aus fernen südlichen Ländern in diese Gegend verschlagen worden sein. Daraufhin von mir angesprochen, wollte sie aber von solcher Verwandtschaft nichts wissen und meinte, sie sei eine echte Bajuvierin.
Dieselbe Frau wusste nun, während sie das Mahl aus Mehlfladen bereitete, vieles von dieser Gegend zu berichten, wovon mir ihre Erzählung über die Entstehung des Namens Tiefenweiher bemerkenswert erschien. Danach sollen am Ende der bösen Zeit allerlei Kriegswirren über das Land gezogen sein, wobei sich die Damaligen mit Waffen bekriegten, die uns unvorstellbar sind. Manche von diesen Waffen seien von fliegenden Schiffen herabgeworfen worden und hätten tiefe Löcher in den Boden gerissen. Solch ein Loch wäre auch jenes, welches sich als schilfbewachsener Weiher außerhalb des Dorfes befände und von welchem dieses seinen Namen bezogen habe. Soweit die Erzählung, wie sie von dem naiven Volke seit Generationen von Mund zu Mund weitergegeben wird. Mich berührte sie sonderbar, und ich wanderte in der Abenddämmerung in der angegebenen Richtung, bis ich den Weiher entdeckte. Er war vollkommen kreisrund, und das schwarze Wasser mochte in der Tiefe ein Geheimnis behüten, das man nie ergründen wird. Nachdenklich stand ich an dem Ufer, bis mich ein Frösteln, das nicht nur von der Kälte des Abends herrührte, wieder in das Haus des Fürbitters zurücktrieb.
Der nächste Tag brachte nichts Merkwürdiges, und obwohl der Weg jetzt nicht mehr durch das Moor führte, war er doch beschwerlich, denn es fanden sich nur schmale Graswege zwischen den Feldern. Die größeren Waldstücke aber waren schier undurchdringlich und wohl auch nicht ungefährlich wegen der Wildkatzen. Auch sollen hin und wieder Bären in diesen Wäldern angetroffen worden sein.
Wiewohl die festen Wege ihre Vorzüge haben, denn sie erleichtern den Tausch und den Verkehr, so haben sie doch auch ihre Nachteile, und ich gedachte des alten Sprichwortes:
»Gute Wege - Raub und Not, schlechte Wege - ruhig Brot.«
Was besagen will, dass sich in früheren Zeiten böses Gesindel vor allem auf den guten Straßen fortbewegte und diejenigen in Bedrängnis brachte, die in der Nähe solcher Straßen wohnten, so dass es viele vorzogen, in der Unwegsamkeit ihr Leben zu fristen.
Die zweite Nacht verbrachte ich wiederum im Hause eines Fürbitters. Der Name des Dorfes war äußerst merkwürdig, er lautete nämlich Stadt. Es ist dies wohl ein sehr alter Name, und vielleicht war an jener Stelle früher einmal eine große STADT-Siedlung gewesen.
Der Fürbitter war ein ängstlicher Mensch, der den vornehmen Gast - dem Fürbitter war ich ein solcher - mit übertriebener Sorgfalt überhäufte. Es gab eine fette Suppe, und zum guten Ende glaubte er seiner Gastfreundschaft noch ein Übriges schuldig zu sein, indem er mir ein üppiges Mädchen, seine Schwester, in das Gastgemach schickte, bald nachdem ich mich niedergelegt hatte. Sie kroch sogleich zu mir unter die Decke, aber es gelang mir, sie von mir abzuhalten, indem ich ihr weismachte, dass ein Gelübde mich während dieser Reise daran hindere, den Geschlechtsverkehr zu betreiben. In Wahrheit aber war ich von der Wanderung erschöpft und mochte mich nicht in die Gefahr begeben, die Gastgeber durch mein Versagen zu kränken. Da ließ sie von mir ab, und zum trostreichen Ersatz segnete ich sie beim Abschied.
Am dritten Tage regnete es in der Frühe, und ich verschob meinen Aufbruch bis in den späten Vormittag. Gegen Mittag erreichte ich dann, nachdem ich den Isar-Fluss an einer breiten Stelle durchwatet hatte, ein Verbotenes GELÄNDE, das mit einem rohen Zaun umgeben war. Ein Trupp der Heiligen Garden, die mit ihren Pferden meinen Weg kreuzten, erklärte, dies sei die Stelle Garching, die zu betreten nicht angeraten wäre, weil sie von beträchtlicher Gefährlichkeit sei. Welcher Art diese Gefährlichkeit ist, wussten sie allerdings nicht. Man konnte auch nichts hinter dem Zaun erblicken als dichtes Waldgestrüpp.
Ich ließ es dabei bewenden und erreichte bald die Pilgerstraße, die geradewegs in das Feld MUNIC hineinführt. Diese Straße, die einmal von beträchtlicher Breite gewesen sein muss, heißt auch die AUTOBAHN. Auch anderswo gibt es solch alte AUTOBAHN-Straßen, und sie werden dort als Wallfahrtswege benutzt - wohl wegen ihres ehrwürdigen Alters. Ich schritt also aus auf den geborstenen Platten, die mit Moos und Gras bewachsen waren, und versuchte mir gegenwärtig zu machen, wie es wohl hier vor tausend Jahren zugegangen sein mag. Ist es wahr, dass sie mit eisernen Wägen, die schneller als die Schwalben waren, hier entlangfuhren? Und wenn es so war: Zu welchem Zweck taten sie das, und welchen Gewinn hatten sie davon? Wenn ich diese endlos gerade Straße entlangblickte, dann schauderte es mich, denn sie dünkte mir unmenschlich! War es am Ende eine teuflische Lust, welche die Damaligen zu ihrem Tun trieb? Zum Schluss verlor die AUTOBAHN ihre Breite, oder sie war hier zu Ende, und der Weg führte weiter durch das Feld MUNIC, welches man an den vielen kleinen und großen Hügeln erkennt, aus denen zuweilen Mauern, ja ganze Häuser, oder besser: deren Gerippe, herausragen. Eine der höchsten Ruinen ist die eines glatten, runden, sich nach oben etwas verjüngenden Turmes, dessen Höhe sicherlich einmal beträchtlich war, überragt er doch auch jetzt noch um etliche Meter die gewaltigen Bäume, die zu seinen Füßen wachsen. Warum diese Ruine der Fernsee-Turm genannt wird, ist unerfindlich, denn es gibt hier weit und breit keinen See. Aber wie man weiß, haben solche alten Namen im Laufe ihrer Überlieferung oft die wunderlichsten Veränderungen erleiden müssen - so wie etwa auch der Name Pinakothek, hinter dem man auch beim sorgfältigsten Hin- und Herwenden keinen Sinn erraten kann, mit dem aber eine der größten Ruinen hier auf dem Feld MUNIC benannt ist.
So erreichte ich unter allerlei Gedanken, die die ferne Vergangenheit betrafen, endlich gegen Abend den Heiligen Bezirk mit den Brüdern, die meiner Ankunft schon harrten.
Brief des örtlichen Fürbitters aus dem Dorfe Teerstraß an den zuständigen Abt der Kommune Gottesreich-II, einer Filial-Kommune von Gottesreich-I
Das Reich kommt, Sein Wille geschieht! Hochheiliger, ehrwürdiger Vater!
Wir haben uns in den vergangenen Jahren schon oftmals demütig erlaubt, die schlimme Lage unserer Bauern zu beschreiben, denen durch geringe Ernten infolge der immer länger und strenger werdenden Winter und auch infolge des Viehsterbens vor drei Jahren die Abgaben immer saurer werden und kaum noch erschwinglich sind. Auch der Eigennutz, wie Ihr wissen sollt, ist fast gänzlich ausgeblieben, ja, die Bauern haben kaum selbst das Wenige zum Leben. Wo kein Vieh ist, da kann kein Mist auf den Acker gelangen, und dort wachsen die Halme nur bis an das Knie und bringen wenig Korn. - Auch die Kartoffeln sind klein, und es gehen zwanzig auf ein Pfund. Und wo keine Ochsen mehr sind, da müssen die Bauern und ihre Weiber den Pflug selbst ziehen, bis sie vor Entkräftung zu Boden fallen. Ja, es ist schon vorgefallen, dass die Saat auf den ungeackerten Boden gestreut werden musste, weil niemand die Kraft hatte, denselben zu pflügen. Wie soll solches weitergehen? Sollen wir nicht an den Wald gehen und dort neue Äcker schaffen, indem wir die Bäume verbrennen und ausroden? Solche Vermehrung der Äcker könnte die große Not lindern helfen, auch möchte der Boden dort gut und fruchtbar sein!
Oder sollen wir die alte und nutzlose AUTOBAHN hinwegräumen, die uns beengt und das Land wegnimmt?
Diese AUTOBAHN ist ja seit langen Zeiten nicht mehr mit Pferd und Wagen befahren worden, weil sie voller Risse und tiefer Löcher ist. Oder wollt Ihr diese steinerne Straße erhalten, um sie eines Tages wieder heil und ganz zu machen - wo doch genügend gute Sandwege das Land durchziehen und man solch nutzloser Monumente nicht bedarf, die das Land verdecken und einen greulichen Anblick bieten? Wäre es nicht besser, dort Korn und Kartoffeln wachsen zu lassen zum Nutzen der hungernden Menschen?
Und ist es nicht so, dass in anderen Refugien, wo es auch einmal solche AUTOBAHNEN gab, diese längst hinweggeräumt wurden und dort jetzt gute Äcker und Wiesen anzutreffen sind? Warum also sollte diese Straßenwüste bei uns erhalten bleiben! - Unsere Bauern und das ganze übrige Volk wollen gern die Hinwegschaffung - wenn sie auch schwer und mühsam ist - mit ihren Gespannen betreiben, um auf solche Weise neuen Grund und Boden zu gewinnen.
Sollten wir nicht das vierte Gebot befolgen, welches da heißt: »Ihr sollt keinen Boden unnütz vergeuden, sondern denselben bepflanzen, auf dass Gottes Volk ernährt werde«, und diese AUTOBAHN aus der Welt schaffen? Wir erbitten also Eure Erlaubnis, unsere Äcker und Wiesen auf diese oder jene Weise zu vermehren, und bleiben Euer hochheiliger, ehrwürdiger Vater gern dienende Söhne und Töchter. In Ewigkeit, Amen. -
Arbeiter
Fürbitter zu Teerstraß.
Antwort-Brief des Abtes von Gottesreich-II an den Fürbitter in Teerstraß:
Das Reich kommt, Sein Wille geschieht!